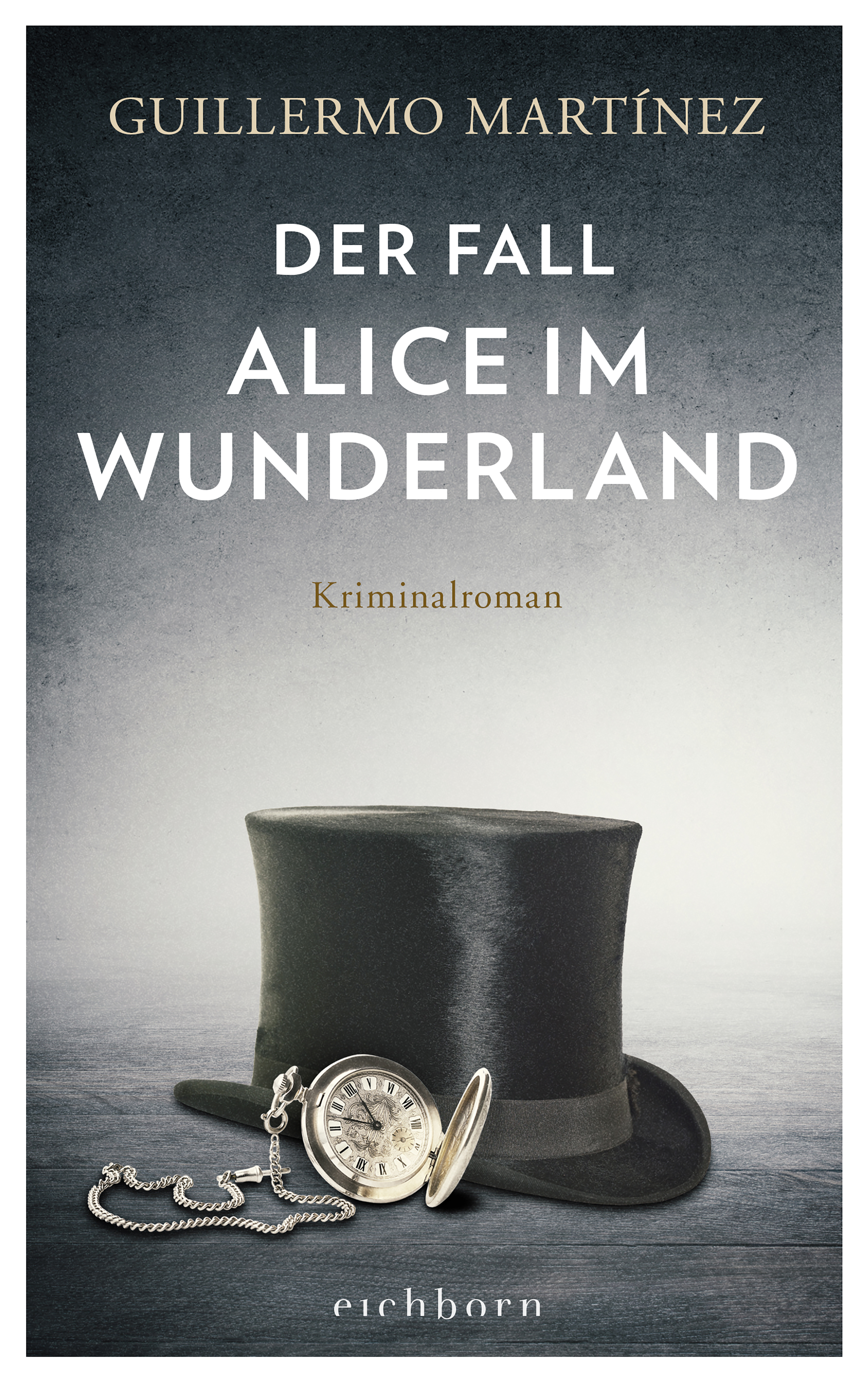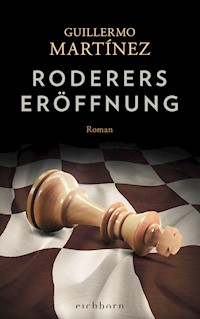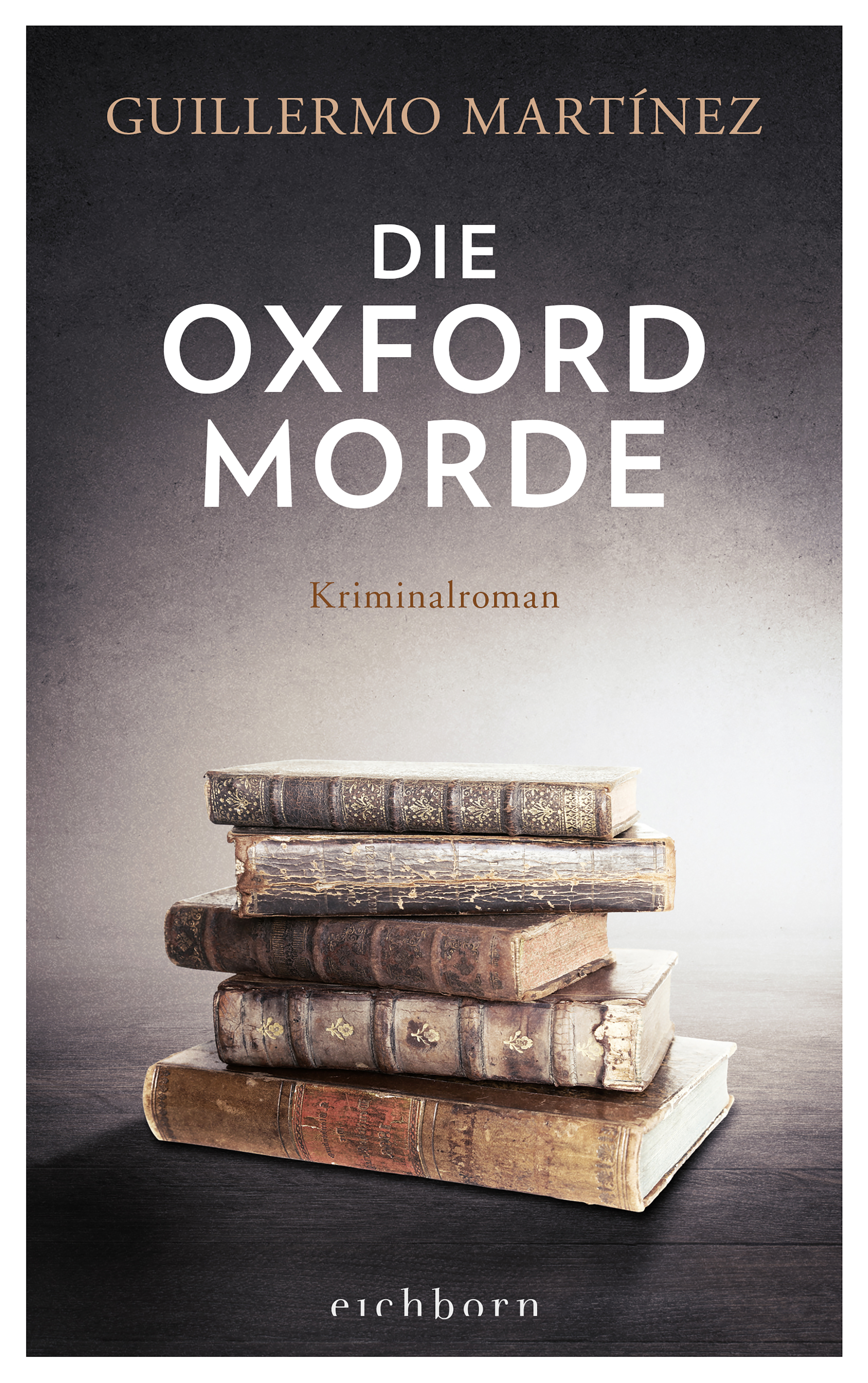
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
An einem lauen Sommerabend in Oxford findet ein argentinischer Mathematik-Doktorand die Leiche seiner Vermieterin. Kurz darauf geschehen weitere Morde, und kein Geringerer als Arthur Seldom, der berühmte Professor für Logik, erhält jedes Mal eine Nachricht mit einem rätselhaften Symbol. Schnell ist klar: Wenn sie den nächsten Mord verhindern wollen, müssen Seldom und der junge Doktorand die logische Reihung der Symbole entschlüsseln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
An einem lauen Sommerabend in Oxford findet ein argentinischer Mathematik-Doktorand die Leiche seiner Vermieterin. Kurz darauf geschehen weitere Morde, und kein Geringerer als Arthur Seldom, der berühmte Professor für Logik, erhält jedes Mal eine Nachricht mit einem rätselhaften Symbol. Schnell ist klar: Wenn sie den nächsten Mord verhindern wollen, müssen Seldom und der junge Doktorand die logische Reihung der Symbole entschlüsseln …
Über den Autor
Guillermo Martínez wurde 1962 Premio Planeta 2003 in Bahía Blanca, Argentinien, geboren und lebt in Buenos Aires. Er ist promovierter Mathematiker und verbrachte zwei Jahre seiner Doktorandenzeit an der Universität in Oxford. Für Die Oxford-Morde erhielt er 2003 als erster Argentinier den Premio Planeta, den bedeutendsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt. Der Roman wurde in 40 Sprachen übersetzt und 2008 mit Elijah Wood und John Hurt fürs Kino verfilmt. Seitdem veröffentlichte Guillermo Martínez mehrere hoch gelobte Romane, Essays und Kurzgeschichten.
GUILLERMO MARTÍNEZ
DIE
OXFORDMORDE
Kriminalroman
Übersetzung aus dem argentinischen Spanischvon Angelica Ammar
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Hinweis: Dieser Roman erschien unter dem Titel »Die Pythagoras-Morde« bereits 2006 im Eichborn Verlag.
Titel der spanischen Originalausgabe:
»Crímenes impercebtibles«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 Guillermo Martínez
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © Reinhold Leitner / shutterstock; © nevodka / shutterstock; © Rawpixel.com / shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-8792-6
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
In Gedenken an meinen Vater
1
Jetzt, da so viel Zeit vergangen und alles längst vergessen ist, jetzt, da mich in einer lakonischen Mail aus Schottland die Nachricht von Seldoms Tod ereilt hat, glaube ich das Versprechen, das er mir nie abverlangte, brechen und die Wahrheit über die Ereignisse erzählen zu können, die im Sommer 1993 die englische Presse mit makabren bis sensationslüsternen Titeln füllten, auf die Seldom und ich jedoch, vielleicht aufgrund der mathematischen Konnotation, immer nur als »die Reihe« oder »die Oxford-Reihe« Bezug nahmen. Die Todesfälle ereigneten sich in der Tat alle innerhalb der Grenzen von Oxfordshire, zu Beginn meines Aufenthaltes in England, und mir kam das zweifelhafte Privileg zuteil, den ersten aus allernächster Nähe zu sehen.
Ich war zweiundzwanzig, ein Alter, in dem so gut wie alles noch entschuldbar ist; ich hatte gerade mein Studium an der Universität von Buenos Aires mit einer Arbeit in Algebraischer Topologie abgeschlossen und begab mich nun zu einem einjährigen Aufenthaltsstipendium nach Oxford, mit dem heimlichen Vorsatz, mich der Logik zu widmen oder jedenfalls das berühmte Seminar von Angus Macintire zu besuchen. Meine künftige Tutorin, Emily Bronson, hatte mein Kommen mit skrupulöser Sorgfalt bis ins letzte Detail vorbereitet. Sie war Professorin und Fellow des St Anne’s, aber in den vor meiner Abreise gewechselten Mails hatte sie mir nahegelegt, von der Unterbringung in den eher ungemütlichen Zimmern des Colleges abzusehen und stattdessen, sollte mein Stipendiengeld es erlauben, lieber ein Zimmer mit eigenem Bad, einer kleinen Küche und separatem Eingang im Haus von Mrs Eagleton zu mieten, der, wie sie mir versicherte, überaus freundlichen und zurückhaltenden Witwe eines ehemaligen Professors von ihr. Ich überschlug mein Budget, wie immer äußerst optimistisch, und sendete einen Scheck mit der ersten Monatsmiete als Vorauszahlung, die einzige von der Vermieterin geforderte Formalität. Zwei Wochen später fand ich mich im Flugzeug über dem Atlantik wieder, in diesem Zustand der Ungläubigkeit, der mich seit jeher auf allen Reisen befallen hat. Wie bei einem Salto ohne Netz erscheint es mir stets eine wesentlich wahrscheinlichere, sogar schlüssigere Hypothese – Occams Rasiermesser, hätte Seldom dazu gesagt –, dass irgendein Unfall mich in letzter Minute in meine Ausgangsposition zurück- oder direkt auf den Meeresgrund befördert, als mir vorzustellen, ein ganzes Land könne sich vor mir auftun, und mit ihm die gigantische Maschinerie eines Neuanfangs. Und dennoch durchbrach das Flugzeug am nächsten Morgen pünktlich um neun Uhr ruhig die Nebelbank, und unzweifelhaft wirklich tauchten die grünen Hügel Englands unter einem plötzlich matteren, oder vielleicht sollte ich sagen schwächeren Licht auf; zumindest kam es mir vor, als würde das Licht, je tiefer wir gingen, an Substanz verlieren, wie gefiltert dünner und kraftloser werden.
Meine Tutorin hatte mir genaueste Angaben gemacht, welchen Bus ich in Heathrow nehmen musste, um direkt nach Oxford zu gelangen, und sich mehrmals entschuldigt, dass sie mich bei meiner Ankunft nicht persönlich würde empfangen können, da sie die Woche über in London an einem Algebra-Kongress teilnahm. Das störte mich nicht im Geringsten, sondern schien mir geradezu ideal: Ich würde ein paar Tage für mich haben, um mir selbst eine Vorstellung von der Umgebung zu machen und die Stadt zu erkunden, bevor meine Pflichten begannen. Ich hatte nicht viel Gepäck, und als der Bus schließlich angekommen war, überquerte ich von der Haltestelle aus mit meinen Taschen einfach den Platz, um mir ein Taxi zu nehmen. Es war Anfang April, aber angesichts des eisigen Windes, gegen den die ziemlich blasse Sonne nicht viel ausrichtete, war ich froh, meinen Mantel angelassen zu haben. Wobei fast alle Besucher des Jahrmarktes, der auf dem Platz aufgebaut worden war, kurzärmelig herumliefen, ebenso wie der pakistanische Taxifahrer, der mir die Tür aufhielt. Ich gab ihm Mrs Eagletons Adresse und fragte ihn beim Losfahren, ob ihm nicht kalt sei. »Überhaupt nicht! Es ist doch Frühling«, entgegnete er und zeigte als unwiderlegbaren Beweis freudig auf die fahle Sonne.
Das schwarze Taxi setzte sich feierlich in Bewegung und fuhr auf die Hauptstraße zu. Dort bog es links ab, und ich konnte zu beiden Seiten durch halboffene Holztore und Eisengitter die adretten Gärten und makellosen, glänzenden Rasen der Colleges sehen. Wir kamen an einem kleinen Friedhof mit moosbewachsenen Grabsteinen vorbei, der eine Kirche säumte. Das Taxi fuhr ein Stück die Banbury Road hoch und bog dann in den Cunliffe Close ein, die Adresse, die ich notiert hatte. Die Straße wand sich jetzt durch einen beeindruckenden Park; grünumrankt erhoben sich in ruhiger Eleganz große alte Villen, die unvermittelt an viktorianische Romane denken ließen, an Nachmittagstees, Kricketpartien und Spaziergänge durch den Garten. Wir verfolgten die Hausnummern entlang des Gehwegs, obwohl es mir angesichts des Betrags auf meinem Scheck unwahrscheinlich erschien, dass die Adresse zu einer dieser Villen gehörte. Am Ende der Straße entdeckten wir schließlich eine Reihe wesentlich bescheidenerer, aber immer noch hübscher Häuschen, die mit ihren länglichen Holzbalkonen etwas Sommerliches an sich hatten.
Das erste war Mrs Eagletons Haus. Ich lud meine Taschen aus, stieg die kleine Eingangstreppe hoch und klingelte. Aus den Publikationsdaten ihrer Doktorarbeit und ihren ersten Artikeln hatte ich geschlossen, dass Emily Bronson mindestens fünfundfünfzig Jahre alt sein musste, und ich fragte mich, wie alt dann wohl die Witwe eines ehemaligen Professors von ihr war. Als die Tür aufging, blickte ich in das kantige Gesicht und die dunkelblauen Augen eines großen, schlanken Mädchens, das nicht viel älter war als ich und das mir lächelnd die Hand gab. Wir sahen uns an, beide angenehm überrascht, obwohl es mir vorkam, als wiche sie vorsichtshalber ein wenig zurück, nachdem sie ihre Hand befreit hatte, die ich wohl einen Augenblick länger als schicklich festgehalten hatte. Sie nannte ihren Namen, Beth, und versuchte, mit nur mäßigem Erfolg, meinen nachzusprechen, während sie mich in ein freundliches Wohnzimmer mit einem rot-grauen Rautenteppich führte. Aus einem geblümten Sessel streckte Mrs Eagleton mir mit einem innigen Begrüßungslächeln die Arme entgegen. Sie war eine alte Dame mit blitzenden Augen und lebhaften Bewegungen, deren weißes, flaumiges Haar sorgfältig zu einer eleganten Welle frisiert war. Während wir das Wohnzimmer durchquerten, fiel mein Blick auf den zusammengeklappten Rollstuhl, der hinter dem Sessel lehnte, und auf die Wolldecke mit dem Schottenmuster, die ihre Beine bedeckte. Ich gab ihr die Hand und spürte die etwas zittrige Zerbrechlichkeit ihrer Finger. Sie hielt meine einen Moment lang herzlich umfasst und klopfte mit der Linken leicht auf meinen Handrücken, während sie mich nach meiner Reise fragte und ob ich das erste Mal in England sei. Erstaunt sagte sie:
»Wir hatten nicht erwartet, dass Sie so jung sein würden, nicht wahr, Beth?«
Beth, die an der Tür stehengeblieben war, lächelte stumm; sie hatte einen Schlüssel von der Wand genommen, und nachdem ich auf drei oder vier weitere Fragen geantwortet hatte, schlug sie ruhig vor:
»Großmutter, meinst du nicht, dass wir ihm jetzt sein Zimmer zeigen sollten? Er muss schrecklich müde sein.«
»Natürlich«, sagte Mrs Eagleton. »Beth wird Ihnen alles erklären. Und wenn Sie heute Abend noch nichts anderes vorhaben, würden wir uns freuen, Sie zum Essen einzuladen.«
Ich ging hinter Beth nach draußen. Die Eingangsstufen setzten sich in einer Spirale nach unten fort und führten auf eine kleine Tür zu. Beth duckte sich ein wenig beim Eintreten, und ich folgte ihr in einen großen, ordentlichen Raum, der trotz des Tiefparterres durch zwei hohe, fast unter der Decke gelegene Fenster ausreichend Licht bekam. Sie begann mir alle Details zu erklären, durchschritt dabei den Raum, öffnete Schubladen, zeigte mir Wandschränke, Geschirr und Handtücher, begleitet von monotonen Ausführungen, die sie offensichtlich bereits mehrfach abgespult hatte. Ich begnügte mich damit, das Bett und die Dusche auszuprobieren, und widmete mich in erster Linie Beths Betrachtung. Sie hatte straffe, wettergegerbte Haut, als wäre sie übermäßig viel an der frischen Luft, was ihr zwar ein gesundes Aussehen verlieh, gleichzeitig jedoch vorzeitige Falten befürchten ließ. Hatte ich sie zunächst auf dreiundzwanzig oder vierundzwanzig geschätzt, tendierte ich unter diesem Licht eher auf sieben- oder achtundzwanzig. Rätselhaft schienen vor allem ihre schönen tiefblauen Augen, die im Vergleich zu ihrem restlichen Gesicht seltsam starr wirkten, als spiegele sich aller Ausdruck und Glanz erst wie verzögert in ihnen. Das weite, ländliche Kleid mit dem runden Kragen, das sie trug, gestattete keine großen Rückschlüsse auf ihre Figur; offensichtlich war sie schlank, obwohl ein etwas aufmerksamerer Blick doch einen gewissen Spielraum einräumte und vermuten ließ, dass diese Schlankheit glücklicherweise nicht durchgängig war. Vor allem von hinten war sie durchaus eine Umarmung wert; sie hatte etwas von der Wehrlosigkeit großer Mädchen. Als sie sich umdrehte, sah sie mir in die Augen und fragte, ich glaube ohne versteckte Ironie, ob ich sonst noch etwas wissen wolle, worauf ich beschämt wegsah und schnell antwortete, alles sei perfekt. Bevor sie ging, stellte ich ihr noch die überaus umständlich formulierte Frage, ob ich mich ihrer Meinung nach wirklich zum Abendessen eingeladen betrachten könne, was sie lachend bejahte; um halb sieben würden sie mich erwarten.
Ich packte die wenigen Dinge aus, die ich mitgebracht hatte, stapelte ein paar Bücher und Kopien meiner Abschlussarbeit auf dem Schreibtisch und brachte meine Kleidung in zwei Schubladen unter. Dann machte ich einen Spaziergang durch die Stadt. Kaum erreichte ich St Giles, entdeckte ich auch schon das Mathematische Institut, das einzige eckige und hässliche Gebäude. Ich sah zur Eingangstreppe, auf die Drehtür aus Glas, und beschloss, dass ich an diesem ersten Tag noch gut daran vorbeigehen konnte. Ich kaufte mir ein Sandwich und machte ein einsames, leicht verspätetes Picknick am Ufer der Themse, wo ich dem Ruderteam beim Training zuschaute. Ich streifte durch einige Buchhandlungen, blieb stehen, um die Wasserspeier im Giebel eines Theaters zu betrachten, schlenderte hinter einer Gruppe Touristen durch die Arkaden eines Colleges und marschierte dann lange durch den riesigen Universitätspark. In einer baumfreien Zone mähte ein Mann gerade große Rechtecke in den Rasen, und ein zweiter malte mit Kalkfarbe die Linien eines Tennisplatzes auf. Wehmütig beobachtete ich dieses kleine Schauspiel, und als sie eine Pause einlegten, fragte ich, wann die Netze eingehängt würden. Seit meinem zweiten Studienjahr hatte ich nicht mehr Tennis gespielt; ich hatte auch gar keinen Schläger dabei, nahm mir aber fest vor, einen zu kaufen und jemanden zu finden, mit dem ich wieder anfangen könnte.
Auf dem Rückweg rüstete ich mich in einem Supermarkt mit ein paar Vorräten aus, und schließlich fand ich auch ein Spirituosengeschäft, wo ich auf gut Glück eine Flasche Wein für das Abendessen mitnahm. Als ich zum Cunliffe Close zurückkam, war es kurz nach sechs, aber schon fast völlig dunkel, und in allen Häusern waren die Fenster erleuchtet. Es erstaunte mich, dass nirgends Vorhänge angebracht waren, und ich fragte mich, ob dies einem vielleicht übertriebenen Vertrauen darin zuzuschreiben war, dass die englische Diskretion niemanden so tief sinken lassen würde, seine Mitmenschen auszuspionieren, oder eher der ebenso englischen Überzeugung, dass es im eigenen Privatleben ohnehin nichts gab, das es sich auszuspionieren gelohnt hätte. Es waren auch nirgends Gitter zu sehen, und man hatte den Eindruck, dass viele Türen unverschlossen waren.
Ich duschte und rasierte mich, suchte das in der Reisetasche am wenigsten verknitterte Hemd heraus, und pünktlich um halb sieben stieg ich die kleine Treppe hoch und klingelte mit der Weinflasche in der Hand an der Tür. Das Abendessen verlief im Zeichen der lächelnden, wohlerzogenen und etwas nichtssagenden Höflichkeit, an die ich mich im Laufe der Zeit gewöhnen sollte. Beth hatte sich ein wenig zurechtgemacht, ohne jedoch so weit gegangen zu sein, sich zu schminken. Sie trug jetzt eine schwarze Seidenbluse und ihr seitlich gekämmtes Haar umschmiegte verführerisch ihren Hals. Aber all das war ohnehin nicht für mich bestimmt; bald erfuhr ich, dass sie Cello im Kammerorchester des Sheldonian Theatre spielte, des halbrunden Theaters mit den Wasserspeiern im Fries, das ich auf meinem Spaziergang gesehen hatte. An jenem Abend hatten sie eine Generalprobe, und ein gewisser Michael hatte das Glück, sie eine halbe Stunde später abholen zu dürfen. Einen kurzen Moment lang erfüllte unbehagliches Schweigen den Raum, als ich fragte, ob das ihr Freund sei, wovon ich ausging; die beiden blickten sich an, und als einzige Antwort fragte Mrs Eagleton mich, ob ich nicht noch ein wenig Kartoffelsalat wolle. Während des restlichen Abendessens war Beth leicht abwesend und zerstreut, und schließlich bestritten Mrs Eagleton und ich die Unterhaltung so gut wie allein. Nachdem es schließlich geklingelt hatte und Beth gegangen war, wurde meine Gastgeberin deutlich lebhafter, als wäre eine unsichtbare Spannung entwichen. Sie schenkte sich ein zweites Glas Wein ein, und eine ganze Weile lauschte ich ihren Geschichten aus einem in der Tat bemerkenswerten Leben. Sie hatte zu den zahlreichen Frauen gehört, die während des Krieges nichtsahnend an einem landesweiten Kreuzworträtselwettbewerb teilgenommen hatten, um dann zu erfahren, dass der Preis darin bestand, rekrutiert und in ein vollkommen isoliertes Dorf geschickt zu werden, mit der Mission, Alan Turing und seinem Stab an Mathematikern zu helfen, die Nazi-Codes der Chiffriermaschine Enigma zu entschlüsseln. Dort hatte sie Mr Eagleton kennengelernt. Sie erzählte mir eine Reihe Anekdoten aus der Kriegszeit und ließ sich lange über die berüchtigte Vergiftung Turings aus. Seit sie sich in Oxford niedergelassen hätten, sagte sie, habe sie die Kreuzworträtsel gegen Scrabble eingetauscht, das sie mit einer Gruppe Freundinnen spiele, so oft sie könne. Voller Enthusiasmus fuhr sie mit ihrem Rollstuhl zu einem niedrigen Tischchen im Wohnzimmer und bat mich, ihr zu folgen. Die Teller solle ich einfach stehen lassen; Beth würde sich darum kümmern, wenn sie nach Hause käme. Besorgt sah ich, wie sie aus einer Schublade ein Spielbrett zog und es auf dem kleinen Tisch aufschlug. Ich konnte unmöglich nein sagen. Und so verbrachte ich den Rest meines ersten Abends damit, englische Worte vor dieser fast schon historischen alten Dame zu bilden, die bei jedem zweiten oder dritten Spielzug wie ein kleines Mädchen aufjuchzte und ihre sieben Buchstaben auf einen Schlag ablegte.
2
In den nächsten Tagen stellte ich mich im Mathematischen Institut vor, wo man mir einen Schreibtisch im Besucher-Arbeitszimmer, eine E-Mail-Adresse und eine Magnetkarte zuwies, mit der ich die Bibliothek auch außerhalb der Öffnungszeiten benutzen konnte. Ich teilte den Raum nur mit einem weiteren Studenten, einem Russen namens Podorow, mit dem ich kaum mehr als einen kurzen Gruß wechselte. Mit eingezogenen Schultern wanderte er von einem Ende des Zimmers zum anderen, beugte sich von Zeit zu Zeit über seinen Schreibtisch, um eine Formel in ein Heft mit festen Deckeln, das an ein Psalmenbuch erinnerte, zu kritzeln, und alle halbe Stunde ging er nach draußen, um eine Zigarette auf dem kleinen gepflasterten Hof unter unserem Fenster zu rauchen.
Zu Beginn der folgenden Woche traf ich zum ersten Mal Emily Bronson; sie war sehr klein und hatte ihr glattes, schlohweißes Haar mit Schulmädchenspangen über den Ohren zurückgesteckt. Sie kam auf einem zu großen Fahrrad ins Institut, im Korb ihre Bücher und am Lenkrad ihr Lunchpaket. Sie hatte etwas Nonnenhaftes, Schüchternes an sich, doch mit der Zeit fand ich heraus, dass sie bisweilen einen beißenden Humor an den Tag legen konnte. Trotz ihrer Bescheidenheit schmeichelte es ihr doch, glaube ich, dass meine Arbeit den Titel Die Bronson’schen Räume trug. Bei dieser ersten Begegnung überreichte sie mir Sonderdrucke ihrer beiden letzten Paper, mit denen ich mich vertraut machen sollte, sowie einige Faltblätter und Pläne von Sehenswürdigkeiten in Oxford, die ich, wie sie sagte, doch besuchen solle, bevor das Semester beginnen und ich nur noch wenig Freizeit haben würde. Sie fragte mich, ob ich irgendetwas aus meinem Leben in Buenos Aires besonders vermisse, und als ich darauf anspielte, dass ich gern wieder mit dem Tennisspielen anfangen würde, versicherte sie mir mit einem offensichtlich an wesentlich exzentrischere Wünsche gewohnten Lächeln, dies ließe sich leicht arrangieren.
Zwei Tage später lag in meinem Fach eine Karte mit einer Einladung zu einem Doppel im Club von Marston Ferry Road. Er war nur ein paar Gehminuten vom Cunliffe Close entfernt und hatte Sandplätze. Die Spieler waren John, ein amerikanischer Fotograf mit langen Armen, der gut am Netz war; Sammy, ein fast weißblonder kanadischer Biologe, schwungvoll und unermüdlich; und Lorna, eine Krankenschwester irländischer Abstammung aus dem Radcliffe Hospital mit rötlichen Haaren und leuchtend grünen, betörenden Augen. Zu der Freude, wieder einen Sandplatz zu betreten, kam das unerwartete Vergnügen, mich beim Einschlagen einem Mädchen gegenüberzufinden, das nicht nur rundum hübsch anzusehen war, sondern auch sichere, elegante Grundlinienschläge beherrschte und alle meine Bälle flach übers Netz zurückbrachte. Wir spielten drei Sätze, zwischen denen wir die Partner wechselten. Lorna und ich bildeten ein lustiges, fast unschlagbares Team, und so zählte ich während der darauffolgenden Woche die Tage, bis ich wieder auf dem Platz stand, und dann die Spiele bis zum Wechsel, der sie erneut an meine Seite brachte.
Fast jeden Morgen traf ich Mrs Eagleton; manchmal war sie schon früh, wenn ich zum Institut aufbrach, im Garten beschäftigt, und wir unterhielten uns kurz. Dann wieder sah ich sie in der Banbury Road auf dem Weg zum Markt, wenn ich mir in meiner Pause etwas zum Mittagessen kaufte. Ihr elektrischer Rollstuhl glitt wie ein ruhiges Schiff über den Gehweg, und mit einer grazilen Kopfbewegung grüßte sie die Studenten, die ihr den Weg frei machten. Beth dagegen begegnete ich sehr selten, einmal erst hatte ich wieder mit ihr gesprochen, als ich eines Nachmittags vom Tennisspielen kam. Lorna hatte mir angeboten, mich mit dem Auto am Beginn des Cunliffe Close abzusetzen, und während ich mich von ihr verabschiedete, sah ich, wie Beth, ihr Cello im Arm, gerade aus dem Bus stieg. Ich ging ihr entgegen, um ihr das Instrument bis zum Haus abzunehmen. Es war einer der ersten wirklich warmen Tage, und ich nehme an, mein Gesicht und meine Arme hatten von dem Nachmittag in der Sonne Farbe bekommen. Sie lächelte mir vielsagend zu.
»Wie ich sehe, hast du dich schon gut eingelebt. Aber solltest du nicht eigentlich Mathematik studieren, statt Tennis zu spielen und mit irgendwelchen Mädchen im Auto herumzufahren?«
»Ich habe die Erlaubnis meiner Professorin«, sagte ich lachend und hob meine Hand wie zur Absolution.
»Ach, ich mache doch nur Spaß! Im Grunde beneide ich dich.«
»Mich beneiden? Worum denn?«
»Keine Ahnung. Du machst einen so freien Eindruck. Du lässt alles zurück, dein Land, dein normales Leben; und zwei Wochen später kommst du mir fröhlich und braungebrannt vom Tennisspielen entgegen.«
»Du solltest es auch mal ausprobieren. Man muss nur ein Stipendium beantragen.«
Sie schüttelte mit einem Anflug von Traurigkeit den Kopf.
»Ich habe es schon versucht, aber für mich ist es wohl zu spät. Natürlich würden sie es nie zugeben, aber sie vergeben die Stipendien lieber an jüngere Mädchen. Ich bin fast neunundzwanzig«, sagte sie, als handele es sich um eine Grabinschrift, und mit einem plötzlich bitteren Ton fügte sie hinzu: »Manchmal würde ich alles darum geben, von hier wegzukommen.«
Mein Blick schweifte über die grünen Mistelblätter an den Häusern, die Spitzen der mittelalterlichen Kuppeln, die Zinnen der Türme mit ihren rechteckigen Schießscharten.
»Von Oxford wegzukommen? Ich könnte mir kaum einen schöneren Ort vorstellen.«
Ein tief sitzendes Gefühl von Machtlosigkeit schien flüchtig ihren Blick zu verschleiern.
»Schon möglich … wenn man sich nicht die ganze Zeit um eine alte, behinderte Frau kümmern und jeden Tag etwas tun müsste, was einem schon lange nichts mehr bedeutet.«
»Spielst du etwa nicht gern Cello?« Das fand ich überraschend und interessant. Ich sah sie an, als könnte ich vielleicht für einen kurzen Moment die unbewegliche Oberfläche ihrer Augen durchbrechen und entdecken, was dahinter lag.
»Ich hasse es«, sagte sie, und ihre Pupillen verdüsterten sich. »Ich hasse es mehr und mehr, und es fällt mir immer schwerer, es zu verheimlichen. Manchmal habe ich Angst, dass man es hören könnte, wenn wir spielen, dass der Direktor oder einer meiner Kollegen merken könnte, wie sehr ich jede einzelne Note der Partitur hasse. Aber nach jedem Konzert klatschen die Leute, und niemandem scheint etwas aufgefallen zu sein. Ist das nicht komisch?«
»Tja, ich würde sagen, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass Hass eine besondere Vibration hat. In dieser Hinsicht ist die Musik so abstrakt wie die Mathematik: Sie kennt keine moralischen Kategorien. Solange du dich an die Partitur hältst, kann ich mir nicht vorstellen, wie es jemand heraushören sollte.«
»Mich an die Partitur halten … ich habe mein Leben lang nichts anderes getan«, erwiderte sie seufzend.
Wir waren an der Haustür angekommen. »Ach, hör gar nicht hin«, sagte sie und griff nach der Türklinke. »Ich hatte heute nur einen schlechten Tag.«
»Aber der Tag ist doch noch nicht zu Ende«, sagte ich. »Gibt es nichts, was ich tun könnte, um ihn zu retten?«
Sie sah mich mit einem traurigen Lächeln an und nahm das Cello wieder an sich.
»Oh, you are such a Latin man«, murmelte sie, als sei dies etwas, wovor man sich sorgsam in Acht nehmen müsse, aber dennoch ließ sie mich ein letztes Mal in ihre blauen Augen schauen, während sie die Tür schloss.
Zwei weitere Wochen vergingen. Langsam begann der Sommer sich mit milden, langen Abenden anzukündigen. Am ersten Mittwoch im Mai hob ich auf dem Rückweg vom Institut an einem Bankautomaten das Geld für meine Zimmermiete ab. Ich klingelte an Mrs Eagletons Tür, und während ich darauf wartete, dass man mir öffnen würde, sah ich, wie sich ein großer Mann mit ernstem, konzentriertem Gesichtsausdruck über den gewundenen Gehweg großen Schrittes dem Haus näherte. Ich musterte ihn aus den Augenwinkeln, als er neben mir angelangt war. Er hatte eine breite, offene Stirn, kleine, tiefliegende Augen und eine auffällige Narbe am Kinn; er mochte um die fünfundfünfzig sein, verrieten seine Bewegungen auch eine unterdrückte Energie, die ihn jugendlicher wirken ließ. Etwas verlegen warteten wir nebeneinander vor der verschlossenen Tür, bis er das Wort ergriff und mich mit einem tiefen, wohlklingenden schottischen Akzent fragte, ob ich bereits geklingelt habe. Ich bejahte und klingelte ein zweites Mal. Vielleicht sei mein erstes Klingeln zu kurz gewesen, bemerkte ich dazu; bei diesen Worten entspannte sich sein Gesicht zu einem freundlichen Lächeln, und er fragte mich, ob ich Argentinier sei.
»Dann«, sagte er daraufhin in perfektem Spanisch, das kurioserweise den Akzent von Buenos Aires durchklingen ließ, »müssen Sie Emilys Schüler sein.«
Überrascht bestätigte ich dies und fragte ihn, wo er Spanisch gelernt habe. Er zog die Augenbrauen hoch, als sinne er einer weit zurückliegenden Vergangenheit nach, und antwortete, das sei schon lange her.
»Meine erste Frau kam aus Buenos Aires«, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin Arthur Seldom.«
Wenige Namen hätten zu jener Zeit größere Bewunderung in mir hervorrufen können. Dieser Mann mit den kleinen hellen Augen, der mir gerade die Hand schüttelte, war unter Mathematikern bereits eine Legende. Monatelang hatte ich für ein Seminar sein berühmtestes Theorem studiert: die philosophische Weiterführung der Thesen von Gödel aus den dreißiger Jahren. Er galt als einer der vier Hauptverfechter der Logik, und allein die vielfältigen Titel seiner Arbeiten wiesen darauf hin, dass er einer der wenigen wirklich herausragenden Mathematiker seiner Zeit war; hinter dieser offenen, gelassenen Stirn waren die bedeutendsten Ideen des Jahrhunderts durchdacht und neu geordnet worden. Bei meinem zweiten Streifzug durch die Buchhandlungen der Stadt hatte ich sein letztes Werk gesucht, eine populärwissenschaftliche Abhandlung über logische Reihen, zu meiner Überraschung jedoch erfahren, dass es seit zwei Monaten vergriffen war. Jemand hatte mir gesagt, Seldom sei seit der Veröffentlichung dieses Buches bei keinem Kongress mehr in Erscheinung getreten, und anscheinend wagte niemand, auch nur eine Vermutung anzustellen, woran er gerade arbeitete. Ich jedenfalls hatte nicht einmal gewusst, dass er in Oxford lebte, und erst recht nicht erwartet, ihm just vor Mrs Eagletons Haustür zu begegnen. Ich erzählte ihm, dass ich in einem Seminar ein Referat über sein Theorem gehalten hätte, und er schien erfreut über meine Begeisterung. Dennoch merkte ich, dass ihn offenbar etwas beunruhigte und sein Blick unwillkürlich immer wieder zur Tür wanderte.
»Mrs Eagleton müsste doch eigentlich zu Hause sein«, sagte er, »oder nicht?«
»Ich dachte schon«, erwiderte ich. »Dort steht ihr elektrischer Rollstuhl. Außer, jemand hat sie im Auto abgeholt …«
Offensichtlich besorgt, klingelte Seldom noch einmal, trat dann an das auf die Veranda hinausgehende Fenster und versuchte, nach innen zu sehen.
»Wissen Sie, ob es noch einen Hintereingang gibt?«, fragte er und fügte auf Englisch hinzu: »Ich habe Angst, ihr könnte etwas zugestoßen sein.«
Aus seinem Gesichtsausdruck schloss ich, dass er wirklich alarmiert war; irgendetwas schien seine Gedanken zu beherrschen und in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken.
»Wenn Sie meinen«, sagte ich, »können wir es mit der Haustür probieren; ich glaube, tagsüber ist sie nie abgeschlossen.«
Seldom griff nach der Klinke, und die Tür öffnete sich widerstandslos. Schweigend traten wir ein; unter unseren Schritten knarrten die Dielen. Von drinnen hörte man das geheimnisvolle Ticken einer Standuhr wie einen gedämpften Pulsschlag. Wir gingen ins Esszimmer und hielten neben dem in der Mitte stehenden Tisch inne. Ich machte Seldom ein Zeichen und deutete auf die Chaiselongue neben dem Fenster zum Garten, auf der Mrs Eagleton lag und tief zu schlafen schien, das Gesicht zur Lehne gewandt. Eines der Kissen war auf den Teppich gefallen, als wäre es ihr im Schlaf entglitten. Die weiße Haarwelle war sorgfältig mit einem feinen Netz bedeckt, und ihre Brille lag auf dem Beistelltisch, neben dem Scrabblebrett. Offensichtlich hatte sie gegen sich selbst gespielt, denn beide Buchstabenständer befanden sich an ihrem Platz. Seldom ging zu ihr, und als er sie leicht an der Schulter berührte, fiel ihr Kopf schwer zur Seite. Im selben Moment sahen wir beide ihre schreckgeweiteten Augen und zwei parallele Blutfäden, die sich von der Nase übers Kinn herabzogen und am Hals zusammenliefen. Unwillkürlich tat ich einen Schritt zurück; fast hätte ich aufgeschrien. Seldom, der ihren Kopf mit dem Arm abgestützt hatte, rückte ihren Körper so weit wie möglich wieder zurecht und murmelte bestürzt etwas vor sich hin. Er griff nach dem Kissen, und als er es vom Teppich aufhob, wurde darauf ein großer roter, in der Mitte fast schon trockener Fleck sichtbar. Für einen Augenblick blieb er mit herabhängendem Arm stehen, das Kissen in der Hand, gedankenverloren, als ginge er den Verzweigungen einer komplizierten Gleichung nach. Er schien zutiefst verstört. Ich war es schließlich, der vorschlug, die Polizei zu rufen, worauf er mechanisch nickte.
3
»Wir sollen vor dem Haus auf sie warten«, sagte Seldom lakonisch, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte.
Ohne etwas zu berühren, gingen wir auf die kleine Eingangsveranda hinaus. Seldom lehnte sich gegen das Geländer und drehte sich stumm eine Zigarette. Seine Hände verharrten bei einer Papierfalte oder wiederholten eine Geste, als spiegelten sie Innehalten und Zögern bei der eingehenden Analyse einer Gedankenkette wider. Seine noch wenige Minuten zuvor spürbare Niedergeschlagenheit war jetzt offenbar dem angestrengten Versuch gewichen, einen Sinn oder eine rationale Erklärung für etwas so Unverständliches zu finden. Zwei Streifenwagen hielten geräuschlos vor dem Haus. Ein großer grauhaariger Mann in dunkelblauem Anzug kam auf uns zu, schüttelte uns mit festem Blick kurz die Hand und fragte nach unseren Namen. Er hatte markante Wangenknochen, die sich mit dem Alter ausgehöhlt zu haben schienen, und eine ruhige, aber entschiedene und autoritäre Art, als wäre er gewohnt, sich stets des Geschehens zu bemächtigen.
»Ich bin Inspektor Petersen«, stellte er sich vor und deutete auf einen Mann in grünem Kittel, der uns im Vorbeigehen zunickte. »Das ist unser Gerichtsmediziner. Bitte kommen Sie doch einen Augenblick mit uns herein; wir haben Ihnen noch die eine oder andere Frage zu stellen.«
Der Gerichtsmediziner zog sich ein Paar Gummihandschuhe an und beugte sich über die Chaiselongue; aus der Entfernung sahen wir, dass er einige Minuten lang sorgfältig Mrs Eagletons Leichnam untersuchte und Blut- und Hautproben nahm, die er einem seiner Assistenten reichte. Ein Fotograf machte ein paar Blitzlichtaufnahmen von dem leblosen Gesicht.
»Nun gut«, sagte der Gerichtsmediziner schließlich und winkte uns zu sich. »In welcher Position genau haben Sie sie gefunden?«
»Ihr Gesicht war zur Lehne hin gedreht«, sagte Seldom, »und ihr Körper lag seitlich … noch etwas mehr … Die Beine waren ausgestreckt, der rechte Arm angewinkelt. Ja, ich glaube, so war es.« Er sah mich um Bestätigung heischend an.
»Und dieses Kissen da lag auf dem Boden«, ergänzte ich.
Petersen nahm das Kissen und zeigte dem Gerichtsmediziner den Blutfleck in der Mitte.
»Erinnern Sie sich, wo?«
»Auf dem Teppich, auf Höhe des Kopfendes. Es sah so aus, als wäre es ihr beim Schlafen heruntergerutscht.«
Der Fotograf machte zwei oder drei weitere Aufnahmen.
»Ich würde sagen«, wandte der Gerichtsmediziner sich an Petersen, »dass jemand die Absicht hatte, sie im Schlaf zu ersticken, ohne Spuren zu hinterlassen. Die betreffende Person hat vorsichtig ein Kissen unter ihrem Kopf weggezogen, ohne dabei das Haarnetz zu verschieben, oder hat das Kissen bereits auf dem Boden vorgefunden. Doch die alte Dame ist aufgewacht, während es auf ihr Gesicht gedrückt wurde, und hat womöglich versucht, sich heftig zu wehren. Da hat der Täter es mit der Angst zu tun bekommen und hat mit der Hand, oder vielleicht sogar mit einem Knie, den Druck verstärkt und dabei, ohne es zu merken, die Nase unter dem Kissen gequetscht. Daher rührt auch das Blut. Es ist einfach nur ein wenig Nasenbluten; die Äderchen sind in diesem Alter sehr verletzlich. Als er das Kissen weggezogen hat, sah er sich dann einem blutigen Gesicht gegenüber. Womöglich ist er erneut erschrocken und hat das Kissen auf den Boden fallen lassen, ohne noch zu versuchen, irgendetwas in Ordnung zu bringen. Vielleicht dachte er sich, dass es ohnehin keinen Unterschied mehr machen würde, und hat so schnell wie möglich das Weite gesucht. Ich würde sagen, der Täter hat zum ersten Mal einen Mord begangen und ist vermutlich Rechtshänder.« Er hielt seine beiden Hände über Mrs Eagletons Gesicht, um es zu demonstrieren. »Die Position des Kissens auf dem Teppich weist auf diese Drehung hin, was die natürlichste Bewegung für eine Person wäre, die es in der rechten Hand gehalten hat.«
»Männlich oder weiblich?«, fragte Petersen.
»Das ist eine interessante Frage«, sagte der Gerichtsmediziner. »Es könnte ein kräftiger Mann gewesen sein, der sie allein durch den verstärkten Druck seiner Mittelhand verletzt hat. Oder aber eine Frau, die sich zu schwach fühlte und ihr gesamtes Körpergewicht eingesetzt hat, um den Druck beizubehalten.«
»Todeszeit?«
»Zwischen zwei und drei Uhr nachmittags.« Der Gerichtsmediziner sah uns an. »Wann sind Sie gekommen?«
Seldom warf mir flüchtig einen fragenden Blick zu.
»Um halb fünf.« Dann fügte er zu Petersen gewandt hinzu: »Ich halte es für wahrscheinlich, dass sie gegen drei Uhr ermordet wurde.«
Der Inspektor blickte ihn mit aufflackerndem Interesse an.
»Ach ja? Woher wollen Sie das wissen?«