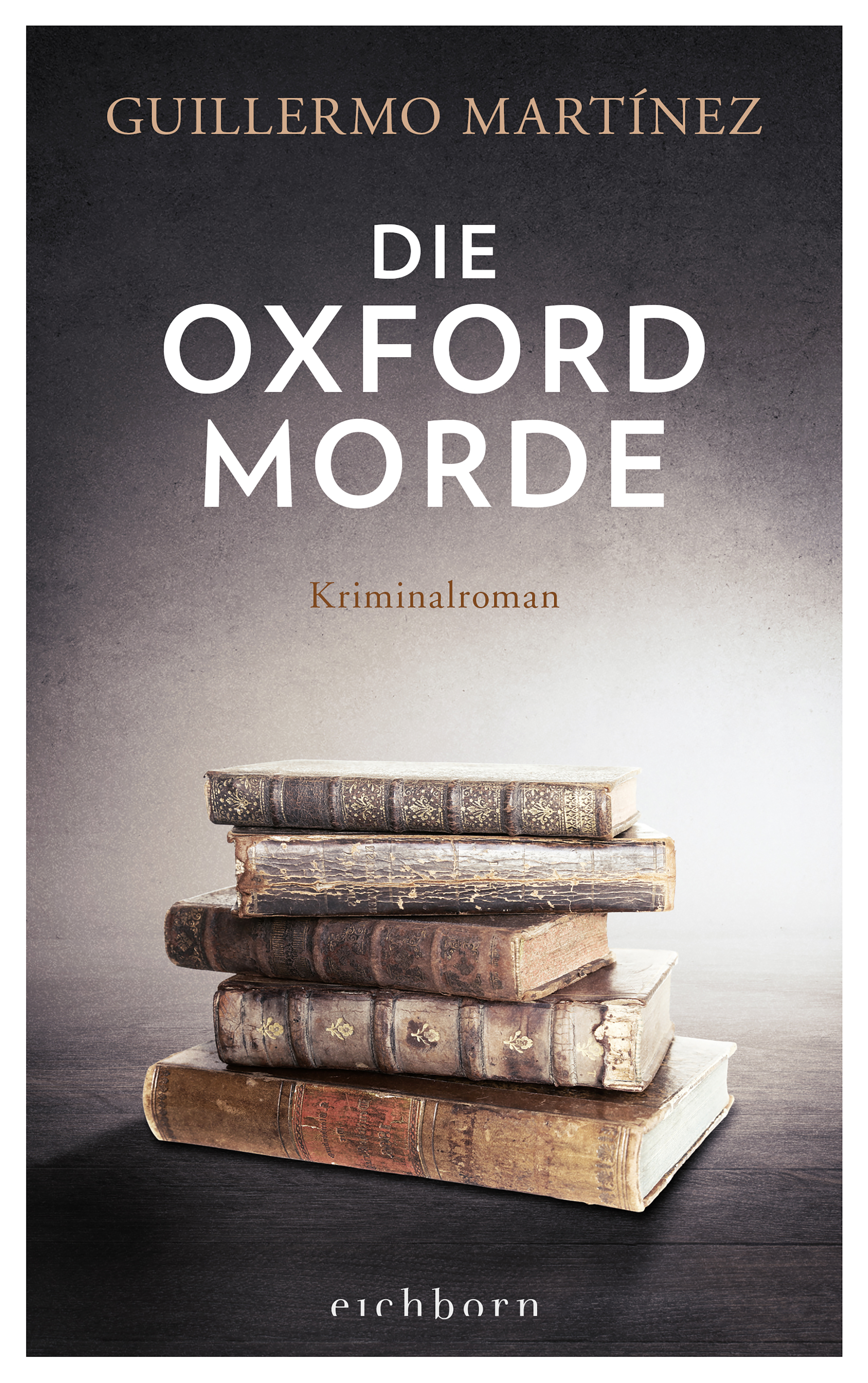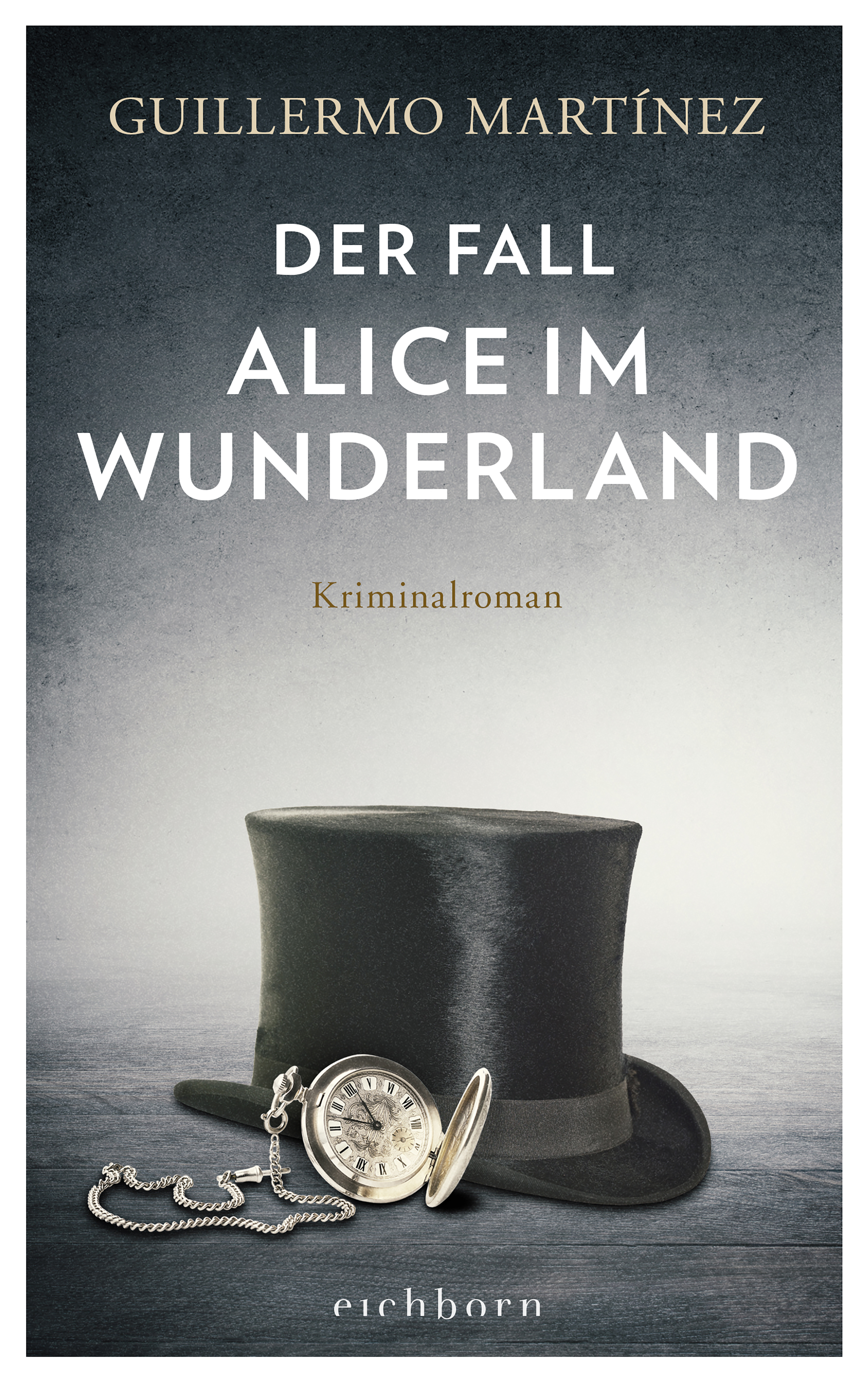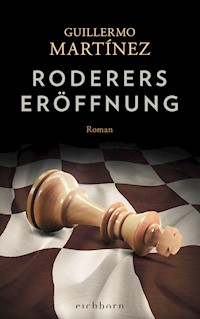
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abend für Abend sitzen Gustavo Roderer und sein Freund im Club Olimpo, um Schach zu spielen. Sie sind jung, hochbegabt und verlieren sich in Gedankenspielen, in denen das wirkliche Leben keinen Platz mehr hat. Doch während sein Freund beginnt, sich den Anforderungen des Lebens zu stellen, verliert Roderer zunehmend den Bezug zur Realität. Bald opfert er alles - Freunde, Familie, sogar Cristina, die ihn abgöttisch liebt, und schließlich sich selbst - um der absoluten Wahrheit des Seins auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Abend für Abend sitzen Gustavo Roderer und sein Freund im Club Olimpo, um Schach zu spielen. Sie sind jung, hochbegabt und verlieren sich in Gedankenspielen, in denen das wirkliche Leben keinen Platz mehr hat. Doch während sein Freund beginnt, sich den Anforderungen des Lebens zu stellen, verliert Roderer zunehmend den Bezug zur Realität. Bald opfert er alles – Freunde, Familie, sogar Cristina, die ihn abgöttisch liebt, und schließlich sich selbst – um der absoluten Wahrheit des Seins auf die Spur zu kommen.
Über den Autor
Guillermo Martínez, geboren 1962, lebt in Buenos Aires und ist promovierter Mathematiker. Zwei Jahre seiner Doktorandenzeit verbrachte er an der Universität Oxford. Für seinen Krimi »Die Oxford-Morde« erhielt er 2003 den Premio Planeta; der Roman wurde in über 40 Sprachen übersetzt und 2008 fürs Kino verfilmt. Der Nachfolgeband »Der Fall Alice im Wunderland« wurde mit dem Premio Nadal 2019 ausgezeichnet.
GUILLERMO MARTÍNEZ
RODERERSERÖFFNUNG
Roman
Übersetzung aus demargentinischen Spanisch von Angelica Ammar
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der spanischen Originalausgabe:
»Acerca de Roderer«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1992, 1999 by Guillermo Martínez
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ann-Catherine Geuder, Lübeck
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotive: © shutterstock.com: Frank Fiedler | ChewHow
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0952-1
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
I
Das erste Mal habe ich Gustavo Roderer an der Bar im Club Olimpo gesehen, wo sich abends die Schachspieler von Puente Viejo trafen. Der Ort war so zwielichtig, dass meine Mutter jedes Mal leise protestierte, wenn ich dorthin ging, aber doch nicht zwielichtig genug, als dass mein Vater sich dazu entschlossen hätte, ihn mir zu verbieten. Die Schachtische befanden sich im hinteren Teil des Raums; es waren nicht mehr als fünf oder sechs, mit einem eingelassenen Spielbrett aus Holz. In der übrigen Bar spielte man in engen, angespannten Runden Kniffel oder Karten, und je später der Abend, desto bedrohlicher klangen die laut nach Gin rufenden Stimmen und das harte Aufknallen der Würfelbecher herüber.
Ich für meinen Teil war überzeugt, dass die großen Schachspieler sich stolz von allem Irdischen fernhalten sollten, und betrachtete diese lärmende Welt mit gelassener Missbilligung, obwohl es mich doch ärgerte – und meine selbstzufriedene moralische Überlegenheit zunichtemachte –, dass meine ablehnende Haltung letztlich doch den Tugendpredigten meiner Mutter recht gab. Noch verwirrender aber war für mich die Entdeckung, dass die beiden Welten nicht gänzlich voneinander getrennt existierten: An diesen Spieltischen saßen einige, wie ich erfuhr, der einst brillantesten Schachspieler des Dorfes – als würde eine unwiderstehliche Anziehung, eine unerklärbare Umkehr der Intelligenz selbst die Besten früher oder später dorthin locken. Später wurde ich Zeuge, wie Salinas, der mit seinen siebzehn Jahren bereits in der gesamten Region als unschlagbar galt, nach und nach auf die andere Seite überwechselte, und damals schwor ich mir, dass es mir niemals so ergehen würde.
An dem Abend, an dem ich Roderer kennenlernte, hatte ich vor, eine Partie aus einer Schachzeitschrift zu rekonstruieren und vielleicht ein paar Runden mit dem ältesten der Nielsen-Brüder zu spielen. Roderer stand an der Theke und unterhielt sich mit Jeremías, oder besser gesagt, der Alte redete und hielt dabei ein Glas nach dem anderen gegen das Licht, während Roderer, der ihm schon gar nicht mehr zuhörte, auf das rasche Kreisen des Geschirrtuches und das kurze Aufblinken des Glases in der Luft sah, mit jenem abwesenden Gesichtsausdruck, der ihn oft mitten in einem Gespräch seiner Umgebung vollkommen enthob. Sowie Jeremías mich erblickte, winkte er mich herbei.
»Dieser Junge hier«, sagte er, »ist wohl gerade hergezogen. Es scheint, als suche er jemanden für eine Partie.«
Roderer war seiner Versunkenheit halbwegs entstiegen und warf mir ohne besonderes Interesse einen flüchtigen Blick zu. Damals streckte ich noch jedem geradewegs meine Hand hin, da mir dieser männliche Gruß mit seiner würdevollen Distanziertheit als eine der besten Errungenschaften des Erwachsenwerdens erschien. Doch diesmal hielt ich mich zurück und nannte nur meinen Namen. Roderer hatte etwas an sich, das den geringsten körperlichen Kontakt unvorstellbar machte.
Wir setzten uns an den letzten Tisch. Beim Auslosen der Farben zog ich Weiß. Roderer stellte seine Figuren äußerst langsam auf. Ich nahm an, er beherrsche gerade einmal die Spielregeln, und da ich in einem der Spiegel Nielsen hereinkommen gesehen hatte, eröffnete ich mit dem Königsbauer, in der Hoffnung, die Angelegenheit mit einem Gambit rasch zu erledigen. Roderer dachte eine verzweifelnd lange Weile nach und bewegte dann seinen Königsspringer auf f6. Mir wurde unbehaglich zumute: Seit Langem studierte ich ebendiese Taktik, die Aljechin-Verteidigung. Mehr oder weniger zufällig hatte ich sie in der Enzyklopädie entdeckt, und sofort hatte alles an dieser Eröffnung meine Bewunderung hervorgerufen: dieser anfängliche Satz des Springers, den man auf den ersten Blick für einen extravaganten, kindischen Zug halten konnte; die heroische, fast schon abfällige Art und Weise, mit der die Schwarzen gleich zu Beginn die mit der Eröffnung stets angestrebte Kontrolle über das Zentrum für einen fernen, vagen Stellungsvorteil opferten; und vor allem die Tatsache, dass es die einzige Eröffnung war, die der Weiße nicht ablehnen oder mit einer anderen Taktik abwenden konnte. In Puente Viejo war sie natürlich vollkommen unbekannt, dort spielte man die Spanische Eröffnung oder neben der Orthodoxen vielleicht noch eine andere Sizilianische Verteidigung. Die Aljechin-Verteidigung hatte ich mir für das Turnier aufsparen wollen. Doch plötzlich spielte dieser Neuankömmling vor aller Augen diese Eröffnungstaktik gegen mich. Natürlich war es immer noch möglich – und diese Option zog ich vor –, dass der Zug mit dem Springer nicht mehr als ein linkisches Anfängermanöver gewesen war. Ich schob meinen Königsbauern vor, und wieder überlegte Roderer sehr lange, bevor er seinen Springer nach d5 zog. Die folgenden Züge liefen ebenso ab: Ich führte gewissenhaft die Variante aus der Enzyklopädie aus, und jedes Mal brauchte Roderer eine ganze Weile, bis er reagierte, wählte aber schließlich immer den korrekten Zug, sodass ich nicht ausmachen konnte, ob er die Verteidigung wirklich kannte oder nur einer glücklichen Intuition folgte, die sich dem ersten ernsthaften Angriff würde beugen müssen.
Nach und nach ließen wir die Eröffnungszüge hinter uns und traten in das Niemandsland ein, in dem das wirkliche Spiel beginnt. Kaum nahm ich noch die Geräusche um mich herum wahr, wie gedämpft drangen sie zu mir vor. Die von Qualm umwobenen Kartentische kamen mir unwirklich weit weg vor, und selbst die bekannten Gesichter, die hinzugekommen waren, um das Spiel zu verfolgen, wurden zu fernen Schemen, wie wenn man weit draußen schwimmend ans Ufer zurückblickt. Dann sah ich wieder zu Roderer. Ich weiß, dass es später Frauen im Dorf gab, die sich nach ihm verzehrten; ich weiß, dass meine Schwester ihn bis zur Verzweiflung liebte. Er hatte braunes Haar, eine Strähne fiel ihm in die Stirn. Obwohl er offenbar nicht älter war als ich, hatten seine Züge etwas Abgeschlossenes, als hätten sie mit dem Ende der Kindheit ihre endgültige Form angenommen, ohne dass diese einem bestimmten Alter zuzuschreiben gewesen wäre. In seinen dunklen Augen lag ein Funkeln, das man im ersten Moment übersehen konnte; ein fernes Licht, das – wie ich später merkte – nie erlosch, als ließe er es in einer geduldigen Wachsamkeit brennen. Zog etwas oder jemand seinen Blick auf sich, wurde er jäh lebendig und richtete sich durchdringend, beinahe bedrohlich auf sein Gegenüber; allerdings nur für einen kurzen Moment, denn sofort sah Roderer wieder beiseite, als sei er sich bewusst, welches Unbehagen dieser Blick auslöste. Vor allem seine Hände waren auffallend, doch obwohl ich sie die ganze Partie lang ein ums andere Mal über das Schachbrett wandern sah, gelang es mir weder damals noch bei einem unserer späteren Zusammentreffen zu bestimmen, was so ungewöhnlich an ihnen war. Lange danach las ich in einem der wenigen Bücher, die von seiner Bibliothek übrig blieben, einen Absatz von Lou Andreas Salomé über die Hände Nietzsches, und da wurde mir bewusst, dass Roderers Hände wohl schlicht und einfach schön zu nennen waren.
Ich erinnere mich nicht mehr an alle Einzelheiten der Partie; sehr präsent ist mir dagegen noch das ohnmächtige Gefühl, das mich befiel, als ich merkte, dass Roderer jeden einzelnen meiner Angriffe abwehrte, wie scharf sie mir auch vorkommen mochten. Er hatte eine sonderbare Art, Schach zu spielen. Er schien meine Bewegungen kaum zu registrieren, als gingen meine Manöver völlig an ihm vorbei. Seine Züge wirkten planlos, konfus: Bisweilen besetzte er irgendein entlegenes Feld oder bewegte eine scheinbar unwichtige Figur, sodass ich meine Pläne bis zu einem gewissen Punkt weiterverfolgen konnte, nur um nach kurzer Zeit zu entdecken, dass Roderers Position sich unterdessen durch irgendeinen seiner Züge leicht verändert hatte, beinahe unmerklich, aber ausreichend, um meine Kalkulationen zunichtezumachen. Und traf dies im Grunde nicht auch auf unsere ganze spätere Beziehung zu? Dieses Duell, bei dem ich der einzige Kämpfende war und nichts als Fehlschläge landete. Denn das war vielleicht das Merkwürdigste: Roderer schien zu keinem Gegenangriff gewillt, keine sichtbare Bedrohung schwebte über meinen Figuren, und dennoch empfand ich jedes seiner Manöver als eine dunkle Gefahr, die Ahnung ließ mich nicht los, dass sich dort subtil und unausweichlich etwas anbahnte, das zu greifen mir nicht gelang. Die Partie war in der Zwischenzeit immer komplexer geworden; alle Figuren befanden sich noch auf dem Brett. Irgendwann hatte ich Salinas neben dem Tisch stehen sehen, sein Weinglas in der Hand; seine Mundwinkel deuteten ein gequältes Lächeln an, wenn er daraus trank. Dann sah ich Nielsen gehen. An der Tür nickte er mir zum Abschied mit einem Gesichtsausdruck zu, den ich nicht zu deuten wusste. Die Bar leerte sich nach und nach. Jeremías stellte die Stühle hoch. Inzwischen war ich es, der vor jedem Zug lange überlegte. Ich hatte meine Figuren gegen einen Randbauern gerichtet. Wie alle vorangegangenen erwies sich auch dieser letzte Angriff als nutzlos: Der Bauer, den ich schwach geglaubt hatte, zeigte sich bei jedem Gegenzug beschützter und schließlich vollkommen unangreifbar. Ich führte weiter Zug um Zug meine verstreuten Figuren zusammen, nicht, weil ich noch irgendeine Hoffnung gehegt hätte, sondern weil ich zu ausgelaugt war, um irgendetwas Neues zu versuchen. Als es mir gelungen war, sie alle zu versammeln, schob Roderer den belagerten Bauern ein Feld vor, und seine Dame stand meiner gegenüber. Ein kalter Schauder durchfuhr mich. Das war’s, gleich würde geschehen, was ich vage befürchtet hatte. Ich verschaffte mir einen raschen Überblick über die Lage:
Der Damentausch, den Roderer anbot, würde durch eine von mir selbst eingeleitete Kettenreaktion das Ende all meiner anderen Figuren bedeuten. Dennoch gelang es mir nicht, mir vorzustellen, wie das Spielbrett danach aussehen würde. Ich konnte fünf oder sechs Züge vorausdenken, aber weiter kam ich nicht. Meine Dame konnte nirgends ausweichen; der Tausch war erzwungen. Das erlöste mich zumindest davon, mir weiter den Kopf zu zerbrechen. Meine Figuren wurden in geordneter Reihenfolge geschlagen, eine pro Zug. Klackernd stießen die anderen gegen sie und beförderten sie an den Brettrand. Wie viele Züge konnte er bloß im Voraus berechnen?, fragte ich mich ungläubig. Als das Brett beinahe leer gefegt war, begriff ich schließlich, worauf es hinauslief: Der Bauer, gegen den ich meine vergeblichen Angriffe gerichtet hatte, war frei und rückte jetzt ein Feld vor. Ich betrachtete meinen eigenen Bauern und überschlug verzweifelt die mir verbleibenden Züge. Es war zwecklos. Roderer wandelte um, nicht ich.
Ich kapitulierte. Als wir aufstanden, sah ich meinen Gegner an, vermutlich in der Hoffnung, in seinem Gesicht ein Anzeichen von Zufriedenheit zu erhaschen, ein schlecht kaschiertes Lächeln, wie ich es selbst nie unterdrücken konnte, wenn ich gewann. Doch Roderer blieb ernst, fast unbeteiligt. Er hatte seinen langen dunkelblauen Mantel zugeknöpft und sah unruhig zur Tür. Seine Miene schien zugleich unentschlossen und verärgert, als setze ihm irgendetwas völlig Belangloses zu, irgendeine Lappalie, für die er keine Lösung fand. Wir waren inzwischen die einzigen Gäste. Da begriff ich, dass er sich nicht entschließen konnte, ob er auf mich warten und die Bar in meiner Begleitung verlassen sollte oder ob er sich gleich verabschieden und allein gehen konnte. Mir war diese Art von Konflikt sehr vertraut, doch bislang hatte ich geglaubt, ich allein leide unter der Unmöglichkeit, mich zwischen zwei gleichermaßen banalen und vollkommen bedeutungslosen Alternativen zu entscheiden. Ich dachte, nur mein Geist würde unschlüssig und gemartert zwischen zwei Möglichkeiten wanken, ins Leere argumentieren, ohne einen zwingenden Grund zu finden, während mein gesunder Menschenverstand mir spöttelnd zusetzte: Ist doch egal, ist doch völlig egal. Bestürzt entdeckte ich in einem anderen Menschen noch um einiges ausgeprägter die Symptome dieser Krankheit, die vielleicht lächerlich sein mochte, die ich bis dahin aber als mein persönlichstes Gut betrachtet hatte.
»Ich gehe auch«, sagte ich, um ihn zu erlösen. Dankbar nickte er. Ich gab Jeremías die Kiste mit den Schachfiguren zurück und schloss mich dem an der Treppe wartenden Roderer an. Beim Hinausgehen fragte ich ihn, wo er wohne; er lebte in einem der Häuser hinter den Dünen, sodass wir einen Block zusammen gehen konnten.
Die Ferien waren fast zu Ende, und in der Luft lag die trostlose Ankündigung der ersten kühlen Tage. Die Sommerfrischler waren abgefahren, das Dorf war wieder leer und still. Roderer lauschte dem fernen Rauschen des Meeres; er hatte offenbar keine Lust auf ein Gespräch. Plötzlich bellten neben dem Weg ein paar Hunde. Es kam mir vor, als versuche Roderer angespannt, sie in der Dunkelheit auszumachen.
»Hier gibt es viele herrenlose Hunde«, sagte ich. »Die Leute setzen sie am Ende der Saison aus.«
Roderer sagte nichts. Ich fragte ihn, auf welches Gymnasium er zu gehen gedenke.
»Ich weiß nicht.« Das sagte er so ernst und knapp, als handele es sich um eine Frage, die ihm schon zu viele Probleme beschert hatte und die er von sich wegschieben wollte.
»Die Auswahl ist ja sowieso nicht besonders groß«, sagte ich. »Entweder das Mariano Moreno, auf das ich gehe, oder sonst das Don Bosco.«
Roderer schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Schule besuchen werde«, sagte er.