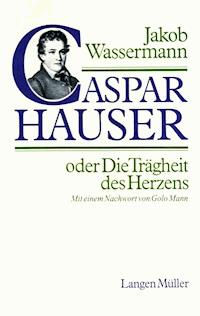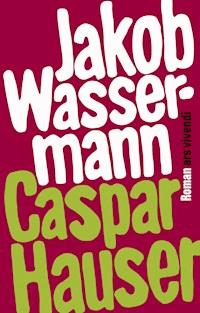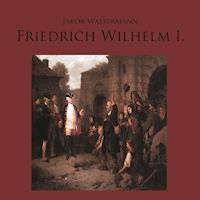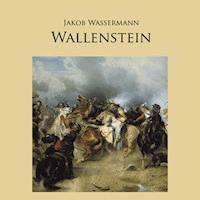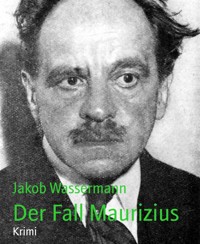
1,49 €
Mehr erfahren.
Der junge Etzel recherchiert einen 18 Jahre alten Mordfall, weil er, gegen seinen Vater, den Staatsanwalt rebellierend, einen Justizirrtum vermutet. Auch der Vater recherchiert und lässt den "Mörder" begnadigen, weil er dessen Unschuld erkennt. Dieser jedoch ist nicht mehr lebenstüchtig. - Eine spannende Geschichte um Schuld und Unschuld, um Vater und Sohn. Was ist Gerechtigkeit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Fall Maurizius
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenErster Teil: Die Kostbarkeit des Lebens - Erstes Kapitel
Schon ehe der Mann mit der Kapitänsmütze aufgetaucht war, hatte sich eine vorahnende Beunruhigung an dem Knaben Etzel gezeigt. Vielleicht war der Brief mit dem Schweizer Poststempel die Ursache. Von der Schule nach Hause kommend, hatte er den Brief auf dem Spiegeltisch im Flur liegen sehen. Er nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn aufmerksam mit seinen kurzsichtigen Augen. Die Schriftzüge berührten ihn wie etwas Vergessenes, das man nicht an seinen Ort bringen kann. Wie geheimnisvoll das war, ein verschlossener Brief! Herrn Oberstaatsanwalt Wolf Freiherrn von Andergast, lautete die Adresse, geschrieben in einer runden raschen Schrift, die gleichsam auf Rädern lief. »Was mag das für ein Brief sein, Rie?« wandte er sich an die Hausdame, die aus der Küche trat. Er nannte Frau Rie seit seinen Kinderjahren kurzweg Rie. Sie war schon über neun Jahre im Haus und ihm so vertraut, wie eine Frau es sein kann, die den Platz der Mutter einzunehmen berufen ist und ihn in allen äußeren Dingen auch ausfüllt. Es sei bei dieser Gelegenheit gleich erwähnt, daß Herr von Andergast seit neuneinhalb Jahren geschieden war; die drakonischen Scheidungsbedingungen verpflichteten die Frau, sich von ihrem Kinde fernzuhalten, sie durfte ihn weder sehen noch ihm schreiben; selbstverständlich war es auch ihm verboten, ihr zu schreiben, und niemand durfte in seiner Gegenwart von ihr sprechen. So wußte der nun Sechzehnjährige nichts von seiner Mutter, der im Hause herrschende Geist hatte sogar den Antrieb erstickt, nach ihr zu fragen, man hatte ihm nur vor langer Zeit einmal beiläufig gesagt, als handle es sich um eine gleichgültige, fremde Person, sie lebe in Genf und könne aus Gründen, die er als erwachsener Mensch erfahren werde, nicht zu ihm kommen. Damit hatte er sich zufrieden gegeben, weil er sich zufrieden geben mußte. Ob er sich nicht heimlich mit der Sache beschäftigte, war bei der Verschlossenheit, die er in allem zeigte, was sein inneres Leben betraf, nicht zu ergründen. Er hatte zu schweigen gelernt, da er die Unübersteiglichkeit der Schranken kannte, die in einem Fall wie diesem der Wißbegier gesetzt waren. Je mehr auf ihn eindrang, das seine Anteilnahme heischte, je beherrschter glaubte er sich geben zu sollen. So wie die Frage an Frau Rie etwas hinterhältig geklungen hatte, war es bei allem, was er erfahren wollte: er stand im Hinterhalt, und seine kurzsichtigen Augen beobachteten Vorgänge und Personen mit gespannter Aufmerksamkeit.
Die Rie hatte den Brief noch nicht gesehen. Sie nahm ihn dem Knaben aus der Hand, beschaute ihn prüfend, zwang sich zu einer unbefangenen Miene und sagte: »Das geht deinen Vater an, kümmer dich nicht. Dein Butterbrot steht drin auf dem Tisch. Man kümmert sich nicht um Briefe, die einem nicht gehören.«
»Gott, wie langweilig du bist, Rie«, erwiderte der Knabe, »du denkst doch nicht, daß ich nicht weiß, von wem der Brief ist? Kommen öfter solche? Schreibt sie öfters?«
Die Rie stutzte und betrachtete verwundert das zu ihr erhobene energische Gesicht des Knaben. »Meines Wissens nicht«, murmelte sie verlegen, »meines Wissens ist es das erste Mal.« Und wieder schaute sie in das schmale, blasse, intelligente Gesicht und senkte scheu den Blick, so daß er nur noch die zarte, kleine Gestalt von den Schultern abwärts umfaßte.
»Ist das wahr, Rie?« fragte Etzel mit verschlagenem Lächeln, aus dem Hinterhalt heraus.
»Was bringt dich denn auf die Vermutung?« ärgerte sich die Rie. »Du bist ja der reinste Detektiv. Willst du mir eine Falle stellen? So schlau wie du bin ich noch lange.«
»Nein, Rie, das schwör ich dir, so schlau bist du nicht«, antwortete Etzel und sah sie mitleidig an. »Sag ehrlich: Kommen öfter solche? Hast du schon mal einen gesehen?« Er fragte mit großgeöffneten Augen, in deren Grüngrau aus der Tiefe her ein bronzenes Funkeln trat. Das Mitleid bezog sich auf die plumpe Manier, mit der die gute Dame ihn zu täuschen suchte. Sooft er Gelegenheit hatte, die Schärfe seiner Sinnesorgane mit derjenigen anderer Menschen zu vergleichen, wunderte er sich mitleidig oder erschrak sogar, wie jemand, der eines Gebrechens inne wird, das er besitzt und von dem er nichts gewußt hat.
»Nie, ich sag' dir doch, es ist das erste Mal«, gab die Rie zurück.
»Ich möcht' dabeisein, wenn er den Brief aufmacht und liest«, murmelte Etzel und biß auf den Knöchel des Mittelfingers, den er dann gedankenvoll zwischen den Zähnen beließ. Er – das hatte den Tonfall von Respekt, von Furcht, von Gläubigkeit, von Abneigung. Der Knabe drehte sich auf dem Absatz herum, und den mit einem Riemen verschnürten Bücherpack in der rechten Hand schlenkernd, während der Mittelfingerknöchel der linken noch im Mund steckte, schritt er seinem Zimmer zu.
Die Rie schaute ihm unzufrieden nach. Sie liebte nicht Gespräche, von denen man, wenn sie zu Ende waren, nicht wußte, ob der andere nicht etwas gegen einen hatte. Etzel war die einzige Person im Hause, bei der sie ein Gemütsecho spürte. Gemüt war hier im Hause weder gefordert noch angesehen. Es war ein strenges Haus. Der Herr vertrug und wünschte keine Nähe. Stumme Pflichterfüllung war, was er erwartete, sympathische Beziehung behielt er sich höchstens in der Stille vor. Selbst aufopferndes Bemühen wäre mit dem gefühlausschließenden Hinweis behandelt worden, daß er ja seine Leute bezahlte, im Notfall sogar für das Opfer.
Sie hörte Etzel in seiner Stube auf und ab gehen. Es waren lächerlich kurze Schrittchen. Die Erinnerung an sein emporgerecktes Gesicht mit dem bronzenen Funkeln in der Tiefe der Augen erfüllte sie mit Sorge. Sie dachte: Da ist plötzlich ein Mensch, bis jetzt ist nur ein dummer kleiner Junge dagewesen; wo kommt auf einmal der Mensch her?
Sie kannte ihn so lange. Ein ruhiges Kind; eher beschaulich als lebhaft; leicht lenkbar, weil ohne Gier und Begierden und hauptsächlich ohne Anfälle jener Langeweile (unzureichendes Wort), die manche Kindheit mit rätselhafter Qual belastet. Es war stets ein Hauch von Heiterkeit um ihn. Seine Verständigkeit entbehrte nicht der Komik; Philosoph Dr. Winzig nannte schon den Zwölfjährigen seine Großmutter, die alte Freifrau von Andergast, die seine drolligen Aussprüche bei ihren Bekannten in Umlauf brachte. Die Rie fühlte sich durchaus als eine von Amts wegen eingesetzte Mutter, da die von Gott eingesetzte, über die sie nur Phrasenhaftes, wenn nicht Lügenhaftes wußte, sich ihrer Pflicht entzogen hatte. So sah sie es, beeinflußt vom Klima des Hauses: Pflichterfüllung, Pflichtvergessenheit, das waren die Pole, positiver und negativer, zwischen denen sich die Andergastsche Welt, und das war die Welt schlechthin, bewegte. Etzel war in ihren Augen ein verlassenes Kind, und weil sie ihn betreuen konnte, hatte sie ihn ins Herz geschlossen und glaubte vor allem, ihn zu verstehen. Ein Irrtum, mit dem sie nach ihrer Fasson glücklich war.
Vermutlich fand auch Herr von Andergast, daß aus dem dummen kleinen Jungen sozusagen über Nacht ein Mensch geworden war, denn Etzels Handlungen, Tageseinteilung, Arbeiten und Lektüre standen unter noch schärferer Kontrolle als früher. Eine Andeutung der Rie über den Zwischenfall mit dem Brief hatte genügt, ihn die Gefahr wittern zu lassen, die von dorther drohte, und er traf seine Maßregeln. Daß man ihm solche Vorkommnisse berichtete, geschah auf Grund des inneren Zwanges, den er auf die Leute seiner Umgebung ausübte; und wenn ein solcher Bericht lückenhaft war, ergänzte er ihn mit der vollendeten Kombinationsgabe, die eine seiner gefürchtetsten und bestechendsten Eigenschaften war. Sie sicherte ihm stets den Vorteil der gedeckten Reserven, die einzusetzen er in der Regel gar nicht mehr genötigt war, wenn er die Begebenheiten und Personen dorthin gelenkt hatte, wo er sie brauchte und wo sie ihm dienten, ohne daß man die Drähte bemerkte, an denen er sie zog. Es war, wie bei einer musterhaften elektrischen Anlage, ein verläßliches Funktionieren von Kontakten, geheimen Leitungen und zeitsparenden Schaltapparaten.
Unter den Wirkungen dieser tadellosen Einrichtung war Etzel aufgewachsen, und seine Nerven hatten sich ihr angepaßt, obwohl sie zuzeiten rebellierten. Er lebte zwischen gläsernen Wänden. Verstöße, die er sich zuschulden kommen ließ, wurden nicht beredet, nicht bedroht, sondern bloß notiert. Es war ein schweigsames System. In der kritischen Lage schienen dann alle Bewohner des Hauses freiwilligen Spionagedienst zu verrichten. Auch Lieferanten, Boten, Briefträger, Amtsdiener waren dem überall spürbaren obersten Willen untertan, der regierte, ohne sein Regiment zu verkünden oder es dem einzelnen besonders einzuschärfen. Sie waren zum Gehorsam gebracht und zur Angeberei dressiert, einfach dadurch, daß er vorhanden war, wuchtig und großartig wie ein Berg.
Das waren Kindheitseindrücke. Seine ganze Kindheit war unter eine luchsäugige, aber verborgene Aufsicht gestellt. Jedem Ding war Aufsicht übertragen. Kalender, Stundenplan, Uhr, Merkbuch, Schulzeugnis: alles ging von der Tabelle aus und strebte zur Festsetzung hin, amtlich starr. Dabei wurde keine Vorschrift ausdrücklich bestimmt oder die Einhaltung äußerlich erzwungen; sie wurde nur still vermittelt, und die eiskalte Selbstverständlichkeit, mit der es geschah, ließ an Widerspruch nicht denken. Die Verrichtungen und die Zeit waren durchätzt von der Vorschrift; Mittagessen: ein Uhr fünfzehn; Abendessen: sieben Uhr dreißig; Bad: Mittwoch und Samstag neun Uhr; Taschengeld: eine Mark per Woche; Umgang mit X. Y.: nicht ratsam, daher zu unterlassen. Im Fall verwunderten Aufblickens: ist etwas zu bemerken? Im Fall verlegenen Zögerns: darf ich bitten? Sehr freundlich, aber sehr kühl. Sehr gemessen. Sehr weltmännisch.
Wenn ein starker Mensch einen Raum verläßt, wird die Atmosphäre lange nicht ruhig von ihm. Seine Energien strahlen auf die Sachen über. Wie erst gibt er sich in den Zimmern kund, in denen er haust und atmet! Das Bett, in dem er schläft, der Stuhl, auf dem er sitzt, der Spiegel, in den er blickt, der Schreibtisch, an dem er arbeitet, die Zigarrenbehälter und Aschenschalen, die er benutzt, alles hat sein Gepräge, etwas von seiner Miene, seiner Gebärde, ja von seiner Körpertemperatur, als ob eine tägliche minimale Abgabe seines Blutes an sie stattfände.
Seit er denken und sich erinnern konnte, hörte Etzel eine bestimmte Tür in ein und derselben Art sich öffnen und schließen; beim Öffnen weit und langsam, als ob die mächtige Figur erst den Raum messen und mit dem Auge von ihm Besitz ergreifen müsse; beim Schließen unwiderruflich, wie man einen Brief mit entscheidendem Inhalt versiegelt. Daraus schmiedete die Phantasie eine Kette gleichbleibender Vorstellungen: Entfernung aus einer Welt, in der sich schauriges Leben ereignete; feierliche Unterzeichnung schicksalsvoller Schriftstücke; einschüchternde Einsamkeit. Als Kind hatte er sich bisweilen zu der Tür hingeschlichen und sie mit großen Augen lange angeschaut, wie um unsichtbare Runen zu entziffern, mit denen sie beschrieben war. Vernahm er ein Räuspern des Vaters, das Scharren seiner Füße, sein gewichtiges Auf- und Abschreiten, das den Rhythmus eines Mannes hatte, den ein Heer unguter Gedanken belagert, dann zog er sich leise zurück und versuchte in der Stille seiner Kammer etwas von diesen Gedanken, den vollzogenen Entschlüssen, der ganzen unbekannten düsteren und gefährlichen Vaterwelt zu erraten.
Ähnlich war es mit den Glockensignalen, die so befehlend kurz nur aus seinen Räumen kamen, Punkt halb acht Uhr morgens aus dem Schlafzimmer, Punkt halb drei, nach der Mittagssiesta, aus dem Arbeitszimmer, ausgenommen an Tagen, wo Gerichtsverhandlungen bis in den Nachmittag dauerten. Bei jedem Signal zuckte Etzel zusammen, zweimal täglich befiel ihn die nämliche, mit Herzklopfen verbundene Beklemmung. Es geschah noch jetzt nicht selten – dem Kind war es ein häufiger Alpdruck gewesen –, daß er nachts aus dem Schlafe fuhr, weil die Glocke in den Traum geschrillt hatte. Er lauschte und sah dicht vor sich – beleuchtete Plastik in der Dunkelheit – die Hand des Vaters mit gebietend ausgestrecktem Zeigefinger. Er kannte diese Hand besser als die eigene; sie gehörte sogar in eine Reihe wiederkehrender Traumerscheinungen; sie war vornehm schmal, mit spitz zulaufenden Fingern, ins Gelbliche spielenden Nägeln und einer seidigen Schicht brauner Haare auf dem Rücken. Manchmal bewegte sie sich im Traum auf einem blauen Aktendeckel wie ein seltsames Reptil. Ihre stumme Beredsamkeit oder ausdrucksvolle Ruhe ließ bisweilen an die Hand eines Schauspielers denken, eines besonders erfahrenen und überlegenen allerdings, der nur strenge und gelassene Charaktere verkörpert und sie wohlerwogen »spielt«, nicht geradezu lebt, sondern eben spielt, um begreiflich zu machen, daß er die Distanz wahrt. Mit dem Begriff Distanz war Etzel schon ziemlich früh vertraut, obschon seine Natur, im Gegensatz zu der des Vaters, auf Nähe angewiesen war. Seine Kurzsichtigkeit betonte es auch äußerlich.
Das lautlose Überwachungssystem erfüllte seinen Zweck kaum noch dem Scheine nach, da Etzel bereits erfolgreiche Anstalten getroffen hatte, sich aus den unbequemen Klammern zu befreien. Dies wurde ihm freilich schwerer als andern Jungen in ähnlicher Lage, da ihn seine Loyalität an Abmachungen band und seine geistige Selbständigkeit ihn verhinderte, sich einem Altersgenossen anzuvertrauen. Es war ihm auch nicht möglich, sich einer der Gruppen oder Parteien anzuschließen, die sich unter den Kameraden gebildet hatten und fortwährend neu bildeten. Er hatte keine Freude an ihren Debatten und nahm an ihren Versammlungen nur selten und widerwillig teil. Kaum war er zu bewegen, sich zu einer Frage beistimmend oder ablehnend zu äußern, und ihre kategorischen Erledigungen erweckten nichts als Zweifel in ihm. In seiner Zurückhaltung lag mehr Mut als in dem Geschrei der Draufgänger, das wurde eingesehen. Sonderbar genug, man achtete ihn deshalb. Trotzdem war der einzige Freund, den er hatte (für sich selbst schränkte er den Titel Freund vorsichtig ein, nach außen ließ er ihn aus Courtoisie gelten), ein Radikalist und unruhiger Kopf; aber schließlich war es ja nicht die Gesinnung Robert Thielemanns, deretwegen er ihn zum Gefährten erwählt, sondern eine gewisse Breite und Offenheit der Natur, die ihm gefiel; und so entstand ein Verhältnis, das auf Temperamentsausgleich gegründet war, wobei sich groß und klein, plump und beweglich, rauh und zart im Gegensatz ergänzten. Thielemann liebte es, den Beschützer Etzels zu spielen, um dessen geistige Überlegenheit oder Überlegenheit der persönlichen Form er übrigens wußte. Für seine manchmal ans Bizarre streifende Ursprünglichkeit im Denken und Urteilen fehlte ihm das Verständnis, aber die körperliche Unentwickeltheit Etzels und seine scheue Feinheit (unter der sich allerdings eine für ihn nicht wahrnehmbare Kraft verbarg) trieben ihn dazu, den Jüngeren und Schwächeren zu bemuttern. Und nicht nur er allein, alle Kameraden gingen glimpflich mit ihm um.
Etzel idealisierte, wie gesagt, seine Freundschaft mit Thielemann nicht. Er erkannte klar das Vorläufige wie das Ungenügende daran und benahm sich wie jemand, der, vielleicht aus Bescheidenheit, vielleicht um nicht aufzufallen, vielleicht weil er nichts Besseres gefunden hat, mit einer ziemlich engen Behausung vorliebnimmt, obwohl ihm seine Mittel gestatten würden, eine bessere zu beziehen. Das Gefühl des Provisorischen herrschte überhaupt bei all seinen Beziehungen in ihm vor, ohne daß er wußte, woher es kam, und ohne daß er dagegen anzukämpfen vermochte. Mühsam genug, es nach außen hin zu verheimlichen, wenn er es in manchen Momenten sich selber nicht mehr verheimlichen konnte. Das war es eben, er hatte die Gabe, sich selber was zu verheimlichen: ein schwieriger Prozeß, der Schlauheit und einige Phantasie erfordert. (Er legte aber keinen Wert auf Phantasie, er wollte nichts wissen von der Phantasie, und das war eine weitere Merkwürdigkeit seines Charakters.)
Gern hätte er mit Robert Thielemann über den Mann mit der Kapitänsmütze gesprochen, unterließ es jedoch, da er fürchtete, auch sich selbst die Beunruhigung, die von ihm ausging, zu deutlich zu enthüllen. Die dreimal wiederholte Erscheinung des Alten beschäftigte und verdunkelte unablässig seine Gedanken. An dem Tage, wo er Zeuge wurde, daß der mysteriöse Mensch auch seinem Vater auf dessen Wegen folgte, auch ihm gegenüberzutreten wagte und daß dies, bei allem Hochmut, bei aller kalten Unnahbarkeit, kein gleichgültiger Eindruck für den Vater zu sein schien, keine verächtliche Episode, dessen glaubte Etzel sicher zu sein, an dem Tage verwandelte sich die bloße Beunruhigung in gereiztes, fortwährend anwachsendes Mißtrauen, das gegen alle und alles in seiner Umgebung gerichtet war, als trügen die Mauern nicht mehr verläßlich das Dach, als seien penetrante Giftstoffe in den Schränken aufbewahrt, als brenne im Keller eine Zündschnur, die demnächst eine Kiste Dynamit zur Explosion bringen mußte. Dieser peinlich abwartende Zustand dauerte mit größeren oder geringeren Pausen an, bis ihm in einem der Aktenfaszikel des Vaters das Schriftstück in die Hände geriet, das dann sein ganzes ferneres Schicksal entscheidend beeinflußte.
Gehaben und Aussehen des Mannes mit der Kapitänsmütze, obwohl zunächst unauffällig und alltäglich, hatten dennoch etwas Gespenstisches, schon durch die Beharrlichkeit und bohrende Aufmerksamkeit, mit der er den Knaben von der ersten Sekunde der Begegnung an betrachtete, ihm eine Zeitlang auf Schritt und Tritt folgte, ihn dann zu überholen suchte, um ihn, wenn dies gelungen war, aufs neue anzustarren und schließlich, wie er unerwartet aufgetaucht war, unerwartet wieder zu verschwinden. Es war ein kleiner, hagerer, alter Mann, kein »Herr«, auch kein Arbeiter, sondern dem Anschein nach ein Kleinbürger. Er mochte etwa siebzig Jahre alt sein, sah aber ziemlich rüstig aus und bewegte sich nicht ohne Flinkheit. Er trug einen schäbigen braunen Pelzrock, die Hände staken in Wollhandschuhen, über den Handgelenken hatte er außerdem sogenannte Pulswärmer mit rotem Saum, der linke Arm hing starr am Körper herab. Die beiden ersten Male hatte er eine kurze englische Pfeife geraucht, oder vielleicht war sie nur kalt zwischen den Zähnen gesteckt; jedenfalls gewahrte man hinter den strichdünnen, glattrasierten Lippen die schadhaften, beinahe schwarzen Zähne. Etzel hätte jede Linie des knochigen, verräucherten, boshaften Gesichts zeichnen können, die kleinen, spähenden, glitzernden Augen, die einen astigmatischen Blick hatten, wie wenn eines davon ein Glasauge wäre, die komisch abstehenden Ohren, die über graugrüne Backenbartbüschelchen hinausragten und an zwei häßliche, bis auf die Haut entfiederte Vögel in einem verdorrten Gestrüpp erinnerten. Das erste Mal hatte ihn Etzel auf der unteren Mainbrücke gesehen. Er befand sich in Gesellschaft von Robert Thielemann, dem Stotterer Schlehlein, dem langhalsigen Max Schuster, der eine Rolle in der Jugendbewegung spielte, dem dicken Klaus Mohl (dem Fresser, wie sie ihn wegen seines ewigen Heißhungers nannten) und Müller I und Müller II. Es hatte sich ein politischer Streit erhoben. Veranlassung war eine erbitterte Bemerkung Thielemanns über die perfiden Umtriebe Schusters gewesen. Die von ihm geführte Gruppe hatte gehässige Gerüchte über die republikanische Gruppe ausgestreut, und Thielemann warf ihnen ihr niederträchtiges Ränkespiel vor und daß sie sich, ohne jemals Farbe zu bekennen, wie ausgestopfte Puppen von Leuten hin und her schieben ließen, von denen sie nicht einmal wußten, ob sie nicht bezahlte Werber der Reaktion waren. »Ihr seid mir saubere Brüder«, rief er immer wieder aus, und der gemütlich breite Dialekt bildete einen komischen Gegensatz zu seinem Zorn. Er fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, sein Gekräh erregte die Mißbilligung der Vorübergehenden. Er sah auch nicht besonders vertrauenerweckend aus mit dem brennroten Haarschopf, dem von kaffeebraunen Sommersprossen übersäten Gesicht und dem wehenden Flaus über den Schultern. Als er ihnen schließlich die Anklage zuschleuderte, sie und ihre Hintermänner terrorisierten bereits diejenigen unter den Lehrern, die man bisher noch zu den Aufrechten habe zählen dürfen, sogar ein Mann wie Camill Raff bekenne sich nicht mehr offen, sondern habe sich scheu in den Beobachterwinkel verkrochen, war er ganz grün vor Wut und schien nicht übel Lust zu haben, sich auf Schuster und die zwei Müller zu stürzen. Jener grinste halb verlegen, halb herausfordernd, der Stotterer Schlehlein, durch die Majorität sich geschützt wissend, pflanzte sich vor Thielemann auf und sagte unverschämt: »Das ist wa... wahr, dein Raff ge... ge... gehört eben auch zu den Bro... Bro... Brotsitzern. Hat A... A... Angst um die Stellung.« Thielemann maß ihn mit geringschätzigem Blick und warf hin: »Halts Maul, du Tropf!« Er sah sich nach Unterstützung um, aber es war niemand da für ihn, denn Etzel, dem derlei Auftritte zuwider waren, hatte sich von der hadernden Schar abgesondert und war vorausgegangen. Sie hatten vom Schweizerplatz her die Brücke erreicht; indem Thielemann sich hilfesuchend umschaute, nahmen seine Züge den Ausdruck des Schreckens an; er sah Etzel mitten auf dem Fahrdamm geistesabwesend auf ein ratterndes Lastauto zugehen, das ihn in den nächsten Sekunden niedergeworfen haben mußte. Er schrie aus vollem Halse: »Paß auf, Andergast, zum Teufel, paß auf!«, war mit einem Sprung bei dem Gefährdeten und riß ihn so rechtzeitig noch zurück, daß das Schutzblech des Wagens nur seine Hüfte streifte.
Bei dem Namensruf, Andergast, wandte sich ein Mann, der am Geländer der Brücke stand und die Pfeife zwischen den Lippen auf den Strom hinunterschaute, als sehe und höre er nicht, was neben und hinter ihm vorging, mit jähem Ruck um, musterte die Gruppe der Knaben, faßte Etzel scharf ins Auge, und als Thielemann seinen Arm in den Etzels schob und halb ärgerlich, halb befehlend sagte: »Marsch, Andergast, lassen wir die Lumpenkerle«, folgte er den beiden in die Neue Mainzer Straße und hielt sich in einem Abstand von etwa zwanzig Schritten hinter ihnen. Erst am Opernplatz, als sie vor der Auslage einer Buchhandlung stehenblieben, überholte er sie, wartete, bis sie ihren Weg fortsetzten, und schaute Etzel wieder wie auf der Brücke mit dem bohrenden, glitzernden, dabei ruhigen und gedankenvollen Blick an. »Kennst du den?« fragte Thielemann verwundert, während sie weitergingen. Etzel verneinte und hatte eine unbehagliche Empfindung im Rücken.
Zwei Tage darauf stand der Mann vor dem Eingangstor des Gymnasiums. Es war mittags um zwölf, die Klassen strömten aus der Halle, zerteilten sich unter betäubendem Stimmenlärm nach allen Seiten; Etzel befand sich unter den Nachzüglern, sein erster Blick, als er ins Freie trat, fiel auf den Mann mit der Kapitänsmütze, er rundete groß die Augen, er stutzte. Der Mann sah ihn an, ohne zu lächeln, ohne eine Miene zu verziehen, und ging dann hinter ihm her. Da sich wieder das unbehagliche Gefühl im Rücken einstellte, stärker noch als vorgestern, schob er den Bücherpack tiefer in die Achsel und setzte sich in einen Trab, der den unbekannten Verfolger nach fünf Minuten einen Kilometer weit zurückließ.
Das dritte Mal stand er vor dem Andergastschen Hause, an der Ecke der Lindenstraße, als Etzel mit Heinz Ellmers von der Turnstunde kam. Dieser Ellmers, Sohn eines Baumeisters, ein vorzüglicher Mathematiker, hatte sich erbötig gemacht, Etzel bei einer algebraischen Hausaufgabe zu helfen, vor der er den ganzen gestrigen Abend ratlos gesessen hatte. Eigentlich mochte er Ellmers nicht leiden, der ein Großmaul und Streber war und vor einigen Monaten wegen einer nicht recht klargewordenen Denunziationsgeschichte beinahe von der gesamten Klasse boykottiert worden wäre. Ellmers hatte aber Etzel seinen Beistand so bieder dringend angetragen – es lockte ihn wohl, sagen zu können, er verkehre beim Baron Andergast –, daß Etzel keinen Grund sah, den Spröden zu spielen. Diesmal erschrak Etzel, als er den Mann mit der Kapitänsmütze erblickte. Es war die Wiederholung, die etwas Drohendes hatte und ein Gefühl der Unausweichlichkeit beschwor. Es war die größere Nähe des Menschen, es war die Einsamkeit der stillen Straße; das alles im Verein rief Schrecken hervor. Seine Kurzsichtigkeit hatte ihn bisher gehindert, die Züge des Fremden und die Einzelheiten seiner Erscheinung genau wahrzunehmen; jetzt stand der Mann so dicht vor ihm, daß er das gelbliche Grau der Augen, sogar die abgeschabten Stoffknöpfe des Pelzrocks sehen konnte. Als er von der Straße in den Vorgarten bog – Ellmers folgte ihm auf dem Fuß –, stand der Hausmeister mit einem Schutzmann plaudernd unterm Tor. Der Hausmeister grüßte; auch der Schutzmann, sich dem Sohn des Oberstaatsanwalts gegenüber wissend, salutierte. Etzel verspürte ein Schwindelgefühl, als er bemerkte, daß der Mann mit der Kapitänsmütze ebenfalls Anstalten traf, ins Haus zu gehen. Wahrscheinlich rechnete er darauf, unangefochten an dem Hausmeister vorbeizukommen und lästigen Fragen zu entgehen, wenn er sich den beiden Knaben an die Fersen heftete; man konnte ihm diese Überlegung vom Gesicht ablesen. Es gelang ihm auch; der Hausmeister warf zwar einen argwöhnischen Blick auf ihn, ließ ihn aber passieren. Im Flur blieb er dann stehen und schaute den Knaben nach. Der zusammengeschnallte Bücherpack entfiel Etzel. Ellmers hob ihn auf. »Danke«, sagte Etzel. Er lauschte angestrengt; je höher sie gegen den zweiten Stock kamen, je angestrengter lauschte er. Ein paar Stufen nach dem ersten Stock drehte er sich um und horchte hinunter. Ellmers schaute Etzel besorgt ins Gesicht und fragte: »Fehlt dir was, Andergast! Du bist ja so bleich.« Etzel lauschte und flüsterte: »Kommt er?« Der andere, erstaunt: »Wer? wen meinst du?« Etzel hielt sich am Stiegengeländer fest. Er hörte tappende Schritte heraufkommen. Was für ein Mensch mag das sein, daß er sich so hartnäckig an einen klammert? dachte Etzel, und die hartnäckige Verfolgung des Unbekannten flößte ihm immer stärkere Furcht ein. Heinz Ellmers aber empfindet gerade in diesem Moment, mit einer Schärfe wie nie zuvor, daß er Etzel von Grund aus unsympathisch ist, und er schaut düster und etwas feindselig zu dem um zwei Stufen höher stehenden Etzel hinauf, der wieder seinerseits, mit einer neuen Spannung in den Zügen, in die Höhe blickt, denn er hört auch von oben Schritte herunterkommen, Schritte, die ihm vertraut sind. Nach einer Weile zeigt sich Herrn von Andergasts schlanke Gestalt im Fensterviereck. Eben biegt er um die Ecke der Stiege; unten biegt der Mann mit der Kapitänsmütze um die Ecke der Stiege. Es ist Etzel, als sei dies von folgenschwerer Bedeutung, obwohl er es mit seiner Vernunft nur als Zufallsbegegnung betrachten kann. Herr von Andergast nickt den Knaben zu, stellt eine gleichgültige Frage (»Seid ihr schon fertig mit dem Tag!« oder so), ohne im Hinabschreiten innezuhalten; dann fällt sein Blick auf den Mann mit der Kapitänsmütze. Dieser bleibt sofort stehen, mit dem Rücken gegen die Mauer, soldatisch stramm, legt zwei Finger an den Schirm seiner Mütze und sagt mit komisch-krächzendem Ton, militärisch kurz, was gleichfalls komisch wirkt: »Ich heiße Maurizius.« Dabei greift er mit der linken Hand schwerfällig, wegen der augenscheinlichen Starre des Arms, in die innere Tasche seines Pelzrocks und will etwas hervorholen. Herr von Andergast dreht den Kopf, sieht ihn an, eine Sekunde, zwei Sekunden – er hat seine hochmütige Miene und den matten Blick aus halbgeschlossenen Lidern –, sieht ihn an und geht weiter. Dann wendet er den Kopf noch einmal, die Stirn ist leicht gerunzelt, er macht mit der Hand eine unwillige Gebärde und beschleunigt seinen Schritt. Alles dies hat nicht länger als anderthalb Minuten gedauert, aber Etzel weiß nun bestimmt, daß auch der Vater den Mann mit der Kapitänsmütze kennt, daß er ihn hier auf der Treppe nicht zum erstenmal gesehen hat; aus dem Gesichtsausdruck des Vaters hat er es entnommen, aus der unwilligen Gebärde, aus der Bewegung des Rückens noch und der Art, wie er Stufe um Stufe die Treppe hinuntergeht, während jener Maurizius noch an der Mauer steht, soldatisch stramm, die linke Hand im Innern des Pelzrocks, die Augen mit dem astigmatischen Blick hinab in das Dämmer des Stiegenhauses gekehrt.
Und so war es wirklich: Herr von Andergast hatte den Alten mit seiner trägen Ruhe und späherhaften Beharrlichkeit wiederholt vor sich auftauchen sehen. Es gab viele, die in seinen Weg traten, niemand tat es ohne Scheu, wenige ohne Beklommenheit. Dieser schien weder Scheu noch Beklommenheit zu spüren. Er machte zwar nicht den Eindruck eines Strolches oder eines Deklassierten, ganz und gar nicht; eher erinnerte er an einen Provinzler, der sich in gedrückten Umständen befindet und sich in der Großstadt nicht recht zu bewegen weiß. Dennoch war in seinem Gehaben ein Mangel an Ehrerbietigkeit, eine gewisse Frechheit sogar, die Herrn von Andergast auf die Nerven fiel. Er wußte nicht, wer der Mann war. Er hatte ihn, wie er meinte, nie zuvor erblickt. Eines Tages stand er da wie jemand, der sich um jeden Preis Beachtung ertrotzen will. Es war um die Mittagsstunde. Mit demselben Frösteln, das ihn stets überkam, wenn er das Justizgebäude verließ, und woran an diesem Tag auch die warme Märzsonne nichts änderte, knöpfte Herr von Andergast seinen Mantel zu, bedachte mit blicklosem Nicken den devoten Gruß des Pförtners und trat den Nachhauseweg an. Er legte den Weg täglich zu Fuß zurück. Auf den belebten Straßen war er unzählige Male genötigt, den Hut zu lüpfen; und obwohl er auch diese Zeremonie blicklos ausführte, hatten doch Haltung und Geste jedesmal die Schattierung, die dem sozialen Rang des andern entsprach, vom flüchtigen Berühren der Krempe bis zum Emporheben des Hutes und dem gemessenen kurzen Halbkreis, den er in der Luft beschrieb, um langsam auf das kahle Haupt zurückzukehren. Diese andern aber, wer sie auch sein mochten, Handwerker, kleine Kaufleute, Bankdirektoren, Redakteure, Gutsbesitzer, Stadtverordnete, zeigten bei ihrem Gruß die hastige Beflissenheit, die sie der hohen Funktion des Herrn von Andergast wie auch dem gefürchteten Manne schuldig zu sein glaubten. Gewöhnt an die Reverenz einer ganzen Stadt, ging er kalt durch sie hindurch. Sein steif vorangerichteter Blick nahm an den Bildern der Straße keinen Anteil. Nicht nur das, seine Miene leugnete gleichsam ihre Wirklichkeit, als sei diese Wirklichkeit eine Falle für ihn, als enthalte sie eine verletzende Intimität, und sein Schritt hatte nicht nur das charakteristisch Gehemmte, das Männern eigen ist, die sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen bewegen, sondern auch das charakteristisch Vorübergehende derjenigen, die sich beständig gegen Behelligungen zu schützen haben. Und da war nun diese Gestalt am Wege. Ein Unbekannter, der es wagte, ihm, Herrn von Andergast, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, ins Gesicht zu starren. Mit einer Pfeife im Maul. Ihm ins Gesicht zu starren und, wie er ohne sich umzuschauen spürte, ihm zu folgen. Dann, schneller gehend, ihn zu überholen und, an einer Ecke, wieder dazustehen und zu starren. Die Pfeife im Maul. Beispiellos. Den nächsten Tag das nämliche Spiel, die nämliche Unverschämtheit. Drei Tage darauf wieder. Vielleicht war es ein Wahnsinniger, einer der zahlreichen gerichts- und polizeinotorischen Stänkerer, die mit irgendeinem unerfüllten Anspruch herumgehen und die Behörden damit in Atem zu halten suchen. Das klügste war, den Mann zu ignorieren und gelegentlich dem Polizeibeamten des Bezirks einen Wink zu geben. Dann kam die Attacke auf der Treppe. Eindringen ins Haus, das war zu viel, das mußte geahndet, dagegen mußte Vorkehrung getroffen werden. Zunächst überhörte Herr von Andergast den Namen, den der verdächtige Bursche nannte. Als er ihn auffaßte, wandte er unwillkürlich den Kopf noch einmal zurück. Er konnte seine Betroffenheit nicht verbergen.
Am andern Tag wurde auf dem vorgeschriebenen amtlichen Weg das Gesuch eingereicht, das durchaus nicht das erste in dieser Angelegenheit, sondern eine von vielen, sozusagen gewohnheitsmäßigen Belästigungen des Gerichtes aus derselben Quelle war. Damit hatte der ganze Vorgang eine anscheinend harmlose Erklärung gefunden, obschon das dreiste Auftreten des Menschen deshalb nicht minder unbegreiflich blieb. Keinesfalls war die Sache nun weiteren Nachdenkens mehr wert.
Zweites Kapitel
Unlöslich vermengte sich in Etzels Geist die Erscheinung des Mannes mit der Kapitänsmütze, besonders das unerwartete und dabei planvoll wirkende Zusammentreffen mit dem Vater auf der Treppe und das Bild des Briefes mit dem Schweizer Poststempel und der vertraut zu ihm redenden Handschrift. In beiden Geschehnissen forderte ihn etwas auf oder heraus; der Unterschied lag nur darin, daß jenes ganz außen, dieses ganz innen blieb, so daß er sich zwischen ihnen wie ein schwingendes Pendel vorkam. Beides aber verwirrte ihn tief und zog seine Gedanken von der gewöhnlichen Beschäftigung und dem täglichen Pflichtendienst dermaßen ab, daß er eines Vormittags, statt mit dem mechanischen Gedächtnis der Beine den Weg zum Gymnasium einzuschlagen, in die entgegengesetzte Richtung ging, immer weiter, wie traumverloren, im Bockenheimer Bahnhof seinen Bücherpack deponierte und in den Taunus hinausfuhr. In Oberursel verließ er den Zug, wanderte gegen die Saalburg, kümmerte sich schließlich um Ziel und Straße nicht mehr und irrte im Wald umher, ohne auf den Sturm und die zeitweise niederprasselnden Regengüsse zu achten. Wenn es zu arg wurde, suchte er Schutz unter einem Baum oder in einer Holzfällerhütte. Wie traumverloren; aber eben nur »wie«. Wir haben es hier mit keinem Träumer zu tun, in keiner Weise, das muß vor allem festgestellt werden. Er hatte seine fünf Sinne ausgezeichnet beieinander. Er wußte, was er tat, er wurde mit den Dingen ohne viel Federlesens fertig, er schwindelte sich nichts vor, er hatte die Uhr im Kopf und die Zeit in den Fingerspitzen (Beweis dafür: um ein Uhr fünfzehn erschien er pünktlich wie immer, gewaschen und angezogen, am Mittagstisch). Mit einer Sache fertig werden, und zwar mit dem Verstand fertig werden, mit sich ins reine kommen, Ursache und Folge überblicken, Schluß machen können, das war sein Ehrgeiz, darin übte er sich bei jeder Gelegenheit. Das wollte er auch hier, das trieb ihn hinaus. Aber es mißlang in diesem Fall, die Verwirrung war zu groß.
Am nächsten Abend, bei dem obligaten Gespräch mit dem Vater, merkte er, daß dieser sich anders gab. Es war nicht recht zu ergründen, in welcher Art, auch nicht, was er beabsichtigte; seine Absichten und Zwecke konnten, wenn er sie verbergen wollte, höchstens von einem Hellseher durchschaut werden. Er war freundlicher als sonst, ja, er hatte etwas Zuvorkommendes in seinem Wesen; zum Beispiel reichte er Etzel die Käseplatte zweimal und erkundigte sich lächelnd, ob er sich nicht demnächst die Haare scheren lassen wollte. Sofort war es Etzel klar, daß er von dem Vormittagsausflug und dem Wegbleiben von der Schule wußte und daß es deswegen zu einer jener versteckten Auseinandersetzungen kommen würde, die ihm ein Schrecken waren. Mit Sicherheit konnte man es nicht erwarten, schlimmer noch, wenn es in Schweigen gehüllt als Drohung zwischen ihnen blieb. Das war dann sogenanntes Material. Herr von Andergast legte sichtlich alles darauf an, daß Etzel selbst davon zu sprechen begann; er lud ihn durch seine Milde gleichsam dazu ein; aber je mehr er sich bemühte, je unbehaglicher wurde dem Knaben zumut, er verstummte schließlich und schaute gespannt, fast ohne mit den Lidern zu zucken, in das imponierende, für ihn so unaufschließbare, stets das Gefühl der Unzulänglichkeit in ihm erregende Gesicht auf der andern Seite des Tisches. Es war ihm nicht möglich zu tun, was unter so starkem moralischem Druck, obschon wortlos, von ihm verlangt wurde; er hätte es ja dann gestern schon tun können. Warum er es nicht getan und es überhaupt nicht vermochte, wußte er nicht. Da half kein Mut, kein Argument. Indem er dem Vater in befremdlicher, diesen aber anscheinend gar nicht weiter störender Weise ins Gesicht starrte, zerbrach er sich nur den Kopf darüber, wie er von dem Ausflug so schnell erfahren haben konnte (vom Ordinarius sicherlich nicht; Dr. Camill Raff hatte nicht die Gewohnheit, bei jeder Kleinigkeit Lärm zu schlagen; außerdem schonte er Etzel gern; die Rie hatte sein Heimkommen überhaupt nicht bemerkt), ferner, weshalb er ihm das Geständnis auf lauter Umwegen zu entlocken trachtete, statt einfach zu fragen und ihn zur Rede zu stellen. Das war ihm freilich nicht neu. Einfach war nichts in ihrem gegenseitigen Verhältnis; wenn er darüber nachdachte, wurden sogar die Gedanken verzwickt.
Hier muß ich aber, damit in die Beziehung zwischen Vater und Sohn einiges Licht fällt, zuerst erklären, was unter dem »obligaten Gespräch« zu verstehen ist.
Sie sahen einander nur im Hause. Herr von Andergast, beruflich bis zur Überlastung beansprucht, unternahm weder Spaziergänge noch besuchte er Theater und Konzerte. Er zeigte sich ungern in der Öffentlichkeit; außer mit einigen engeren Amtskollegen, zum Beispiel dem Landgerichtspräsidenten Sydow und dessen Familie, pflog er fast keinen gesellschaftlichen Verkehr. Geselligkeit war ihm kein Bedürfnis. Offizielle Veranstaltungen, denen er sich nicht entziehen konnte, empfand er als Last. Einmal im Monat besuchte er seine alte Mutter, die Generalin, wie sie kurz genannt wurde, in ihrem Landhaus draußen in Eschersheim. Die Sonn- und Feiertagsnachmittage waren dem Studium aufgesammelter Akten gewidmet.
Mit Etzel täglich zwei Stunden zu verbringen, war jedoch eine Lebenseinrichtung, genau wie das Aktenstudium. Das Programmatische daran, zugleich erzieherische Maßregel, zu verwischen, gehörte zu den gestellten Aufgaben. Es kamen nur die Abendstunden in Betracht. Während des Mittagessens, das ohnehin wegen amtlicher Verhinderung häufig entfiel, waren sie einander geradezu fremd. Die Miene Herrn von Andergasts war verschlossen, hinter der bemerkenswert geistreichen und schön modellierten Stirn haderten noch die Meinungen, die veilchenblauen Augen, in deren Tiefe eine unbewegliche, düstere Glut lag, blickten abweisend. Dazu kam, daß am Mittagessen auch Frau Rie teilnahm, und sosehr Herr von Andergast ihre Nützlichkeit als Vorsteherin des Haushalts anerkannte, so sehr langweilte sie ihn durch ihre »außerdienstliche« Gegenwart. Etzel ging es nicht viel besser mit ihr; er hatte sie gern, unterhielt sich gern mit ihr, aber nur, wenn er mit ihr allein war, in Gegenwart des Vaters und namentlich bei Tisch machte sie ihn nervös bis zum Haß. Sie saß so selbstzufrieden auf ihrem Stuhl, als spende sie sich im stillen ununterbrochen Lobsprüche über die Güte und das Zustandekommen der Mahlzeit nach so vielen Schwierigkeiten, die sie rücksichtsvoll verschwieg. Auch der Appetit, mit dem sie aß, war wie eine stumme Selbstanpreisung; und was sie sagte, war so banal wie die Sätze in einem Lesebuch für Töchterschulen.
Abends blieb sie in ihrem Zimmer. Wenn dann der Tisch abgeräumt war, zündete Herr von Andergast die Zigarre an und entspannte sich durch einen merkbaren Willensakt. Haltung und Miene lockerten sich, niemals bis zum unbeachteten Sichgehenlassen freilich, weit davon; die veilchenblauen Augen hatten aber die verkrochene Glut nicht mehr und erinnerten dann auffallend an die Augen eines naiven jungen Mädchens.
Gewöhnlich begann er mit unverfänglichen Fragen, plänkelte eine Weile, griff ein Thema auf, reizte Etzel zum Widerspruch, fand Vergnügen am Widerspruch, parierte mit fechterischer Gewandtheit, schützte das Überkommene und Bewährte vor verwegenen Reformgelüsten, machte Kompromißvorschläge, war nach hitziger Fehde bereit, eine umstürzlerische Ansicht in der Theorie gelten zu lassen; aber dabei ging es Etzel, obwohl er sich mit Feuer ins Zeug legte, ähnlich wie bei der Vorstellung von der »spielenden« Hand des Vaters, alles war nur wie Spiel, sarkastisches Spiel eines Partners, der aus seiner unvergleichlich stärkeren Position keinen Vorteil ziehen will. Er ist verdammt gescheit, dachte Etzel wütend und voll Hochachtung, man kann ihm nicht beikommen. In seinem naiven Jungeneifer geriet er immer an die Grenze, wo es keine andere Rettung gab als das Paradox, und in dieses stürzte er sich dann tollkühn und unter dem jesuitischen Bedauern seines mit allen Wassern gewaschenen Gegners. »Du bist nicht nur ein Kampfhahn«, sagte Herr von Andergast schließlich und schaute auf seine goldene Deckeluhr, »du steckst auch voller Finten und Schliche, bei dir muß man aufpassen.« Da gaffte Etzel erstaunt und argwöhnisch; gerade dieses Kompliment nicht verdient zu haben, war er sicher.
So oder ähnlich endete die Unterhaltung meistens, unverbindlich und in ein quälendes Vakuum laufend. Punkt halb zehn erhob sich Herr von Andergast mit einer Miene, die nicht mehr die geringste Beziehung zum letztgesprochenen Wort hatte; worauf sich Etzel in etwas alberner Überstürzung zur Tür wandte, die Klinke packte und sich mit dem vagen Lächeln eines Menschen verbeugte, der auf abgefeimte Manier überlistet worden ist. Ja, er kam sich geprellt vor, er konnte nicht sagen, warum, und jedesmal, wenn er aus dem Zimmer ging, fühlte er sich »entlassen«, ungefähr wie nach einem Verweis beim Rektor.
Mußte Herr von Andergast am Abend ausgehen, so erschien er spätnachmittags in Etzels Stube, setzte sich an den Tisch, an dem der Knabe seine Schularbeiten machte, bat ihn, ruhig fortzufahren, und schaute zu. Nach einiger Zeit wurde Etzel befangen, verlor den Faden und stockte. »Was arbeitest du?« fragte Herr von Andergast. Wenn es etwa das mathematische Exerzitium oder der Geschichtsaufsatz war, zeigte sich Herr von Andergast interessiert. Mit seiner überlegenen Rednergabe jedes Wort »bringend«, wie die Schauspieler sagen, pries er eines Tages die geistige Sauberkeit, zu der die Mathematik erziehe, den Zauber der Figur, der reinen Figur nämlich, für den sie empfänglich mache. Sie gewähre, behauptete er, lebendige Anschauung der Naturgesetze, und wie die Krönung einer Kuppel das anscheinend Auseinanderstrebende vereinige, könne sie die höchsten menschlichen Fähigkeiten verbinden und die gegensätzlichsten. Etzel hörte aufmerksam zu, sah aber aus wie ein störrisches Hündchen, das nicht gelaunt ist zu apportieren. Doch bei einer andern Gelegenheit, als der Vater mit ebenso sanfter Eindringlichkeit das Studium der Geschichtswissenschaft empfahl, ereiferte er sich trotzig und bestritt vor allem, daß es sich um eine Wissenschaft dabei handle. Mit demselben Recht könne man Aktenschreiben und Zeitunglesen eine Wissenschaft heißen. Wo sei da Erkenntnis? wo Gesetz? wo trete man auf festen Boden? Gedächtnislast sei es, Willkür, Nomenklatur, Chronologie, im besten Fall Roman. »Ei«, sagte Herr von Andergast und machte eine Geste wie ein Dirigent, wenn die Pauke zu laut wird.
Es waren dialektische Übungen im Grunde, und das Gebiet, auf dem sie sich abspielten, war von Herrn von Andergast genau umgrenzt. Etzel wußte, daß er die Grenze nicht überschreiten durfte. Die Person, die mit so viel Freundlichkeit seinen geistigen Erlebnissen lauschte, ja sie ihm entlockte, seinen oft unreifen, meist sehr entschiedenen, manchmal sehr leidenschaftlichen Gedankengängen folgte, hätte sich unbedingt in eine frostige Masse verwandelt, wenn er sich hätte beifallen lassen, über äußere Geschehnisse zu reden, über Tagesereignisse, die Beziehung zu einem Freund, einem Lehrer, oder gar Fragen zu stellen, die den Beruf, die private Existenz, die Vergangenheit des Vaters berührten. Wenn er dergleichen auch nur in der Andeutung wagte, heimlich gestachelt und wohl wissend, daß er scharf zurückgewiesen werden würde, erhob sich Herr von Andergast, runzelte die Stirn und sagte mit schräg abgleitendem Blick: »Wir wollen das zu einer passenderen Zeit erörtern.« Etzel hatte Ursache zu vermuten, daß er die untersten Grade jener Frostigkeit noch gar nicht zu spüren bekommen hatte; das sofortige Sinken der Temperatur bei der geringsten Entgleisung jagte ihm ohnehin Angst genug ein. In Momenten, wo er sich nicht beobachtet glaubte (sie waren noch seltener, als er vermutete, denn Herrn von Andergasts ganze Wesenheit war Auge und Sammeldienst des Auges), sah er den Vater an wie einen Turm, der keinen Zugang hat, keine Türen, keine Fenster, der nur gewaltig ragt und von unten bis oben Geheimnisse birgt. Seine tiefe Bewunderung war einer ebenso tiefen Furcht verschwistert. Als einziger Sohn, mutterlos, stand er ihm unerhört allein gegenüber. Dieses Gegenüberstehen wurde ihm durchaus zum Bild, und schickte er sich an, im Bilde, ihm entgegenzutreten, so wich der Vater um ebenso viele Schritte zurück; trat andererseits dieser auf ihn zu, so erfaßte ihn die Furcht und zwang ihn zur Vorsicht. Der Ruf seiner Strenge, seiner Unerbittlichkeit, seiner stählernen Grundsätze war schon früh zu ihm gedrungen, hieß man ihn doch im Volk den blutigen Andergast, sehr mit Unrecht freilich, denn ihn erfüllte bis in die Poren, bis zur Steinwerdung beinahe das Bewußtsein hoher Pflicht und hohen Amtes. Aber solche Worte sind ambulant wie giftige Bakterien, und kam es Etzel auch nicht ausdrücklich zu Ohren, so fühlte er doch den Widerhall, und seine Träume (da er mit wachen Sinnen die Augen davor verschloß und die Phantasie nicht daran rühren ließ) produzierten Gestalten wie aus dem Danteschen Höllenkreis – alles ist ja von Uranfang da im Menschen, auch das Niegesehene, Niegewußte –; der Vater stand dann in einer feurigen Lohe und hielt Gericht über die Scharen der Verdammten.
Herr von Andergast saß im Halbschatten, er konnte das volle elektrische Licht nicht vertragen, seine Augen entzündeten sich leicht davon; mit den Augen waren alle Andergasts nicht in Ordnung, die alte Generalin litt schon seit Jahrzehnten an einer Störung des Sehnervs. Vielleicht hatte das eine tiefere Bedeutung: wer bloß mit den Augen lebt, leidet durch die Augen. Hatte doch auch die intensive Veilchenbläue der Augen des Herrn von Andergast etwas Abnormes. Er saß mit übereinandergeschlagenen Beinen, der Oberkörper war fast zwangvoll gereckt, ebenso der lang-ovale Kopf mit der kahlen, wie poliert glänzenden Schädelwölbung und der bis auf einen Millimeter kurzgeschorenen eisengrauen Randbehaarung. In seiner thronenden Haltung und Halbabgekehrtheit war etwas, wodurch er Etzels Blick zu sich her spann; als spule er Fäden auf ein Weberschiff, zog er die Blicke des Sohnes her, schien es aber weder zu wissen noch zu wollen. Dem Knaben war die Silhouette des halbabgekehrt, mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzenden Vaters wie ein täglich gesehenes starres Emblem vertraut. In der Tat hatte er Ähnlichkeit mit einer ägyptischen Tempelfigur, wenn man ihn im Halbschatten flüchtig betrachtete. Vertrautwerden des Starren, darin liegt viel Unheil, Vertrautsein, das kein Lösendes und Aufschließendes hat. Die Scheu und die empfundene Entfernung blieben immer gleich, auch die doppelte Gefaßtheit: erstens auf das mögliche Sinken der Kältegrade, sodann auf die Minute, wo man »entlassen« wurde. Stets sah er mit der nämlichen Spannung in den Halbschatten hinüber, so wie heute spürte er jeden Abend ein banges Erstaunen über die athletische Figur, die starke Stirn, die starke, gerade Nase, die starken Lippen, den starken Hals, der durch den kurzgeschnittenen, sorgfältig gepflegten und schon ergrauten Spitzbart nur zum Teil verdeckt wurde. Über seine Person war ein undefinierbarer Hauch von Melancholie gebreitet, eine verdunkelnde Unzufriedenheit, wie sie Menschen eigen ist, die nicht der von ihnen geglaubten Bestimmung leben können und, abgelenkt von dem Ziel, das sie sich einst vorgenommen haben, ein Einst, an welches sie sich nur wie an eine Phantasmagorie erinnern, ihre Enttäuschung hinter einem Panzer von Stolz und Unnahbarkeit vor den Blicken der Welt sichern. Was ihnen vor sich selber Wert verleiht und worin sie sich mit jeder Erfahrung, jeder Enttäuschung befestigen, ist das Gefühl der Isolierung. Indem sie sich schließlich darin verlieren, werden sie so fremd, so unerratbar, so abseitig, daß es scheint, als gebe es die Sprache nicht mehr, in der man sich mit ihnen verständigen kann. Das war Etzels vorherrschende Empfindung oft; es ist schrecklich weit bis zu ihm, dachte er, wenn man endlich da ist, macht einen die Müdigkeit vollkommen dumm. Eine etwas übersteigerte Sensitivität vermutlich, aber es war doch so viel Zusammenhang und Anziehung vorhanden, daß das Scheidende und Abstoßende zehnfach quälend wurde. So wie heute hatte er selten darunter gelitten. Ein paarmal war er nahe daran, aufzuspringen und unter dem Vorwand von Kopfschmerz das Zimmer zu verlassen.
Schwer zu sagen, was Herrn von Andergast bewog, sich so eingehend mit Etzels gestrigem Vormittagsabenteuer zu befassen. (Wirklich, er sprach von einem »Abenteuer«, so wenig die Bezeichnung auf die simple Schulschwänzerei und das planlose Herumirren im Regen paßte.) Ein Rechtsanwalt hatte Etzel auf der Station in Oberursel gesehen und hatte es Herrn von Andergast heute früh beiläufig erzählt, das war die platte Erklärung seiner rätselhaften Wissenschaft. Zufall, und den nützte er nun in seiner Weise aus. Ob ihn psychologische Neugier dazu trieb oder die Befürchtung, daß dies nur der Beginn einer Reihe von Eigenmächtigkeiten und Versäumnissen war, läßt sich bei seiner unendlich komplizierten Denkungsart nicht entscheiden. Selbständige Handlungen mußten so lange wie möglich unterbunden werden; aber wie und mit welchen Mitteln? Es war ja der Geist, der zu zähmen war, der gefährlichste Explosivstoff der Welt. Er erkannte allmählich, erstens, daß das kunstvolle System der Distanzierung fehlerhaft war, zweitens, daß es sich auch tückisch an ihm selber rächte, denn da nach so ausschließlicher Frequenz nur noch die Umwege gangbar waren, hätten die verrammelten direkten ein lächerliches Übermaß von Zeit gekostet. Gefangenenwärter haben ihren Berufsehrgeiz. Sie fühlen sich nicht bloß verantwortlich für den Häftling, sondern auch für das Haus, die Mauer, das Gitter, die Tür, das Schloß und die Schlüssel. Zuletzt hat der Hüter selber keine Freiheit mehr.
Seine sonore Stimme füllte den Raum. Sie hatte unter allen Umständen etwas Zwingendes. Die Langsamkeit des Wortfalls (Schrankensprache nannte es einer seiner Feinde) wurzelte in dem Bestreben, für jeden Gedanken die prägnanteste Form zu finden. Dies machte bisweilen den Eindruck der Selbstgefälligkeit, aber er war nicht selbstgefällig, es war nur ein bis in den Blutgang dringendes Überlegenheitsbewußtsein, das sich im Verkehr mit den Menschen als trockene Pedanterie oder konsequente Sachlichkeit äußerte. Hierin war er außerordentlich deutsch, will heißen nach dem modernsten Begriff davon. Fast alle begabten Redner haben die Neigung, ihre Zuhörer als Unmündige zu betrachten; aber niemals ist das weniger berechtigt als bei einem Unmündigen. Je mehr Mühe er aufwandte, je ärgerlicher spürte er, wie seine Worte zerstäubten. Keinen Widerstand zu erfahren, war der unbesiegbarste Widerstand. Was verfocht er eigentlich? Wogegen predigte er? Verschiedenes lag in der Luft, außer dem Taunus-»Abenteuer« noch die Briefgeschichte und die Begegnung mit dem idiotischen Alten auf der Treppe. Er spürte latente Fragen, die sich nicht herantrauten; wünschte aber keineswegs, daß sie gestellt würden. Am Abend vorher hatte Etzel gewagt, die Berechtigung eines Urteiles in einem politischen Prozeß anzuzweifeln, ungewöhnliche Kühnheit, Durchbruch des herrschenden Zeremoniells. Die Kameraden hatten sich über den Fall ereifert, Etzel berichtete es; soweit er die Sache überblicken konnte, schien es, daß Schuld und Strafe in einem krassen Mißverhältnis standen, die Schuld geringfügig, die Strafe unmenschlich. Auf dieses Gespräch, das er gestern brüsk abgebrochen, griff Herr von Andergast heute zurück. Es sei vom Übel, wenn ein Rechtsfall zum Redefutter der Straße gemacht werde. Es sei verhängnisvoll, Recht und Gefühl zu verquicken, und heiße, das Unbedingte ins Joch des Ungefährs spannen. Das Recht sei eine Idee, keine Angelegenheit des Herzens; das Gesetz kein beliebig zu modelndes Übereinkommen zwischen Parteien, sondern heilig-ewige Form. Wahr und unantastbar gültig, seit es Richter gibt, die Schuldige verdammen, und Gesetzbücher, die Verbrechen nach Paragraphen ordnen. Und doch, was flammt so leugnerisch, so unglaubend aus den Augen des Knaben herüber? Ewige Form das Gesetz? Er rückt unruhig auf seinem Stuhl und beißt verlegen auf den Fingerknöchel. Er hat etwas raunen hören, daß der Staat eine rechte und eine linke Hand habe und zweierlei Maß, eins für die eine, eins für die andere, und mehrerlei Waagen und für jede Waage mehrerlei Gewichte. Wie verhielt es sich damit? Das fragte er nicht laut, das fragten seine Augen. Im übrigen hatte er ja nicht am »Recht als Idee« gezweifelt, sondern an der Gerechtigkeit eines aktuellen Spruchs, und mit seinem Herzen hatte das schon gar nichts zu schaffen, sondern lediglich mit seinem Denkvermögen und seiner Urteilsfähigkeit. Hier bist du mal gründlich aufgesessen, lieber Vater, aber schweigen wir darüber, sagten seine Augen.
Vielleicht versteht Herr von Andergast die stumme Sprache, die aus dem Sechzehnjährigen nur echot und den leugnerischen, unglaubenden Geist seiner Generation vermittelt, einen Geist, krank von Krankem, entfesselt von Entfesseltem. Es war Anfall aufgesammelten Zorns, der ihn zu dem taktischen Mißgriff verleitet hatte. Umsonst Beweis, Beispiel, Erklärung. Finsternis wird nicht dadurch Licht, daß man Gründe gegen sie mobilisiert. Licht kann Blinde nicht überzeugen, Verblendete nicht treffen. Das Neue, von dem sie fabeln, auf das sie pochen, wo ist es? In ihnen selbst, sagen sie. Es gibt kein Neues, es gibt kein Altes. Der Mensch, sein Weg, seine Geburt, sein Tod, alles dasselbe seit sechstausend, seit sechzigtausend Jahren, Fabelei der Zeitbeschränkten, jedes Lustrum zur Epoche zu machen; je weniger sie selber sind, je mehr erwarten sie von der Zeit: der uralte Strom treibt auch ihre Klappermühlen, und sie bilden sich ein, sie hätten seinen Lauf verändert, weil in seinen Wassern auch ihr Rad sich dreht.
Er glaubte selbst hier noch überlegen zu sein und zu »spielen«, wo er mit seinem Despotismus im Begriffe war zu scheitern. Natürlich war er darauf gefaßt, in seinem Sohn eines Tages den anders geprägten Menschen gelten lassen zu müssen; vielleicht trat die andere Prägung deshalb so früh hervor, weil er in seiner gefrorenen Skepsis so gut und schon so lange darauf vorbereitet war; Furcht erzeugt das Gefürchtete. Aber es war nicht der Despotismus des Vaters, der eine Niederlage erlitt, es war der des Beamten. Herrn von Andergast war der Dienst Berufung, der Beruf Sendung. Er war der Beauftragte eines absoluten Herrn, dessen Interessen er vertrat, in dessen Namen er wirkte und dessen asiatische Machtvollkommenheiten durch Lockerung der Regierungsformen nicht beeinträchtigt werden konnten. Der Herr, verschwand er auch als wirkliche Person vom Schauplatz, als Symbol blieb er bestehen. Und Symbol war auch der Diener, als Diener hatte er keine Geschichte, kein Vorleben, kein Privatleben. Jede menschliche Bindung war der amtlichen gegenüber von untergeordneter Bedeutung. Unwandelbarkeit ist das Prinzip, das ihn trägt, seine Zeit ist alle Zeit, der religiöse Glaube an die Hierarchie, der er angehört, macht ihn zum Mönch, zum Asketen, unter Umständen zum Fanatiker. Es hieß von Herrn von Andergast, wenigstens rühmten es seine Kollegen an ihm, daß sein starker Tatsachensinn bei den schwierigsten und dunkelsten Rechtsfällen Triumphe gefeiert und ihm das autoritative Ansehen verschafft hatte, das durch keine Umwälzung, keine Neuerung in der Verwaltung erschüttert worden war. Begreiflich. Warum sollte jemand von außen erschüttert werden, der so unerschütterlich in sich selber ruht?
Es war halb zehn geworden. Herr von Andergast zog die goldene Deckeluhr. Etzel erhob sich. Er machte seine Verbeugung, sagte gute Nacht und wandte sich mit der gewohnten Fluchtgebärde zur Tür. Dort zögerte er. Er blickte gegen die Wand und fragte schnell und scheu: »Wer ist denn dieser Maurizius, Vater?«
Herr von Andergast blieb auf der Schwelle seines Arbeitszimmers stehen. »Wozu willst du das wissen;« fragte er zurück und maß den Sohn mit kaltem Blick.
»Nur so . . .«, erwiderte Etzel, »es ist, weil . . .« Er stockte.
Er hatte auch die Rie gefragt. Sie hatte nachgedacht und den Kopf geschüttelt. Er nahm sich in diesem Augenblick vor, noch andere Leute zu fragen, so viel Leute wie möglich, vor allem die Großmutter, bei der er, wie jeden Sonntag, übermorgen zu Mittag essen sollte. Er entsann sich, daß der Mann mit der Kapitänsmütze seinen Namen mit einer Art von Berühmtheitsbewußtsein genannt hatte, ungefähr, wie wenn einer sagen würde: ich heiße Bismarck, wennschon nicht triumphierend, sondern verbissen. Der Ton lag ihm noch im Ohr.
»Es ist keinesfalls ein Gegenstand, über den wir beide uns unterhalten können«, sagte Herr von Andergast und ragte als unzugänglicher Turm in der Wolke der Frostigkeit.
»Ich möchte ihr mal schreiben«, murmelte Etzel, als er in seiner Stube auf und ab ging. Er sah eine Wiese vor sich, darüber einen waldbedeckten Hügel, darüber die untergehende Sonne; die Erde war gebogen wie der Rücken eines Riesen. In seiner Kehle juckte es.
Er setzte sich hin und schrieb auf ein Blatt, das er aus einem der Schulhefte gerissen hatte: »Es geht vieles vor, ich denke viel über alles nach. Gräßlich, daß ich Dich nicht mal kenne. Wo bist Du eigentlich? Es kann sein, daß ich mich eines Tages auf die Eisenbahn setze und zu Dir hinfahre. In den Ferien vielleicht. Du lachst vielleicht über den Schulbubenplan. Natürlich, wenn ich von dem Vorsatz was verlauten ließe, wär's aus. Warum? frag ich. Es sind überhaupt eine Menge Fragen zu beantworten. Ein Mensch in meinem Alter ist wie an Händen und Füßen mit Stricken gebunden. Wer weiß, wenn die Stricke mal zerschnitten werden, ist man am Ende schon lahm und zahm! Das ist wohl der Zweck. Zahm soll man werden. Haben sie Dich auch zahm gemacht? Kannst Du mir nicht sagen, was ich tun soll, damit wir uns sehen können? Ich tue, was Du willst, nur muß es geheim bleiben. Du verstehst. Er erfährt immer alles. Dieser Brief muß unbedingt geheim bleiben. Ich werde ja älter mit der Zeit. Es ist aber zum Verzweifeln, wie langsam es geht. Es wird ihnen nicht gelingen, mit dem Zahmmachen. Weißt Du, wie ich den Brief im Vorzimmer sah, war's, als hätte der Blitz in mein Hirn eingeschlagen. Gern möcht ich wissen, was da los ist. Du verstehst mich schon. Ich habe das Gefühl, daß man Dir ein Unrecht zugefügt hat. Stimmt das? Ich muß Dir überhaupt sagen, was man so tagtäglich von Ungerechtigkeiten hört, ist ganz schauderhaft. Du mußt wissen, daß mir Ungerechtigkeit das Allerentsetzlichste auf der Welt ist. Ich kann Dir gar nicht schildern, wie mir zumut ist, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, an mir oder an andern, ganz gleich. Es geht mir durch und durch. Leib und Seele tun mir weh, es ist, als hätte man mir den Mund voll Sand geschüttet und ich müßte auf der Stelle ersticken . . .«
Er hielt inne. Mißbilligend nahm er wahr, daß er an sich selber schrieb oder an eine erdachte Person, nicht an eine wirkliche. Er konnte ja die Epistel nicht einmal abschicken. Er hatte keine Adresse. Er hatte versäumt, die Rückseite des Briefs, der aus Genf kam, anzuschauen. Ferner war zu befürchten, daß der Vater wie von allen seinen Handlungen auch davon Kenntnis erhielt. Als Kind hatte er sich eingebildet, daß der Vater im Mittelpunkt des Weltalls saß und sämtliche Sünden und Vergehungen aller Leute in der Stadt mit einem Marmorgriffel auf eine Marmortafel verzeichnete. Reste dieses Glaubens waren noch in ihm vorhanden, noch jetzt formten sich bisweilen innere Szenen, imaginäre Gespräche daraus. Gebietend stand der Vater im Zimmer. Als Zauberer hatte er die Macht, durch geschlossene Türen zu gehen. In seiner Eigenschaft als Zauberer hatte ihm Etzel den Namen Trismegistos gegeben. Immer, wenn er sich den Vater in einer strafenden Aktion dachte, hieß er ihn so. Der Dialog vollzog sich ungefähr, wie folgt: Trismegistos: Wo bist du, Etzel; – Hier bin ich. – Warum verbirgst du dich vor mir; – Ich verberge mich nicht, ich habe nur die Maske vom Gesicht genommen. – Wie, du erdreistest dich, ohne Maske vor mir zu erscheinen? – Wenn einer allein ist, Vater, braucht er doch keine Maske. – Aber ich sehe in dich hinein, ich bin überrascht, ich bin sehr überrascht, ich wünschte, ich hätte dich nicht ohne Maske erblickt.
Er faltete den Brief zusammen, steckte ihn in einen Umschlag, schrieb darauf: »An meine Mutter, ich weiß nicht wo«, und schob ihn in ein Geheimfach, das er sich in der Schublade seines Arbeitstisches selbst angefertigt hatte und worin noch andere Papiere lagen, Notizen, Aufzeichnungen, Gedichte und als besondere Kostbarkeit zwei Briefe, die er von Melchior Ghisels erhalten hatte. Dann saß er, das Kinn auf beide Hände, die Ellbogen auf den Tisch gestützt. Er hätte längst zu Bett gehen sollen, doch in seiner Brust war eine nicht zu beschwichtigende Unruhe. Von der Straße herauf tönte ein langer, schriller Pfiff. Der Regen rauschte auf die Bäume. Er sprang auf, ging herum, blieb dann vor dem Bücherregal stehen. Jedes einzelne Buch war ein Freund. Er hatte sie nach und nach von seinem Taschengeld gekauft oder sie sich von der Großmutter schenken lassen, manche hatte ihm auch der Vater geschenkt. Den ersten Platz nahmen die Schriften seines geliebten Melchior Ghisels ein, vier schöngebundene Bände mit eigenhändiger Widmung des Autors. Dieser war ihm wie ein Gott und jeder Satz in den Büchern eine Offenbarung. So kann nur ein Sechzehnjähriger einen Schriftsteller verehren. So reine Glut hegt nur der unentfachte Geist. Die Bewunderung, mit der Etzel an dem Mann und seinem Werk hing, war zugleich voll Zärtlichkeit. Ghisels, ein Autor von Kierkegaardscher Tiefe, war ihm Prophet und Führer. Oft las er vor dem Einschlafen eine halbe Seite, ganz langsam, mit atemloser Andacht, ein schon zehnmal gelesenes Kapitel, dann verlöschte er schnell das Licht und lächelte in den Schlummer hinein. Er kannte Ghisels persönlich nicht. Er hatte ihm einmal geschrieben, als er ihn um die Inschrift bat, und ein zweites Mal, sehr schüchtern, um ihn über den Sinn einer schwierigen Stelle in einem schönen Aufsatz über die Lebensalter zu befragen. Der Buchhändler Thielemann, Roberts Vater, hatte ihm die Adresse gegeben; seit er wußte, daß Ghisels in Berlin lebte, war Berlin ein heiliges Lhasa für ihn. Er war eifersüchtig auf Melchior Ghisels, wie man auf einen Juwelenschatz eifersüchtig sein kann, und es erfüllte ihn mit Genugtuung, daß seine Schriften nur von wenigen gekannt waren. Lärmender Ruhm, den zu erringen die Werke freilich wenig Eignung besaßen, hätte ihn vielleicht ernüchtert. Camill Raff hatte ihm dieses Reich hoher Gedanken als erster erschlossen; im vorigen Sommer, als er krank gewesen, hatte ihn Dr. Raff besucht und ein Buch von Ghisels mitgebracht, aus dem er ihm einen ganzen Nachmittag lang vorlas.
Er nahm eines von Ghisels' Büchern vom Ständer, legte sich damit bäuchlings auf die Erde, schlug das Buch auf und begann zu lesen. Nur so, bäuchlings auf dem Boden, war er fähig, sich ganz beim Lesen zu sammeln. Allein nach einer Weile hörte die Hand auf, die Blätter umzuschlagen, die Stirn sank auf den Oberarm, die Beine streckten sich, er schlief. Erst um zwei Uhr nachts erwachte er wieder, sah sich verstört um, sprang in die Höhe, streifte hastig die Kleider vom Leib, drehte den Lichtschalter ab und schlüpfte geräuschlos ins Bett. Den Kopf schon in die Kissen gegraben, murmelte er etwas Bestürztes und Entschuldigendes vor sich hin und streckte wie ein zehnjähriger Fratz in verschlafener Beschämung gegen sich selber die Zunge heraus.