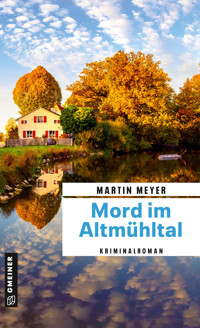Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
München 1926. Der erfolgreiche Komiker und Sprachakrobat Karl Valentin erhält ein lukratives Angebot aus den USA - für zwei Jahre Bühne und Film. Fast zeitgleich taucht ein dreister Doppelgänger in München auf, ebenfalls aus Amerika. Zum heiligen Plagiarius, steckt dahinter etwa ein abgezirkeltes Komplott? Valentin wird in seinen Grundfesten erschüttert. Er kämpft mit sich und seinen Ängsten und fürchtet um seine Originalität und Identität. Wird es ihm gelingen, den Konkurrenten zu stoppen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Meyer
Der falsche Karl Valentin
Roman
Zum Buch
Falsch erwischt München 1926. Der erfolgreiche Komiker und Sprachakrobat Karl Valentin erhält ein lukratives Angebot aus den USA – für zwei Jahre Bühne und Film. Eine verlockende Offerte, für den von Reiseängsten geplagten Künstler zunächst jedoch unerreichbar. Damit aber nicht genug. Ebenfalls aus den USA taucht ein gewisser Wellano in der Isarmetropole auf, der Sohn eines 1900 vor der Münchner Justiz nach Amerika geflüchteten Viehhändlers. Der begnadete Hochstapler und Schauspieler doubelt Karl Valentin mit Erfolg, macht ihm Säle streitig und bandelt sogar mit Valentins Bühnen-Partnerin Liesl Karlstadt an. Gelingt es Valentin, den Angriff auf seine Originalität und Identität zu kontern und in dieser Konfrontation mit sich selbst seine Ängste zu überwinden?
Martin Meyer, 1967 geboren, studierte Jura und war in Bamberg als Staatsanwalt und Richter tätig. Nach seinem Ausscheiden aus dem Justizdienst im Jahr 2007 öffnete er sich seinen literarischen Begabungen und schreibt seither Romane, Kurzgeschichten und Gedichte. In seinen Texten spürt er den Wunden und Brüchen im Menschen nach. Sein juristisches Fachwissen gibt er heute als Dozent in Workshops weiter. Außerdem spielt der Autor Orgel und Posaune. So gilt sein Ohrenmerk stets dem Dreiklang von Sinn, Text und Wort. Martin Meyer lebt mit seiner Frau und Kater Poldi bei Bamberg. »Der falsche Karl Valentin« ist sein Romandebüt.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
ISBN 978-3-8392-6602-1
Haftungsausschluss
Dieses Buch ist kein historisches Werk, sondern ein Roman, in dem Fakten und Fiktion eine untrennbare Einheit eingehen. So tragen zwar einige der handelnden Personen ihre historisch richtigen Namen, die individuelle Figurenzeichnung, die Handlung und sämtliche Dialoge sind aber erfunden.
Erster Teil: Ende 1926
16. Oktober 1926
Es kam, wie es kommen musste. Immer wenn er auf dem Weg zu einem Auftritt im Deutschen Theater war, fielen erste dicke Regentropfen. Als ob die nicht bis zum Stachus hätten warten können.
Diesmal kam es ihm zupass. Nun konnte er den Münchner Regen exakt mikroskopieren lassen, für seine Wissenschaftliche Plauderei über den Regen, die er, ehe sie demnächst in der Zeitung erschien, noch ein letztes Mal überarbeiten wollte.
Karl Valentin fasste in die linke Tasche seines Gehrocks. Zog sein Reagenzglas hervor, hielt es in den Regen, bis es halb voll war. Schloss es, bombensicher, mit seinem Apothekerkorken. Mitten auf dem Isartorplatz stehend, traf ihn ein »Schleich dich, du G’scherter!«, der Fahrer einer sich nahenden Droschke. Als ob der nicht, so dürr wie Valentin war, problemlos hätte um ihn herumfahren können.
Valentin drückte noch einmal auf den Korken und steckte das Reagenzglas ein, dann erst gab er den Platz frei. Er passierte das Isartor und drückte sich einen Steinwurf weiter im Tal, der Straße Richtung Marienplatz, in einen Hauseingang, dessen Tür wie zumeist nach innen nicht nachgab. Böen plusterten seinen Gehrock auf, es fröstelte ihn. Zeit für eine erste Zigarette, der, er ahnte es bereits, noch viele folgen sollten.
Drei prallvolle Trambahnen ließ er passieren, dann schritt er eilig zurück zum Isartorplatz und nahm die nächste, wo er wie stets, dem Unmut des Schaffners zum Trotz, auf der Plattform verblieb und das Reagenzglas abermals in den Regen hielt, bis es voll war. Dass er deshalb schon am Marienplatz durchnässt war, samt seinem Hut, nahm er in Kauf.
Kurz vor dem Stachus ereilte ihn der nächste Generalangriff; sein Asthmapulver ging zur Neige, mit seiner austarierten, vom Apotheker des Vertrauens handverlesenen Mixtur, allein dank selbiger sich diese chronisch tuberkulöse Münchner Luft ohne asphyktische Bronchialverrenkung derschnaufen ließ. So war guter Rat teuer. Der Apotheker seines Vertrauens saß in der Au, Valentins Heimatquartier der »kleinen Leut«. Um Stachus und Bahnhof waltete die Syphilis, und der nach jeder Pause, sprich direkt vor seinem Auftritt, in den Saal oszillierende Ruß allzu billiger Zigaretten des Publikums brachte ihn demnächst zu Grabe, von seinen eigenen ganz zu schweigen.
Valentin fröstelte, Nässemikroben krochen ihm unter die Haut, und darunter kamen die Knochen. Liesl Karlstadt, seine zweite Haut, würde ihm gleich in der Garderobe ihre Geschichte vom Regenschirm erzählen, und die ging so: Man kauft ihn, spannt ihn auf und wird nicht nass. Dabei trug er einen Hut, wozu brauchte es zusätzlich einen Schirm? Karlstadt machte ihm eh schon genug Sorgen. Als Frau. Die sie trotz der von ihr gespielten Hosenrollen nicht abstreifen konnte.
Die Bahn hielt unfallfrei am Stachus. Valentin stieg aus, winkte eine Droschke herbei. »Fahren Sie mich auch zum Deutschen Theater?«
»Wozu die Frage? Selbstverständlich.«
»Weil sie am Stachus meistens woanders hingefahren werden wollen.«
Der Fahrer ging drüber hinweg; er hieß ihn zusteigen, fuhr an. Valentin zitterte, völlig durchnässt wie er nun war, hinzu kam erstes Lampenfieber. Schon brannte die nächste Zigarette, und er griff in den Gehrock, um sich der Regenprobe zu versichern. Gleich am Montag würde er sie dem Mikroskop seines Apothekers anvertrauen.
Der Wagen hielt an. Valentin bezahlte die Fahrt und klappte den Mantelkragen nach oben; er stieg grußlos aus, überquerte, die letzten Schwaden seines Asthmapulvers versprühend, die Schwanthaler Straße und betrat das Deutsche Theater, vorbei an den karger besoldeten Schauspielern der ersten Nummern dieses Abends. Diese drehten sich, wie er sich selber schuldig war, stets nach ihm um – und wünschten ihm, sowie er außer Hörweite war, die Pest an den Hals.
In der Garderobe angelangt, schwoll ihm der nächste Kamm. Karlstadt war noch nicht da, nur ihr Parfum, vom Abend zuvor. Und anderthalb Spuren zu feminin.
*
Am selben Abend, in einem Linienschiff der Hapag von New York nach Hamburg; dem letzten Abend auf See, der Ärmelkanal war bereits passiert.
Leopold Wellano in seiner Kabine erster Klasse und, wichtiger noch, avec discrétion. Handverlesen sein Personal, allein dazu da, ihm Flankenschutz zu gewähren.
Der Wichtigste: ein Coiffeur, im Kampf gegen die ergrauenden Schläfen, mit Wuchsmitteln und Henna, auf dass seine Haare fülliger würden und so rot wie bei Valentin. Gleich groß von Gestalt war er schließlich, dazu ebenso dürr.
Er trat an die Kabinentür, verriegelte sie und fixierte den Riegel mit einem zusätzlichen Vorhängeschloss. Dann trat er an den schwenkbaren Ganzkörperspiegel, den er sich hatte bringen lassen, und übte seinen Karl Valentin. Bayrisch konnte er, der gebürtige Münchner und jetzige US-Amerikaner, er hatte sich extra einen greifbaren Valentin-Stummfilm an seinen Wohnort Pittsburgh versenden lassen, und auf seines Vaters Münchner Vertrauten und Verwalter Louis war ebenso Verlass wie auf die Zeitungen Pennsylvanias. Die so süffisant wie bedauernd über Karl Valentins Angst vor Dampfschiff und Eisenbahn zu berichten wussten.
Am liebsten mimte Wellano den tumben Wachposten aus Die Raubritter vor München. Dumm war bloß, dass bei diesem Valentin kein Stück je fertig und unabänderlich war; er schrieb sie laufend um. Weshalb Wellano an diesem Morgen von Bord aus dem Louis telegrafiert hatte, er möge die tagesaktuelle Fassung dieser Nummer mitstenografieren, jedenfalls bis zu seiner Ankunft in München. Und Louis sollte schon jetzt nach Statisten Ausschau halten, die bei den Raubrittern mitwirken könnten.
Ein Lakai klopfte diskret an die Kabinentür, kaum hörbar durch den fingerdicken Vorhang – ein Telegramm von Louis. Das lief wie am Schnürchen: »Spielt heute Abend. Lanciere Raubritter als Zugabe.«
So gab sich Wellano für diesen Abend übefrei und orderte bei dem Livrierten eine Flasche Champagner. Veuve Clicquot. Zur Feier des Tages, seiner baldigen Ankunft in München, seinem München. Der Stadt aller Hochstapler, Inflationsgewinnler und Hasardeure. Die sich nicht in die Karten schauen ließen. Und bereits sein erster Trumpf hatte es in sich, das war sein Name: Wellano. Der bürgerliche Name von Valentins Partnerin Liesl Karlstadt. Ohne freilich mit ihr verwandt oder verschwägert zu sein.
Und vor allem: Nirgendwo sonst ließ sich ein Valentin doubeln, sprich seiner Einzigartigkeit berauben. Weil Valentin München allenfalls in Begleitung Karlstadts (und für gut bezahlte Auftritte) verließ.
*
So spät Liesl Karlstadt auch dran war – sie ließ sich überreich Zeit. Zu guter Letzt trug sie doch noch etwas Rouge auf gegen den aufkeimenden Kummer.
Hosenrollen. Abend um Abend, mit einem Herrn und Meister, der ihr auf Schritt und Tritt misstraute. Der sie bloß gelten ließ als Partnerin, Souffleuse und Therapeutin, doch nicht als eigenständige Künstlerin und gleich gar nicht als Frau.
Unverhofft hatte es zu regnen aufgehört. Sie verzichtete daher auf ihren Wagen, genoss die frische, vom Regen gesäuberte Luft. München. Ihr München, dessen hartes Brot der Armut sie als Kind eingetunkt hatte, das es danach aber doch gut mit ihr meinte. Sie hatte ein Auto zu eigen, konnte ihre Schwester, die es nicht so gut hatte, nach Kräften unterhalten und wohnte längst in der reichen Maximilianstraße. Nicht alles, aber vieles hatte sie Karl Valentin zu verdanken.
War sie, die sie ihn nun gerne hinterrücks schalt, eine stolze, undankbare Jungfer?
Sie lief über den Stachus, schrak beim Blick auf die Normaluhr zusammen, beschleunigte ihre Schritte und kam noch vor der Pause im Deutschen Theater an. Nach der Pause erst kam ihr gemeinsamer Auftritt. Rundfunk, Firmling … sie beide mit zwei, drei Komparsen dazu.
Wider Erwarten war Valentin nicht in der Garderobe; er saß in der Loge des Portiers am Telefon und wählte sich, wie er sich lauthals erregte, »die Finger potzteufelswund«.
»Was ist los?«, fragte sie den Portier. Der winkte sie herein, mit einem Blick, den Karlstadt nur allzu gut kannte: Schaff mir den Kerl vom Hals!
»Da ziehst blank!«, polterte Valentin, kaum ihrer ansichtig geworden. »Die wollen die Raubritter, Fräulein Karlstadt, als Zugabe! Die Direktion, auf Teufel komm raus!«
Karlstadt begriff – er war dabei, die Besetzung für dieses Viel-Personen-Stück herbeizutelefonieren. Die ganze Bürgerwehr mitsamt den Musikern.
»Das ganze Stück?«
»Ja!«
»Ich geh jetzt, mich herrichten«, knurrte sie, verärgert über das »Fräulein Karlstadt«, mit dem Valentin sie immer in Gegenwart weiterer Personen ansprach.
»Bleiben Sie da, Sie müssen mir helfen.«
»Nein.«
Sie signalisierte dem hilflosen Portier ein »Bedaure!« und ließ sie beide zurück.
Viel zu zeitig klang der erste Gong zum Ende der Pause durch die Garderobe. Erst nach dem zweiten kam Valentin gerannt. Wenn Blicke töten könnten. Sie töteten jedoch nur halbherzig, denn sein zweiter Blick sprach Bände: Er hatte es mit all seiner Impertinenz wieder einmal geschafft und für die Raubritter die ganze Bürgerwehr zusammengetrommelt. Ihre Frage, warum die Direktion wider alle Usancen auf die Raubritter bestanden habe, quittierte er unwirsch: »Verstehen S’ eh nicht. Geld- und Geheimsache.« Sein Blick hingegen, haarscharf an ihr vorbei, signalisierte ihr das Gegenteil: Er begriff es auch nicht, und es beunruhigte ihn. Denn stets hörte er das Gras wachsen, bevor es gekeimt war.
Schon wurde der Rundfunk aufgerufen. Karlstadt biss die Zähne zusammen. Suchte sich auf den Auftritt zu fokussieren, auf all die Hänger und Sprachpirouetten, auf die sich Valentin verstand wie kaum ein anderer. Doch Karlstadt gab sich keine Blöße. Auch der Firmling gelang ihnen unfallfrei.
Danach eine kurze Pause; für die Raubritter musste umgebaut werden. Die Flüche der Bühnenarbeiter, Hungerleider wie sie damals als Kind, gellten Karlstadt tief in den Ohren; an Valentin dagegen perlten sie ab. Er spitzte ins Publikum, als witterte er auf jedem Sitz einen Verräter. Hing das mit den Raubrittern zusammen, dem Hals über Kopf für diesen Abend angesetzten Stück? Warum hatte er ihr verschwiegen, wie es dazu gekommen war?
Karlstadt flüchtete sich in die Garderobe, zu den von Valentin zusammengetrommelten Komparsen. Auch aus ihren Mienen sprach Unverständnis, doch keiner wagte zu fragen. Dann nahten Schritte. Rasselnder Atem. Valentins Schritte, und die verkündeten Hektik, die Unrast aller Kurzatmigkeit: »Gleich. Sofort!«
»Was?«
»Einer mit Stift und Papier.«
»Ja, und?«
»Raus … muss raus!«
»Ein gestandenes Mannsbild aus dem Saal rauswerfen? Und morgen steht es dick in der Zeitung? Das wird ein Journalist sein.«
Valentin bebte, knickte mittig ein, ein Taschenmesser vor dem Zusammenklappen. Er rang heillos nach Luft, ein Raub seines Asthmas. Karlstadt eilte zum Spind, fasste in ihre Handtasche. Immer hatte sie Felsol, eins seiner diversen Asthmamittel, für ihn parat. Schon öfters wäre er sonst beinahe erstickt; gedankt hatte er es ihr nur selten.
So griff er wortlos zu. Seine hektischen Sprühstöße schossen ins Nirwana.
»Brauchst du Zielwasser?«, witzelte Bergmayr, im Stück der Korporal.
Normalerweise reichte das leicht für einen grantigen Blick, aber Valentin winkte nur ab, taumelte wie ein Boxer, nachdem er angezählt worden war. Darein erscholl der Gong, dann der Aufruf: »Die Raubritter vor München«.
Karlstadt blieb an seiner Seite; sie half ihm auf die Bühne, ihm, dem tumben Trompeter und Wachburschen Bene. Es reichte jedoch nicht mal mehr zum Burschen. Valentin zitterte wie ein zu groß geratenes Kind, an heillos ineinander verschlungenen und viel zu dürren Schnüren einer Marionette. Auch Karlstadts Nerven waren am Zerreißen. Doch wieder das Wunder: Es lief alles glatt, denn was auch immer sie spielten, das spielten sie wie am Schnürchen. Immer dazu vergattert, aneinander zu leiden, in Banden gekettet zu sein.
Gegen Mitternacht war es endlich vorbei. Noch ehe der karge, übernächtigte Applaus endete, ließ sich Valentin von Karlstadt ins Off führen. Dort angekommen, brummte er: »Jetzt bringen Sie mich heim. Der Bobsi muss austreten, sonst bekommt er eine Blinddarmverrenkung.«
»Tut mir leid, ich bin zu Fuß«, gab sie patzig Kontra. »Da wird sich der Hund noch etwas gedulden müssen. Übrigens, das Spray vorhin war das letzte, das ich noch habe. Falls dich das interessiert.«
»Dann besorgen Sie mir bitte ein neues. Und jetzt gehen Sie mir zum Portier und bestellen einen Wagen.«
»Braucht es nicht.«
»Warum?«
»Wir sind in einem Theater, da stehen Droschken parat, wenn die Vorstellung zu Ende ist.«
Nun fiel Valentin wieder jener feminine Duft ein, den er vor ihrem Auftritt erschnuppert hatte. Noch übler: Auch sein Etui mit den Zigaretten war leer.
»Bis morgen, aber ohne dies Parfum.« Er ließ Karlstadt stehen, kroch in seinen Gehrock und eilte nach draußen, wo in der Tat eine Droschke auf ihn gewartet hatte.
Zu Hause angekommen, leinte er seinen Foxterrier Bobsi noch im Windfang an und drehte eine Runde. Nervös, wie das Tier war, am Ufer der Isar, dort kam ihm kein Auto verquer.
Bald war er wieder daheim. Frau und Tochter waren längst zu Bett gegangen. Neben dem Telefon im Flur lag ein Brief. Er war frankiert mit exotischen Briefmarken, per Einschreiben versandt und deshalb offenbar noch am Abend zugestellt. Als wollte man ihm, dem passionierten Briefmarkensammler, eine Freude machen.
Der Brief selbst war jedoch keine rechte Freude, denn er kam aus dem reichen Amerika. Und er sollte ihn nicht nur in dieser Nacht um den Schlaf bringen.
Ein Angebot, von einem Herrn Steve Hartman, für zwei Jahre Bühne und Film in Amerika. Am anderen Ende der Welt.
19. Oktober 1926
Drei Tage später.
Karl Valentin schrak hoch, aus viel zu flachem Schlaf. Und aus einem Albtraum, einer stürmischen Überfahrt per Dampfschiff. Tief unter ihm der Atlantische Ozean, hundertmal tiefer als der Bodensee. Den er, ebenfalls bei Sturm, einige Jahre zuvor für einen Auftritt in Zürich zu Schiff überquert hatte. Was er auch dank eines von Karlstadt herbeigeschwankten Beruhigungsbieres überlebt hatte.
Valentin setzte sich auf, die schweißnasse Nachtwäsche hing ihm am Leibe, und seine Armbanduhr auf dem Nachttisch war um Punkt 2.30 Uhr stehen geblieben. Draußen aber dämmerte der Tag, was ihn ein wenig beruhigte, denn dann konnte er so wenig nicht geschlafen haben. Obschon er unter der Matratze diesen kreuzvertrackt verlockenden Brief aus den Vereinigten Staaten versteckt wusste, in dem es auch um eine Schiffsreise ging. Jene Überfahrt nach Amerika, die er für das ganz große Rad und harte Dollars wagen sollte.
Er stand auf, liftete die Matratze und vergewisserte sich des Schreibens, dann erst zog er sich an. Auch Bobsi war sichtlich unruhig. Winselte. Witterte er das mit Amerika? Valentin stellte das Frühstück hintan, rauchte nur zwei Zigaretten und leinte den Hund für die Morgenrunde an. Wenn das so weiterging, musste er auch Karlstadt anleinen. Vertrauen tat not, Kontrolle noch nöter. Zu viele, bereits hier in München, die sie für Film und Funk engagieren wollten. Ferner wohnte sie auch noch in der Maximilianstraße, gegenüber dem Schauspielhaus, dem neuen Domizil der Münchner Kammerspiele, wo sie beide im Dezember für Firmling sowie Christbaumbrettl gebucht waren. Noch steckte das Theater in finanziellen Nöten, deshalb hatte Intendant Falckenberg sie wieder mal engagiert. Sie brachten Geld ins Haus. Das er dafür akquirierte, Zugpferde fest an sich zu binden, und die Karlstadt käme bei ihm an erster Stelle. Er musste also wachsam sein.
Inzwischen waren Hund und Herrchen draußen, und wie stets mied Valentin die Umtriebe der inneren Stadt, geleitete Bobsi durch die Zweibrückenstraße zur Isar. An deren rechtem Ufer, sprich in der Au, er im Juni 1882 das Licht des Künstlertunnels erblickt hatte, in jener Vorstadt, deren Kleinkünstler und Raufhändel im vornehmen München links der Isar verrufen waren. So war und blieb die Isar für ihn, den ob seiner Jugendstreiche sogar in der Au verschrienen Lausbuben, stets in Sichtweite, Blutbahn und Nerv zugleich, meist träge im Kiesbett, zuweilen aber mürrisch und ungebändigt. Wann immer es ging, machte er mit Bobsi Spaziergänge durch die Welt seiner Jugend, die mit dem plötzlichen Tode seines Vaters und dem Niedergang und Notverkauf des heillos überschuldeten Tapeziergeschäfts Falk & Fey unerbittlich zu Ende gegangen war.
An der Brücke über die Isar verspürte Valentin erste Atemnot; der Regen der letzten Tage hatte die Luft feucht anschwellen lassen, die Isar ebenfalls. Sie roch nach Schlick und Kies, faules Totholz trieb oben auf der Gischt. Vom nahen Kirchturm der Lukaskirche schlug es acht; nun öffnete drüben in der Au, unweit des Mariahilfplatzes, der Apotheker seines Vertrauens, der für ihn nicht nur das Asthmapulver komponierte, sondern ihm inzwischen auch die Regenprobe mikroskopiert haben sollte. Eine Viertelstunde Weges entfernt, jenseits der Isar und nahe seinem Elternhaus, das heute sicher einem neureichen Privatier gehörte.
Nur widerwillig folgte ihm Bobsi; Valentin musste an der Leine zerren.
*
Zur selbigen Stunde näherte sich ein Nachtzug aus Hamburg dem Münchner Hauptbahnhof. Drinnen Leopold Wellano, der, mit gespanntem freudigem Herzen und kleinem Handgepäck für den Schlafwagen erster Klasse, bereits bei Augsburg sein Coupé geräumt hatte und daher im Seitengang des Waggons die letzten Kilometer seiner weiten Reise genussreich an sich vorüberziehen ließ.
War doch alles auf das Beste bestellt: Sein Zimmer, feudal im ersten Haus hier am Platze, dem Hotel Bayerischer Hof, war telegrafisch avisiert, und sein großes Gepäck hatte er à jour dorthin expedieren lassen, direkt von dem nicht minder noblen Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten aus, in dem er die Nacht nach der Ausschiffung verbracht hatte. Daher klaffte im Säckel bereits ein erstes tiefes Loch. Aber aufs Verdienen von Geld verstand er sich wie kaum ein anderer. Er war schließlich ein Wellano, Nachfahre einer über Bayern verzweigten Dynastie betrügerischer Viehhändler, alle begnadete Schauspieler und Hasardeure.
Von den Wellanos der Schlimmste war unbestritten Korbinian Wellano – Leopolds Vater, der Münchner Kopf dieser Bande. Der 1900, rechtzeitig bevor die Schlinge der Gläubiger sich zuzog, alles Vermögen nach Amerika geschafft hatte – von Bogenhausen aus, rechts der Isar, dem Stadtteil der Rentiers und Parvenüs. Sein letzter Coup in München war ein windiger Auftrag an Falk & Fey, die Firma von Karl Valentins Vater, gewesen, ihr neues Jugendstilpalais in Bogenhausen zu tapezieren und die Möbel einzulagern. Ohne zu zahlen, versteht sich.
Nun gehörte sein Vater auch in Pittsburgh, wo sich die Wellanos angesiedelt hatten, zu den Reichsten. Denn Stahl lief immer; erst recht, wenn man es richtig drehte. Und dank ihres nach Dolce Vita klingenden Namens Wellano hatten sie nach 1917, der Kriegserklärung der USA an das Deutsche Reich, weniger Ressentiments erfahren als andere deutsche Unternehmer in den Vereinigten Staaten.
So fügte es sich, dass sein Vater dieses noble Palais halten konnte, welches er, um es vor dem Zugriff seiner Gläubiger zu schützen, gewandt an Louis veräußert hatte. Dieser wiederum hatte sich für dieses Vertrauen erkenntlich gezeigt und es so weit erhalten, dass es jederzeit wieder in alter Weise bezogen werden könnte. Denn mit der Hochinflation der Jahre 1922/23 hatten sich auch die letzten Altschulden seines Vaters in Luft aufgelöst.
Der Zug bremste allmählich, rechter Hand zweigten die Gleise der Münchner Südumgehung ab, die über die Isar und durch die Au zum Ostbahnhof führte. Leopold Wellano schmunzelte. »Jetzt hat’s ihn erwischt, den Fey«, hatte sein Vater noch viele Jahre später über Valentins Vater gespottet, nachdem Louis, der getreue Hofberichterstatter über alles in München, von dem Falk & Fey drohenden Konkurs berichtet hatte. Was lag näher, als sich listig der Identität (und damit der Existenz) des Sohnes und Künstlers Karl Valentin zu bemächtigen? Und aus dessen Prestige Geld herauszuschlagen – weit mehr, als es der zugegeben geniale, aber von Ängsten bedrängte Valentin tat?
Dann der Halt im Hauptbahnhof. Zu allen Schandtaten bereit, stolzierte Wellano mit seinem Handkoffer zur Waggontür. Nun fehlte nur mehr eine Droschke erster Güte, die ihn rasch zum Bayerischen Hof fuhr.
*
Derweil hatte Karl Valentin den Stadtteil Au erreicht. Er band den Hund an einer Laterne fest und betrat die Apotheke seines Vertrauens.
»Habe die Ehre«, hofierte ihn der Apotheker mit dem gelehrten, aber saupreußischen Namen Kant. »Wo drückt denn heute der Schuh?«
»Am Kopf«, replizierte Valentin und wies auf sein Reagenzglas auf dem rückwärtigen Tisch mit dem Mikroskop. Noch immer war da seine Regenprobe drin, also offenbar noch nicht untersucht. »Fragen Sie sich nicht, was im Regen drin ist und uns aufs Hirn tropft?«
»Wenn’s irgendetwas wäre, was Wachstum erzeugt, wär’s mir grad recht«, brummte Kant, dessen Haarkranz Valentin wieder ein wenig dünner geworden zu sein schien. »Und wegen Ihres Regens tut’s mir leid; ich war die Tage über unpässlich. Heute Mittag tu ich’s Ihnen mikroskopieren.«
»Gäb es denn etwas, das die Haare wachsen lässt?«, fragte Valentin. »Insbesondere die roten?«
»Schaun S’ her«, murmelte Kant. »Wenn’s da irgendwas gäbe, wäre ich der Sorgen frei.«
»Der Sorgen ums Haar?«
»Nein, ums Geld.« Kant schlurfte in die Ecke, wo er Valentins Asthmapulver zusammenmischte. »Drei Pfennig das Gran, wie immer.«
»Wirken die Gran granantiert?«, fragte Valentin. Er konnte nicht umhin, ein kleines Wortspiel mit dem Apothekergewicht zu machen.
Kant winkte ab, mit einer Miene, die Valentin sattsam kannte. Sowie er runter war von der Bühne, mochte keiner mehr über die Valentiniaden lachen. Und noch was bereitete ihm Sorgen, derweil er sein Pulver bezahlte: das Schweigen der Zeitungen. Kein einziges Münchner Blatt hatte über seinen Auftritt vor drei Tagen berichtet, den Abend mit den Raubrittern vor München, während derer jemand im Publikum stenografiert hatte.
So war er rasch draußen, verabreichte sich seinen ersten Schuss vom Pulver, band Bobsi wieder los und kaufte an einem nahen Kiosk sämtliche Münchner Zeitungen. Entlang der Isar schritt er der Stadt zu. Der Regen der vergangenen Tage war vorbei, es züngelten gar die ersten Sonnenstrahlen; seiner Laune half das jedoch kaum. Und als er zu Hause die Zeitungen sichtete, sank sie noch weiter. Rein gar nichts. Kein Sterbenswort über die Raubritter. Und sein »Mädi« Bertl, die geliebte Tochter Berta, war bereits in der Handarbeitsschule.
Der Preis dafür, dass man ihr dort hoffentlich die Idee austrieb, Schauspielerin zu werden. Zu dringend brauchte er sie daheim, allzu sehr war sie ihm an sein Vaterherz gewachsen.
Und nun das mit den Raubrittern gestern. Und dem Brief aus Amerika.
Nein, das passte nicht hinten und vorn. Da musste ein Gauner daran mitgeschraubt haben; jemand, der ihm schon bald übel mitspielen würde.
*
Wellano brauchte keine Droschke, denn eine Chaise séparée wartete auf ihn. Sein Louis, dem er die Stunde seiner Ankunft avisiert hatte, ließ es sich nicht nehmen, ihn mit seinem Horch am Bahnhof abzuholen.
Wellano stieg in den Fond des Wagens, klappte dezent seinen Taschenspiegel aus, um noch ein wenig an seinem Aussehen zu arbeiten. Gleich würde er sich, am Empfang des Hotels, als »Dr. Polt W. Wellano« ausgeben. Völlig gefahrlos, hatte er doch unlängst dank der Beziehungen seines Vaters einen schicken Doktorgrad sowie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit erlangt. Hatte sich dann einen amerikanischen Reisepass mit dem Doktortitel und mit »Polt«, einem eingeebneten »Leopold«, ausstellen lassen. Sein ungeliebter zweiter Vorname Wilhelm war zu einem weltläufigen »W.« eingedampft: Doctered, but with style.
Ferner war er stilsicher gekleidet: Cutaway, mit grau-schwarz gestreiftem Beinkleid und passender Weste.
Nur auf eines galt es zu achten, aber auch das hatte Wellano lange geübt: dass sein Englisch keinen bajuwarischen Akzent aufwies.
Zehn Minuten später hielt der Wagen vor dem Portier und zwei livrierten Pagen des erstrangigen Hauses. »Your luggage has already arrived«, hauchte der Portier; ein Page nahm ihm brav den Handkoffer ab, der andere kümmerte sich um den Horch. Wellano blieb nichts mehr zu tun. Anscheinend hatte Louis im Hotel bereits zu verstehen gegeben, dass er sich mit ihm ins Foyer setzen wolle.
So war bald alles zu ihrer Zufriedenheit arrangiert. Der Doktor hatte Leopold Wellano eine Suite ersten Ranges eingetragen, alle Koffer und Kisten waren da, ihr Inhalt eingeräumt, und auf einem diskret abgeschirmten Tisch im noblen Foyer stand eine Flasche Champagner für sie parat.
»Pfundig«, entfuhr es Wellano, auf gut Bayrisch. Er erschrak, zum Glück war kein Livrierter in der Nähe. Galt es doch auch, den für ein so feines Hotel fatalen Viehhändlerstammbaum zu verschleiern.
»Okay so far«, raunte Louis mit seinem Grübchen auf der Stirn, das merklich tiefer war, als es Wellano in Erinnerung behalten hatte.
Sie setzten sich in zwei Fauteuils comme il faut, dann kam auch schon ein Kellner. Köpfte den Champagner, ohne jeden Knall, schenkte ihnen ein und stellte die Flasche in den vergoldeten Kühler. Nervös tippte Wellano mit den rechten Fingern auf den kleinen Tisch, das »Pfundig« von vorhin hing ihm nach. Deshalb war er froh darum, dass Louis nun die Zügel ergriff und den Kellner auf Englisch bat, sie mit sich und ihrem Champagner allein zu lassen.
»Sieh dich vor«, züngelte er, nachdem der Kellner außer Sicht war. »Der Valentin hat auch seine Helfer, und die sind nicht auf den Kopf gefallen.«
»Hast recht.« Wellano hob die Schale, stieß mit Louis an. »By the way, shall we go on speaking English together?«
»Nein, nur, wenn sich jemand nähert. Bayrisch ist das Einzige, was wir wirklich können.«
»Stimmt.«
»Und geh ihm vorerst aus dem Weg.« Louis griff in sein Jackett, zog einen Zettel heraus und schob ihn über den Tisch. »Üb ihn noch ein bisserl, dann erst greif an. Hier stehen Säle drauf, in Stadtteilen, die er bisher gemieden hat.«
»Und die wären?«
»Bogenhausen vor allem, das ist ihm viel zu vornehm, diesem Bauernfünfer aus der Au. Neuhausen und Nymphenburg gehen auch.«
»Auf dich und deine Hilfe.« Wellano hob seine Schale, schaute dem Champagner genießerisch beim Perlen zu, ehe auch er trank. Louis hatte recht; sie durften all das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
»Noch etwas.« Louis senkte die Stimme. »Seine größte Sorge neben dem Asthma ist die Karlstadt. Dass sie fremdgeht – und dass man sie als das enttarnt, was sie in Wirklichkeit ist: seine Geliebte. Dass das Bild des getreuen Ehemannes Kratzer abkriegt.«
»Interessant, interessant.« Wellanos Wangen liefen heiß. Wie uns die Alten sangen: Schmiede das Eisen, solange es glüht. Den Keil dort ansetzen, wo er am stärksten spaltete, für einen Wellano ein Klacks.
»Lebt sie also nicht bei ihm?«, fragte er.
»Nein. Schon allein wegen dem Tratsch, den so was mit sich bringt.« Louis grinste. »Umso schmaler der Grat, auf dem er wandelt.«
Wellano merkte auf. In seinen Augenwinkeln ein Schatten, ein Herr in Uniform, der auf Blickkontakt hin verschwand. War das ein Spion? Oder ein Kellner? Kaum, der wäre zu ihnen an den Tisch gekommen.
Auch Louis schien den Herrn bemerkt zu haben; er stand auf und fächerte die als Sichtschutz dienende Stellwand auf volle Länge auseinander.
»Lass uns in mein Zimmer gehen«, raunte Wellano, noch bevor Louis wieder Platz genommen hatte. Der nickte, auffällig spät, als fiele der Groschen nicht recht. Gab schließlich dem Kellner einen Wink und bedeutete ihm auf Englisch, den Champagner aufs Zimmer zu bringen.
Dann lotste er Wellano durch das elegante Foyer zum Aufzug, vorbei an dem Schatten von vorhin. Es war jedoch kein Spion, sondern ein Offizier, in der Galauniform der ehedem Königlich Bayerischen Gebirgsjäger. Als wäre Bayern nach wie vor ein Königreich. Beseelt fuhren Wellano und Louis mit dem Aufzug nach oben.
»Wie schaut denn Karl Valentin in Zivil aus?«, erkundigte sich Wellano, kaum dass die Zimmertür hinter ihnen ins Schloss gefallen war. Schon auf den ersten Blick ein Zimmer mit allem Komfort.
»Ich hab Fotos dabei«, flüsterte Louis, sah sich verstohlen um. Wähnte er selbst hier einen Spion? »Sogar eines mit Karlstadt zusammen. Sind von Pit.«
»Pit?«
Louis hielt den Zeigefinger vor den Mund, darauf fügte er noch verhaltener hinzu: »Ist sein Deckname.« Er fasste in seine aus feinstem Hirschleder maßgefertigte Diplomatentasche, wie sie Wellano taxierte, zog ein nicht minder elegantes Lederetui heraus und reichte es ihm.
»Danke.« Wellano nahm einen Kleiderbügel aus dem Schrank, zog den Cutaway aus und hängte ihn an die Garderobe, dann sichtete er die auffällig scharfen und allesamt höchst beredten Fotos. »Spitze. Wie hat er das geschafft? In aller Öffentlichkeit zu fotografieren?«
»Ich habe ihm eine Leica gekauft.«
In das Wort »Leica« hinein klopfte es leise an der Tür. Wellano sah zu Louis. »Wird unser Champagner sein«, meinte der, und er behielt recht. Schnell, zu schnell, war die Flasche leer, und Wellano prickelte vor Tatendrang. Zumal er den Fotos gemäß alles an Bekleidung bei sich hatte, was er für die Valentiniaden benötigte, sprich um bereits auf der Chaussee den Valentin zu mimen.
»Zum Umkleiden kommst bitte zu mir«, beschloss Louis seine weiteren Instruktionen und wandte sich zum Gehen. »Du weißt ja wohl noch wo.«
*
Nicht mal der Zwetschgendatschi mit Streuseln, den ihm seine Frau Gisela gebacken hatte, vermochte Valentin aufzuheitern. Bereits diesen Abend stand der nächste Auftritt im Deutschen Theater an, gottlob diesmal ohne die Raubritter vorMünchen, nach einer Revolte der Bühnenarbeiter wegen Überschreitung einer gewerkschaftlich ausgehandelten Höchstarbeitszeit. Als ob das Theater eine Fabrikation wäre.
Dabei war ihm die Bühne schon lange zu wenig. Gewiss, den kleinen Sälen der Vorstadt sowie den seicht-seligen Bierschwemmenauftritten der Volkssänger war er inzwischen entwachsen; er hatte schon mit Herrn Bertolt Brecht gespielt, ging in den renommierten Münchner Kammerspielen ein und aus und spielte in sämtlichen Abend-Varietés des Deutschen Theaters die erste Geige. Doch schon bald, er ahnte es, lernten die Stummfilme das Reden, erreichte der Rundfunk über München hinaus ein Millionenpublikum, ohne dass er dafür in die lebensgefährliche Eisenbahn steigen musste. Dies galt es sich zunutze zu machen.
»Geh zu.« Gisela dazwischen, mitten rein ins Denken. »Stocher nicht dran rum, iss lieber.«
»Wie viel Mühe steckt in der Kunst«, seufzte Valentin, legte die zerlesenen Zeitungen zusammen und aß ein zweites Stück Datschi.
Galt es doch, durch die gesamte Stadt bis in die Nähe des Glaspalastes zu wandern. Ein neues Geschäft mit Foto-Artikeln bewarb heute in einer Anzeige der Münchner Neuesten Nachrichten zum Einführungspreis eine neu auf den Markt gekommene Kamera mit Namen Leica. Keine Riesenkiste oder Quetschkommode, sondern eine, die man gar elegant im Gehrock verschwinden lassen konnte. Mit welcher er, ohne jeden Argwohn allfälliger Passanten, sein altes München dokumentieren konnte. Oder, genauer gesagt, das, was davon noch übrig war. Das es daher zu sammeln und zu bewahren galt. Zusammen mit Valentins Memoiren, an welchen er bereits im Mutterleibe geschrieben hatte.
Valentin ließ seine letzte Kuchenzwetschge vom Teller in die hohle rechte Hand gleiten. Zerdrückte diese zu Brei und kippte sie in den über den Zeitungen kalt gewordenen Kaffee. Darauf setzte er den Hut auf und machte sich auf den weiten Weg zu dieser Leica. Abseits der Trambahnen, die er meistens mied. Also querfeldein, vorbei am Hofbräuhaus und der Frauenkirche und durch die Löwengrube. Dachte er sich. Dann aber war die Löwengrube wegen, wie es hieß, Kanalbau-Arbeiten gesperrt, sodass er über den von der Tram befahrenen Promenadeplatz ausweichen musste. Auch gut. Gab es doch auf diesem von Bankhäusern, Ministerien sowie dem Hotel Bayerischer Hof gesäumten Areal jene Großkopferten, die er in seinen Szenen mit seinem München zu konfrontieren pflegte, dem München der Handwerker und Hungerleider. Denn Valentin ging bereits seit Tagen ein neues Stück durch den Kopf, eines über einen Herrn Ministerial- oder Geheimrat, der sich vornehm in einem Fotoatelier in Szene setzen lassen will. Dort jedoch, weil der Meister dummer-, aber sinnigerweise außer Haus ist, mit zwei Lehrbuben vorliebnehmen muss.
Valentin bog ab. Durcheilte die Hartmannstraße und erreichte den Promenadeplatz, wo er schließlich, umgeben von fast im Minutentakt anfahrenden Droschken sowie elegant befrackten Livrierten, in Sichtweite dieses Hotels Stellung bezog, aber so weit weg, dass kein Livrierter oder gar die Gendarmerie daran Anstoß nehmen konnte.
Nach wenigen Minuten auf der Lauer merkte Valentin auf: Ein spindeldürrer Herr trat aus dem Hotel. Der ihm von Gestalt wie ein Ei dem andern glich. Der einen Cut trug wie aus Amerika. Und wie g’schert der herumstolzierte. Als wär’s ein Stück vom Karl Valentin.
Valentin nahm die Verfolgung auf. Bis ihm Metall auf Metall, Klingeln und ein grelles »Obacht« tief in Mark und Bein fuhren. Links neben ihm die Trambahn, zum Halt gekommen, nur einen Meter von ihm entfernt.
Valentin trat aus dem Gleis, sammelte sich, doch war der Herr ihm entkommen. Der Rest blieb Zittern, halb vor Schreck, halb aus Zorn. Er zitterte abseits der Gleise durch die halbe Stadt und, typisch Valentin, direkt vor dieses Fotogeschäft. Mitsamt der Leica im Schaufenster.
Dort aber rauschte eine dralle Hutschachtel in einem falschen Pelz an ihm vorüber und betrat, einen Buben an der Hand, der ihr Enkel sein mochte, großspurig das Geschäft. Pfeilgrad wie der fesche Herr Geheimrat, den Valentin sich bis dato für sein neues Stück vorgestellt hatte.
Valentin zögerte nicht lange; er folgte ihr in dies Geschäft und trat, noch ehe ein Angestellter seiner ansichtig wurde, an der Tür diskret zwischen zwei vollgepackte, bis zur Dachkante reichende Regale mit wirrem Zeugs. Als hätte es ihm der Herr Fundus dort aufgestellt.
»Sie wünschen, gnädige Frau?«, piepste es, verlegen und wie aus dem Off. Valentin spitzte die Ohren, duckte sich und spähte durch eine Regallücke zwischen zwei Stativen. War auch hier der Meister außer Haus?
»Oma, ist das der Herr Graf? Der Fotograf?«, säuselte eine piepsige Bubenstimme. Valentin stieß sich das Asthma. Omas schwüles Parfum waberte immer näher.
»Ist ja fatal«, moserte Oma. »Zwei Lehrbuben und sonst neamd. Wo ist der Meister? Wann ist er wieder da?«
»Übermorgen«, stotterte ein Dritter, mit einer etwas kräftigeren Stimme.
Lehrbuben also, schlussfolgerte Valentin und rieb sich feixend die Hände, so, wie er es sich für sein neues Stück ausgedacht hatte.
Rasch hielt er die Luft an, bei seinem Asthma war es ohnehin vorbei mit Atmen. Derweil sich Oma, die anscheinend nicht die Rückkehr des »Meisters« abwarten mochte, laut keifend in das Unvermeidliche fügte und die zwei Lehrlinge darum bat, ihren Enkel zu fotografieren.
Valentin rettete sich ins Freie, er zückte sein Spray; kurzatmig und voller Ideen. Adieu, Herr Geheimrat, Oma war der bessere Anfang für sein Stück. Und dann, als weitere Kunden, vielleicht ein Scharfrichter? Ein groteskes Brautpaar? Er verweilte noch etwas vor dem Schaufenster, betrachtete versonnen die darin ausgestellte Leica. Aber die würden ihm die beiden Lehrbuben nicht erklären geschweige denn vorführen können, und so zog Valentin von dannen, nordwärts, um über Brienner Straße und Max-Joseph-Platz zu Liesl Karlstadts Wohnung in der noblen Maximilianstraße zu gelangen und ihr das Stück vorzustellen. Auch war es besser, er bliebe Schaja treu, jenem Atelier in der Maximilianstraße, das ihm seit Jahr und Tag alle seine Fotoarbeiten machte.
Rief doch dieses Stück, um zur Bühnenreife zu kommen, nach einem Atelier. Worin es, in Probe und Dialog zwischen ihm und Karlstadt, erst zur endgültigen und letzten Fassung gelangen würde.
Am Königsplatz setzte er sich auf die Stufen zur Staatsgalerie und begann, Oma und Enkel, also den Anfang des Stücks, zu skizzieren, auf dem Rand eines Kuverts, deren einige er stets bei sich trug.
Beseelt schritt er weiter. Nur allmählich wich sein Asthma. Auf dem Odeonsplatz verschlug es ihm abermals den Atem: Der mit dem Cut näherte sich, auf der Theatinerstraße. Paradierte dann vor dem Portikus der Feldherrnhalle und blieb aufreizend stehen. Als sollte ihn einer fotografieren. Doch war er es wirklich? Zum Teufel auch, könnte er sich nur Gesichter besser merken.
Valentin fingerte nach einer Zigarette. Bald wurden Passanten auf den Schönling aufmerksam, und als Valentin ihn ostentativ zu ignorieren suchte und einfach weiterlief, schien es ihm, als wechselten die Blicke mehrerer Passanten zwischen ihm und dem Beau hin und her. Egal, weiter, es war nicht mehr weit bis zur Maximilianstraße.
Immer noch angefressen, klingelte Valentin Schlag 11 Uhr bei Liesl Karlstadt, wo die Zornesader weiter anschwoll. Niemand öffnete; nicht einmal Karlstadts Schwester, die sonst um diese Zeit daheim war.
Ging Karlstadt spazieren oder war sie auf der Suche nach eigenen Engagements, statt für ihn und sein Fotoatelier da zu sein?
Valentin fiel der Schönling im Cut wieder ein. Schäumend vor Wut erwog er, sich in der Stadt auf die Suche nach Karlstadt zu machen. Doch sie fuhr neuerdings in einem Opel Kabriolett und das konnte ihn leicht überrollen. So zog er ab, in Richtung Isar, und machte sich missmutig entlang des Flusses auf den Weg nach Hause.
Indes, der dürre Beau ging ihm nicht aus dem Kopf, er spukte darin noch am Abend umher. Bis vor Valentins und Karlstadts Auftritt im Deutschen Theater. Valentins Lampenfieber stieg auf 41, beäugt von Josef Rankl, dem Neuling in der Truppe, der, wie es Valentin schien, auch schon mit Karlstadt angebandelt hatte.
Wieder verspätete sich Karlstadt. Valentin schäumte vor Zorn und Eifersucht, verbarrikadierte sich in der Garderobe. Sollten die anderen schauen, wie sie sich herrichteten.
Auf der Bühne war er fahrig, und es wurmte ihn mehr als je zuvor, dass er auf Karlstadts Soufflieren angewiesen war.
Selbst beim Firmling, den sie bereits derart oft gespielt hatten, dass er längst seine allerendgültigste, sprich schriftlich fixierte Fassung besaß.
Zu viel, was ihm alles Leben vergällte: Karlstadt, Rankl, dieser Brief aus Amerika, und nun noch dieser freche Schönling. Der, wie ihm zum Spott, ebenso dürr war wie er. So knurrte er über Karlstadts »Tut mir leid für die Verspätung« hinweg.
Kaum dass der letzte Vorhang gefallen war, machte er sich auf den Weg zu seinem Freunde Ludwig Greiner in die Gastwirtschaft Zum Feuerhaus