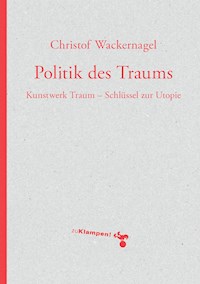Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Stefan hat Deutschland schon vor Jahrzehnten den Rücken gekehrt und lebt als Schreiner in Mali, er fühlt sich nahezu heimisch in Bamako unter seinen malischen Freunden. Für einen der reichsten Männer der Stadt eine Küche anzufertigen, scheint ihm ein lukrativer Auftrag, doch dann begegnet er dessen Frau und verliebt sich auf der Stelle - was Folgen hat! Denn Fatoumata ist, wenn auch unfreiwillig, in die Kunstschiebergeschäfte ihres Ehemanns verwickelt. In München ermittelt Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig Höfl wegen der Einfuhr geraubter Kulturgüter aus Afrika und lässt den Galeristen Philipp Laube hochgehen, der eine heilige Maske des malischen Dogon-Volkes für seine Galerie "Dialog der Kulturen" ergattert hatte. Ausgerechnet Fatoumata wird als Vermittlerin eingesetzt ... Mit ironischer Fabulierlust verbindet Christof Wackernagel Bamako mit München zu einem atmosphärisch dichten Spannungsroman, in dem es um Kunstraub, Geheimnisse, eine BKA-Fahnderin, Wirrnisse der Liebe, Kulturaustausch mit reichlich Missverständnissen geht. Ein Roman mit viel Lokalkolorit, voller überraschender und dramatischer Wendungen, in dem nichts so ist, wie es scheint, und Flüche von Dogon-Zauberern zuweilen sehr ähnliche Wirkungen haben wie deutsche Gründlichkeit und Bürokratie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan hat Deutschland schon vor Jahrzehnten den Rücken gekehrt und lebt als Schreiner in Mali, er fühlt sich nahezu heimisch in Bamako unter seinen afrikanischen Freunden. Für einen der reichsten Männer der Stadt eine Küche anzufertigen, scheint ihm ein lukrativer Auftrag, doch dann begegnet er dessen Frau und verliebt sich auf der Stelle – was Folgen hat! Denn Fatoumata ist, wenn auch unfreiwillig, in die Kunstschiebergeschäfte ihres Ehemanns verwickelt. In München ermittelt Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig Höfl wegen der Einfuhr geraubter Kulturgüter aus Afrika und lässt den Galeristen Philipp Laube hochgehen, der eine heilige Maske des Dogon-Volkes für seine Galerie »Dialog der Kulturen« ergattert hatte. Ausgerechnet Fatoumata wird als Vermittlerin eingesetzt …
Mit ironischer Fabulierlust spannt Christof Wackernagel einen Bogen von Bamako nach München – es geht um Kunstraub, eine BKA-Fahnderin, Wirrnisse der Liebe und Kulturaustausch mit reichlich Missverständnissen. Ein Roman mit viel Lokalkolorit, voller überraschender und dramatischer Wendungen, in dem nichts so ist, wie es scheint, und Flüche von Dogon-Zauberern zuweilen sehr ähnliche Wirkungen haben wie deutsche Gründlichkeit und Bürokratie.
Christof Wackernagel, geb. 1951 in Ulm, Jugend und Kindheit in München. Schauspieler und Schriftsteller, lebt seit 2003 in Bamako, Mali. Neben Film- und Fernsehrollen auch Hörspielautor und Theater-Dramaturg sowie seit 1982 diverse Buchveröffentlichungen.
CHRISTOF WACKERNAGEL
DER FLUCH DER DOGON
KRIMINALROMAN
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2012
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Februar 2012
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Autorenfoto Seite 2: © Felix Artmann
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
1. Auflage
Print · ISBN 978-3-89401-749-1
eBook · ISBN 978-3-86438-064-8 (ePub)
ISBN 978-3-86438-065-5 (PDF)
Teil I
Die Verschiebung
Die Nachmittagssonne flimmerte verschwommen über der Rue Nelson Mandela in Bamakos Stadtteil Hippodrome. Obwohl bereits der Feierabendverkehr eingesetzt hatte und zahlreiche Mopeds und Motorräder über den Asphalt rollten, vor allem die schicken Djakartas mit ihren noch schickeren Fahrerinnen, deren schwarze Haare im Wind wehten, und die, fest den Lenker umklammernd, in der einen Hand auch noch ihr Täschchen, in der anderen ihr Handy hielten; obwohl bereits viele grün bemalte Minibusse des Nahverkehrs mit ihrem schwarzen Auspuffqualm den vom ständigen Wind hochgewirbelten feinen Sandstaub zu einer Smogmischung verdichteten, die bei Anwendung deutscher Feinstaubverordnungen für Großstädte zur sofortigen Einstellung des gesamten Verkehrs geführt hätten; und obwohl bereits fabrikneue Luxuslimousinen neben verbeulten Schrottmühlen das Ganze zu einer einzigen Schlange machten, die nur noch träge vor sich hin kroch, fegte ungerührt von alldem eine Putzkolonne von fünf Arbeitern und Arbeiterinnen den Straßenrand und erhöhte damit die Unfallgefahr der sich halsbrecherisch zwischen den Autos durchschlängelnden Mopeds und Motorräder, im Volksmund motos genannt.
Die Arbeiter trugen allesamt eine blassblaue, orange gesäumte, sackartige Arbeitsuniform, dunkelblauen Mundschutz, wie man ihn auf den Nachtflügen nach Bamako von den Flugbegleitern als Augenschutz bekam, und kehrten mit dicken, feinfaserigen Reisigbüscheln, die mit Draht am unteren Ende ihrer Besenstangen befestigt waren. Sie wirbelten den Sand und Staub der Straße damit mehr auf, als dass sie ihn auf kleine Häufchen zusammentrugen, die von den immer wieder heftig aufbrausenden Windböen oft schon abgetragen waren, bevor die beiden der Kolonne folgenden Kollegen die übrig gebliebenen Häuflein Staub mit Schaufeln in ihre Eimer verfrachten konnten. Auch wenn ihre Münder verdeckt waren, konnte man doch in den Augen dieser sanften Enkel des Sisyphus ein mildes Lächeln erkennen – als ob die ganze Hektik der Rushhour nur eine neuzeitliche Geistererscheinung sei.
Die Rue Nelson Mandela wird von der Rue Danfaga gekreuzt, stadtauswärts holpriger roter Sandstein, stadteinwärts bereits asphaltiert; dort ist sie von prächtigen Villen gesäumt, zwischen denen sich der Supermarché Miniprix angesiedelt hatte, um den herum Frauen an Ständen Gemüse und Obst der Saison feilbieten.
Direkt neben der Kreuzung hatte sich der Taxistand der Coopération Taxi Hippodrome installiert, deren Mitglieder meist unter einem Zeltdach mit dem Kooperationslogo Dame oder Karten spielten, während sie auf Kunden warteten; im weiteren Verlauf der Straße hatten verschiedene Handwerker ihre Werkstätten eingerichtet, Schlosser, moto-Reparateure, Reifenhändler oder Schneider, die alle entweder bei offener Tür oder am Straßenrand unter einem Sonnendach arbeiteten. Zwischen einer Bude, in der man frisches, den ganzen Tag auf einem Holzkohleofen vor sich hin schmorendes Lammfleisch auf die Hand kaufen konnte, und der eines Herrenfriseurs, der mit einem handgemalten Portrait des amerikanischen Präsidenten Barack Obama für sich warb und in erster Linie mit seiner Schneidemaschine Glatzen schnitt, fand sich eine kleine Schreinerei mit dem Namen Menuiserie d’espoir, Schreinerei der Hoffnung.
Auch wenn dieser Name allgegenwärtig war – als Pharmacie d’espoir, Boulangerie d’espoir oder gar Cabine de téléphone d’espoir –, unterschied diese Schreinerei sich von den Geschäften der Umgebung: Ihr Chef war ein Weißer; schlank, etwa ein Meter achtzig groß, fast kahlköpfig, braun gebrannt, aber eben weiß. Zwar trug er die landesübliche Kleidung – leichte, luftig geschnittene Baumwollstoffe mit den für Mali typischen Zeichenaufdrucken – und arbeitete wie die Kollegen um ihn herum an alten Maschinen, stets umgeben von vielen, den hiesigen lange gekochten, starken grünen Tee trinkenden Leuten, stets begleitet von krächzender Radiomusik. Er fiel in seiner Umgebung niemandem mehr auf, aber oft genug hielten trotzdem Passanten oder gar Autos an und erkundigten sich, was es mit diesem Weißen für eine Bewandtnis habe. Sie waren schnell zufriedengestellt, wenn er ihnen in der Landessprache Bamanankan und auf die landesübliche zurückhaltende, fast barsche Art erklärt hatte, dass er diese Arbeit mache, weil er sie liebe, und dass er sie hier mache, weil er dieses Land liebe – und wenn er dann noch hinzufügte, dass er zwar als Stefan hierher gekommen sei, sein malischer Name aber nun Madou Diarra sei, lachten sie herzlich, gaben ihm, weit ausholend, die Handflächen laut klatschend aneinanderschlagend die Hand und zogen weiter.
Er stellte gerade seine Kreissäge ab, weil ein junger Mann ihn angesprochen hatte.
»Was ist los?«, fragte er, während er sich die Hände mit einem Lappen abwischte.
»Es ist tot«, sagte der junge Mann.
»Oh«, Stefan seufzte und sah auf seine Uhr. »Herzliches Beileid«, setzte er hinzu.
Der junge Mann blieb weiter bedrückt vor ihm stehen.
Stefan sah auf die Kreissäge und fuhr sich mit der Hand über den Kopf. »Wir haben jetzt eigentlich den Termin bei Wueleguem«, sagte er.
Der junge Mann schüttelte den Kopf.
»Okay«, seufzte Stefan, »dann muss er halt warten.«
»Solo«, rief er in Richtung des Büros der Schreinerei, »bring mir den Autoschlüssel!«
Kurz darauf erschien Solo in der Tür des Büros, ein derart dunkelhäutiger junger Mann, dass sein Gesicht wie ein schwarzes Loch wirkte, aus dem ab und zu die weißen Zähne blinkten, wenn er lachte oder etwas sagte. Nachdem er erfahren hatte, dass das Neugeborene von Abdulaj Sissoko gestorben war, tauschten die beiden Beileidsfloskeln aus, deren monotones Aufsagen dem Ernst der Situation entsprach wie auch der Umstand, dass sie sich dabei nicht in die Augen blickten.
Inzwischen hatte Stefan am Steuer des vierradangetriebenen Pick-ups mit der Aufschrift Menuiserie d’espoir, der auf der anderen Straßenseite im Schatten stand, Platz genommen und startete den Wagen, sobald Abdulaj eingestiegen war.
Der Alte
Am Hang eines Berges im Dogonland trat ein junger Mann in eleganten Jeans und einem roten T-Shirt mit Krokodilslogo zwischen den Tüchern der Türöffnung einer der fast völlig verlassenen traditionellen Höhlenwohnungen auf den davorliegenden Absatz; von der Nachmittagssonne geblendet, kniff er die Augen zusammen, dann setzte er seine Sonnenbrille auf und eilte den Hang hinunter, ohne auf die überwältigende Schönheit der sich vor ihm ausbreitenden Landschaft auch nur einen Seitenblick zu verschwenden. Ihm folgte ein in dunkle, mit magischen Zeichen bedruckte Baumwolltücher gekleideter alter Mann, der reglos vor dem Eingang stehen blieb und dem Davoneilenden nachblickte. Es war der Hogon, der Hellseher, Zauberer, Magier des Stammes. Der letzte Dogon, der noch in den Höhlenwohnungen lebte.
Am Fuße des Berges stand am Rand eines Dogon-Dorfes im Schatten eines knorrigen Baobab-Baumes, der aussah wie ein versteinerter Rauchzeichengeist, ein schwarzlackiert funkelnder Van der Marke Hummer, ein kleiner Luxuspanzer mit schwarz getönten Fenstern. Als der junge Mann den Wagen erreicht hatte, öffnete er die Tür, sah sich aber noch einmal um und entdeckte den Alten vor der Höhle. Dann schwang er sich auf den Fahrersitz und knallte die Tür zu.
Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau. Sie trug ein knielanges, knapp sitzendes italienisches Markenkleid mit Spaghettiträgern, goldene Ringe, große, kreisrunde Ohrgehänge und Armreifen und langstielige Stöckelschuhe. Ihr Gesicht war maskenhaft geschminkt: silbern schimmernde Wangen, groß geschwungene Augenbrauen und grellrote Lippen.
»Und?«, fragte sie.
Der junge Mann zuckte mit den Achseln, während er eine Zigarette aus einer roten Schachtel mit goldenem Aufdruck fingerte. »Er begreift das nicht«, antwortete er, steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und suchte mit fahrigen Bewegungen in seinen Hosentaschen nach einem Feuerzeug.
Nach einer Weile löste die junge Frau ihre übereinandergeschlagenen Beine, beugte sich vor, öffnete das Handschuhfach, entnahm ein Feuerzeug und reichte ihm die Flamme. Gierig sog er mit der Zigarette daran, nahm einen tiefen Zug, lehnte sich in seinen Sitz und blies den Rauch aus. Die junge Frau drückte den Knopf für den Fensterheber, was aber dazu führte, dass der Rauch an ihrem Kopf vorbei aus dem Wagen zog und sie zum Husten brachte.
»Ein alter Mann!«, sagte er und machte dazu ein Gesicht, das spöttisch wirken sollte, aber eher schief verzogen geriet.
Sie schlug ihre Beine wieder übereinander und lehnte sich ebenfalls zurück.
»Was hat er gesagt?«, fragte sie in einem Ton, als drohte sie zu ersticken.
»Tsch!«, machte der junge Mann. »Du weißt selbst, dass der Hogon nie etwas sagt! Aber ich habe ihn trotzdem verstanden«, grinste er schief. »›Ihr werdet schon sehen‹, hat er gedroht.«
Nun verschränkte die junge Frau ihre Arme, und ihre Maske versteinerte: »Das ist nicht gut.«
»Tsch!« Der junge Mann ließ den Motor an, schob den Schalter für die Gangautomatik auf »Fahrt« und ließ den Wagen langsam anrollen.
»Die Zeiten sind vorbei«, sagte er, während er den Wagen auf die Piste dorfauswärts steuerte.
Die Maske wandte sich in seine Richtung, und ihr Blick landete auf dem silbernen Ring an seiner rechten Hand, aus dem eine runde Erhöhung von einem halben Zentimeter Durchmesser ragte. Ihre Mundwinkel zuckten verächtlich. Dann setzte sie eine Sonnenbrille französischen Luxusdesigns auf und wandte ihren Blick wieder der Straße zu.
Der junge Mann ließ sein Fenster herab und der Wagen nahm Geschwindigkeit auf, soweit das bei der unebenen Piste möglich war. »Wir haben, was wir brauchen«, sagte er schließlich und deutete mit seinem Kopf zum hinteren Teil des Wagens. »Was wollen wir mehr.«
Der Hogon sah dem sich entfernenden Wagen nach, bis der in der hinter ihm aufwirbelnden Staubwolke verschwunden war. Aus dem Dorf drang das trompetenartige »I-ahhh« eines Esels zu ihm hoch. Er öffnete die Vorhänge der Türöffnung und trat ein.
Am hinteren Ende des Höhlenzimmers lag eine Matte, auf die er sich mit Blick in Richtung der Tür setzte. In diesem Moment erschien ein Salamander unter dem Türvorhang, nickte ihm zu und verschwand. Er nickte ebenfalls, traurig.
Die Trompetenstöße der Esel von Bandiagara hallten wie eine unumkehrbare Bekräftigung über das weite Dogonland, das von der untergehenden Sonne in ein Goldbad getaucht wurde.
Eines von Vielen
Die nicht asphaltierten Straßen des Stadtteils Banconi waren so eng und steinig, dass der Pick-up der Menuiserie d’espoir nur in Schrittgeschwindigkeit darüberholpern konnte, abgesehen davon, dass ständig kleine nackte Kinder über die Straße rannten, nebst Hühnern, Ziegen, Schafen, Eseln und Hunden, größere Kinder, die ein verdrecktes Fetzchen anhatten, Ball spielten, ohne sich dabei im Geringsten um irgendwelche Fahrzeuge zu kümmern. Auch die mitten auf der Straße flanierenden Fußgänger machten erst in allerletzter Sekunde Anstalten auszuweichen, wenn ein Auto auftauchte.
Hier waren weit und breit keine prächtigen Villen zu entdecken, im Gegenteil, die meisten Häuser hatten nur Blechdächer, die wenigsten waren verputzt, viele Umfassungsmauern verfallen. Etwa die Hälfte der Häuser war nicht mit den ansonsten üblichen modernen Zementziegeln gebaut, sondern noch mit althergebrachten Lehmziegeln, die nach jeder Regenzeit erneuert werden mussten, da das Gebäude sonst in wenigen Jahren weggeschwemmt würde. Da sich viele solch eine Renovierung nicht leisten konnten, verfiel so manches Haus, dessen Bewohner sich eine andere Unterkunft suchten. Einige Grundstücke hatten eigene Brunnen, die wenigsten Leitungswasser, aber an zentralen Stellen des Quartiers fanden sich öffentlich zugängliche Wasserhähne, an denen für wenig Geld stark gechlortes Trinkwasser gekauft werden konnte.
Als ein Zeltdach an der Straße in Sicht kam, unter dem Blechstühle aus Eisenrohren aufgestellt waren, hielt der Wagen an, und die beiden Insassen stiegen aus. Auf den Stühlen saßen Männer und Jugendliche, aber kaum jemand redete. Sie sahen schweigend vor sich hin.
Stefan und Abdulaj grüßten nur mit einem leichten Kopfnicken und gingen durch das geöffnete Tor auf den dahinterliegenden Hof, in dem ein alter Mangobaum stand, der weitflächig Schatten spendete. In dessen Ecke war ein großer Topf auf drei Steinen platziert, unter dem Holzscheite glühten und in dem ein Hirsebrei köchelte; in der Mitte des Hofes war ein Brunnen zu sehen, Leitungswasser gab es nicht. Das Haus war mit traditionellen Lehmziegeln gebaut, aber in gutem Zustand, und über der Tür waren Zeichen gegen übelwollende Geister eingraviert.
Stefan streifte seine Schuhe ab, bevor er den Eingangsbereich betrat, in dessen Mitte das tote Kind lag und in dem schweigende Frauen saßen; eine ältere, neben dem Kind auf dem Boden sitzende Frau sprach ab und zu gute Wünsche ausdrückende Formeln für das verstorbene Kind, die von den anderen im Chor mit »Amina« beantwortet wurden. Die Gesichter wirkten emotionslos, starr, was aber das Ausmaß der Betroffenheit ausdrückte.
Stefan verweilte eine Weile stehend unter ihnen und stimmte in den Chor ein. Dann ging er zur Mutter des Kindes, sprach ihr sein Beileid aus, gab ihr eine Geldnote in Höhe von 2000 westafrikanischen Francs, was etwa drei Euro entsprach, und verließ den Raum wieder.
Draußen setzte er sich zu den Männern und fragte Abdulaj, wer das Kind zuletzt behandelt habe. Abdulaj antwortete nicht und sah an ihm vorbei.
»Wart ihr bei einem Marabout?«, fragte Stefan ärgerlich, einem der selbst ernannten Heiler, die sich auf die traditionelle afrikanische Medizin beriefen, in der Mehrzahl aber Quacksalber und Betrüger waren. Abdulaj schüttelte den Kopf.
»Ihr habt doch nicht etwa Medikamente von einem Straßenhändler gekauft?«, setzte Stefan sein Verhör fort; Männer und Frauen, die ihre Ware oft tage- oder wochenlang auf dem Kopf in der glühenden Sonne herumtrugen und Tabletten, auch stärkste Antibiotika, einzeln anboten, ohne Verpackung, gänzlich unberührt von der Frage nach dem Ablaufdatum.
Abdulaj sah schweigend zu Boden.
»Das darf doch nicht wahr sein«, erregte sich Stefan, »ich habe dir doch tausendmal erklärt, dass du damit alles nur viel schlimmer machst!«
Missbilligende Blicke trafen ihn.
»Die Apotheke ist zu teuer«, sagte Abdulaj leise.
»Du weißt doch, dass ich dafür immer…«, brauste Stefan kurz auf, brach ab, sah auf die anderen, die stumm vor sich hin schauten, legte sein Kinn in die Hände, die Arme auf den Knien aufgestützt, und schloss sich den anderen in ihrem Schweigen an; es war ohnehin zu spät.
Ein erster Gebetsrufer trat in Aktion, aber weil Freitag war, verkündete er nicht den üblichen Appell, sondern sang eine traurig-tröstliche Melodie, die beruhigend durch die Straßen waberte.
Dialog der Kulturen
Um diese Zeit war in der bayerischen Landeshauptstadt München die Sonne bereits untergegangen, erste Straßenlaternen blinkten im Zwielicht und glühten auf, bis sie ihre volle Leuchtkraft erreicht hatten. Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig Höfl, ein untersetzter bayerischer Beamter wie aus dem Touristenprospekt geschnitten, Lodenmantel, Aktentasche und Hut mit Gamsbart, passierte wie an jedem Abend nach der Arbeit auf dem Weg zur U-Bahn-Haltestelle Marienplatz die an der Maximilianstraße residierende Galerie »Dialog der Kulturen«, wie immer ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Obwohl er schon unzählige Male an den Auslagen dieser Galerie vorbeigelaufen war, die zwischen einem Juweliergeschäft der teuersten Preisklasse und einem Möbelgeschäft mit italienischen Designerprodukten lag, ohne dass ihm irgendetwas aufgefallen wäre oder dass ihn irgendetwas daran interessiert hätte, geschah an diesem Tag etwas Merkwürdiges: Als ob seine Füße plötzlich schwer würden und ihm das Weitergehen versagten, kam er kaum einige Meter über das Schaufenster hinaus und blieb stehen, stutzte, ging schließlich, wie magisch angezogen, zur Auslage der Galerie zurück, und vertiefte sich in den Anblick der darin ausgestellten Objekte, Masken und Fetische aus dem westafrikanischen Dogonland, die mit hohläugiger Trauer in die Münchner Luxusmeile starrten, in deren Rushhour ausnahmslos glänzende Limousinen fast ohne jeden Feinstaubausstoß vorbeischnurrten.
»Eine jahrtausendealte Kultur grüßt unsere moderne Zivilisation«, blinkte es von einem darüberhängenden Spruchband, und kleine Preisschildchen meldeten bescheiden, dass man diese Kunstgegenstände für schlappe 750 000 Euro mit nach Hause nehmen konnte, eine Information, die Stirnrunzeln bei Dr. Ludwig Höfl auslöste.
»Bunter Mali-Tag am Samstag, den 9.10., in unserer Galerie«, kündigte ein weiteres Werbeplakat an, »Speisen und Getränke, Trachten und Volksmusik aus dem Herzen Westafrikas.«
Kurz darauf entrang sich seiner Brust ein Knurren. In diesem Moment stellte sich eine etwa sechzigjährige Dame neben ihn und fragte, seinen unwilligen Gesichtsausdruck bemerkend: »Gefällt’s Ihnen nicht?«
Dr. Ludwig Höfl schüttelte den Kopf. »Ich find des geschmacklos, wie man so eine Geldschneiderei als ›Völkerverständigung‹ verkaufen kann«, erklärte er naserümpfend.
Die Dame lachte deutlich angetan auf. »Des tut ja gut, so was auch mal zu hören!« Sie sah Höfl neugierig an. »Wissens, ich arbeite beim Völkerkundemuseum, und mir tut des manchmal richtig weh, wie solche Kunstschätze bei der Münchner Schickeria landen, obwohl die überhaupt keine Ahnung von dem wahren Wert haben – bloß weil sie’s zahlen können!«
Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig Höfls Miene verfinsterte sich parallel zur einbrechenden Dunkelheit, er sah kurz einer die Maximilianstraße in Richtung Marienplatz fahrenden Straßenbahn nach und wandte sich dann direkt an seine neue Bekanntschaft: »Die haben so viel Geld wie umgekehrt proportional wenig Hirn«, sagte er mit bayerisch rollendem »R« – und seine Gesprächspartnerin lachte glockenhell.
Doch dann wurde sie schnell wieder ernst. »Ich frage mich manchmal, ob das überhaupt erlaubt ist! Ich bin Kunsthistorikerin, ich versteh nichts von der Juristerei, aber es handelt sich gerade hier bei den Dogonkunstschätzen um nichts weniger als das Weltkulturerbe der Menschheit, auf so was hat doch ein Individuum gar kein Anrecht, so was gehört ins Museum«, redete sie sich in Fahrt, während ihr Dr. Ludwig Höfl mit zunehmender Aufmerksamkeit zuhörte. »Abgesehen davon, dass diese Schätze eigentlich in ihren Ursprungsländern zu verbleiben haben, und das sag ich, obwohl ich stellvertretende Direktorin des Münchner Völkerkundemuseums bin und schon rein beruflich ein Interesse an solchen Dingen haben müsste. Aber das wird auf europäischer Ebene schon lange diskutiert, und das kennen wir doch schon seit Napoleon, dass unsere größten Museumsschätze Raubkunst sind, und so was gehört sich für eine moderne Zivilisation nicht, aber wirklich, wo leben wir denn, wir haben das einundzwanzigste Jahrhundert, da kann man sich doch nicht mehr benehmen wie im achtzehnten.«
»Höfl, Ludwig«, stellte sich ihr Gegenüber nun vor, »Oberfinanzdirektion, Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung – da sind Sie bei mir beim Richtigen, gnädige Frau!«
»Schörghuber, Rosalind«, sagte die Dame und reichte ihm die Hand, »des is ja ein Zufall!«
»Es gibt keine Zufälle«, entgegnete Dr. Ludwig Höfl, »da ist was reif, des hab ich im Urin!« Er sah auf seine Uhr. »Sie«, fuhr er fort, »ich muss zu meiner Bahn, in welche …?«
»Ich muss auch zum Marienplatz«, sagte Rosalind Schörghuber und wandte sich zum Gehen.
»Vielleicht sollten wir uns in meinem Büro mal in Ruhe über diese Fragen unterhalten«, hörte man Dr. Ludwig Höfl noch sagen, bevor die beiden in angeregtem Gespräch in Richtung Marienplatz davongingen, und ihre Stimmen vor der Galerie »Dialog der Kulturen« mit dem sanften Brausen der Münchner Rushhour verschmolzen.
Aber die Mundwinkel der tausend Jahre alten Maske der Dogon kräuselten sich befriedigt, während aus ihren hohlen Augen geschossene unsichtbare Giftpfeile die Luxusmeile durchbohrten.
Das Märchenschloss
In Bamako war jetzt auch die Dunkelheit hereingebrochen, und die vierspurige Ausfallstraße Rue Koulikourou, auf der der Pick-up der Menuiserie d’espoir stadtauswärts fuhr, gehörte zu den wenigen, die das Privileg einer Straßenbeleuchtung hatten. Der ohnehin dichte Verkehr hatte sich gestaut, da wieder einmal ein moto sein waghalsiges Schlängelmanöver nicht überstanden hatte und unter die Räder eines der vorsintflutlichen LKWs gekommen war, die hoch beladen mit Reissäcken, Getränkekisten oder Küchengeräten, Motorrädern, Elektronikteilen oder Metallschrott auf dem Weg ins Landesinnere waren. Ziemlich zerbeult ragte es unter einem der Reifen hervor, von dem Fahrer war nichts zu sehen. Gruppen von Menschen standen am Straßenrand, und es war nicht zu erkennen, was weiter passieren würde.
Da sein Mitarbeiter Abdulaj unabkömmlich war, hatte Stefan seinen Freund Mamadou Coulibaly gebeten, ihn zu dem Kundengespräch zu begleiten, das eigentlich für den Nachmittag angesetzt gewesen war. Mamadou Coulibaly war Stefans größter Vertrauter und unersetzlicher Ratgeber in vielen Dingen des täglichen Lebens, mit denen Stefan trotz seines langjährigen Aufenthalts immer noch nicht zurechtkam. Er war Musiker, spielte ab und zu Balafon, das malische Vibrafon, auf Hochzeiten oder in Restaurants, verdiente seinen Lebensunterhalt aber als Maurer. Die Musik war in Bamako zwar rund um die Uhr und an allen Plätzen in unübersehbarer Vielfalt allgegenwärtig – und sei es nur auf Blechdosen getrommelt –, aber nur die wenigen großen Namen, die den Sprung nach Europa geschafft hatten, konnten davon leben.
Am Stadtrand von Bamako verengte sich die Rue Kouli-kourou zu einer normalen zweispurigen Landstraße, die kurz darauf ein Eisenbahngleis kreuzte, von dem aus auf der linken Seite eine Tankstelle zu sehen war.
»Das ist bestimmt die Tankstelle, vor der wir links abbiegen müssen«, sagte Stefan, »und wenn es auf dem Weg nicht mehr weitergeht, hat er gesagt, rechts, dann kommt das Haus nach etwa einem Kilometer.«
»Warum hast du mir nicht gleich gesagt, welchen Wue-leguem du meinst«, sagte Mamadaou, »dann hätte ich dir auch den Weg zeigen können«.
»Woher soll ich das wissen?« Stefan bremste ab und blinkte.
»Er ist Anwalt?«, vergewisserte sich Mamadou.
»Ich habe doch schon sein halbes Büro ausgestattet!« Stefan bog in die Seitenstraße ein.
Mamadou lachte: »Das ist er! Dann kannst du viel verdienen, das ist einer der reichsten Männer von Bamako!«
»Er hat immer gut gezahlt«, fand Stefan, »und deswegen ist die Piste hier auch so glatt, guck mal, kein Loch, kein Stein.«
»Der Mann hat unglaublich viel Geld«, fuhr Mamadou kopfschüttelnd fort, »und wenn es irgendwo in Bamako um viel Geld geht – er hat seine Finger drin.«
»Ich wundere mich immer wieder«, sagte Stefan, »wie viel Geld es hier in diesem angeblich ärmsten Land der Welt gibt.«
Mamadou lachte und zuckte mit den Achseln. »Er hat zwei Frauen«, fuhr er fort, »eine alte und eine junge«, er grinste, »und wie viele er in der Stadt hat, weiß er wahrscheinlich selbst nicht genau!«
»Ja, ja – die Frauen und das Geld!« Stefan bog seufzend rechts ab; der Weg war links von einer Mauer gesäumt, rechts von Bäumen.
»Außergewöhnliche Frauen«, Mamadou nickte, »sie waren mal auf einer Hochzeit, auf der ich spielte, jede im eigenen Mercedes mit Chauffeur, die junge arbeitet, glaube ich, in seinem Büro mit – die alte, ein Traum von Frau: eine Königin!«
Stefan beugte sich vor, um besser erkennen zu können, was der Scheinwerferkegel nur unzureichend beleuchtete; er schaltete das Fernlicht an, und ein von einer hohen, mit spitzen Eisen bewehrten Mauer umgebenes weißes Gebäude, dessen Ende nicht absehbar war, ragte wie eine Erscheinung aus dem Dunkel heraus, mit Erkern, Türmchen, Winkeln und Rundungen, roten Ziegeldächern, an denen, von Eisengittern geschützt, Klimaanlagen hingen.
»Das kann ja wohl nicht wahr sein«, stöhnte er und hielt den Wagen an, »das ist ja keine Villa, das ist ein Schloss!«
»Ich hab’s dir doch gesagt«, sagte Mamadou.
»So was hab ich ja noch nie gesehn!« Stefan war fassungslos, »das ist ja wie der übertriebene Nachbau eines französischen Barockschlösschens.«
Mamadou zuckte mit den Achseln: »Kenne ich nicht!«
Stefan fuhr langsam weiter. Kurz darauf kam ein großes Tor in Sicht, beleuchtet und von Videokameras überwacht; Stefan hupte zweimal kurz, und umgehend öffneten sich die Torflügel automatisch. Er war noch nicht ganz durchgerollt, als ein Wächter erschien, sich in das offene Fenster beugte, nach Stefans Auskunft aber sofort zurücktrat und ihn hineinwinkte.
Um eine Bananenstaude herum waren fast mannshohe Blumen mit riesigen blutroten und gelbvioletten Blütenkelchen angeordnet, zwischen denen zwei Pfaue stolzierten. Um das Haus herum waren akkurat geschnittene kniehohe Büsche gepflanzt, und Marmorplatten führten zwischen rautenförmigen Rasenflächen zu einer mit vergoldeten Schmiedeeisengittern bewehrten Eingangstür, über der die üblichen Zeichen gegen übelwollende Geister eingeritzt waren.
»Was allein der Garten an Wasser verbraucht!«, sagte Mamadou leise, als sie auf die Tür zugingen. Er stammte aus einem Dorf, in dem die Frauen oft kilometerweit gehen mussten, um Wasser zu holen.
Im Vorraum, den die beiden jetzt betraten, fläzten sich einige Männer und Frauen auf Plüschsesseln vor Glastischen in vergoldeten Eisenrahmen und glotzten auf einen unter der Decke hängenden Fernseher, aus dem in verkörnten Bildern und Überlautstärke Nachrichten dröhnten.
Es dauerte eine Zeitlang, bis einer der Männer sich langsam den beiden Ankömmlingen zuwandte und sie fragend ansah. Stefan, der seinen Zollstock mitgebracht hatte, tippte darauf und machte seinerseits ein fragendes Gesicht. Finsteren Blickes arbeitete sich der Mann aus seinem Sessel, schlurfte zur geschwungenen offenen Treppe, die in den ersten Stock führte, und hangelte sich am Treppengeländer hoch. Mamadou und Stefan wandten sich grinsend dem Fernseher zu.
Eine Stimme ertönte, aber erst beim dritten Anruf wandte sich Stefan um und sah den Mann am oberen Ende der Treppe. Er winkte ihnen hochzukommen.