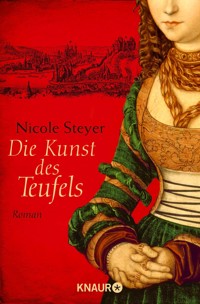9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankfurt im 17. Jahrhundert. Maria Merian ist Malerin, und vor allem Schmetterlinge, die sie liebevoll "Sommervögel" nennt, sind ihre Leidenschaft. Sie beobachtet sie genau, erforscht ihre Verwandlung, zeichnet jedes Detail, auch wenn ihre Familie und ihre Umgebung ihr mit Unverständnis begegnen, denn Schmetterlinge gelten zu ihrer Zeit als Unheilsbringer und Vorboten des Todes. Eines Tages lernt sie auf dem Friedhof den eigenwilligen Totengräber Christian kennen. Die beiden schließen Freundschaft, aus der Liebe wird. Doch Christian hat eine dunkle Vergangenheit, die auch Maria in Lebensgefahr bringt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Nicole Steyer
Der Fluch der Sommervögel
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Frankfurt im 17. Jahrhundert. Maria Merian ist Malerin, und vor allem Schmetterlinge, die sie liebevoll »Sommervögel« nennt, sind ihre Leidenschaft. Sie beobachtet sie genau, erforscht ihre Verwandlung, zeichnet jedes Detail, auch wenn ihre Familie und ihre Umgebung ihr mit Unverständnis begegnen, denn Schmetterlinge gelten zu ihrer Zeit als Unheilsbringer und Vorboten des Todes.
Da lernt sie auf dem Friedhof den eigenwilligen Totengräber Christian kennen. Die beiden schließen Freundschaft, aus der Liebe wird. Doch Christian hat eine dunkle Vergangenheit, die auch Maria in Lebensgefahr bringt …
Inhaltsübersicht
»Bin ich schon nicht mehr da, wird man noch sagen, das ist Merians Tochter.«
Matthäus Merian, der Ältere
Institut für Stadtgeschichte, S8-Stpl/1628, Merian-Stadtplan Frankfurt
Kapitel 1
Frankfurt, 1664
Durch die Bleiglasfenster drang nur wenig Tageslicht in den kleinen Nebenraum der Druckereiwerkstatt, in den sich Maria zurückgezogen hatte. Es war ein kalter und trostloser Apriltag, der mit seinen tiefhängenden Wolken die eng beieinanderliegenden Dächer der Stadt grau und düster aussehen ließ. Anfangs hatten ihre Hände bei der Arbeit gezittert, doch die immer gleichen Handgriffe, die sie mit Sorgfalt und geübter Sicherheit ausübte, vertrieben die Kälte aus ihren Gliedern. Die Werkstatt ihrer Brüder war ein verwunschener Ort, der wie eine eigene Welt wirkte, in der sie das sein konnte, was sie sein wollte. Die Tür zum Nebenraum war nur angelehnt. Die Geräusche der Druckerpresse, das Knarren des Dielenbodens, das vertraute Lachen und die Gespräche der Männer beruhigten sie genauso wie der allgegenwärtige Geruch von Druckerschwärze, Wachs und Holzrauch. Sie schaute auf ihren Kupferstich hinunter. Erst gestern hatte sie die groben Linien mit der Radiernadel übertragen, und jetzt begann sie mit den Feinarbeiten. Liebevoll strich sie mit den Fingern über die Konturen einer Blume, auf der sich ein Sommervogel mit einigen Raupen tummelte. Dieser Sommervogel war einer ihrer Lieblinge gewesen. Sie hatte die winzige Raupe auf der Mauer gefunden, die den kleinen Garten einrahmte, der zum Karmeliterkloster führte. Sie war ihr unbekannt gewesen, was nur noch selten passierte, denn eigentlich kannte sie bereits alle Sommervögel Frankfurts.
Stundenlang hatte sie vor dem Glas gesessen, in dem sie ihn eingeschlossen hatte, und jede noch so unwichtige Kleinigkeit notiert und gemalt. Die Färbung und Größe der Raupe, ihre Art, sich fortzubewegen und zu fressen. Die Puppe dieses Sommervogels hing nach unten. Genau hatte sie beobachtet, wie die kleine Raupe immer mehr in der schützenden Haut verschwunden war, hatte jedes Stadium skizziert, alle Auffälligkeiten notiert. Wie sehr hatte sie sich gefreut, als bereits durch die Puppenhülle die Flügelzeichnung zu erkennen gewesen war. Die unvorstellbare Verwandlung dieser kleinen Wesen, die niemand mochte und die alle für Teufelsgeziefer hielten oder als Butter- und Schmandfliegen beschimpften, faszinierte sie. Für sie waren sie Sommervögel, einzigartige Wesen voller Anmut und Schönheit, denen sie fast jedes ihrer Gemälde widmete.
Knarrend öffnete sich die Tür, und Caspar betrat den Raum.
»Guten Morgen, Maria. Ich habe dich gar nicht kommen sehen.« Er deutete nach draußen. »Bei dem schlechten Licht kannst du doch nicht arbeiten. Du wirst dir die Augen verderben.«
Er trat näher und blickte seiner Halbschwester über die Schulter.
»Ist das der Sommervogel, von dem du mir neulich erzählt hast?«
»Ja, das ist er.« Auf Marias Gesicht breitete sich ein Lächeln aus, und in ihre Augen trat das ganz eigene Strahlen, das sie nur hatte, wenn es um ihre geliebten Sommervögel ging. Caspar musste lächeln. Mit diesem Ausdruck in den Augen hatte das Gesicht seiner Halbschwester eine besondere Ausstrahlung, und sie wirkte fast ein wenig hübsch. Gott hatte Maria so viele wunderbare Talente geschenkt. Sie besaß eine schnelle Auffassungsgabe, war eine talentierte Malerin und beherrschte das Handwerk des Kupferstechens fast besser als er, doch Schönheit hatte er ihr nicht gegeben. Ihre einfachen Gesichtszüge, eine knollige Nase, zu eng beieinanderstehende Augen und runde Pausbacken wurden von glanzlosem braunem Haar eingerahmt, das sie meist zu einem Zopf geflochten trug. Wem genau sie ähnelte, war schwer zu erkennen. Weder das kantige Gesicht des Vaters noch die hohen Wangenknochen der Mutter waren bei ihr zu sehen.
Der Glanz in ihren Augen verschwand so schnell, wie er gekommen war.
»Du hast ja recht, Caspar. Seitdem Abraham in Utrecht ist, fühle ich mich wie ein halber Mensch, und das Atelier des Vaters wirkt ausgestorben und leer. Ich konnte die Stille nicht ertragen, und deshalb bin ich hierhergekommen und mache an der begonnenen Arbeit weiter.« Sie deutete auf die Kupferplatte.
Caspar ging neben ihr in die Hocke und strich sanft über ihre Hände. Er wusste, wie sehr Maria unter dem Weggang Migons litt. Vor zwei Wochen war Abraham nach Utrecht aufgebrochen, um sich dort weiterzubilden. Dies war allerdings nicht der einzige Grund für seinen Aufbruch, das wusste Caspar genau. Maria hatte ihren Lehrer längst überflügelt. Ihre Werke waren bedeutend filigraner, liebevoller gearbeitet und harmonischer. Abraham Migon konnte ihr nichts mehr beibringen und floh vor dem talentierten, oft eigenwilligen Mädchen, das er nicht verstand.
»Ich weiß, du vermisst Abraham. Aber auch er muss seine Fähigkeiten verbessern, und das kann er nicht, wenn er dich unterrichtet.«
Maria strich mit den Fingern über ihren Kupferstich.
»In der letzten Zeit war er sowieso nicht mehr nett zu mir und hat Dinge an meinen Bildern kritisiert, die ihm bisher gut gefallen haben.« Sie sah ihren Bruder nachdenklich an.
»Dinge, die ich genauso machte wie er. Seitdem er fort ist, lässt mich die Mutter kaum noch aus dem Haus. Sie sagt, mein Unterricht wäre beendet und ich sollte mich den Arbeiten zuwenden, die sittsame junge Mädchen machen.«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Doch die Stick- und Näharbeiten sind mir zuwider, und die Küchenarbeit kommt mir wie eine Strafe vor. Bärbel gibt sich die allergrößte Mühe, wir lachen viel. Aber ich fühle mich eingesperrt wie ein Sommervogel im Glas.«
Wieder einmal wusste Caspar keine Antwort. Er griff nach ihrem Grabstichel und drehte ihn in der Hand hin und her. Gott hatte Maria nicht nur bei der Vergabe der Schönheit ein Schnippchen geschlagen, sondern auch beim Geschlecht. Sie würde sich irgendwann fügen müssen, ob sie es wollte oder nicht. Junge Mädchen machten keine Kupferstiche, sammelten keine Raupen und saßen nicht stundenlang in einem Atelier oder über Büchern. Sie versorgten das Haus, kümmerten sich um die Kinder und waren treue Ehefrauen, die ihrem Gatten ein wohliges Heim bereiteten.
Er legte den Grabstichel auf den Tisch, griff nach Marias Hand und versuchte, aufmunternd zu lächeln.
»Komm, ich will dir etwas zeigen.«
Maria ließ sich von ihm mitziehen, hinaus in die Werkstatt, in der schwarzer Rauch unter der dunklen Decke hing und zwei Männer damit beschäftigt waren, Papier auf die Druckerpresse zu legen. Sie durchquerten den Raum und den kleinen Innenhof, der von dem Überbau des Seitenflügels überragt wurde und deshalb düster und unfreundlich wirkte.
Dann betraten sie die Schreibstube des Verlagshauses. Die beiden ausladenden Schreibtische aus schwerem Eichenholz mit messingfarbenen Griffen an den Schubladen füllten den kleinen Raum aus, der von zwei schmalen, bleiverglasten Fenstern nur wenig erhellt wurde.
An den Wänden hingen einige Öllampen, die heute entzündet worden waren. Ihr Licht flackerte im Luftzug und malte Flecken auf den grauen Untergrund.
Caspar führte Maria zu seinem Schreibtisch, klappte zwei aufgeschlagene Bücher zu, davon eines der Wirtschaftsbücher, und legte sie zur Seite. Unter ihnen tauchte seine Zeichenmappe auf, in der er seine Entwürfe aufbewahrte. Er öffnete sie und zog Maria näher heran.
»Ich würde gern deine Meinung hören, Schwesterchen.« Er nahm eines der Bilder heraus.
Maria setzte sich und besah sich das Bild näher. Es war ein Aquarell, das er auf der anderen Seite des Mains gemalt hatte. Fischernetze der Mainfischer waren im Vordergrund zu sehen, dahinter der Fluss mit einigen Booten und Frankfurt, überragt vom Dom. Fasziniert musterte sie die vielen kleinen Details, die ihr Halbbruder festgehalten hatte. Vergissmeinnicht und Löwenzahn blühten auf dem Rasen, welcher die Fischernetze umgab. Der Baum dahinter war umhüllt von rosa Blüten.
Caspar beobachtete seine Halbschwester gespannt, und es gefiel ihm, was er sah. Ihre Augen leuchteten beinahe wie eben, als sie von ihrer Butterfliege gesprochen hatte. Dieser Blick war ihm Lob genug, mehr musste sie nicht sagen.
»Es ist wunderschön«, sagte sie und ließ das Papier sinken. »Wieso hast du mir die Bilder nicht früher gezeigt? Du hast Talent.«
Maria war wirklich überrascht. Natürlich beherrschte Caspar das Zeichnen, Kupferstechen und vieles mehr, sonst wäre er kein Merian. Aber er kümmerte sich in der Regel um das Geschäftliche. Matthäus, sein Bruder, hielt sich für den talentierten Merian.
Caspar spürte, wie ihm die Röte in die Wangen stieg, und blickte zu Boden.
Sie legte das Bild zurück auf den Schreibtisch, griff nach der Mappe, blätterte die Seiten durch und staunte immer mehr. Weitere Landschaften tauchten auf. Der Fluss, weiß überzogen mit Eis, kahle Bäume in grauem Nebel, Spaziergänger flanierten am Ufer entlang, die warme Mäntel trugen. Auf einem anderen Gemälde war ein kleiner Dachgarten zu sehen, wie es in Frankfurt viele gab. Vergissmeinnicht und bunte Stiefmütterchen blühten in Blumenkästen, die vor einem schmiedeeisernen Gitter standen. Eine zierliche weiße Gartenbank lud zwischen den Ästen eines kleinen blühenden Kirschbaumes zum Verweilen ein. Hinter dem Dachgarten erhob sich der mächtige Turm des Doms bedrohlich in den Himmel.
Auf einem weiteren Gemälde spielten ein Knabe und ein Mädchen zwischen den dunklen Mauern einer schmalen Gasse, des Tuchgardens. Die eng beieinanderstehenden und für Frankfurt typischen Häuser, in denen ein Raum ein Stockwerk ausmachte, reihten sich dicht an dicht. Es war seltsam: Die Gasse war voller Leben, Händler verkauften ihre Waren, Frauen hängten ihre Wäsche auf, zwei Kätzchen saßen am unteren Bildrand, doch der Blick des Betrachters richtete sich sofort auf die beiden Kinder, die mit ihrer Lebendigkeit den Mittelpunkt des Gemäldes ausmachten.
»Die Bilder sind hervorragend und wunderschön.« Sie ließ die Mappe auf ihren Schoß sinken und sah ihren Bruder nachdenklich an.
Caspar nickte schweigend. Eine Weile sagte keiner etwas. Die Geräusche der Werkstatt drangen dumpf zu ihnen herüber, irgendwo zwitscherte ein Vogel, das Tropfen des Wassers von der Dachrinne war zu hören. Maria erhob sich und trat ans Fenster, blickte in den finsteren Innenhof und rieb sich fröstelnd über die Arme.
»Warum hast du nie etwas von den Bildern gesagt?«, fragte sie.
Er seufzte hörbar. »Matthäus hätte sie nur belächelt. Er setzt doch alles herab, was ich tue.«
Maria drehte sich um. »Er setzt jeden in seiner Umgebung herab. Du wirst dich doch nicht von der Arroganz deines Bruders, die wir nur zu gut kennen, beeindrucken lassen. In dir steckt mehr als der Verleger, der immer nur auf den Umsatz achtet und über den Büchern sitzt. Du bist ein Merian, vergiss das nicht.«
Ihre Augen funkelten wütend. Sie deutete auf die Mappe. »Diese Bilder sind großartige Meisterwerke, die …«
»Die niemand kaufen wird«, fiel er ihr ins Wort.
Maria schnappte nach Luft. Die Traurigkeit in seinen Worten dämpfte ihre aufflammende Wut.
Matthäus hatte kein Recht dazu, seinen Bruder schlecht zu behandeln. Caspar litt darunter, vergrub sich immer mehr und konnte nicht das sein, was er wollte. Er war ein Künstler, der, wie sie alle, das Talent des Vaters in sich trug, doch er versteckte sich hinter der Fassade des Kaufmanns, des Verlegers und Druckers.
Sie trat näher heran und strich ihm liebevoll über die Schulter. »Es war lieb von dir, mir die Bilder zu zeigen.«
Er blickte auf und verzog den Mund zu einem Lächeln.
»Ich muss mich bedanken.« Er griff nach ihrer Hand und drückte ihre schmalen Finger. »Dein Urteil bedeutet mir viel.«
Maria errötete und winkte ab. »Ich bin nicht weit genug, Bilder zu beurteilen. Abraham hätte sicher ein besseres Urteil abgeben können.«
Caspar schüttelte den Kopf. »Nein, das hätte er nicht, denn du bist besser als er, schon seit langer Zeit.«
Maria verließ nachdenklich das Verlagshaus ihrer Brüder. Es hatte zu regnen aufgehört, doch große Pfützen, durch die Fuhrwerke fuhren und Kinder hopsten, verwandelten die gepflasterten Straßen in feuchte, glitschige Rutschbahnen, auf denen sie achtgeben musste, wo sie hintrat.
Es war bereits später Nachmittag, und eigentlich hätte sie nach Hause gehen sollen, doch ihr Weg führte sie nicht in die heimische Kruggasse. Sie schlüpfte stattdessen durch die Katharinenpforte, um über die Buchgasse in die Alte Mainzergasse zu gelangen, in der sie früher mit ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung neben dem Karmeliterkloster gewohnt hatte. Sie war noch sehr klein gewesen, als die Mutter Jacob Marrell geheiratet hatte, aber die Erinnerungen an diese Gasse waren geblieben, und die vertraute Umgebung gab ihr ein Gefühl von Sicherheit.
Die Erker und vorgeschobenen Winkel der Häuser überragten die Gasse, und verschlossene Tore und Hinterhöfe wechselten sich mit Ladengeschäften und Handwerksbetrieben ab. Auch heute erschwerten umherstehende Regentonnen und dicke Fässer das Durchkommen. In der Mitte der Straße war das kleine Abwasserrinnsal angeschwollen und wirkte wie ein Bachlauf, auf dem einige Kinder begeistert Papierschiffe schwimmen ließen, die sie immer wieder mit hastigen Griffen vor den vorbeifahrenden Fuhrwerken retteten. Lächelnd blieb Maria stehen, beobachtete die Kleinen bei ihrem Spiel und erkannte sich in einem bezopften Mädchen mit nackten Füßen wieder, das vor Freude laut quietschend durchs Wasser hüpfte.
»Sie erinnert mich an dich, Maria«, drang die Stimme der alten Grete an Marias Ohr.
Maria drehte sich um, und das warme Gefühl in ihrem Bauch verstärkte sich.
Die alte Grete saß wie immer an ihrem Platz und verkaufte frische Kräuter, die sie unten am Fluss und in den umliegenden Gärten sammelte.
»Guten Tag, Grete.« Maria ging auf die Frau zu und ließ den Blick über deren Angebot schweifen. »Gut sehen deine Kräuter aus. Und wie sie duften, wunderbar.«
Grete winkte ab. »Es ist zu feucht. Am Flussufer ist alles matschig, überall steht das Wasser. Viele Kräuter sind faulig oder nicht zu finden. Und bis in den Stadtwald, wo bessere Kräuter wachsen, wollen mich meine alten Beine nicht mehr tragen. Bestimmt machen die Kräuterweiber vor dem Steinernen Haus bessere Geschäfte.« Ihr Blick wurde wehmütig.
Maria nickte verständnisvoll. Sie wusste um die Fehde, die Grete mit den anderen Kräuterfrauen hatte.
»Ach, Kindchen«, lamentierte Grete weiter, »damals, als ich noch die Zügel in der Hand hatte bei den jungen Dingern, die nichts von guten Kräutern verstanden, da war die Welt noch in Ordnung, und jeder Kunde wusste, welch gute Qualität er kaufte. Aber heute« – sie schüttelte den Kopf –, »heute bin ich zu alt und müde. Die Zeiten sind vorbei.« Sie warf Maria einen fragenden Blick zu. »Willst wieder zum alten Valentin, wegen der Bücher, nicht wahr?«
Maria lächelte. »Dir werde ich nie etwas vormachen können, Grete.«
Die Alte grinste verschmitzt. »In diesem Leben nicht mehr, Kindchen.« Sie musterte Maria von oben bis unten. »Bist eine richtige junge Frau geworden, die eigentlich an anderes als an Bücher denken sollte. Was sagt denn die Mutter, wenn du dich immer bei dem alten Valentin in seinem Buchladen herumdrückst?«
»Was soll sie schon sagen«, wich Maria aus.
Ein Fuhrwerk fuhr hinter Maria vorbei, sie sprang zur Seite, um nicht nass gespritzt zu werden, und Grete breitete rasch ein schützendes Tuch über ihre Auslage.
»Die Leute reden über dich, Kindchen. Sind nicht immer gute Dinge, die ich höre.« Grete legte das Tuch wieder zur Seite.
Maria zuckte mit den Schultern. »Die Leute reden immer.«
Gretes Gesichtsausdruck wurde ernst. Die sonst so weichen Züge verhärteten sich.
»Ich rate dir, Kindchen, gib auf dich acht. Hat schon so mancher in diesen Tagen gedacht, er könnte tun und lassen, was er wollte. Besonders wir Frauen müssen vorsichtig sein. In der Stadt sind Leute unterwegs, die alles genau beobachten und nichts Gutes wollen. Du bist anders, was gewiss nicht schlecht ist, aber bedenke, die Köpfe der Menschen sind voller Vorurteil und Dummheit. Freigeister sind nicht überall gern gesehen.«
Maria wusste, wovon Grete sprach, wollte es aber nicht wahrhaben. Sie verschränkte abwehrend die Arme vor der Brust und reckte das Kinn hoch. »Sollen sie doch reden. Ich werde mich nicht ändern.«
»Ich bin nicht diejenige, die dir Böses will, Maria.« Grete warf Maria einen langen Blick zu, in dem Besorgnis stand.
»Du solltest wachsamer sein und nicht mehr so viel allein umherstreifen. Schnell schlägt einfacher Klatsch und Tratsch in ganz andere Dinge um. Ich meine es nur gut mit dir.«
Maria blickte die Gasse hinunter. An diesem regengrauen Tag wirkten die Fassaden der Häuser wenig einladend. Tief hingen die Wolken, und dämmriges Licht kündete den herannahenden Abend an.
»Ich muss weiter, Grete, sonst wird es zu spät.«
Grete nickte. Eine Reaktion auf ihre Worte hatte sie nicht erwartet. Maria würde sich nicht ändern, das wusste sie.
Wie immer erklang die kleine Glocke, die über der Tür hing, als Maria Valentins Buchladen betrat. Staubige Luft, erfüllt mit dem Aroma von Pfeifentabak, schlug ihr entgegen. Sie atmete den vertrauten Geruch tief ein und blickte sich versonnen um. Die Wände waren mit Regalen gesäumt, in denen dicke und dünne, in Leinen gefasste, prachtvoll gebundene und teilweise aufwendig verzierte Bücher auf einen Käufer warteten. Auf kleinen Tischen und Bänken, die zwischen zwei gemütlichen, mit grünem Stoff bezogenen Lehnstühlen standen, stapelten sich ebenfalls Bücher, Schriften und Zeitungen. Selbst auf dem Fußboden, neben dem bleiverglasten Fenster, lag der geliebte Lesestoff hoch aufgetürmt und ließ Marias Puls schneller schlagen. Wenn die Gasse dort draußen schon heimatliche Gefühle in ihr geweckt hatte, dann tat es dieser Raum noch viel mehr. Hier konnte sie stundenlang einfach nur sitzen, die vielen Bücher ansehen, ihren Blick über die Regale gleiten lassen und den Zauber in sich aufsaugen, der von dem geschriebenen Wort ausging.
Auf der rechten Seite des schmalen Ladengeschäfts lag ein Erker, in dem ein klobiger dunkel gebeizter Schreibtisch mit einem silberfarbenen Kerzenständer stand. Die brennenden Kerzen malten Schatten und goldenes Licht auf die Wände und Regale. Auf dem Schreibtisch stapelten sich ebenfalls Bücher, zwischen denen kreuz und quer Schriftrollen lagen. Von Valentin war außer einer kleinen Rauchwolke, die hinter der Büchermauer aufstieg, nichts zu erkennen.
Maria trat näher heran, räusperte sich und begrüßte den Buchhändler.
Der Kopf von Valentin tauchte aus der Versenkung auf, und sein Mund verzog sich zu einem Grinsen. »Guten Tag, Maria. Ich habe dich schon erwartet, denn ich habe etwas für dich, was dich bestimmt interessiert.« Er trat hinter seinem Schreibtisch hervor und lief geschäftig an Maria vorbei. Sie folgte dem alten Mann in den hinteren Teil des Ladens, wo er eifrig damit begann, einen der Bücherstapel auseinanderzunehmen.
»Hier irgendwo muss ich es hingelegt haben«, murmelte er, während Maria geduldig wartete. Sie kannte die schrullige Art Valentins und wusste, wie sehr er Hast und Eile verabscheute. Valentin und seinen Buchladen gab es schon, seit sie denken konnte. Der Buchhändler war in die Jahre gekommen, und seine dicken grauen Augenbrauen, die er auf lustige Art und Weise auf und ab tanzen lassen konnte, lenkten inzwischen nicht mehr von seinem dünner werdenden Haupthaar ab. Um seinen Mund hatten sich tiefe Falten gegraben.
»Da ist es ja.« Triumphierend zog er ein Buch aus dem Stapel und bedeutete Maria, ihm zu folgen. »Ich habe es von einem Buchhändler erworben, der erst kürzlich aus Amsterdam zurückgekehrt ist.«
Neugierig folgte Maria Valentin ans Fenster. Das Buch, eher ein Büchlein, sehr klein und schmal, war in schwarzes Leinen gebunden. Doch als sie es aufschlug, blickte sie auf Zeichnungen von Butterfliegen, die sie noch nie gesehen hatte. Farbenprächtige Tiere waren zwischen wunderschönen fremdartigen Blumen abgebildet. Hingerissen blätterte sie die Seiten um und vergaß alles um sich herum.
Valentin sah ihr freudig zu. Diese Freude von Maria war ihm die Ausgabe wert gewesen. Fasziniert musterte er sie, wie sie in die Betrachtung des Buches versunken war und ihn und alles um sich herum vergaß.
Die Erinnerung an das kleine fünfjährige Mädchen stieg in ihm auf, das in seinen Laden gekommen war und sich mit großen Augen umgeblickt hatte. Er hatte es hinauswerfen wollen wie all die anderen Bälger auch, die Büchern nichts abgewinnen konnten und liederlich damit umgingen. Doch dann tat dieses Kind etwas, was ihn faszinierte. Es nahm ein Buch von einem der Stapel, setzte sich auf die schmale Fensterbank, öffnete es und blätterte die Seiten vorsichtig mit den Fingerspitzen um. In ihre Augen war genau derselbe Ausdruck getreten wie heute. Leise hatte er sich damals genähert, war neben ihr in die Hocke gegangen und hatte in das Buch geblickt. Es war ein Bildband gewesen, nichts Besonderes, Landschaftsmalereien wechselten sich mit Textpassagen ab, weiß Gott nichts für Kinder. Schweigend hatten sie eine Weile nebeneinandergesessen. Irgendwann hatte sie aufgeblickt und ihn fragend angesehen.
»Kannst du mir daraus vorlesen?«
Diesen Satz würde er den Rest seines Lebens in sich bewahren wie einen Schatz, den man für alles Geld der Welt nicht kaufen konnte.
»Der Händler hat mir erzählt, er hätte es von einem Künstler, der längere Zeit in Südamerika gewesen ist.«
Maria blickte auf, in ihren Augen standen Tränen der Rührung. »Es ist einzigartig. Solche Sommervögel habe ich überhaupt noch nie gesehen. Diese Farben, die Schattierungen der Flügel und langen Fühler, bezaubernd.«
Er lächelte. Sommervögel, da war es wieder, dieses Wort, das er so liebte und das nur sie benutzte. Die Bezeichnung Sommervögel stand für den Respekt, den Maria diesen Tieren entgegenbrachte. Er wusste, dass ihr leiblicher Vater diese Tiere so genannt hatte. Der wunderbare und begnadete Künstler, von dem sie sich viel zu früh verabschieden musste, der ihr aber sein größtes Gut hinterlassen hatte: sein Talent.
»Ich schenke es dir«, sagte er und strich liebevoll über ihren Arm.
Jetzt rannen die Tränen über ihre Wangen.
Er griff nach dem Buch, zog ein Taschentuch aus seiner Hose und reichte es ihr. »Wir wollen es doch nicht beschmutzen.«
Maria tupfte die Tränen ab. »Nein, das wollen wir nicht.«
Er gab ihr das Buch zurück und blickte nach draußen. Die Dämmerung war hereingebrochen, und die gegenüberliegenden Häuser waren im Nebel dieses feuchten Frühlingsabends nur noch schemenhaft zu erkennen.
»Langsam wird es Zeit, nach Hause zu gehen, mein Kind.«
Maria nickte, der Glanz in ihren Augen verschwand, und sie schaute sich wehmütig um. Sie war jetzt siebzehn Jahre alt. So viele Jahre hatte sie schon in diesem Buchladen verbracht, der ihr zur zweiten Heimat geworden war.
»Am liebsten würde ich für immer hierbleiben. Seitdem Abraham fort ist, ist es zu Hause unerträglich geworden. Die Mutter gängelt mich und lässt mich kaum noch aus dem Haus. Wenn es Bärbel nicht gäbe, dann würde ich nur noch in der Küche oder der Stube sitzen und Haus- und Stickarbeiten erledigen.«
Valentin nickte seufzend. Das Atelier war Marias Zufluchtsort, der Malunterricht bei Abraham Migon war vom Vater angeordnet gewesen, dagegen hatte sich Johanna nicht wehren können. Sie hatte zusehen müssen, wie ihre Tochter ihren Willen bekam und anders wurde als die anderen Mädchen. Doch war sie nicht schon immer anders gewesen? Das seltsame Kind, die außergewöhnliche junge Frau, die sich nicht anpassen wollte. Dagegen halfen keine Verbote. Maria war eine Merian, durch und durch ihr Vater, mehr noch als ihre Brüder. Johanna würde ihre Tochter niemals verstehen, dafür war sie nicht geschaffen.
Er versuchte, Maria aufzuheitern. »Ich habe da noch etwas, was dich interessieren könnte.«
Er trat hinter seinen Schreibtisch, wühlte in den Schubladen herum, murmelte etwas Unverständliches und schob die Papierstapel von links nach rechts. In einer der Laden fand er schließlich, wonach er gesucht hatte.
Er hielt Maria ein unbedeutendes kleines Heft hin.
»Es ist ein kleiner Lehrgang der lateinischen Sprache, nichts Besonderes, aber praktisch. Es enthält die wichtigsten Wörter und grammatikalischen Grundlagen.«
In Marias Gesicht kehrte sofort das Lächeln zurück.
»Ach, Valentin, was würde ich nur ohne dich tun.« Überschwenglich fiel sie ihm um den Hals und drückte ihn fest an sich.
Liebevoll strich er mit der Hand über ihren Rücken, in den Augen Tränen der Rührung.
Sie löste sich aus der Umarmung, nahm das Heft an sich, schob es in ihre Rocktasche und begann, sich übermütig im Kreis zu drehen.
»Wenn ich erst Latein kann, dann kann ich all die Bücher endlich lesen.«
Lachend fing Valentin einen Kerzenständer auf, den Maria vom Tisch gefegt hatte. »Wie gern hätte ich Zeit, um es dir beizubringen.«
Maria griff nach seinen Händen und drückte sie liebevoll.
»Du hilfst mir schon so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles vergelten soll.«
Er grinste verschmitzt. »Ich hätte da schon ein Anliegen.« Er griff nach einer Papierrolle, die ganz oben auf seinem Schreibtisch lag. »Könntest du mir von diesem Gemälde einen Nachdruck anfertigen? Es ist beschädigt. Ich hätte es gern für meine Sammlung. Sieh doch, jemand hat eine Flüssigkeit darübergegossen, und die Farben sind verdorben.«
Maria nahm die Papierrolle an sich.
»Aber gern. Gleich morgen gehe ich zu Caspar in die Werkstatt und beginne mit den Arbeiten daran.«
Der neue Morgen zog herauf, tauchte den dunklen Himmel in gräuliches Licht, ließ die Sterne verblassen und den Horizont rötlich schimmern. Maria saß, in eine Decke gehüllt, auf dem winzigen Balkon, der zu ihrem Zimmer gehörte, und beobachtete das Schauspiel, das ihr der anbrechende Tag bot. Um sie herum standen Blumenvasen und -töpfe voller Pflanzen, dazwischen zahlreiche Schachteln und Einmachgläser. In den meisten Gläsern war es ruhig, doch in einem flatterte ein Nachtfalter unruhig herum. Seine Flügel stießen gegen die glatten Wände, an denen er keinen Halt fand.
Maria hob das Glas in die Höhe und betrachtete das schlichte, graue Tier nachdenklich. Es war nicht hübsch, trotzdem faszinierte es sie. Der Nachtfalter war nicht wie die anderen Sommervögel, die mit ihrer Schönheit protzten und durch die Sonnenstrahlen tanzten. Er war unansehnlich und suchte in der Dunkelheit das Licht der Laternen, nur um tagsüber vor der Sonne zu fliehen. War er etwa ein Geschöpf des Teufels, der Finsternis, die dunkle Seite der Sommervögel, vor der es sich zu fürchten galt?
Maria schaute in den winzigen noch dämmrigen Innenhof hinunter. Plötzlich fiel ihr das diffuse Licht auf, das allem ein einzigartiges Leuchten gab. Das besondere Licht des Morgens, die ersten Sonnenstrahlen, wie sie den Horizont eroberten. Begeisterung ergriff von ihr Besitz und beflügelte ihre Sinne, vertrieb die Müdigkeit. Sie stand auf, streckte sich und genoss den kühlen Hauch des Morgens, wie er ihre nackten Beine hinaufkroch und eine Gänsehaut auf ihre Schenkel zauberte. Sie ließ den Blick über ihre Schächtelchen und Gläser schweifen, in denen schlafende Raupen und Sommervögel ruhten, und blieb erneut bei dem Glas des Nachtfalters hängen. Sie hob es hoch und klopfte mit dem Finger dagegen.
»Na, kleiner Mann, langsam wird es Zeit, Abschied zu nehmen.«
Sie öffnete den Deckel des Glases. Der Falter flog heraus, wirbelte durch die Luft und verschwand in seine verdiente Freiheit.
Maria schaute ihm nach, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte, trat zurück in ihre Kammer, kleidete sich an und verließ wenig später mit ihrer Zeichenmappe unter dem Arm das Haus.
Die Gasse lag inzwischen im sanften Licht des frühen Morgens, und die Dunkelheit hatte sich in die Ecken verzogen. Nur das Zwitschern der Vögel durchbrach die Stille. Am Ende der Gasse blieb Maria vor dem Ladengeschäft des Schusters stehen und ließ ihren Blick über seine Auslage schweifen. Feine Lederschuhe mit Absätzen teilten sich den Platz mit prachtvollen, mit Schnallen und Schleifen verzierten Schuhen, die viel zu schade zum Tragen waren. Immer wenn sie hier vorbeilief, blickte sie auf ihr eigenes schäbiges Schuhwerk hinab. Ihre einfachen Lederschuhe waren abgerieben, bereits mehrfach geflickt, bequem, aber nicht wasserdicht, was ihr regelmäßig feuchte Strümpfe bescherte. Sie ging die menschenleere Schnurgasse hinunter. Tagsüber schnurrten hier die Webstühle, Frauen liefen mit Tüchern und Teppichen hin und her, und zwischen den vielen Werkstätten hatten sich Schneidereien und Händler florierende Läden geschaffen. Ein Stück weiter bog Maria in die Graubengasse ab und tauchte in die Welt der Schreiner und Küfer ein, die hier ihr Handwerk betrieben. Zwischen den Häusern lag der Geruch von Sägemehl und Holz. Das Gackern von Hühnern drang aus einem Hinterhof, und zwei Ratten flohen quietschend in ein winziges Loch unter einer Mauer.
Maria ließ die Gasse schnell hinter sich, und als würde sie eine magische Hand durch das Wirrwarr der Gassen geleiten, lief sie zu dem Ort, den sie so sehr liebte und an dem sie Zuflucht fand, wenn sie die Enge der Gassen nicht mehr aushalten konnte oder sich wie heute in ein Abenteuer stürzte und all die Ermahnungen der Mutter und die sorgenvollen Worte von Bärbel vergaß. Jetzt zählte nur noch dieser besondere Moment, das Licht des Morgens einzufangen. Tief durchatmend öffnete sie das schmiedeeiserne Tor des Peterskirchhofs und betrat den stillen Friedhof. Das dämmrige Grau war inzwischen dem hellen Licht eines strahlenden Frühlingsmorgens gewichen, der im Osten von einem goldenen Himmel angekündigt wurde.
Die besondere Aura des Ortes hüllte sie ein, während sie langsam durch das hohe Gras lief und ihren Blick über die Grabsteine und -kreuze schweifen ließ. Wie immer schlug sie den Weg zur Totenkapelle ein, von der man über die Bleichwiesen bis zum Eschenheimer Turm schauen konnte. Mahnend blickte Jesus Christus, flankiert von zwei steinernen Frauen, auf sie herab, als sie an ihm vorüberging. Vor dem Denkmal wucherte Gras, und der Sockel, aus Sandstein gefertigt, verwitterte bereits wie so manch anderer Grabstein auch. Neben der winzigen Totenkapelle, die sich zwischen Weidenbäume und Büsche duckte, lag das Grab ihres Vaters, umrandet von Buschwerk und Grün. Er ruhte hier mit seiner ersten Frau, der Mutter von Caspar und Matthäus, die eine herzliche und gottesfürchtige Frau gewesen war. Maria setzte sich auf eine kleine Steinbank neben das Grab und atmete die Gerüche der Blumen und der feuchten Erde tief ein. Das Licht der aufgehenden Sonne schimmerte durch die Weidenzweige und malte tanzende Kreise auf den moosigen Untergrund, auf dem Leberblümchen, Hahnenfuß und Wiesenschaumkraut wuchsen. Nachdenklich blickte Maria auf das Grab ihres Vaters hinab und fragte sich, warum sie so oft zur Ruhestätte eines Menschen ging, von dem ihr kaum Erinnerungen geblieben waren. Doch die kurze Zeit, die er bei ihr gewesen war, hielt den Zauber fest, der ihn zu einem wunderbaren Menschen gemacht hatte.
Der Augenblick, als er sie lächelnd hochgehoben hatte, um sie neben sich auf den Zeichentisch zu setzen, damit er ihr seine Arbeit zeigen konnte. Manchmal glaubte sie, dieser Moment wäre erst gestern gewesen und sie könnte seine warmen Hände noch auf ihren Armen spüren und den Geruch des Schnupftabaks noch immer riechen. Ob er heute stolz auf sie wäre? Sie und die Dinge, die sie tat, akzeptieren würde? Sie wusste es nicht, glaubte aber fest daran, denn er war ein Künstler gewesen, einer der größten Kupferstecher seiner Zeit, ein Mann mit einer anderen Seele. Sie hatte das Gefühl, genau diese Seele in sich zu tragen und damit ein Stück von ihm, das sie festhalten und niemals hergeben wollte.
Sie griff nach ihrer Zeichenmappe, holte Stift und Papier heraus und blickte über die Weidenbäume und Grabsteine bis zum Eschenheimer Turm, der von der Morgensonne angestrahlt wurde. Der Turm wäre ein schönes Motiv, das es einzufangen lohnte, doch etwas anderes zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Zwei Zitronenfalter flatterten an ihr vorüber, wirbelten durch die Luft, als würden sie miteinander spielen. Fasziniert beobachtete sie die beiden Sommervögel. Von ihrer Sorte flogen Hunderte durch Frankfurts Gärten und Gassen. Doch heute, in diesem Licht, das den Bäumen, Grabsteinen, Gräsern und Blumen einen ganz eigenen Charakter verlieh, schienen ihre gelben Flügel zu funkeln, und ihr Spiel hatte etwas Elfenhaftes an sich. Schnell griff Maria nach ihrem Zeichenblock, beobachtete die beiden und hielt mit gekonnten Strichen die Konturen der Flügel und des Körpers fest. Das Licht und die Umgebung nahmen sie gefangen, und sie fühlte sich, als würde sie mit ihnen herumflattern, ihre Welt kennenlernen und ein Teil davon werden. Immer schneller flog der Zeichenstift über das Papier, auf dem sie Blumen und Bäume einfing, Licht und Schatten festhielt, die die gelben Falter einrahmten.
Doch dann holten laute Hammerschläge sie in die Wirklichkeit zurück, und sie schaute irritiert auf. Die Sommervögel flatterten über die Totenkapelle davon. Erneut ertönten die lauten Schläge, gingen ihr durch Mark und Bein. Sie packte ihre Malutensilien ein und folgte dem Geräusch. Neben einem wackeligen Schuppen, der sich an die hintere Wand des Pfarrhauses lehnte, wurde sie fündig. Ein junger Mann, kaum älter als sie selbst, bearbeitete mit Meißel und Hammer einen Grabstein. Neugierig trat sie näher. Er trug einen schäbigen Filzhut und ein einfaches Leinenhemd, das er in braune, dreckige Hosen gesteckt hatte. Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen. Konzentriert beugte er sich über den Stein und wischte den Staub fort, um sein Werk besser betrachten zu können.
Maria blieb unsicher stehen. Sie hatte gesehen, wer den Lärm verursachte, also konnte sie wieder gehen. Aber ihre Neugierde hielt sie zurück, und sie beobachtete den Mann eine Weile dabei, wie er in seiner Tasche kramte, kleineres Werkzeug hervorholte und vorsichtig begann, sein Werk zu verfeinern. Irgendwann richtete er sich auf und blickte prüfend auf den roten Sandstein hinab.
»Möchtest du sehen, was es geworden ist?«, fragte er in die Stille.
Maria zuckte zusammen. Meinte er sie?
Er drehte sich, ein Grinsen auf dem Gesicht, um.
Maria wich zurück.
Er hob beschwichtigend die Hände. »Ich habe dich vorhin kommen sehen, kleine Merian.«
Erstaunt sah sie ihn an. »Woher weißt du …«
Er fiel ihr ins Wort. »Wer kennt dich nicht? Die Tochter des berühmten Matthäus Merian.«
Maria legte den Kopf schräg und musterte ihr Gegenüber genauer. Unter dem Filzhut blickten große braune Augen hervor, in denen goldfarbene Funken schimmerten. Ein spitzbübischer Ausdruck lag in ihnen. Seine Haut war wettergegerbt, und eine große, breite Nase dominierte sein kantiges Gesicht, was ihn wenig ansehnlich machte. Doch es lag etwas in seinen Zügen, eine Art von Eleganz, die ihn anziehend machte.
»Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
Sie versuchte, ihrer Stimme einen forschen Klang zu geben, denn er hatte sie heimlich beobachtet, was ihr missfiel.
»Willst du nicht erst einmal sehen, was ich gemacht habe?«
Er streckte ihr auffordernd die Hand hin.
Maria schnappte nach Luft. So ein unhöflicher Mensch war ihr noch nie untergekommen, trotzdem trat sie neugierig näher. Auf dem nackten Stein reihten sich drei Butterfliegen aneinander. Die Tiere waren filigran gearbeitet. Die Fühler, die Flügel, die Beinchen sahen aus, als würden sie gleich zum Leben erwachen. Fasziniert strich sie mit den Fingern über den Stein und fuhr die Konturen nach.
»Sie sind wunderschön«, flüsterte sie ehrfürchtig.
Der junge Mann lächelte. »Butterfliegen sind etwas Einzigartiges, nicht wahr?«
Der Stein fühlte sich unter Marias Hand rauh, aber nicht kalt an. »Warum machst du sie auf einen Grabstein?«
Er fing ihren Blick auf. »Kennst du die Antwort nicht selbst?«
Maria schüttelte den Kopf und ließ die Hände sinken.
Er lächelte nachsichtig. »Sie sind ein Sinnbild der befreiten Seele, der Unsterblichkeit. Sie gleichen mit ihrer Verwandlung der sterblichen Seele, die die Hülle des Menschen verlässt.« Er wischte sich die Hand an seiner Hose ab und streckte sie ihr entgegen. »Ich heiße Christian. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, kleine Merian.«
Maria ergriff seine Hand. Ihre Neugierde war Interesse gewichen. Dieser Mann schien zu verstehen, warum sie herausfinden wollte, wer diese Tiere waren. Schweigend standen sich die beiden eine Weile gegenüber und hielten sich an den Händen.
Irgendwann unterbrach lautes Schimpfen die Stille und holte sie in die Wirklichkeit zurück.
»Ihr dummen Hühner, wollt ihr wohl herkommen?« Die Stimme einer Magd war zu hören.
Maria ließ Christians Hand los. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie leise. »Ich sollte gar nicht hier sein.«
Er deutete auf ihre Zeichenmappe. »Kommst du wieder und zeigst mir, was du gezeichnet hast?«
In Marias Magen breitete sich ein warmes Gefühl aus, und sie nickte lächelnd. »Gern komme ich wieder.«
»Vielleicht heute Abend schon?«, fragte er.
Erstaunt sah sie ihn an, nickte aber. »Ja, vielleicht heute Abend schon.«
Kapitel 2
Maria trat auf den Flur und blickte in das muffige, wenig einladende Treppenhaus. Ihr Zimmer lag außerhalb der Wohnung, direkt gegenüber der Stiege, die in den finsteren Hinterhof führte. Hier bewohnte auch Elisabeth, das größte Tratschweib der Gasse, ein winziges Zimmer, das ihr Hannes Kohlmeier, der ein gutes Herz hatte, für wenig Geld vermietete. Die winzige Kammer grenzte direkt an die Neugasse und hatte zwei Ausgänge, einen zum Treppenhaus und einen auf die Gasse. So war Elisabeth immer über alle Vorgänge informiert, und es war nicht einfach, etwas vor ihren neugierigen Blicken zu verbergen. Die ältere Frau schlug sich als Mädchen für alles durch. Sie war Kinder- und Putzfrau, verkaufte aber auch Kräuter oder Obst auf dem Markt. Jacob Marrell, ihr Stiefvater, ließ von ihr sein Atelier reinigen. Maria konnte Elisabeth nicht leiden, und ihr Mitleid über deren frühe Witwenschaft, von der Elisabeth oft theatralisch erzählte, hielt sich in Grenzen. Auch andere Frauen hatten ihre Männer verloren, zogen ihre Kinder allein groß oder heirateten erneut, ohne dauerndes Klagen und Jammern.
Auch heute öffnete sich knarrend Elisabeths Tür, und sie steckte neugierig ihren Kopf heraus.
»Guten Morgen, Maria«, grüßte sie spitz, die Augenbrauen nach oben gezogen. Maria kam sich ertappt vor und zuckte zusammen. Erst vor einer halben Stunde war sie in ihre Kammer geschlüpft, noch immer berauscht von den vielen Eindrücken auf dem Friedhof und dem Zusammentreffen mit Christian, den sie unbedingt wiedersehen wollte.
»Du siehst müde aus, Kindchen. Was kein Wunder ist, wenn man sich zu so früher Stunde in den Gassen herumtreibt.«
Maria verdrehte die Augen. Natürlich hatte die Alte ihr morgendliches Weggehen bemerkt.
»Steck deine Nase in deine eigenen Angelegenheiten, Elisabeth.« Maria drehte sich um.
Bärbel stand plötzlich wie aus dem Nichts neben ihr am Treppengeländer. Elisabeth sah die Magd wütend an. In der Gasse wusste jeder, wie sehr sich die beiden älteren Frauen hassten.
»Also, ich würde mich was schämen, wenn sich meine Tochter allein in den Gassen herumtreiben würde. Über den Raupendreck will ich gar nicht erst reden. Den Teufel persönlich wird sie uns ins Haus holen.«
Bärbels Augen begannen, vor Wut zu funkeln. Maria legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm. Ein lautes Streitgespräch der beiden war das Letzte, was sie jetzt wollte. Die Mutter würde sowieso beim Kirchgang von ihrem Fortgehen erfahren. Streit musste es nicht auch noch geben.
»Lass es sein, Bärbel, bitte.«
Die Magd warf Maria einen kurzen Blick zu, atmete tief durch und tätschelte ihre Hand. »Hast ja recht, Kindchen. Sie ist es nicht wert. Soll sie doch tratschen.« Die letzten Worte hatte Bärbel etwas lauter gesprochen, und das wütende Schnauben Elisabeths war deutlich zu hören, danach fiel ihre Tür laut ins Schloss. Die beiden Frauen wandten sich ab, und Maria öffnete die Tür zum Rest der Wohnung, in der die Mutter mit dem Morgenmahl wartete.
Verwundert bemerkte Maria wenig später, als sie auf dem Weg zur Kirche waren, die Ablehnung, die die anderen Mägde Bärbel heute entgegenbrachten. Viele grüßten sie nur kurz, andere gar nicht. Bärbel versuchte, die Zurückweisungen der anderen Frauen zu ignorieren, was ihr jedoch nicht gelang. Maria beobachtete die Magd nachdenklich von der Seite. Normalerweise gesellte sich Bärbel gern zu den anderen Mägden und tauschte mit ihnen auf dem Weg zur Kirche den neuesten Tratsch aus, doch heute lief sie stumm neben ihr her. So still kannte Maria Bärbel gar nicht. Irgendetwas erzählte sie immer, und wenn sie vom Wetter sprach. Manchmal empfand Maria das Geplapper von Bärbel als ermüdend, aber dieses Schweigen war ungewohnt und machte ihr Angst.
Sie ließ ihren Blick zu den anderen Mägden schweifen, die einer von ihnen zuhörten, die aufgeregt von den Hochzeitsvorbereitungen ihrer Herrin berichtete.
»Warum sind die anderen heute so abweisend zu dir?«, fragte Maria, obwohl sie die Antwort bereits ahnte.
Bärbel wiegelte ab. »Sie machen alle so ein Aufhebens um die Hochzeit. Das interessiert mich sowieso nicht.«
Sie beschleunigte ihre Schritte, und Maria hatte plötzlich Mühe, mit ihr mitzuhalten. »Es ist wegen mir, oder?«
Bärbel drehte sich nicht um. »Es gibt immer einen Grund, Kindchen. Sie sind eben dumm und glauben jeden Klatsch und Tratsch.«
Sie erreichten die Neue Kräme und tauchten in den Strom von weiteren Gläubigen ein, die ebenfalls zur Kirche gingen. Bärbel wurde wieder langsamer, und Maria holte sie ein. Fuhrwerke rumpelten durch die Gasse und drängten die Menschen zur Seite. Kinder liefen an ihnen vorüber, und Blumenmädchen und fahrende Händler mit Bauchläden versuchten, ihre Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Duft von frisch Gebackenem vermischte sich mit dem milden Frühlingswind.
Maria atmete tief durch und genoss es, in dem Chaos zu versinken und ein Teil des Ganzen zu sein. Ihre Mutter war bereits ein ganzes Stück voraus. Sie trug ein schwarzes Leinenkleid, eine passende Haube und ein weinrotes Tuch um die Schultern.
Maria hatte von ihr das braune Haar geerbt, doch weitere Ähnlichkeiten gab es nicht. Johannas Gesicht war schmal, nicht so breit wie das ihrer Tochter. Ihre hohen Wangenknochen verliehen ihr eine eigene Art von Schönheit, die einen Hauch von Überheblichkeit ausstrahlte. Neben der Mutter tippelte lamentierend die alte Elisabeth. Wahrscheinlich wurde die Mutter gerade über das ungebührliche Verhalten ihrer Tochter aufgeklärt und darüber, wie unschicklich es für eine junge Frau sei, morgens allein durch die Gassen zu streifen.
»Jetzt redet Elisabeth der Mutter wieder ein, wie schlecht ich bin und wie schrecklich die Butterfliegen und Raupen sind, die aus dem Haus müssen, damit sie ruhig schlafen kann und der Teufel sie nicht verschlingen kommt.«
Bärbel warf Maria einen kurzen Blick zu. »Viele reden und tuscheln.«
Maria sah Bärbel erstaunt an. Solche Worte war sie von ihr nicht gewohnt.
Die Magd zuckte mit den Schultern. »Sogar ich werde inzwischen gemieden, wie dir schon aufgefallen ist. Auch Constanze, meine liebe Freundin, will nicht mehr so häufig mit mir gesehen werden, denn ihre junge Herrschaft hat ihr den Umgang mit mir verboten.«
Maria sog scharf die Luft ein, und plötzlich wirkte die Straße nicht mehr beruhigend, sondern machte ihr Angst. Doch dann straffte sie die Schultern. »Es wird auch wieder anders werden«, erwiderte sie stur. »Schon immer haben sie geredet, das ist nichts Neues. Du wirst sehen, Bärbel, bald gibt es wieder neue Dinge, die sie beschäftigen.«
Das Portal der Barfüßerkirche kam in Sicht.
Maria ging eiligen Schrittes darauf zu, doch Bärbel hielt sie am Arm zurück und sah sie eindringlich an. »Ich habe immer zu dir gehalten, Kindchen, und das wird sich auch nicht ändern, aber es wird nicht besser werden. Du bist anders und verhältst dich nicht so, wie es verlangt wird. Die Menschen können es nicht verstehen, das musst du begreifen.«
Fluchend wichen einige Gläubige den beiden aus, und ein Mann hob schimpfend die Hand. »Blinde Hühner sind sie, bleiben schwätzend mitten vor dem Portal stehen, elendes Weibsvolk.«
Maria griff nach Bärbels Hand und drückte sie fest. »Solange du mich nicht verlässt, Bärbel. Ohne dich zu sein, das könnte ich nicht ertragen.«
Die Magd grinste, und ein Leuchten trat in ihre Augen, wie es eigentlich nur Mütter hatten, wenn sie ihre Kinder ansahen. Vielleicht war es das, was sie so sehr an Maria band, warum sie ihr alles verzieh und gegen alle Widerstände bei der Familie Marrell und bei dem sturen Mädchen blieb. Ihre Liebe zu einem besonderen Kind, das von seiner leiblichen Mutter gegängelt und verurteilt wurde. Bärbel hatte es schon vor langer Zeit aufgegeben, die Menschen ändern zu wollen. Sie hatte die Welt mit all ihren Fehlern angenommen und wollte sie nicht besser oder anders machen. Jeder sollte auf seine Art glücklich werden, und wenn Maria ihr Glück im Beobachten von Butterfliegen fand, dann war das eben so. Anders sein kam doch keiner Sünde gleich.
Sie legte ihre andere Hand auf die von Maria. »Keine Angst, ich bleibe. Nur manchmal macht mir das Gerede eben Angst.«
Maria dachte an Gretes Worte. »Ich weiß, mir auch.«
Erneut wurden die beiden angerempelt.
»Ihr steht im Weg, seht ihr das denn nicht?«, schimpfte eine Frau, die ein kleines Kind hinter sich herzog und eines auf dem Arm trug.
Die Glocken der Kirche begannen lautstark zu läuten, und Bärbel und Maria betraten das Gotteshaus.
Maria war kein Freund von Kirchen. Der Geruch in diesen Häusern raubte ihr den Atem, und die vielen Gemälde und Ausschmückungen an den Wänden und Decken bedrückten sie. Die Barfüßerkirche, die Hauptkirche der Frankfurter Protestanten, war in den letzten Jahren immer prunkvoller ausgestattet worden. Goldener Stuck prangte neben großen Gemälden an den Wänden. In kleinen Seitennischen luden Altäre zum stillen Gebet ein, auf denen kunstvoll geschmiedete Kerzenständer im bunten Licht schimmerten, das durch die bleiverglasten, farbigen Fenster hereinfiel. Von einer reich mit Blattgold und Stuck verzierten Kanzel herab wurden die Predigten gehalten. Auf dem Altar brannten feinste, aus Bienenwachs gefertigte Kerzen.
Suchend blickte sich Maria nach ihrer Mutter um und entdeckte sie in einer der mittleren Reihen. Als sie sich neben sie setzte, warf Johanna ihrer Tochter einen prüfenden Blick zu und strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Wie du schon wieder aussiehst. Was sollen denn die Leute denken?«
Maria antwortete nicht darauf und deutete ein Schulterzucken an, als sie das Grinsen auf Bärbels Gesicht bemerkte.
Um sie herum saßen alle Bewohner der Kruggasse, die eine eingeschworene Gemeinschaft waren und nach außen hin fest zusammenhielten. Doch Maria hatte schon längst begriffen, wie häufig Neid und Missgunst im Vordergrund standen. Nicht jeder war dem anderen wohlgesinnt, auch wenn er in derselben Gasse wohnte.
Neben ihnen saß der Schuster Justus Oberbinder, der ein liebevoller und warmherziger Mann und Vater war. Seine Frau Sieglinde war guter Hoffnung. Allzu lang konnte es bis zur Niederkunft nicht mehr dauern, denn ihr Leib wirkte schon sehr aufgebläht, und sie watschelte einer Ente gleich durch die Gegend, die anderen beiden Kinder stets hinter sich herziehend. Neben dem Schusterladen war in der Gasse eine Schreinerwerkstatt. Schwere Bretter, Holzreste und Sägeblätter stapelten sich auf dem Hof neben einer großen Eiche, an der ein kleiner Schuppen lehnte, der so aussah, als würde er beim kleinsten Windhauch in sich zusammenfallen. Der Schreinermeister Friedrich Gauber war ein korpulenter Mann, der seine Gesellen, genauso wie seine Frau und Kinder, zwei Buben, lauthals durch die Gegend scheuchte und schnell mit Schlägen bei der Hand war. Maria ging dem herrschsüchtigen Mann mit den roten Wangen und kleinen Augen, die unter dicken Brauen hervorstachen, am liebsten aus dem Weg.
Direkt vor ihr saß die Familie des Apothekers Ludwig Kolb, der seinen Laden neben dem Brunnen hatte. Die älteste Tochter, Lisbeth, war in Marias Alter. Früher hatten sie öfter miteinander gespielt und sich in den milden Abendstunden des Sommers, wenn die anderen Bewohner der Gasse bei einem Becher Wein beisammensaßen, mit Puppen die Zeit vertrieben. Wehmütig schaute Maria auf Lisbeths geflochtenen Zopf. Seitdem sich die Freundin verlobt hatte, sahen sie sich kaum noch, und wenn doch, dann sprachen sie nur über Belanglosigkeiten. Bald würde sie fortziehen, Kinder bekommen und die Freundin aus den Jugendtagen vergessen.
Plötzlich schien es, als würde sich alles im Kreis drehen, und die bunten Fenster, die Köpfe der Menschen, die stuckverzierten Mauern verschwammen vor ihren Augen. Das Gerede der Leute schwoll in ihren Ohren zu einem lauten Rauschen an und dröhnte in ihrem Kopf. Am liebsten wäre sie schreiend nach draußen gelaufen, irgendwohin, wo die Sonne schien und die Sommervögel flogen, die frei waren und sie mitnahmen, weit weg von diesem Ort, an dem sie zu ersticken glaubte.
Die Orgel begann zu spielen, und die Gläubigen erhoben sich. Maria hatte Mühe aufzustehen und klammerte sich an der Kirchenbank fest. Sie schüttelte den Kopf, schloss die Augen und öffnete sie wieder. Das Spiel der Orgel schwoll an, wurde immer lauter, nahm die ganze Kirche in Besitz und ließ die Menschen verstummen. Bernhard Waldschmidt, der Pastor, betrat, gefolgt von einem Messdiener, den Altarraum. Er baute sich vor dem Altar auf und legte ein Buch darauf. Er trug eine dunkelbraune Perücke, halblange Locken umrahmten sein fleischiges Gesicht, aus dem eine große, nach vorn breiter werdende Nase ragte. Seine braunen Augen blickten ernst in die Welt und zeichneten, gemeinsam mit den schmalen Lippen, die unter einem Schnauzbart verschwanden, einen unnahbar erscheinenden Mann.
Als die Orgel verstummt war, überlegte Maria, wohin sie später gehen konnte. Die Sonne schien heute so warm vom Himmel, dass es einer Sünde gleichkam, seine Zeit in einem Raum zu verbringen. Sie beobachtete die bunten Flecken auf dem Boden und stellte sich die verschiedenen Farben vor, wie sie tanzend ineinander verschwammen, sich erhoben und durch den Raum flogen, jedem der verbissen dreinblickenden Gläubigen ein Lächeln schenkten, um sie danach hinauszugeleiten in den warmen Frühlingstag, den Gott geschaffen hatte.
Bernhard Waldschmidt stieg auf die Kanzel und begann nach einem kurzen Räuspern mit seiner Predigt, die er sich sorgfältig für den heutigen Sonntag zurechtgelegt hatte.
»Heute möchte ich noch einmal zurückkehren zu der Zauberei und dem Gespensterglauben, der Hexerei und Wahrsagerei, die in dieser Stadt blühen, wie ich es nur selten gesehen habe. Nehmt euch in Acht vor den Greueltaten des Teufels, der euch alle heimsuchen wird. Und auch wenn ihr glaubt, es gäbe keine solchen Sünder in dieser Stadt, so sage ich euch, dass sie unter uns weilen.
Besonders die weltliche Obrigkeit gilt es, dabei ins Gebet zu nehmen. Ihnen ist auferlegt, das Böse zu strafen. Sie sollen es forttreiben, damit sich die Sündigen fürchten. Auch der heilige Paulus spricht über die Aufgabe der Obrigkeit: Sie trage das Schwert nicht umsonst, sondern sei Gottes Dienerin, die jeden rächt, der Böses tut.
Besonders die schwere Sünde der Zauberei und Hexerei muss verfolgt und bestraft werden.
Ich sage euch, selbst Saul war eine ordentliche Obrigkeit, der die Wahrsager, Hexen und Zauberer mit harter Hand aus dem Land vertrieben hat. So sollten wir es auch tun mit den Sündigen, da wir in der Stadt nicht frei sind von solch teuflischen Anhängern.
Gottes Befehl in Exodus zweiundzwanzig Vers neunzehn hat sich an Saul und hiermit auch an die heutige Obrigkeit gerichtet: Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen!«
Maria schaute zu Bärbel. Das Gesicht der Magd, in dem sich tiefe Falten um Augen und Mund gegraben hatten, wirkte wie versteinert. Ihre Hände waren fest ineinander verschlungen, die Knöchel traten weiß hervor. Maria strich behutsam über die verkrampften Hände. Bärbel schaute hoch, und in ihren Augen lag derselbe Ausdruck wie eben in der Gasse.
Christian stand am Fenster und beobachtete die grauen Gewitterwolken, die langsam wichen, um der Sonne Platz zu machen. Ein Regenbogen zog sich über den Himmel, malte seine bunten Farben auf die dunklen Wolken, und der winzige Hinterhof des Hauses, in dem Flieder und Stiefmütterchen blühten, erstrahlte golden im Licht der Nachmittagssonne.
»Ist es endlich vorbei?«, fragte seine Großmutter.
»Ja, das Unwetter ist weitergezogen.«
Er trat vom Fenster weg, und die Düsternis des kleinen Raumes umfing ihn. Morgens war die Kammer, in der seine Großmutter Sara ihr Dasein fristete, von Sonnenlicht erfüllt, warm und freundlich, doch jetzt, am späten Nachmittag, wirkte der winzige Raum, in dem es nur ein Bett, eine Kommode und einen Kleiderständer gab, dunkel und ungemütlich. Kein Bild hing an den grauen Wänden, keine Blumen standen auf dem Nachttisch. Die Großmutter versank in den Kissen, die kleinen Augen umschattet.
»Gehst du jetzt, Jeremia?«
Er setzte sich auf die Bettkante und griff nach ihrer Hand.
»Bitte nenn mich nicht so. Ich heiße Christian.«
Sie lächelte. »Den Namen mag ich nicht.«
Liebevoll strich er über ihre Hand, spürte ihre Knochen unter der ledrigen Haut, die von braunen Flecken übersät war. Bald würde sie nicht mehr hier sein, das fühlte er. Noch vor wenigen Wochen war sie unten im Hof herumgelaufen, hatte Blumen gepflanzt und das Haus versorgt. Dann war sie umgefallen, ohne jede Vorwarnung.
Tara, die Küchenmagd, hatte sie gefunden. Seitdem lag sie hier, konnte sich kaum bewegen, nur noch wenig den Kopf heben. Aus der agilen Frau war ein hilfloser Krüppel geworden.
»Erzählst du mir, wie es im Hof aussieht?«, fragte sie.
»Das geht aber nur, wenn du die Luft draußen auch riechen kannst«, antwortete er, stand auf und öffnete das Fenster. Die vom Regen geschwängerte Luft trug den Geruch des Flieders herein. Sara atmete tief ein und schloss die Augen, während ihr Enkel zu sprechen begann.
»An der Mauer rankt Efeu nach oben, und dazwischen blühen kleine lila Blümchen, die überall aus den Ritzen sprießen wie ein Teppich, der die kahlen Steine bedeckt. Darunter stehen Blumenkästen, bepflanzt mit Stiefmütterchen, deren Blüten lila und gelb gefärbt sind. Seitlich der Sommerlaube blüht der Flieder in schönstem Rosa. Er ist groß, seine Zweige überragen die Mauer, wiegen sich leicht im Wind. Und an der Hauswand hat sich der Rosenbusch bereits in helles Grün gehüllt. Seine dicken Knospen warten darauf, aufzuspringen. Der Leiterwagen steht an seinem Platz in der Ecke, Harke und Spaten darin. Auf der Gartenbank, von der die weiße Farbe abblättert, liegt schlafend unsere Katze Mona, und in den Pfützen, die das Gewitter hinterlassen hat, tummeln sich zwei Spatzen.«
Die Großmutter lächelte. »Ich kann ihn sehen, ganz genau. Es ist alles so, wie es sein muss.« Sie öffnete die Augen. »Nur du bist ein Fremdkörper. Warum verleugnest du dich selbst?«
Er ließ ihre Hand los. Hatte er es doch geahnt. Wieso sollte es auch nur einen Tag geben, an dem sie nicht mit diesem Thema anfing.
»Weil ich es nicht bin – und auch nie sein wollte.«
Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. »Du verleugnest deine Mutter.«
Christian sprang auf. »Nicht ich habe sie verlassen, sondern sie mich.«
Die alte Frau seufzte hörbar. »Sie hat es nicht gewollt.«
Christian erwiderte ihren Blick, und Tränen schimmerten in seinen Augen. »Doch, sie hat es gewollt und hat mich alleingelassen.«
Später am Tag stand Maria auf der Alten Brücke, warf Gänseblümchen in den Main und beobachtete, wie sie durch die Luft wirbelten und im Wasser landeten. Sie hatte einen ganzen Strauß in den Gärten am Ufer gepflückt. Die Wiesen dort waren übersät von den kleinen weißen Blümchen, die niemand zu beachten schien. Um Tulpen wurde so ein Aufhebens gemacht, sie wurden für teuer Geld verkauft, in allen Formen und Farben gezüchtet und in Katalogen festgehalten, doch die Gänseblümchen sah niemand. Sie führten eine Art Schattendasein auf den Wiesen, obwohl sie diese auf ihre ganz eigene Art verzauberten.
Unter der Brücke fuhr ein Schiff hindurch. Einer der Schiffsjungen winkte ihr fröhlich mit seinem Hut zu. Maria winkte lächelnd zurück und ließ alle Gänseblümchen gleichzeitig los, so dass sie auf den Burschen hinabregneten. Eilig lief sie auf die andere Seite der Brücke. Der Schiffsjunge stand immer noch auf seinem Platz und verbeugte sich tief.
»Er sieht glücklich aus, was ich auch wäre, wenn mir eine so hübsche Frau Blumen schenken würde.«
Maria drehte sich um. Christian stand neben ihr und grinste sie an.
Sie errötete. »Es waren doch nur ein paar Gänseblümchen.«
»Die sind mir sowieso die liebsten. Sie mögen nicht so prachtvoll wie Rosen oder Tulpen sein, aber ich finde sie hübsch, und die Wiesen am Flussufer und in den Gärten wären ohne sie leer und trostlos. Der Wirbel, der um die Tulpen gemacht wird, ist mir zuwider. Was hat diese Blume an sich, weshalb sie wertvoller sein soll als all die anderen.«
»Das habe ich mich auch schon gefragt«, erwiderte Maria. »Tulpen musste ich in allen Variationen zeichnen, andere Blumen nur selten und Gänseblümchen niemals.«
»Du musst Tulpen zeichnen? Ich dachte, du malst nur Butterfliegen.«
Maria lächelte nachsichtig. »Mein Stiefvater ist Blumenmaler und fertigt ganze Kataloge an. Er hat mich im Malen unterrichtet, am Anfang habe ich nur Tulpen gezeichnet. Als kleines Mädchen habe ich sogar eine wertvolle Tulpe aus einem der feinen Gärten gestohlen, weil ich sie malen wollte.«
Sie schlenderten Richtung Fahrtor.
»Also bist du nicht nur ein Raupenmädchen, sondern auch eine Diebin.«
Maria warf ihm einen strafenden Blick zu. »Ich bin keine Diebin. Der Mann hat natürlich geschimpft, aber als er sich beruhigt hatte, durfte ich die Tulpe für ihn zeichnen, und alles war wieder gut.«
Christian wich einem Karren aus, auf dem sich Bierfässer in die Höhe stapelten. »Aber das Raupenmädchen bist du.«
Maria blieb stehen. Ungewollt stieg Wut in ihr auf. »Ich kann diese Bezeichnung nicht leiden. Ich mag Sommervögel und zeichne sie gern, mehr nicht.«
Ihre Stimme war laut geworden. Irritiert blickten einige Passanten sie an.
Er hob beruhigend die Hände. »Ich wollte dich nicht beleidigen.«
Der Anflug von Wut verrauchte so schnell, wie er gekommen war. »Die Leute nennen mich so, aber für mich klingt diese Bezeichnung wie ein Schimpfwort.« Sie warf ihm einen Seitenblick zu. »Immer sprechen wir von mir. Du meißelst Sommervögel in Grabsteine, aber was machst du sonst? Ich spaziere mit einem Mann durch die Gassen, den ich kaum kenne, was sich nicht schickt.« Sie grinste.
Er warf ihr einen prüfenden Blick zu. »Willst du mich denn kennenlernen?«
Sie überlegte kurz. »Vielleicht.«
Sie hatten die Mehlwaage erreicht. Mehlsäcke wurden von Karren heruntergewuchtet oder aufgeladen. Neue Fuhrwerke kamen, andere fuhren wieder.
»Soll ich dir meinen Lieblingsplatz zeigen, kleine Merian?«, fragte er plötzlich. »Dort kannst du mich sehr gut kennenlernen.«
Maria sah ihn verwundert an und wurde neugierig. Normalerweise hätte sie sich spätestens jetzt verabschieden sollen, denn ein tugendhaftes Mädchen begleitete einen fremden Mann nicht irgendwohin. Aber es reizte sie zu erfahren, wo dieser wundersame Ort war, also nickte sie.
Sie verließen die Fahrgasse, und wenig später fand sich Maria in der Judengasse wieder. Sie kam nur selten in diesen Teil der Stadt, obwohl es auch hier viele Buchläden gab, neben denen sich Pfandleihen und kleine Läden mit allerlei Krimskrams aneinanderreihten. Bunte Tische, auf denen Kerzenständer, Seifen, Becher und Tücher auf Kundschaft warteten, standen dicht an dicht. Die Läden wirkten unordentlich und ärmlich, und bärtige Männer mit Kappen oder Hüten auf den Köpfen kreuzten ihren Weg. Eine Gruppe Frauen lief schwatzend an ihnen vorüber. Sie stießen eine von ihnen immer wieder in die Seite. Es schien um deren Hochzeit zu gehen, denn das Wort Bräutigam fiel mehrfach. Aus einem Laden rannte ein junger Bursche, verfolgt vom lautstark schimpfenden Inhaber, der den Dieb nach wenigen Metern ziehen ließ. Kleine Kinder starrten Maria neugierig an, und der eine oder andere Bewohner der Gasse nickte Christian zu. Sie registrierte es verwundert. Anscheinend schienen die Leute ihren Begleiter zu kennen.
Christian öffnete ein rot gestrichenes Holztor, von dem die Farbe bereits abblätterte, griff nach Marias Hand und zog sie hinter sich her. Neugierig schaute Maria sich um.
Ein winziger Hinterhof tat sich vor ihr auf, der das Trugbild einer besseren Welt zauberte.
An einer Mauer lehnte eine weiß gestrichene, schiefe Sommerlaube. Daneben blühte rosafarbener Flieder, verschwenderisch schön. Der berauschende Duft der Blüten hüllte sie sofort ein. Blumenkästen standen vor dem Haus, Stiefmütterchen blühten darin. An der Mauer rankte Efeu nach oben, zwischen dem kleine lila Blümchen wuchsen. Auf einem winzigen Stück Rasen neben dem Hauseingang tummelten sich einige Gänseblümchen, über denen sich bald die zauberhaften Blüten der Kletterrose erheben würden, die sich an die Hauswand klammerte.
Maria blieb in der Mitte des Hofes stehen und blickte sich versonnen um. Christian beobachtete sie wortlos. Er hatte diese Reaktion erhofft, obwohl er sich noch immer nicht klar darüber war, weshalb er sie hierhergebracht hatte. Dieser Ort zeigte sein Innerstes wie kein anderer und verriet zu viel über Dinge, die nur er wissen durfte. Maria trat an die Mauer und strich sanft über den Teppich der lilafarbenen Blüten.
»Sind sie nicht wunderschön? Kein Künstler hätte sie besser plazieren oder zeichnen können.«
Er trat neben sie. Jetzt hatte sie genau dasselbe Leuchten in den Augen wie auf dem Friedhof, als sie die Butterfliegen beobachtete. Er war noch nie einem Menschen begegnet, der sich so für etwas begeistern konnte, der ihn so magisch anzog.
Sie sah ihn an. »Warum hast du mich hierhergeführt?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so genau. Vielleicht weil ich mich hier wohl fühle und dir den Hof zeigen wollte.«
Sie schaute zu den Fenstern hinauf. »Wer wohnt hier?«
»Eine alte Freundin von mir.«
Seine Stimme veränderte sich, und Maria glaubte herauszuhören, dass er über die Bewohner des Hauses nicht reden wollte. Doch so schnell ließ sie nicht locker.
»Woher kennst du sie?«
»Ich weiß nicht mehr. Ich kenne sie eben«, antwortete er ausweichend.
»Darf ich sie kennenlernen?«
Sein Blick wanderte zu dem geschlossenen Fenster hinauf, und er sah Saras trostlose Zimmer vor sich.
»Ich weiß nicht. Sie ist sehr krank, schon seit einer Weile.«
Auf Marias Gesicht zeigte sich Bestürzung. »Das tut mir leid. Was hat sie denn?«
Er bückte sich und pflückte eines der Gänseblümchen, plötzlich zitterten seine Hände.
Maria beobachtete ihn. Er hatte recht, dachte sie. Wenn man ihn irgendwo kennenlernen konnte, dann hier.