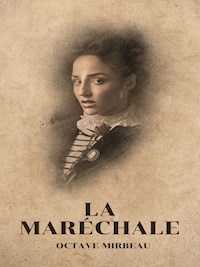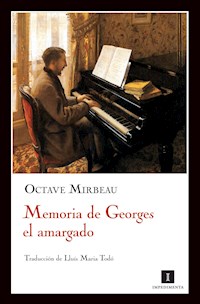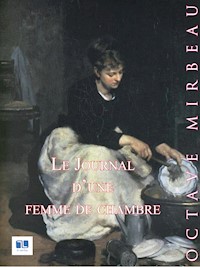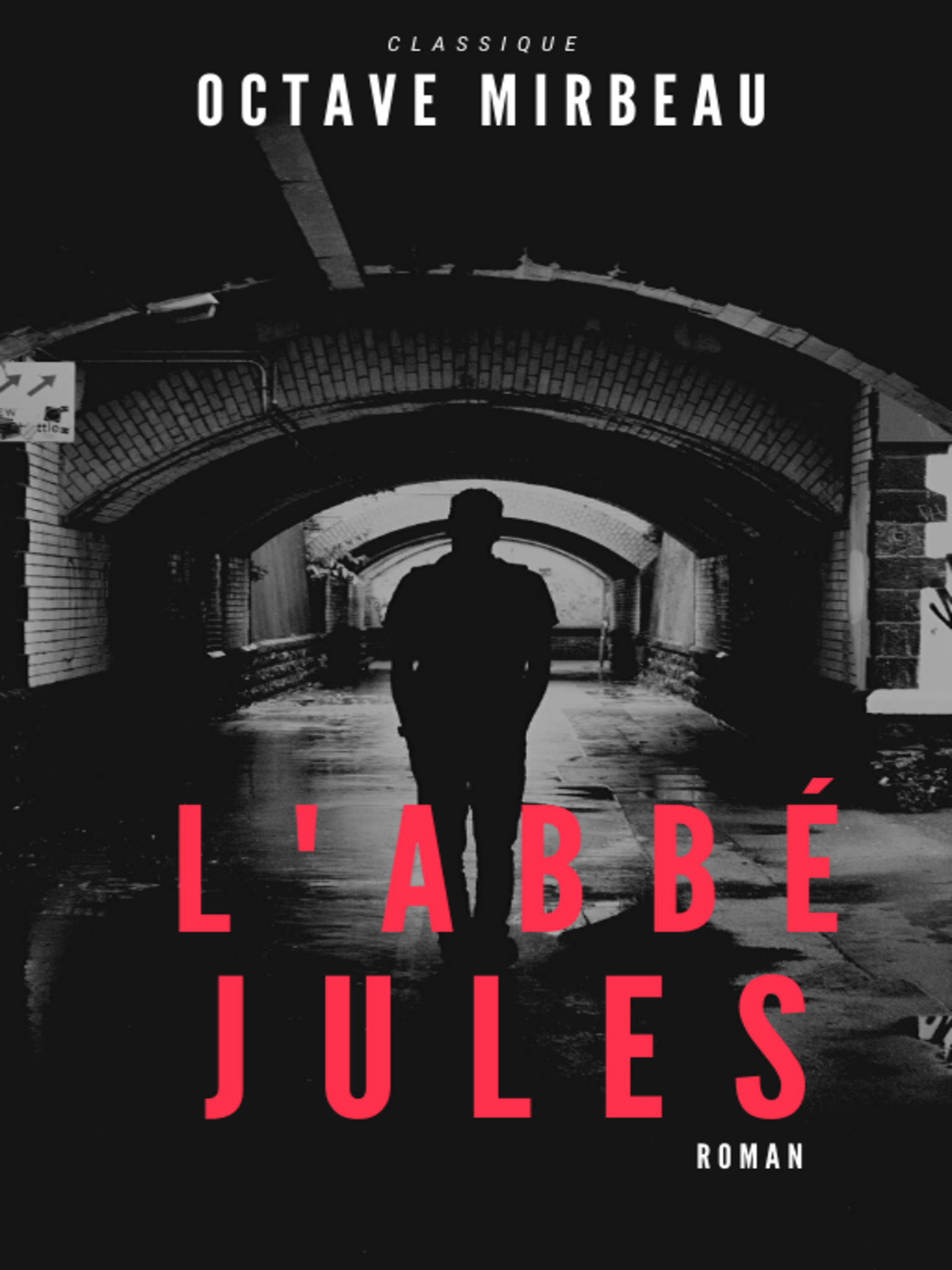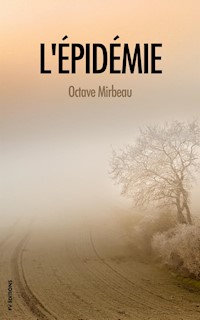1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In "Der Garten der Qualen" entwirft Octave Mirbeau ein fesselndes und provokantes Literarisches Werk, das tief in die Abgründe menschlicher Begierden und moralischen Dilemmas eintaucht. Mit einem einzigartigen Mix aus surrealen Bildern und detaillierten Beschreibungen gelingt es Mirbeau, die Beziehung zwischen Lust und Leiden auf eindringliche Weise darzustellen. Das Buch ist gesellschaftskritisch und entfaltet sich im Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche des späten 19. Jahrhunderts, wo Normen und Tabus auf den Prüfstand gestellt werden. Mirbeaus Stil ist sowohl eindringlich als auch poetisch, wodurch die grausamen und sinnlichen Elemente des Lebens eine verstörende Schönheit entwickeln. Octave Mirbeau, ein bedeutender französischer Schriftsteller und Kritiker, war zeitlebens ein provokativer Denker und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Durch seine eigenen Erfahrungen im Kunst- und Literaturschaffen sowie sein Interesse an den psychologischen Aspekten des menschlichen Verhaltens wurde er zu einem Meister der Erkundung der dunkleren Seiten der menschlichen Natur. Seine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft und deren Konventionen durchdringt seine Werke und verstärkt die Relevanz der Erzählungen auch in der modernen Zeit. "Der Garten der Qualen" ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die komplexen Dynamiken von Lust, Schmerz und der menschlichen Psyche interessieren. Mirbeaus Meisterwerk regt zum Nachdenken über die moralischen Fragestellungen unserer Zeit an und offenbart, wie Zeit und Raum die menschlichen Erfahrungen prägen. Einnehmend und herausfordernd, fordert dieses Buch den Leser auf, die Schattenseiten der menschlichen Existenz zu erforschen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Garten der Qualen: Erotik Klassiker
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Begehren und Grausamkeit verstricken sich in diesem Roman zu einer verstörenden Allegorie über Macht, Körper und Blick. Der Garten der Qualen von Octave Mirbeau, erstmals 1899 in Frankreich erschienen, verbindet erotische Faszination mit fin-de-siècle-Dekadenz und politischer Satire. Das Buch gilt als provokanter Klassiker, der die Grenzen zwischen Lust und Gewalt auslotet. Sein Schauplatz führt von europäischen Gesprächsräumen in eine exotisierte Landschaft Ostasiens, in der sich eine radikale Ästhetik des Schmerzes entfaltet. In diesem Spannungsfeld entwickelt Mirbeau ein Werk, das literarische Konventionen unterläuft und die Leserinnen und Leser in eine moralische Grauzone hineinzieht.
Ausgangspunkt ist die Begegnung eines europäischen Ich-Erzählers mit einer charismatischen, weltgewandten Frau, deren Begehren untrennbar mit der Betrachtung von Gewalt verbunden scheint. Eine Reise in den Fernen Osten eröffnet einen Ort, an dem Strafe als Spektakel inszeniert wird und Natur, Kunst und Körper zu einem unheimlichen Ensemble verschmelzen. Der Ton schwankt zwischen verführerischer Sinnlichkeit und bitterer Ironie; die Stimmung ist zugleich betörend und beunruhigend. Ohne den Fortgang zu verraten, lässt sich sagen: Das Leseerlebnis gleicht einem Gang durch einen duftenden, zugleich giftigen Garten, in dem jede Schönheit eine schmerzliche Kehrseite hat.
Mirbeau erzählt in einer dichten, bildgesättigten Prosa, die zwischen Bekenntnis, Pamphlet und Reisebildern oszilliert. Die Ich-Perspektive erzeugt Nähe und Komplizenschaft, während die reflektierenden Passagen die scheinbar private Obsession mit einer umfassenden Kulturkritik verschränken. Ironie und Übertreibung dienen als stilistische Schneide, mit der Ideologien, Posen und moralische Selbstbilder seziert werden. Der Text setzt stark auf Kontraste: Üppige Beschreibungen von Pflanzen, Farben und Düften stehen ungerührt neben nüchternen, oft schockierenden Beobachtungen menschlicher Gewalt. So entsteht ein Sog, der nicht durch Handlungstempo, sondern durch Intensität, Rhythmus und gedankliche Zuspitzung getragen wird.
Thematisch kreist der Roman um die Verflechtung von Eros und Thanatos, um Voyeurismus, die Ästhetisierung des Leids und die Frage, wie Machtverhältnisse sich in und über Körper einschreiben. Dabei stellt er die beunruhigende Möglichkeit aus, dass moralische Urteile brüchig werden, sobald Gewalt als Kunst, Lehre oder Naturphänomen rationalisiert wird. Für heutige Leserinnen und Leser ist das relevant, weil es einen blinden Fleck moderner Gesellschaften berührt: die Faszination am Spektakel der Zerstörung – privat, medial, politisch. Das Buch lädt dazu ein, die eigenen Blickregime zu hinterfragen und darüber nachzudenken, welche Rolle Lust, Empathie und Abwehr im Angesicht des Schreckens spielen.
Zugleich ist Der Garten der Qualen ein fin-de-siècle-Text, der den europäischen Kolonial- und Wissenshunger entlarvt. Der asiatische Schauplatz erscheint als Projektionsfläche, an der Europa seine Fantasien, Ängste und Herrschaftslogiken spiegelt. Mirbeau nutzt diese exotisierende Optik nicht bloß als Kulisse, sondern als kritisches Instrument: Sie macht sichtbar, wie Gewalt mit Wissenschaft, Verwaltung, Moral und Genuss verknüpft wird. Diese Lesart fordert dazu auf, historische Stereotype zu erkennen und den ethischen Blick zu schärfen. Gerade die unbequeme Mischung aus Anziehung und Abscheu zwingt dazu, Ambivalenzen auszuhalten, statt sie vorschnell aufzulösen.
Formal verschränkt der Roman Elemente der erotischen Literatur mit politischer Satire, Reisebericht und moralisierendem Traktat – ein hybrides Gefüge, das konventionelle Genregrenzen unterläuft. Die wiederkehrenden Gartenmotive strukturieren die Wahrnehmung: Kataloge von Pflanzen, Farben und Texturen bilden ein ästhetisches Gegengewicht zum thematisierten Schmerz. Diese sinnliche Überfülle ist bewusst überfordernd; sie verlangt ein langsames, aufmerksames Lesen. Wer sich darauf einlässt, erlebt eine intensive, mitunter beklemmende Textur, deren Bilder lange nachhallen. Zugleich bleibt der Stil präzise: Die Schärfe der Beobachtung und die kontrollierte Übertreibung verhindern, dass die Opulenz in bloße Dekoration umschlägt.
Für die Gegenwart eröffnet Mirbeaus Buch einen kritischen Resonanzraum: Es verhandelt, wie Zivilisationen ihre Gewalt ästhetisieren, wie Begehren politisch wird und wie Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen Mitgefühl und Distanz pendeln. Ohne den weiteren Verlauf zu verraten, lässt sich sagen, dass der Roman weniger Antworten gibt als Fragen stellt – über Verantwortung, Scham und die Grenzen des Genusses. Wer die Klassiker der Dekadenz erkunden will, findet hier ein Schlüsselwerk, das provoziert und klärt, verstört und erhellt. Der Garten der Qualen bleibt damit nicht nur ein historisches Dokument des fin de siècle, sondern ein Prüfstein unserer eigenen ästhetischen und moralischen Wahrnehmung.
Synopsis
Octave Mirbeaus Roman Der Garten der Qualen verbindet Reisebericht, Satire und fin de siècle Dekadenz zu einer provokanten Erzählung über Macht, Begehren und Gewalt. Ein namenloser Erzähler führt durch eine Folge von Begegnungen und Betrachtungen, die das Verhältnis von Schönheit und Grausamkeit ausloten. Früh wird eine skeptische, politisch ernüchterte Haltung etabliert, aus der der Impuls entsteht, Europa zu verlassen. Statt psychologischer Tiefe einzelner Figuren dominiert ein bewusst komponierter Reigen von Szenen, Dialogen und Beobachtungen. Das Buch inszeniert einen Weg vom gesellschaftlichen Salon in eine exotische Randzone, wo Moralbegriffe ins Wanken geraten und die Grenzen der Zivilisation geprüft werden.
Zu Beginn zeichnet der Erzähler seine Distanz zu parlamentarischen Ritualen, Skandalen und der Selbstgefälligkeit europäischer Eliten. In dieser Atmosphäre der Überdrüssigkeit sucht er das Weite, getrieben von Neugier und Fluchtlust. In England trifft er auf Clara, eine wohlhabende und schillernde Frau, deren kultivierte Kühle und rätselhafte Vorlieben ihn anziehen. Zwischen mondänen Gesprächen und ironischen Seitenblicken auf gute Gesellschaft entsteht eine Spannung, die weniger romantisch als intellektuell elektrisiert. Die Aussicht auf eine Reise in ferne Häfen konkretisiert sich, als beide unabhängig ähnliche Ziele verfolgen. Daraus erwächst eine Zweckgemeinschaft, die sogleich von unausgesprochenen Erwartungen und Rivalitäten geprägt ist.
Auf der Überfahrt in den Osten verdichten sich Gespräche, die die Programmatik des Textes offenlegen. Clara entwirft eine Ästhetik, in der Genuss, Macht und Schmerz verflochten erscheinen, während der Erzähler schwankt zwischen Faszination und Vorbehalten. Beobachtungen an Bord liefern Miniaturen über Kolonialbeamte, Kaufleute und Missionare, deren Selbstbilder unbewusst demontiert werden. Anekdoten, naturkundliche Exkurse und skeptische Aperçus verschieben die Tonlage von leichter Konversation zu moralischer Prüfung. Der wiederkehrende Topos des Gartens fungiert als Verheißung eines Ortes, an dem Regeln anders gelten. So zeichnet sich eine Bewegung ab: vom Oberflächenglanz des Reisens zur Konfrontation mit den verborgenen Motiven des Begehrens.
Die Ankunft in einer Hafenmetropole des Fernen Ostens bringt Kontraste zutage: zwischen westlichen Enklaven, lokalen Märkten und Zonen, die dem europäischen Blick entgleiten. Vermittelt durch Kontakte der Kolonialgesellschaft hören die Reisenden von einem abgeschiedenen Gelände, einem Garten, der an eine Strafstätte grenzt und für ausgewählte Besucher zugänglich ist. Gerüchte um eine Kunst der Züchtigung wecken Neugier, die offizielle Moral übersteigt. Ein Besuch wird arrangiert, begleitet von Dolmetschern und Aufsehern, deren höfliche Distanziertheit die Fremdheit markiert. Der Weg dorthin verläuft durch eine üppige Landschaft, deren Reiz den Eindruck verstärkt, sich einer Bühne zu nähern, auf der die Ordnung der Dinge zur Schau gestellt wird.
Der Eintritt in den Garten offenbart eine sorgfältig komponierte Welt, in der Wege, Teiche und Pavillons eine scheinbar friedliche Szenerie bilden. Ein kundiger Führer erläutert Regeln und Zeremonien, die eine Tradition ästhetischer Strenge mit Exempel und Abschreckung verbinden. Alles ist ritualisiert, als sei die Zeit verlangsamt und der Blick gezwungen, zu verweilen. Die Natur erscheint kultiviert, Düfte und Farben scheinen das Auge zu beruhigen, während die Funktion des Ortes eine gegenteilige Botschaft sendet. Clara zeigt nun unverhohlenen Enthusiasmus für das Gesehene, wo der Erzähler eher tastend registriert. Aus Andeutungen entsteht die Idee einer Kunst des Strafens, die Wirkung und Form vereint.
In weiteren Stationen des Rundgangs vertieft sich der Dialog zwischen Clara, dem Erzähler und den Wärtern des Gartens. Mit Anleihen bei Wissenschaft, Mythologie und Modeideen der Zeit erklärt Clara, dass die Natur angeblich keine Mitleidsethik kenne und Schönheit oft an Grenzerlebnisse gebunden sei. Der Erzähler setzt Einwände, die von humanistischer Korrektur bis zu ironischer Distanz reichen, ohne die Faszination abzustreifen. Zugleich weitet der Text die Perspektive: Die Praxis im Garten spiegelt nicht nur lokale Gebräuche, sondern hält dem Westen sein eigenes Verhältnis zu Gewalt vor. Koloniale Hierarchien, Nutzenkalkül und Bildungsattitüden erscheinen als Varianten derselben Logik der Verwertung.
Psychologisch gerät der Erzähler in ein Feld widersprüchlicher Regungen. Er möchte sich den Reizen des Gartens entziehen und ist doch gebannt von dessen stillgestellter Intensität. Die Beziehung zu Clara verdichtet sich zur Versuchsanordnung: Nähe entsteht durch geteilten Blick, doch gerade darin zeigt sich ihre Differenz. Liebe, Macht und ästhetische Bewunderung verschränken sich zu einer unsicheren Choreografie, in der Wunsch und Abwehr ununterscheidbar werden. Rückblenden, Randbeobachtungen und selbstironische Geständnisse skizzieren, wie leicht das Auge zum Komplizen wird. So wächst die Einsicht, dass Passivität keine Unschuld garantiert und die Haltung des Zuschauers Teil des Geschehens ist.
Ein Wendepunkt ergibt sich, als eine Vorführung die impliziten Grenzen der Besucher berührt. Die ritualisierte Ordnung steigert ihre Wirkung, und eine Szene im Herzen des Gartens macht die philosophischen Debatten existenziell. Clara verfolgt die Abläufe mit souveräner Spannung, während der Erzähler überfordert ist von der Verdichtung aus Form, Macht und Gehorsam. Die Beziehung der beiden kippt in eine neue, riskante Konstellation, die die frühere Leichtigkeit hinter sich lässt. Ohne Einzelheiten auszuführen, lässt sich sagen: Der Garten führt beide an Punkte, an denen Worte nicht mehr genügen und Haltung zur Entscheidung drängt. Die Konsequenzen betreffen Wahrnehmung, Gefühl und Selbstbild.
Im Ausklang rückt die Deutung in den Vordergrund. Der Erzähler erkennt, dass Zivilisation und Gewalt keine Gegensätze sind, sondern sich in Ritualen, Institutionen und ästhetischen Idealen durchdringen. Der Garten bleibt als Metapher zurück: ein Ort, an dem Schönheit Ordnung stiftet und zugleich Grausamkeit verbirgt. Die Kritik an politischer Pose, kolonialer Selbstgewissheit und konsumierbarer Sensation bündelt sich zu einer ernüchternden Einsicht in die Ambivalenz des Begehrens. Ohne finale Auflösung belässt der Text seine Figuren in einem Schwebezustand, der den Leser zur eigenen Stellungnahme auffordert. So vermittelt das Buch seine zentrale Botschaft: das Unbehagen an einer Kultur, die ihre Schatten bewundert.
Historischer Kontext
Mirbeaus Der Garten der Qualen ist in der Spe4tzeit des Kaiserreichs der Qing und im europe4ischen Fin de Sie8cle verortet. Die erze4hlte Zeit le4sst sich auf die 1890er Jahre eingrenzen, wenn sich der Erze4hler aus dem politischen Morast der Dritten Franzf6sischen Republik lf6st und per Dampfschiff, fcber den 1869 erf6ffneten Suezkanal und Ceylon, in Richtung China aufbricht. Das Ziel ist der sfcdchinesische Raum um Kanton (Guangzhou) und das benachbarte, seit 1842 britische Hongkong, also ein Geflecht aus Vertragshe4fen und ausle4ndischen Enklaven. In dieser Kontaktzone zwischen imperialen Me4chten und der geschwe4chten Qing-Herrschaft inszeniert Mirbeau einen Strafgarten, der zugleich Reiseziel, koloniale Bfchne und moralischer Spiegel Europas wird.
Die d6ffnung Sfcdchinas ffcr den westlichen Handel wurde durch die Opiumkriege erzwungen: 1839e280931842 unterlag das Qing-Reich Grodfbritannien; der Vertrag von Nanjing (1842) erzwang die Abtretung Hongkongs und die d6ffnung von ffcnf He4fen, darunter Kanton. Der Zweite Opiumkrieg (1856e280931860) endete mit den Vertre4gen von Tianjin (1858) und Peking (1860), die weitere He4fen f6ffneten, Missionen erlaubten und Ausle4nder extraterritorial stellten. Diese rechtliche und milite4rische Infrastruktur erkle4rt, warum europe4ische Reisende im spe4ten 19. Jahrhundert relativ ungehindert in chinesische Ste4dte und Gefe4ngnisse gelangten. Mirbeau nutzt dieses Machtgefe4lle: Seine Figuren bewegen sich dank imperialer Privilegien durch Re4ume, in denen Leiden und Strafrituale zum exotisierten, aber politisch bedingten Spektakel werden.
Die Niederlage Chinas im Ersten Chinesisch-Japanischen Krieg (1894e280931895) markierte den dramatischen Machtverlust der Qing. Mit dem Vertrag von Shimonoseki (17. April 1895) trat China Taiwan ab, zahlte hohe Entsche4digungen und verlor vorfcbergehend die Liaodong-Halbinsel (Rfcckgabe nach der Dreime4chteintervention). 1897e280931898 folgte die sogenannte Schacherung um Einflusssphe4ren: Deutschland sicherte sich Kiautschou (Jiaozhou), Russland Pachtvertre4ge ffcr Port Arthur/Dalian (Me4rz 1898), Grodfbritannien Weihaiwei (Juli 1898) und die New Territories von Hongkong (Juni 1898), Frankreich Guangzhouwan/Kouang-Tche9ou-Wan (27. Mai 1898). Mirbeaus Schauplatz im Perlflussdelta korrespondiert direkt mit diesen Arrangements: Seine englische Protagonistin und der europe4ische Erze4hler verkf6rpern die arrogante Bewegungsfreiheit, die solche Pachtvertre4ge den Kolonialeliten verschafften.
Das Qing-Strafrecht (Da Qing lfcli) kannte abgestufte, oft f6ffentlich vollzogene Kf6rperstrafen: Stockhiebe, Zwangskorsett (Kragen, cangue/jiagun), Brandmarkung, Verbannung und die extremen Sonderstrafen ffcr Hochverrat, darunter die Zerstfcckelung (lingchi). Lingchi, in Europa als Tod durch tausend Schnitte skandalisiert, wurde erst 1905 formell abgeschafft; f6ffentliche Hinrichtungen blieben im 19. Jahrhundert ein Herrschaftsritual. Reiseberichte, Missionsschriften und frfche Fotografien kursierten seit den 1860er Jahren in Europa. Mirbeau kondensiert diese Praktiken zu einem symbolischen Garten, in dem Strafgewalt, Erotik und Botanik verschmelzen. Indem er minutif6se Que4lformen beschreibt, spiegelt er einerseits europe4ische Obsessionen mit dem Exotischen, andererseits verweist er auf die Normalite4t staatlicher Gewalt ff auch in westlichen Justizsystemen.
Die Boxerunruhen (1899e280931901) radikalisierten die Konfliktlage. Aus antikolonialen, anti-missionarischen Netzwerken (Yihetuan) erwuchs eine Massenbewegung, die am 20. Juni 1900 zur Belagerung der Gesandtschaften in Peking ffchrte; am 14. August 1900 nahmen Truppen der Acht-Nationen-Allianz (Grodfbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland, Japan, USA, Italien, d6sterreich-Ungarn) die Hauptstadt ein. Es folgten Repressalien, Plfcnderungen und das Boxerprotokoll (7. September 1901) mit drakonischen Entsche4digungen und Besatzungsrechten. Mirbeaus Roman erschien 1899, am Vorabend dieses Gewaltausbruchs. Die Darstellung wechselseitiger Grausamkeit antizipiert die Logik der Vergeltung: koloniale dcbermacht, verletzte Souvere4nite4t und ressentimentgeladene Gegenwehr, deren Opfer vor allem Zivilisten und Gefangene wurden.
Die Panama-Affe4re erschfctterte 1892e280931893 die Dritte Republik. Die Compagnie universelle du canal interoce9anique de Panama, 1879 gegrfcndet und seit 1881 am Kanalbau, brach 1889 zusammen. 1892 wurde aufgedeckt, dass Unternehmer wie Ferdinand und Charles de Lesseps mittels Mittelsme4nnern (u. a. Baron Jacques de Reinach, Cornelius Herz) Bestechungsgelder an Abgeordnete gezahlt hatten; Reinach starb am 20. November 1892 unter mysterif6sen Umste4nden. 1893 kam es zu Prozessen und Verurteilungen, teils spe4ter aufgehoben. Mirbeau, als politischer Journalist scharf antikorrupt, fcberffchrt in seinem Roman die Pariser Parlamentarierwelt in moralischen Bankrott: Die Flucht in fernf6stliche Re4ume entspringt explizit der Ekelstarre gegenfcber diesem System.
Die Dreyfus-Affe4re (1894e280931906) spaltete Frankreich entlang der Achsen Milite4r, Nationalismus und Antisemitismus. Hauptmann Alfred Dreyfus wurde am 22. Dezember 1894 verurteilt und am 5. Januar 1895 degradiert; es folgten Verbannung nach Teufelsinsel und eine Kampagne ffcr Revision. c9mile Zolas Jaccuse erschien am 13. Januar 1898 in Lb4Aurore; 1899 kam es in Rennes zur Wiederaufnahme und zu einer erneuten, skandalf6sen Verurteilung mit mildernden Umste4nden, worauf Pre4sident c9mile Loubet am 19. September 1899 begnadigte; die vollste4ndige Rehabilitierung erfolgte am 12. Juli 1906. Mirbeau engagierte sich offen dreyfusard. Im Roman spiegelt sich diese Haltung in der Attacke auf Milite4rjustiz, Staatsre4son und die sadistische Pose der Autorite4t.
Als gesellschaftlich-politische Anklage seiner Zeit entlarvt das Buch die Verflechtung von Gewalt, Sexualite4t und Macht als transnationales System. Mirbeau setzt die chinesischen Exekutionsge4rten mit europe4ischen Apparaten der Disziplinierung ff Armee, Parlament, Justiz und Kolonialverwaltung ff in Beziehung und demonstriert, wie Souvere4nite4t sich fcber den Kf6rper der Entrechteten behauptet. Er macht die grodfen Probleme der Epoche sichtbar: die Zynik des Imperialismus, den giftigen Nationalismus der Dreyfus-c4ra, die Ke4uflichkeit politischer Eliten und die Banalisierung der Todesstrafe. So attackiert der Roman soziale Ungerechtigkeiten und Klassengegense4tze, indem er die Lust der Herrschenden am Spektakel der Strafe als Kern moderner Politik ausweist.
Der Garten der Qualen: Erotik Klassiker
Widmung
O. M.
Einleitung
Mehrere Freunde waren eines Abends im Hause eines unserer berühmtesten Schriftsteller vereint. Nachdem sie ein köstliches Diner genommen hatten, stritten sie über das Thema des Mordes, ich weiß nicht aus welchem Anlaß, wahrscheinlich ohne jeden Grund. Es waren alles Männer; Moralisten, Dichter, Philosophen, Ärzte, kurz ausnahmslos Leute, die sich frei aussprechen durften, wie es ihnen ihre Phantasie, ihr Tollpunkt oder ihr Widerspruchsgeist eingab, ohne befürchten zu brauchen, daß sie plötzlich jenes Entsetzen und Verblüfftsein zu sehen bekämen, das schon der geringste, ein wenig gewagte Gedanke auf dem bestürzten Gesicht eines Notars malt. – Ich sage Notar, wie ich Advokat oder Portier sagen könnte, durchaus nicht in verächtlichem Sinne, sondern um die mittlere Norm des französischen Denkvermögens anzuführen. Ein Mitglied der Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften bemerkte mit vollkommener Seelenruhe, als ob es sich darum gehandelt hätte, seine Meinung über die Vorzüge der Zigarre, die er rauchte, zu äußern:
– Meiner Treu! ... ich glaube allerdings, daß der Mord am meisten die Menschheit in Anspruch nimmt und beherrscht und alle unsere übrigen Thaten davon abzuleiten sind ...
Man machte sich auf eine lange theoretische Begründung gefaßt. Er aber verstummte.
– Selbstverständlich! ... stimmte ein gelehrter Darwinianer[2] bei ... Der Grundsatz, den Sie da aufstellen, mein Lieber, ist eine jener ewigen Wahrheiten, wie sie der sagenhafte Herr de La Palisse[1] tagtäglich entdeckte ... Da Mord sogar die Basis unserer sozialen Einrichtungen, folglich auch die dringendste Nothwendigkeit des civilisierten Lebens ist ... Wenn es keinen Mord mehr gäbe, würden auch keinerlei Regierungen mehr bestehen, infolge der bewunderungwürdigen Thatsache, daß das Verbrechen im Allgemeinen, der Mord im besondern, nicht nur für sie eine Entschuldigung, sondern sogar ihre alleinige Daseinsberechtigung vorstellt ... Wir würden sonst in vollster Anarchie leben, in einem Zustande, den man sich gar nicht vorstellen kann ... Infolge dessen ist es unerläßlich, weit davon entfernt den Mord zu vernichten, ich sage, es ist unerläßlich ihn mit Verständnis und Ausdauer zu pflegen ... und ich kenne kein besseres Culturmittel als Gesetze.
Und als Jemand Einspruch erhob, äußerte der Gelehrte, in fragendem Tone:
– Aber ich bitte Sie! sind wir unter uns, und sprechen wir ohne Rückhalt und Heuchelei, oder nicht?
– Um des Himmelswillen! ... bemerkte der Hausherr beruhigend ... benutzen wir ausgiebig die einzige Gelegenheit, da es uns gestattet ist, unsere heimlichen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, da ich in meinen Büchern und Sie in Ihren Collegien dem Publikum nur Lügen vorsetzen dürfen.
Der Gelehrte schob sich noch tiefer in die Polster seines Sessels, streckte die Beine aus, die ihm, da er sie zulange gekreuzt hatte, eingeschlafen waren und den Kopf zurückgebeugt, die Arme herabhängend, den Bauch von einer glücklichen Verdauungsthätigkeit geliebkost, blies er Rauchringe zur Decke empor und begann endlich von Neuem:
– Übrigens wird der Mord zur Genüge ganz von selbst gepflegt ... genauer ausgedrückt, ist er nicht das Resultat irgend einer Leidenschaft, auch nicht die pathologische Form der Entartung. Er ist ein Lebensinstinkt, der in uns wohnt[1q] ... der in allen organischen Wesen wohnt und sie gleich dem Geschlechtstriebe beherrscht ... Und dies ist so wahr, daß die längste Zeit sich diese beiden Instinkte so eng verbinden, so vollkommen ineinander aufgehen, daß sie gewissermaßen nur den einen und gleichen Instinkt bilden, daß man wirklich nicht mehr weiß, welcher von beiden uns dazu treibt, Leben zu geben, oder zu nehmen, welcher Mord und welcher Liebe ist. Ich habe die Beichte eines ehrenwerthen Mörders entgegengenommen, der Frauen tödtete, nicht um sie zu berauben, sondern um sie zu vergewaltigen. Sein Sport bestand darin, daß die Verzückung der Fleischeslust des einen, genau mit der Verzückung des Todes der andern zusammentraf: »In diesen Augenblicken, sagte er zu mir, stellte ich mir vor, ich sei ein Gott und schüfe die Welt.«
– Oho! rief der berühmte Schriftsteller ... wenn Sie Ihre Beispiele von den gewerbemäßigen Meuchelmördern herbeiholen!
Der Gelehrte entgegnete sanft:
– Wir sind eben alle mehr oder weniger Meuchelmörder ... Wir haben alle im Geiste analoge Gefühle gespürt, minder heftig, das will ich allenfalls glauben ... Der angeborene Drang nach Mord wird gezügelt und seine körperliche Heftigkeit gemildert, indem ihm gesetzlich gestattete Ausflüsse zur Verfügung stehen, die Industrie, der Colonialhandel, der Krieg, die Jagd, der Antisemittismus ... Weil es eben gefährlich ist, sich ihm ohne alle Mäßigung außerhalb der Gesetze zu überliefern, und weil die moralische Befriedigung, die man dadurch erhält, schließlich das doch nicht aufwiegt, daß man sich den gewöhnlichen Folgen dieser That aussetzt, der Verhaftung ... den Unterredungen mit den Richtern die stets ermüdend und jedes wissenschaftlichen Interesses bar sind ... schließlich der Guillotine ...
– Sie übertreiben, unterbrach ihn der Mann, der zu erst gesprochen hatte ... Nur für Mörder ohne Eleganz, ohne Geist, für impulsive und rohe Patrone, die keinerlei Art von Psychologie besitzen, ist Mord eine gefährliche That ... Ein intelligenter Mensch, der nachzudenken versteht, kann mit unantastbarer Ruhe jeden Mord, der ihm gutdünkt, begehen. Er ist der Straflosigkeit sicher ... Die Überlegenheit seiner Combinationen wird stets die Routine der polizeilichen Nachforschungen erfolgreich bekämpfen und sagen wir es frei heraus, auch die Armseligkeit der kriminalistischen Verhöre, in der sich unsere Untersuchungsrichter gefallen ... In dieser Hinsicht, wie in jeder andern, müssen eben die Kleinen für die Großen die Zeche bezahlen ... Nicht wahr, mein Lieber, Sie geben sicher zu, daß die Zahl der unaufgedeckten Verbrechen ...
– Und der geduldeten ...
– Und der geduldeten Verbrechen ... das wollte ich ja eben sagen, Sie geben sicher zu, daß diese Zahl tausendmal größer ist als die der entdeckten und bestraften Verbrechen, über die die Zeitungen mit seltsamer Weitschweifigkeit und einem widerlichen Mangel von Philosophie schwätzen? ... Wenn Sie dies zugeben, müssen Sie auch einräumen, daß der Gensdarm kein Abschreckungsmittel für die Intellektuellen des Mordes ist ...
Zweifellos. Aber darum handelt es sich nicht ... Sie verschieben die Frage ... Ich sagte: der Mord ist eine normale – und keineswegs eine außergewöhnliche – Function der Natur und jeglichen Lebewesens. Es ist folglich haarsträubend, daß die Gesellschaft unter dem Vorwande die Menschen zu regieren, sich das ausschließliche Recht, sie zu tödten angemaßt hat, zum Schaden der Individualitäten, denen allein dieses Recht inne wohnt.
– Sehr richtig! ... pflichtete ein liebenswürdiger, redseliger Philosoph bei, dessen Vorlesungen in der Sorbonne allwöchentlich ein auserlesenes Auditorium herbeiziehen ... Ich glaube meinerseits nicht, daß ein menschliches Geschöpf existirt, das nicht – wenigstens geistig – etwas von einem Mörder an sich hat ... Sehen Sie: mir macht es zuweilen Spaß, in Salons, in Kirchen, auf den Bahnhöfen, auf den Terrassen der Kaffeehäuser, im Theater, kurz überall wo Menschenmengen vorbeiziehen und sich ansammeln, vom Gesichtspunkt mörderischen Aussehens, die Physiognomien zu beobachten ... Sie tragen im Blicke, auf dem Nacken, in der Schädelform, an den Kinnbacken und den Wangen, kurz an irgend einer Stelle ihres Individuums, ausnahmslos sichtlich die Merkmale jenes physiologischen Factums, das man Mord nennt, an sich ... Das ist keine Verirrung meines Geistes, wenn ich Ihnen hier erkläre, daß ich keinen Schritt thun kann, ohne Mord zu streifen, ohne ihn unter den Augenlidern aufflammen zu sehen, ohne seine geheimnißvolle Berührung an den Händen, die sich mir entgegenstreckten, zu fühlen ... Vorigen Sonntag begab ich mich nach einem Dorfe, in dem gerade Jahrmarkt stattfand ... Auf dem großen Platze, der mit Laubwerk verziert war, mit blumengeschmückten Thriumphbogen und vielfarbenen Masten, konnte man aller Arten der bei diesen Volksunterhaltungen üblichen Belustigungen finden ... und unter der väterlichen Obhut der Behörden amüsirte sich eine Menge braver Leute ausgezeichnet ... Die Karoussels, die Rutschbahnen und Schaukeln übten nur sehr wenig Anziehungskraft auf die Menge aus. Vergebens quitschten die Leierkasten ihre lustigsten Weisen und verführerischen Melodien. Andere Vergnügungen fesselten diese Menge in Festesstimmung. Die Einen schossen mit dem Gewehr, oder mit Pistolen, ja mit der alten guten Armbrust auf Scheiben, die menschliche Gesichter darstellten. Andere brachten mit Ballwürfen Marionetten, die jämmerlich auf Holzbalken aufgestellt waren, zur Strecke; Andere schlugen mit Hämmern auf eine Platte, wodurch in patriotischer Weise ein französischer Seemann in Bewegung gesetzt wurde, der mit seinem Bajonett am Ende eines Balkens einen armen Hova oder einen bedauerlichen Dahomeyer durchbohrte ... Überall gab es unter den Zelten und in den kleinen beleuchteten Buden Darstellungen des Todes, Parodien von Metzeleien, Aufführungen von Hekatomben ... Und diese braven Leute waren überglücklich!
Jeder begriff, daß der Philosoph losgelassen war ... Wir richteten uns so gut es eben gieng ein, um die Lawine seiner Theorien und Anekdoten über uns ergehen zu lassen. Er fuhr fort:
– Ich habe sogar bemerkt, daß diese friedfertigen Vergnügungen seit einigen Jahren ansehnlich an Ausdehnung zugenommen haben. Die Freude am Tödten ist größer geworden und hat sich mehr verallgemeinert, in demselben Maaße wie die Sitten sanfter werden – denn die Sitten werden sanfter, das läßt sich nicht bezweifeln! ... Einstmals, als wir noch Wilde waren, zeigten diese Jahrmarktschießstände eine eintönige Armseligkeit, die jämmerlich anzusehen war. Es wurde nur auf Pfeifen geschossen, sowie auf ausgeblasene Eier, die auf einem Wasserstrahle tanzten. In den luxuriösesten Etablissements gab es allerdings Vögel, doch die waren aus Gips ... was für ein Vergnügen kann man daran finden, frage ich Sie? ... Heute hat sich der Fortschritt geltend gemacht, für jeden ehrenwerthen Mann ist es angänglich, sich für zwei Sous die köstliche und civilisatorische Aufregung eines Meuchelmordes zu verschaffen ... Und überdies kann man dabei auch noch bunte Schüsseln und Kaninchen gewinnen ... An Stelle der Pfeifen, der Eierschalen, der Vögel aus Gips, die in thörichter Weise zerbrachen, ohne uns eine blutige Vorstellung zu suggerieren, hat die Phantasie des fahrenden Volkes Gesichter von Männern, Frauen und Kindern gesetzt, die sorgfältigst ausgeführt und angezogen sind, wie es sich gebührt ... Darauf hat man diese Figuren mit Bewegungs- und Laufmechanismen versehen ... Durch eine geniale Maschinerie gehen sie glücklich hin und her, oder fliehen entsetzt. Man sieht sie einzeln oder in Gruppen, in Landschaften auftauchen, Mauern erklettern, in Burgthürme einsteigen, aus Fenstern springen und durch Fallthüren erscheinen ... Sie funktioniren gleich wirklichen Menschen, sie bewegen die Arme, die Füße und den Kopf. Einzelne scheinen zu weinen ... Einzelne gleichen armen Leuten ... einzelne sehen wie Kranke aus ... Es gibt auch welche, die mit Gold gleich märchenhaften Prinzessinnen bekleidet sind. Man kann sich wahrhaftig vorstellen, daß sie Vernunft, Willen und Seele besitzen ... daß sie lebend sind! ... Einige Figuren nehmen sogar pathetische, beschwörende Haltungen an ... Man glaubt sie sagen zu hören: »Gnade! ...Tödte mich nicht! ...« Folglich ist es ein entzückendes Gefühl, sich vorzustellen, daß man Wesen, die sich bewegen, die vorwärts schreiten, die Schmerz fühlen und um Gnade flehen, tödten kann! ... Und während mau auf sie das Gewehr oder die Pistole richtet, hat man im Munde einen Geschmack wie von warmem Blut ... Welche Lust, wenn der Ball diese scheinbaren Menschen enthauptet! ... Welcher Reiz liegt darin, wenn der Pfeil die Papierbrust durchbohrt, und die kleinen Leiber leblos zu Boden streckt, in der Lage eines Leichnams ... Jeder regt sich auf, wird mordlüstern und läßt sich Muth zusprechen ... Man hört nur noch Worte der Zerstörung und des Todes: »Gib' ihm nur den Rest! ... Ziel' auf sein Auge ... Ziel' auf's Herz ... Der hat sein Theil! ...« So gleichgültig diese braven Leute gegen Kreisscheiben und Pfeifen sind, so sehr begeistern sie sich, wenn das Ziel ein menschliches Bild vorstellt. Die Ungeschickten werden ärgerlich, nicht gegen ihre Ungeschicktheit, sondern gegen die Figur, die sie verfehlt haben ... Sie bezeichnen sie als einen Feigling, überhäufen sie mit gemeinen Beschimpfungen, wenn sie unverletzt hinter dem Thor des Burgthurmes verschwindet ... Sie fordern sie heraus: »Komm' nur, du elender Schuft!« und dann beginnen sie wieder darauf loszuschießen, bis sie sie getödtet haben ... Beobachten Sie nur diese braven Leute ... in diesem Augenblick sind es durchaus Mörder, Wesen, die von dem Gelüst zu tödten einzig und allein beherrscht werden. Die menschenmordende Bestie, die eben noch in ihnen schlummerte, ist vor der Illusion, daß sie ein lebendes Geschöpf vernichten könnten, erwacht! Denn das Männchen aus Pappe oder Holz, das vor der Coulisse hin- und hergleitet, ist für sie kein Spielzeug, kein Stückchen vernunftlosen Stoffes mehr ... Wenn sie die Figur hin- und hergleiten sehen, leihen sie ihr unbewußt eine Bewegungsfähigkeit, ein fühlendes Nervensystem, Gedanken und Vernunft, kurz all' das, was man so wollüstig gern vernichtet, mit so köstlicher Wildheit durch Wunden, die man ihm zugefügt hat, verbluten sieht ... Sie gehen sogar so weit, daß sie das Männchen mit politischen oder religiösen Meinungen ausstatten, die den ihren entgegengesetzt sind, daß sie ihm vorwerfen, ein Jude, Engländer oder Deutscher zu sein, um noch einen speziellen Haß zu diesem allgemeinen Haß gegen alles Leben hinzuzufügen und so durch eine persönliche, äußerst erquickliche Rache das instinktive Vergnügen am Tödten zu verdoppeln.
Hier legte sich der Hausherr ins Mittel, der aus Höflichkeit gegen seine Gäste, oder in der barmherzigen Absicht, unsern Philosophen und uns selbst ein wenig ausschnaufen zu lassen, lässig einwendete:
Sie sprechen nur von rohen Gesellen, von Bauern, die, wie ich zugeben will, im Banne ständiger Mordlust stehen ... Aber es ist nicht möglich, daß Sie dieselben Beobachtungen an »kultivirten Geistern«, an »polizeilich geschulten Naturen,« an Mitgliedern der guten Gesellschaft zum Beispiel, gemacht haben, die in jeder Stunde ihres Daseins Siege über den Urinstinkt und die wilden Gelüste des Atavismus davon tragen.
Darauf antwortete unser Philosoph lebhaft: