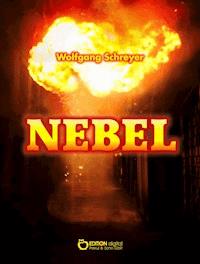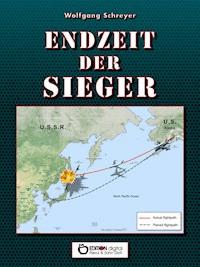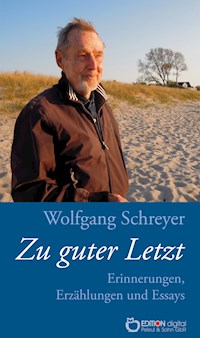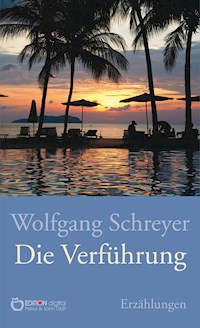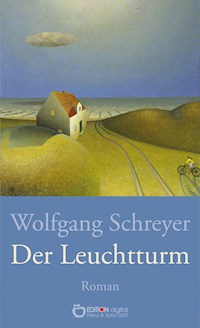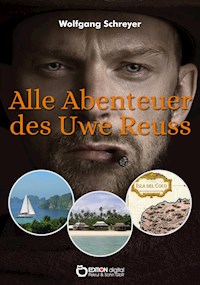7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am 22. November 1963, 12.30 Uhr, fielen in Dallas (Texas) Schüsse, die in aller Welt Trauer und Entsetzen auslösten – denn der 35. Präsident der USA, der charismatische John F. Kennedy, der in Vorbereitung seiner angestrebten Wiederwahl im darauffolgenden Jahr gemeinsam mit seiner Frau Jacqueline im offenen 1961er Lincoln Continental X-100 durch die Stadt gefahren war, wurde ermordet. Die Handlung des wie immer bei Schreyer sehr spannend und abenteuerlich geschriebenen Romans setzt kurz nach diesem Attentat ein, das für eine Zäsur in der amerikanischen Politik sorgte – aber auch in Miami in Florida, wo es eine Kolonie von Exil-Kubanern gab, die vor Castro geflohen waren. Zu ihnen gehört seit Oktober zweiundsechzig der Erzähler, Antoni (Tony) Varona, Ex-Leutnant in der Nachrichtentruppe der kubanischen Armee: Abends kam Sprühregen auf, die beleuchteten Palmen vor dem Hotel "Commodore" tropften im Wind. Irgendwo auf dem Weg durch die Stadt hatte sich ein Schatten an mich gehängt. Ich spürte ihn zum ersten Mal beim Überqueren der Patton Avenue, fünfzig Schritte vor meinem Stammlokal. Nicht, dass ich ihn gesehen hätte; die City war viel zu belebt. Wer immer es sein mochte, er schwamm im großen Strom hinter mir her. Als ich die Stufen zum "El Chico" hinabstieg, glaubte ich es wieder zu fühlen ... Aber warum? Ich tat ja nichts, hatte nichts in Aussicht – seit einem Dreivierteljahr lungerte ich in Miami herum. Sie hatten uns auf Eis gelegt, das war mein Kummer, darüber wollte ich nachher mit Lopez sprechen. Also warum? Ich grübelte noch vor der Theke, wo man für neunzig Cents ein Sandwich mit Schinken und Käse, Muschelsuppe und Kaffee bekommt, meistens auch ein Doughnut. Die Warteschlangen sind entsprechend lang. Der Raum war wie immer laut und voll – ein Treffpunkt meiner Landsleute. Anscheinend redete alles von dem Mord an Kennedy. Aus dem Attentat von Dallas wurde allmählich ein amerikanischer Albtraum. Eben sagte der Fernsehsprecher, Johnson habe durch Verfügung Nr. 11 130 sieben prominente Bürger unter dem Vorsitz des Obersten Richters Warren beauftragt, Hergang und Hintergrund des Anschlags zu klären. Ich nickte Bekannten zu und beobachtete die Schwingtür. Doch es erschien kein fremdes Gesicht. Aber damit ist es nicht vorbei, denn wenig später schiebt man ihm einen Zettel zu. Er las einen einzigen Satz und fühlte einen Schock. Dringend an Tony: Erwarte Dich im Garten – Lopez Ihn erwartet ein Verhör – allerdings ohne Lopez.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der gelbe Hai
Abenteuerroman
ISBN 978-3-86394-099-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1969 beim Verlag Das Neue Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
ERSTES KAPITEL
1
Abends kam Sprühregen auf, die beleuchteten Palmen vor dem Hotel "Commodore" tropften im Wind. Irgendwo auf dem Weg durch die Stadt hatte sich ein Schatten an mich gehängt. Ich spürte ihn zum ersten Mal beim Überqueren der Patton Avenue, fünfzig Schritte vor meinem Stammlokal. Nicht, dass ich ihn gesehen hätte; die City war viel zu belebt. Wer immer es sein mochte, er schwamm im großen Strom hinter mir her. Als ich die Stufen zum "El Chico" hinabstieg, glaubte ich es wieder zu fühlen... Aber warum? Ich tat ja nichts, hatte nichts in Aussicht – seit einem Dreivierteljahr lungerte ich in Miami herum. Sie hatten uns auf Eis gelegt, das war mein Kummer, darüber wollte ich nachher mit Lopez sprechen. Also warum?
Ich grübelte noch vor der Theke, wo man für neunzig Cents ein Sandwich mit Schinken und Käse, Muschelsuppe und Kaffee bekommt, meistens auch ein Doughnut. Die Warteschlangen sind entsprechend lang. Der Raum war wie immer laut und voll – ein Treffpunkt meiner Landsleute. Anscheinend redete alles von dem Mord an Kennedy. Aus dem Attentat von Dallas wurde allmählich ein amerikanischer Alptraum. Eben sagte der Fernsehsprecher, Johnson habe durch Verfügung Nr. 11 130 sieben prominente Bürger unter dem Vorsitz des Obersten Richters Warren beauftragt, Hergang und Hintergrund des Anschlags zu klären. Ich nickte Bekannten zu und beobachtete die Schwingtür. Doch es erschien kein fremdes Gesicht.
Eine Zeitlang hörte ich auf, mir Sorgen zu machen, blieb aber auf der Hut. Die allgemeine Nervosität hatte mich angesteckt. Eine Woche nach dem Attentat zog der Fall noch immer neue Kreise. Ich begann zu fürchten, sie könnten auch uns hier erreichen. Bis zum Sonntagvormittag waren die meisten bereit gewesen, in Lee Oswald einen Verrückten zu sehen, dem es durch Zufall gelungen war, seine Wahnidee in die Tat umzusetzen. Doch als man im Fernsehen den untersetzten Mann ins Bild stürzen und schießen sah, als Oswald unter Jack Rubys Kugel zusammenbrach, da regten sich Zweifel. Seitdem schien es mehr und mehr, als habe der Präsidentenmörder nicht allein gehandelt, als sei er bloß das einzig sichtbare Glied einer Kette von Verschwörern. Widerspruchsvolle Gerüchte kamen auf: Hinter Oswald stünden lateinamerikanische Anarchisten oder texanische Ölmillionäre, cubanische Revolutionäre oder Antikommunisten, Fidel Castro oder Lyndon B. Johnson. Unser spanischsprachiges Emigrantenblatt war instinktlos genug, die Wahrsagerin Jeane Dixon zu zitieren: "Castro glaubte, Kennedy und Chruschtschow wollten ihn stürzen..."
Ich sah von der Suppe auf und merkte, dass der Teint des Nachrichtensprechers sich gründlich färbte, sein Mund lief blau an wie der einer Wasserleiche. Das lag nicht an den Lügen, die er verbreitete, sondern an Mängeln des Farbfernsehens. Der Kellner korrigierte die Einstellung, er tat das immer im Vorübergehen, die Wasserleiche blühte rosig auf und sagte: "... vermutet, dass John F. Kennedys Tod in New Orleans geplant worden sei, und zwar von Antikommunisten, rechtsradikalen Amerikanern und Cubanern als Antwort auf die fehlgeschlagene Invasion in der Schweinebucht und die spätere Weigerung des US-Präsidenten, ähnliche Aktionen zu genehmigen."
Dieser Satz hätte mich nicht stören müssen, doch soviel war klar: er zog die amtliche Aufmerksamkeit auf uns. Wir standen geradezu im Rampenlicht, nicht jeder konnte das vertragen. Würde das FBI nun die cubanische Kolonie überprüfen, besonders diejenigen, die irgendwann einmal Waffen besessen und an Aktionen teilgenommen hatten? Der Personenkreis war nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte. Neunzigtausend Emigranten lebten in Florida, sechstausend davon hatten der Invasionsarmee angehört, aber nur ein paar hundert waren an den Unternehmungen dieses Jahres beteiligt. Uns Burschen von den Kommandos würden sie sich ansehen wollen.
Ich schob den Teller weg – plötzlich schwitzte ich; nicht von der Suppe. Auf dem Tablett lag ein Zettel, eben war er noch nicht da gewesen, wer hatte ihn unter den Teller geschoben? Ich las einen einzigen Satz und fühlte einen Schock.
Dringend an Tony: Erwarte Dich im Garten – Lopez
Die Mitteilung war ungewöhnlich nach Inhalt und Form. Ich wusste nicht einmal, ob es Lopez' Schrift war; er hatte mich niemals schriftlich benachrichtigt und auch nicht durch Vermittlung Dritter. Und weshalb wählte er für unseren Treff einen so auffälligen Ort? Er verkehrte kaum im "Garten", ebenso wenig passte es zu mir. Er hatte mich heute bei sich erwartet, war sein Quartier nicht mehr sicher?
Ich merkte, dass ich den Maiskuchen zerkrümelte. Es war jetzt unerträglich heiß. Von dem Stimmengewirr ringsum dröhnte mir der Kopf. Wenn nun gar nicht die Yankees mich beschatteten, sondern die eigenen Leute? Das würde erklären, weshalb kein Fremder hinter mir hereingekommen war. Einer von Hectors oder Rafaels Vertrauten etwa? Ich sah mich um, ohne einen Mann des Alpha-Kommandos zu entdecken. Schließlich hatten die beiden mich nie gemocht, ihre letzte Aktion war fehlgeschlagen, vielleicht glaubten sie, ich hätte den Plan verraten. Und die Panne von Norman's Key, wo die Briten das beste Boot von Alpha aufgebracht hatten... Aber wieso sollte man jetzt auf mich verfallen, nach reichlich einem halben Jahr?
Ich stand auf und schob mich zur Tür. Ich musste zu Lopez, sofort, doch auf Umwegen. Nicht zum ersten Mal war ich hier einen Schatten losgeworden.
2
Niemand schien mir zu folgen, es war auch nicht mehr so leicht. Der Regen fiel stärker, er schlug mir ins Gesicht. In solchen Nächten kann man die Stadt für sich allein haben. Die Nässe treibt die Bewohner Miamis tief in das Dunkel der Häuser, weg von den Adern, die die Vororte miteinander verbinden. Der Asphalt spiegelte Neonreflexe, zischende Reifen schleuderten Pfützenwasser hoch. "Hi there", sagte eine Stimme hinter mir. "Wollen Sie nicht unser ausgezeichnetes Lendensteak probieren? Nur ein Dollar fünfzehn und soviel Kaffee, wie Sie wollen." Die Tonbandstimme warb für ein Kettenrestaurant, doch ich war zusammengezuckt.
An der vierten Ecke wartete ein Taxi. "Driver", sagte ich, "wollen Sie mich zum 'Les Pyrenées' fahren?"
"Welchen Weg soll ich nehmen?"
"Hab's nicht eilig", antwortete ich. "Nehmen Sie den interessantesten." Er grinste mich über die Schulter an und startete. Die Fahrer mögen Leute, die sie – wenn überhaupt – nicht mitten im Block anhalten, sondern an der Ecke, die vom Trottoir aus einsteigen anstatt von der Straße und sich brav nach hinten setzen. Ich tat das schon im Hinblick auf das Rückfenster. Doch es waren zu viele Wagen unterwegs; jetzt war ich nicht mehr sicher, ob jemand folgte.
"Les Pyrenées" ist ein kleines französisches Hotel nahe dem Atlantik, mit zwei Ausgängen. Rafael hatte mich dort einmal mit weißem Bordeaux und mit Huhn Divan bewirtet, einer käseumhüllten Spezialität des Hauses. Das war nach dem Schnellbootangriff auf Miramar gewesen, als Alberto genug hatte und Rafael einen Nachfolger suchte.
In der Halle bat mich eine tizianrote Dame um Feuer, dann fragte sie mit munterem Augenaufschlag: "Haben Sie ein Zimmer hier im Hotel" – die übliche Eröffnung der Prostituierten.
Ich führte sie zum Lift, sie gab eine gewisse Deckung ab. Zu ihrem Erstaunen drückte ich den Abwärtsknopf. "He, was wollen Sie denn?", fragte sie.
"Nur ein paar Sehenswürdigkeiten besichtigen", sagte ich, schob ihr einen kleinen Schein in den Ausschnitt und verließ "Les Pyrenées" durch die Kellergarage.
"Verrückter Cubaner", rief sie hinterher, während ich in den Regen tauchte. Ich hatte den Ruf unserer Kolonie weiter geschädigt. Kein Mädchen, das auf sich hält, knöpft einem Kunden weniger als zwanzig Dollar ab; aber sie hatte ja nur zwei Minuten an mich verloren.
Irgendwo tutete eine Schiffssirene. Ich lief um ein paar Ecken und sah die Leuchtschrift "Garden of Allah". Die großen Buchstaben hatten Kurzschluss, so dass man "arden of llah" las. Wieder fragte ich mich, was in Lopez gefahren sein mochte. Er arbeitete zum gesetzlichen Mindestlohn in einer Blechstanzerei; das hier war zu teuer für ihn. Das Lokal gehörte einem Syrer, der auf einer steigenden Welle ritt – der orientalischen Hüftenschwingerei. Ganz zu Unrecht gilt diese Art Zerstreuung als lasterhaft, sie ist legal und ersetzt das offiziell verbotene Striptease. In jenen Tagen war "Garden of Allah" der Nabel des Bauchtanzes von Florida.
Ich verharrte eine Zeitlang neben dem Eingang, um mich an das Dämmerlicht und den Lärm von Tamburin und Zimbeln zu gewöhnen. Der Empfangschef musterte mich, vielleicht war ihm mein Hemd zu feucht. Wo steckte Lopez? Auf der Tanzfläche hockte ein Mädchen, spähte durch einen violetten Schleier und schüttelte den Busen. Sie war groß, schwarz, barfuß, der Bauch eine Spur zu dick, wie man es im Orient schätzt. Sie trug ein schweres, glitzerndes Kostüm; Hector hatte mich nach der Zuckergeschichte einmal hierher mitgenommen, daher wusste ich, sie würde höchstens den Schleier abwerfen. Auch dann hatte sie immer noch mehr an als die meisten Mädchen am Strand. Lopez hatte den Ort schwerlich des Vergnügens wegen gewählt.
"Mr. Varona?", redete mich jemand an; es war der Kellner. "Sie werden an Tisch sechs erwartet, Sir. Darf ich Sie hinbringen?" Ich folgte ihm zu einer erhöhten Nische. Hinter dem Perlenvorhang erhob sich ein hagerer Mann mit dem Profil eines Raubvogels: nicht Lopez, sondern Rafael. Neben ihm saß Héctor – krauses graues Haar über der Sonnenbrille, die übliche schwere Zigarre in der Hand.
"Hallo, Tony", sagte Rafael und wies auf ein Lederkissen. "Fein, dass Sie gekommen sind."
3
In meinem Rücken schepperten die Perlen. Ich hatte den Eindruck einer Falle, in die ich freiwillig hineingetappt war, nach allen Regeln der Konspiration; das machte es besonders schmerzlich. "Noch ein Glas", sagte Héctor zu dem Kellner.
Was wussten sie von meinem Verbindungsmann? Sie hatten mich in Lopez' Namen herbestellt, also kannten sie ihn, obwohl er unserem Kreis ganz fern stand. Ich hatte ihn allenfalls einmal wöchentlich und stets mit dem Anschein größter Beiläufigkeit getroffen, ins "El Chico" war er nie gekommen. Es sah so aus, als ob sie mich nicht erst seit heute beschatteten.
"Wir möchten uns mit Ihnen über Lopez unterhalten", sagte Rafael. "Was macht er eigentlich?"
"Er verchromt die Beschläge von Spielzeugautos, nehme ich an."
"Um diese Zeit?" Héctor war Trainer im Habana Yacht-Club gewesen, er liebte kurze Sätze.
"Er sollte hier sein", sagte Rafael vorwurfsvoll.
Sie taten, als sei Lopez ein Freund von ihnen, der sie versetzt hatte. "Das ist hier zu fein für ihn", gab ich zu bedenken. "Er verdient einen Dollar fünfundzwanzig die Stunde." "Und Sie?", fragte Héctor. Die Zigarre war ihm ausgegangen, er führte damit eine Art Dolchstoß gegen mich. "Was verdienen Sie?"
"Die Sozialabteilung des US-Gesundheitsministeriums zahlt mir neunzig Dollar im Monat, Boss. Einheimische Rentner müssen sich mit sechsundsechzig Dollar begnügen; Mr. Farris betont das immer wieder."
"Bleiben Sie ernst, Tony", mahnte Rafael. Er beugte sich vor, ich roch den Duft kostspieliger Herrenkosmetik. "Wie lange kennen Sie ihn?"
"Seit ein paar Wochen. Warum?"
"Wir werden unter keinen Umständen gestatten, dass eine inkompetente Person sich zwischen uns drängt."
"Was ist denn schon noch zwischen uns?"
"Nichts – bis Sie die Karten auf den Tisch legen."
Wir verstummten, denn man servierte Boula-Boula, eine Suppe für Snobs, die halb aus Erbsencreme, halb aus grüner Schildkröte besteht und mit gebackenem Schlagrahm überkrustet ist. Rafael verlangte für uns Fasan mit Salat und eine neue Flasche Pommard. Das schien mir nicht ganz sein Stil; er nahm gern flambierte Gerichte, die alles, auch den Daumen des Kellners, in Brand setzten und die Rechnung in die Höhe trieben. Zumindest bestellte er gebackene Kartoffel mit saurer Sahne und Kaviar, die teuerste Beilage der Welt. Und Hector trank sonst immer Dom Perignon 1955 zu siebenundzwanzig Dollar; nach dem geglückten Zuckercoup hatte er Errol Flynn nachgeahmt und dem Toilettenmann davon eine Flasche geschickt. Die Creme der Emigranten drohte zu verarmen, mit Alpha ging es abwärts.
"Harte Zeiten", sagte ich und blies auf die Suppe.
"Nun mal los", drängte Héctor, "wer ist Lopez?"
Sie wussten es also nicht. Hinter der schwarzen Brille blieb Héctors Blick finster; ich fing das kleine Kopfschütteln auf, mit dem Rafael ihn bedachte. Héctor mochte ein glänzender Seemann sein, doch die richtigen Fragen zu stellen fiel ihm schwer. Ich atmete auf. Wäre Lopez' Tarnung defekt gewesen, hätten sie mich kaum mit Boula-Boula traktiert. "Nehmen wir ruhig an, dass gar kein Lopez existiert."
"Es gibt ihn, mein Junge, sonst wären Sie ja nicht hier!"
"Sie müssen es wissen", sagte ich. "Sie sind der Boss."
"Tony, seien Sie nicht schwierig", riet Rafael sanft. "Wahrscheinlich wollten Sie andeuten, dass Ihr neuer Bekannter nicht zwischen uns steht. Eben darüber möchten wir Gewissheit haben." Er nickte mir aufmunternd zu, und ein bisschen fühlte ich mich wie ein Häftling, den der große Strafverteidiger aufsucht, um ihm in schonender Form die Beichte abzunehmen. Aber Rafael war nicht mehr Anwalt, eher Richter in diesem Fall: die graue Eminenz des Alpha-Kommandos, der Beauftragte Miro Cardonas und der anderen politischen Führer.
"Nun reden Sie schon, Tony..."
"Spucken Sie aus", sekundierte ihm Héctor, der sich seit je in harten Wendungen gefiel. Wenn man die beiden vor sich hatte – Rafael möglichst im Profil –, war man geneigt, dem Reporter Farris vom Fernsehsender WCKT zuzustimmen, der dem Zorn ganz Miamis häufig ein Ventil schuf. "Mit den Cubanern haben wir hier alles importiert, von den kleinen Gaunern über tausend Prostituierte bis zu den großen Rauschgifthändlern", hatte er erst gestern erklärt. "Organisiert wird dies alles von einigen der schlimmsten cubanischen Unterweltlern..."
Rafael probierte den Zwölfdollarwein und zerlegte seinen Vogel. "Sie schweigen", stellte er fest. "Vielleicht erzählen Sie uns lieber etwas von Isabel. Sie ist doch Ihr Mädchen gewesen, nicht wahr?"
Ich blinzelte, als hätte man mir ohne Grund Wasser ins Gesicht geschüttet. Das kam überraschend.
"Sie haben sich ein wenig aus den Augen verloren..." Rafaels Worte ertranken im Tamburingeklapper. "Hm, schade."
Was zum Teufel sollte das? Ich hatte Isa seit März nicht mehr gesehen – ein kleines verträumtes Mädchen. Ich erinnerte mich kaum noch an ihr Gesicht, wohl aber an ihre Geschichte. Sie war in Cienfuegos Krankenschwester oder Arzthelferin gewesen und mit ihrer Familie kurz nach Weihnachten herübergekommen, auf dem Frachter "African Pilot", der Medikamente nach Habana gebracht hatte – das Lösegeld für die Gefangenen der Schweinebucht. Sie sehnte sich nach Hause, beklagte die Übersiedlung Tag für Tag, ihre Traurigkeit wurde mir schließlich zuviel.
"Sehr schade", wiederholte Héctor bedeutsam.
"Schade für wen?"
"Für Ihre Kleine natürlich." Rafael rollte methodisch Salat auf seine Gabel. "Sie begreift Englisch nicht und verliert dadurch jede Stellung. Wir haben ihr schon oft etwas besorgt. Sie war Tankwart, Spülmamsell, Schuhputzerin – immer bloß für ein paar Tage."
"Zur Zeit verkauft sie Zigaretten", sagte Héctor.
Ich horchte auf. Mir gefiel nicht, dass sie sich an Isa herangemacht und sie offenbar in der Hand hatten. Es war eine unklare Drohung.
"Sie haben ihr zwar nie etwas anvertraut, Tony", sagte Rafael. "Aber der verschwiegenste Mann spricht manchmal im Schlaf oder verliert ein Notizbuch bei seiner Freundin."
Ich war überzeugt, dass er bluffte. Ich notierte mir fast nichts, und wenn, dann nicht im Klartext. Niemals hatte ich Notizen vermisst – trotzdem wurde mir kalt, meine Hand spielte mit den Perlenschnüren. Ich hörte wieder das Tamburin rasseln; im rosafarbenen Licht eines Scheinwerfers tanzte das Schleiermädchen immer noch, so unglaubwürdig es war. Jemand hatte mir gesagt, dass die Stammgäste – Türken oder Griechen – sich betrogen fühlten, wenn der Tanz nicht mindestens zwanzig Minuten dauerte. Sie bog sich zitternd hintenüber, schweißgebadet, und vollführte mit dem Bauch die interessantesten Bewegungen. Genauso lange zappelte auch ich schon in dem Netz, das sie mir übergeworfen hatten, um es langsam zusammenzuziehen.
"Sie wollen Lopez erst seit kurzem kennen." Héctors Zigarre stach zu. "Isabel hat den Namen schon letzten Winter von Ihnen gehört."
Ich sagte nichts, jede Antwort machte es nur schlimmer. Meine Finger umspannten die Eiswasserkaraffe. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Etwas musste die unerträgliche Situation beenden, doch ich konnte mir nicht vorstellen, was.
Rafael schob den Teller weg, er betupfte seine Lippen und schnippte ins Dämmerlicht – vermutlich, um das Dessert zu bestellen.
"Tony, woran denken Sie?", fragte er mild.
"Dass sogar der schönste Bauchtanz allmählich öde wird."
"Oh, Sie finden Nejla nicht sexy? Das tut mir wirklich leid. Vielleicht gefällt Ihnen aber das Zigarettengirl?" Neben mir schlüpfte das Mädchen durch die Perlenschnüre, das er herbeigewinkt hatte. Durch seinen Ton alarmiert, sah ich hoch; es war Isa.
Mein Mund war trocken, ich brachte kein Wort heraus. Isa trug ein golddurchwirktes Halstuch und einen Gürtel aus Goldschuppen, ihr Oberkörper war nackt bis auf den Tragegurt des Zigarettenkastens – ein Vorwand, sich ihr zu nähern und ihre Brüste anzustarren.
"Setz dich", befahl Hector.
"Das ist verboten."
"Nicht bei uns, Muchacha."
Sie zog sich einen Lederhocker heran. "Buenas noches, Tony", sagte sie verspätet und sah mich aus ihren Rehaugen groß an.
Ich bemerkte, dass der Gürtel ihr als Kasse diente. Offenbar schoben die Gäste, was sie bei der Tänzerin nicht durften, ihr dort das Geld hinein. "Wie geht es dir?", fragte ich hilflos.
"Ach, gut..." Sie saß unruhig da, mit flatternden Lidern, und verteidigte sich sofort: "Ich lerne hier tanzen, Tony, hab' das Essen frei, und bald kann ich auftreten." Sie lächelte gequält. "Nejla verdient hundertzwanzig die Woche..." Sie redete hastig drauflos, vielleicht froh, spanisch zu sprechen, oder auch, mich wieder zu sehen – obschon unter den lauernden Blicken ihrer Manager.
"Kein Begrüßungskuss?", fragte Héctor. "Macht ruhig, Kinder, mir kommen sowieso die Tränen."
Rafael bereitete der Szene ein Ende. "Hör zu, Isabel", sagte er väterlich, "wir möchten nur eine Auskunft von dir. Hat Tony damals den Namen Lopez erwähnt?"
Isa rutschte auf dem Hocker hin und her, behindert von dem Zigarettenkasten, den sie nicht abzusetzen wagte. Ihre Nervosität steigerte sich, als ich sie ansah. Sie schien zu nicken, blieb aber stumm. Ein Rest von Anhänglichkeit hielt sie davon ab, den beiden zu gehorchen.
Héctor richtete seine schwarze Zigarre wie einen Zauberstab, der einem die Wahrheit entlockt, auf Isa. "Sei vernünftig, Muchacha", mahnte er, lehnte sich vor und stäubte ihr kalte Asche zwischen die Brüste.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich fühlte, dass er sie beleidigen, an ihre Abhängigkeit erinnern wollte. In diesem Augenblick schien es mir, als sei alles darauf angelegt, Isa und mich zu erniedrigen. Ein Hassimpuls überwältigte mich, ich schlug Héctors Hand weg, hob die Karaffe und übergoss ihn mit Eiswasser. Die Eisstücke rutschten über sein Hemd – ein cubanisches Hemd mit doppelten Längsfalten und Taschen, das er als Patriot trug –, die Brille blieb unversehrt, doch Weingläser stürzten, und es zerbrach auch etwas.
Isa verschwand durch den Perlenvorhang, zwei Kellner rieben Héctor ab und fischten ihm Eis aus dem Kragen. "Das werden Sie bereuen", sagte Rafael zu mir. Von den anderen Tischen starrte man herüber, der Tanz ging zu Ende.
In dem Durcheinander ging ich. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen, die Alpha-Gruppe schrieb mich ab. Und ich begriff schnell, dass sie es nicht dabei beließ. Draußen näherte sich mir ein Schatten. "Mr. Varona?", hörte ich ihn fragen. "Erlauben Sie bitte..." Bevor ich reagieren konnte, traf mich von der anderen Seite her ein Schlag. Mein Kopf schien zu zerspringen, die Beine rutschten mir weg. Ich spürte, wie man mich unterhakte und in eine Limousine schob.
4
Der Wagen passierte das Hotel "Les Pyrenées", er fuhr in Richtung Zentrum. Es wunderte mich, dass sie nicht versuchten, das Fahrtziel geheim zu halten. Ich massierte den schmerzenden Hals und machte mir Vorwürfe. Man hätte sich denken können, dass Héctor und Rafael Maßregeln trafen, wenn sie einen zum Verhör in den "Garten Allahs" luden.
Doch schon nach den ersten Kurven wurde mir klar, dass meine Begleiter keine Alpha-Männer waren. Erstens kannte ich sie nicht, zweitens sprachen sie englisch – und nicht einmal mit dem breiten Akzent der Südstaaten, den auch Cubaner annehmen, die lange genug in Florida oder in Texas leben. Diese Leute waren Yankees. Jetzt erinnerte ich mich auch der Funkantenne auf dem Wagendach. Dies war keine Entführung, sondern eine Festnahme – die staatlich sanktionierte Form der Freiheitsberaubung. Vorübergehend erleichterte mich das: "Kriminalpolizei?", fragte ich.
Mein Nachbar zeigte mir seinen FBI-Ausweis. "Sie haben mit uns gerechnet, stimmt's?"
"Nein, Sir. Schon gar nicht mit solch einer Begrüßung."
"Tut uns leid, Mr. Varona." Sein Ton verriet mir, dass er nichts gegen mich hatte. "Wir möchten nicht unhöflich scheinen, es wird einfach zu oft auf uns geschossen. Da schaltet man Widerstand lieber gleich aus; das ist auch für Sie am besten."
"Ich hätte mich nicht widersetzt."
"Das konnten wir nicht wissen. Vergessen Sie es!"
Ich betastete die Schwellung unterm Ohr und fing an, mich zu ärgern. Für die Polizei mochte es praktisch sein, Präventivschläge auszuteilen, aber sie musste nicht auch noch behaupten, dies geschehe zum Besten des Opfers. "Wohin bringen Sie mich?"
"In unser Stadtbüro."
"Waren Sie sicher, mich im Garten zu finden?"
"Absolut, Mr. Varona."
Auf meine weiteren Fragen schwiegen sie. Ich verstand, dass ihr Auftrag sich darin erschöpfte, mich ins Stadtbüro zu bringen. Sie würden mir ohne einen Befehl aus Washington nicht einmal mehr die Uhrzeit sagen. Den Rest der Fahrt überlegte ich, was sie von mir wollten. Steckte Alpha nicht doch dahinter? Einen unliebsamen Mann den Behörden anzuzeigen und die eigenen Hände in Unschuld zu waschen, das sah ganz nach Rafael aus.
Der Wagen hielt vor einer Fotoschule in der südlichen Stadtmitte. In einer Vitrine auf dem Bürgersteig warb ein Plakat: "Lebende Aktmodelle für Amateurfotografen. Sitzungen stündlich, auch samstags und sonntags!" Darunter stand in kleiner Schrift "P. S.: Vergessen Sie nicht Ihre Kamera." In solch einem Haus gingen ständig Fremde aus und ein, die Bundeskriminalpolizei war gut beraten, hier ihr Quartier aufzuschlagen.
Wir fuhren bis zum fünften Stock hinauf; dort ließ man mich in einem Durchgangszimmer warten. Es gab keine Zeitschriften wie etwa beim Zahnarzt, dafür waren die Wände mit Aktaufnahmen behängt. Die meisten erhoben künstlerischen Anspruch, sie waren mit Weichzeichnern oder im Halbdunkel gemacht, es ging da eher um Konturen, um den Wechsel von Licht und Schatten. Ein Modell hatten sie eingeölt, um das Spiel der Reflexe einzufangen, so dass es nicht mehr sexy war. Zwei oder drei der Bilder schienen eine nähere Betrachtung wert zu sein, obwohl wir in Cuba da Schärferes haben. Wollte das FBI seine Besucher auflockern? Es fehlte nur noch jene Hintergrundmusik – Ray Conniff oder die Swingle Singers –, mit der man auf Flugplätzen die Wartenden tröstet und heiter stimmt.
Nebenan klappte eine Tür, jemand sagte: "Den nächsten hier herein." – "Nein", widersprach eine zweite Stimme, "da haben wir schon den Varona." – "Was denn, Varona?" – "Ja, Sir, er stand mit auf der Liste." – "Himmel! Tony Varona?" – "Genau den, ja." – "Sind Sie verrückt, Lewis? Das ist doch einer ihrer Chefs..." – "Verzeihung, nein, Sir. Das haben wir anfangs auch gedacht. Es hat sich als Namensgleichheit herausgestellt." Die Stimmen entfernten sich, ich wandte mich wieder dem Wandschmuck zu. dass auch die allwissende Bundeskriminalpolizei dazu neigte, mich mit einem Emigrantenführer zu verwechseln, der mehr als doppelt so alt war wie ich, nahm der Sache viel von ihrem Ernst. Es waren eben auch nur Menschen. Außerdem klang es, als seien sie dabei, noch mehr Landsleute herzuschaffen.
Ein baumlanger Kerl trat ein, befahl mir, mich schräg an die Wand zu stützen, und durchsuchte mich nach Waffen. Sie hätten dies, streng genommen, gleich tun müssen. Der Mann lief weg, ohne mir zu erlauben, mich wieder aufzurichten. Das deutete auf einige Verwirrung hin.
Durch beide Türen drangen Schritte, Gelächter, das Ticken einer Schreibmaschine. Die Unterhaltung im Gang bestand aus Abkürzungen und Sätzen, die ein Mensch mit Sprachgefühl besser nur durch die Wand anhörte. Nebenan gab es eine Auseinandersetzung. "Sie wechseln dauernd die Adresse", schallte es dumpf. "Ihr macht euch in Washington keinen Begriff, was das für eine Plage ist!" Es war hauptsächlich dieser Bass, der durchdrang. Ich glaubte ihn zu kennen; er gehörte dem Chef der hiesigen Fremdenpolizei. "Da gibt's bloß eine Lösung: zwangsweise Umsiedlung! Warum zum Teufel verteilt man sie nicht auf die übrigen Staaten?"
"Siebzigtausend sind schon verteilt worden..."
"Aber hunderttausend sind noch hier, und es werden täglich mehr!"
Eine metallische Stimme mischte sich ein: "Ich fürchte, das liegt außerhalb unserer Kompetenz. Ihre Führer wünschen keine Umsiedlung. Das würde Defätismus unter den Flüchtlingen erzeugen, während der Aufenthalt hier in Miami ihren Kampfgeist intakt hält." Die Tür sprang auf, der Leiter der Fremdenpolizei trat heraus, rot im Gesicht wie jemand, der beschimpft worden ist. Auf der Schwelle stand ein drahtiger kleiner Mann; mit einer katzenhaften Geste lud er mich herein.
"Nehmen Sie Platz", sagte die metallische Stimme. Sie gehörte einem konservativ gekleideten Herrn mit goldgefasster Brille, der auf einem Drehstuhl saß. Er machte eher den Eindruck eines Bankdirektors als den eines Detektivs. Er trug einen Anzug aus rostfarbenem Stoff, der zu dick war, als dass er hätte knittern können – und viel zu warm für Florida, selbst in einer Novembernacht wie dieser. Beim Sprechen lächelte er, doch sein Lächeln hatte nichts Fröhliches. "Mr. Varona, wann sind Sie eingewandert."
"Vor reichlich einem Jahr, Sir, im Oktober zweiundsechzig." Ich bemerkte, dass er Umschreibungen liebte. Wir galten ja nicht als Einwanderer – die Quote war längst ausgeschöpft –, sondern als "Gäste auf unbestimmte Zeit".
"Sie waren Offizier in der cubanischen Armee?"
"Ja, Sir. Leutnant in der Nachrichtentruppe.
"Luftnachrichten, nicht wahr?"
"Nein, bei einer Küstenschutzeinheit der Marine."
"Leutnant Varona, wie sind Sie zu uns gekommen?"
Meine Antworten mussten sämtlich in dem Aktenstück stehen, das vor ihm lag und in dem er ab und zu blätterte. Ich hatte sie oft genug gegeben und konnte den Anspruch erheben, ohne Vorbehalte betrachtet zu werden. Um das anzudeuten, zögerte ich absichtlich; dabei wurde mir der erstaunliche Rahmen bewusst, in dem das Verhör stattfand. Der Raum war ein Atelier mit lavendelfarbenen Polsterwänden, blitzenden Fotolampen, Dekorationsteilen und Stativen, der Sessel des Vernehmungsbeamten war ein Frisierstuhl für die Modelle. Für eine Sekunde stellte ich mir ihn darauf nackt vor, wie man ihm eine Perücke gab, ihn schminkte, und erschauderte bei dem Gedanken. Polsterwände und starke Lampen konnten auch der Polizei nützlich sein, da berührten sich die Branchen, das übrige wirkte absurd.
"Der Colonel hat Ihnen eine Frage gestellt", sagte der kleine Mann, der mich hereingewinkt hatte. Er stand jetzt neben mir und federte ungeduldig in den Fußgelenken, wie ein Läufer vor dem Start. Er trug Wildlederschuhe mit hohen Absätzen, sein Sakko war an den Seiten geschlitzt, und das Taschentuch steckte ihm im Ärmel, was mich gegen ihn einnahm. Immerhin hatte er mir enthüllt, dass sein Vorgesetzter Oberst war; das gab dem Fall das Gewicht zurück, das der leichtfertige Rahmen ihm zu nehmen schien. Womöglich leitete der FBI-Oberst eine Sonderkommission, die sich in großer Eile hier etabliert hatte. Das Bundeskriminalamt hatte nicht, wie die CIA, in den Großstädten ständige Filialen. Es stützte sich immer auf die örtlichen Polizeibehörden, deren technischen Beistand es brauchte und denen es dieses Provisorium verdanken mochte.
"Mr. Varona, können Sie mich verstehen, oder soll ich einen Dolmetscher rufen lassen?"
"Nicht nötig, Sir."
"Dann schildern Sie bitte die Umstände Ihrer Flucht."
"Im einzelnen, Sir?"
"Uns genügt jetzt eine Zusammenfassung."
Es war immer derselbe Trick, man ließ sich die Geschichte neu erzählen und hoffte auf Widersprüche, die todsicher einmal auftauchten, wenn die Darstellung nicht stimmte und nicht richtig ausgearbeitet worden war. "Gleich zu Beginn der Raketenkrise erhielt ich den Auftrag, einen Beobachtungsposten auf der nördlichsten Insel des Sabana-Archipels einzurichten. In Cardenas gab man mir ein Motorboot, ein Funkgerät und drei Mann. Weitere fünf Mann sollten folgen. Es ging damals alles drüber und drunter. Wir erwarteten eine Invasion. Während der Überfahrt wurde der Trinkwassertank leck. Die Insel war unbewohnt und ohne Trinkwasser. Ich setzte die übrigen dort ab, gab vor, von der Nachbarinsel Wasser zu holen, drehte aber in der Abenddämmerung um und hielt auf die Lichter der Blockadeflotte zu. Der Kreuzer 'Newport' nahm mich auf."
"Wie stehen Sie zu Castro?"
Vielleicht war die Frage nicht ernst gemeint, vielleicht sollte sie mich nur zum Reden bringen; aber sie war lästig. "Ich war zuerst begeistert von ihm", antwortete ich. "Wie fast alle."
"Was taten Sie bei der Schweinebucht-Landung?"
"Ich kämpfte vor Playa Girón gegen die Landungsbrigade. Ich zeichnete mich dabei aus und wurde zum Leutnant befördert."
"Sie sagen das ohne Bedauern."
"Ich nehme an, Sir, Sie wollen nur Tatsachen."
"Und plötzlich kehrten Sie Castro den Rücken?"
"Anderthalb Jahre später, Oberst. Inzwischen hatte sich einiges geändert. Die Kommunisten drängten sich vor, sie hatten Castro in der Hand. Das Regime zwang jeden zu freiwilliger, unbezahlter Arbeit. Dabei hungerten wir, es gab von März neunzehnhundertzweiundsechzig an nur noch fünf Eier im Monat, sechs Pfund Reis und zwei Pfund Fett pro Kopf."
"Sie sind kein Mann, der deswegen sein Land verlässt. Nennen Sie mir das wirkliche Motiv."
Die Herausforderung war klar, und ich ließ mich nicht lumpen. "Ich habe nicht von mir gesprochen, Sir. Meine Ernährung war drüben gesicherter als hier. Aber ich möchte Sie wieder sprechen, Oberst, wenn man Ihre Familie eine Zeitlang auf diese Ration gesetzt hat."
Überraschend sagte der Mann neben mir: "Die nördlichste Sabana-Insel hat eine Quelle. Wussten Sie das nicht?"
"Die Seefahrtsbücher behaupten es, aber die Quelle ist ein Entenpfuhl – ein Dreckloch, weiter nichts." Ich beschrieb Lage und Zustand der Wasserstelle. Sie wären keine Amerikaner gewesen, hätte die Schilderung des verschmutzten Wassers sie nicht überzeugt.
Der Oberst entnahm der silbernen Dose, die vor ihm stand, eine Zigarette, erhob sich aus dem Frisierstuhl und trat zu einem künstlichen Felsen, vor dem sonst die Modelle posierten. "Haben Sie im Laufe des letzten Jahres jemals Florida verlassen?", fragte er. Hinter ihm dehnte sich eine groteske Gebirgslandschaft; Geröll- und Eismassen quollen bis an die Wand, die mich an eine Steppdecke erinnerte.
"Ja, Sir", antwortete ich. "Sechs oder sieben Mal."
"Wo waren Sie da, und wann?"
"Auf den Bahamas und auf anderen Inseln; einmal in Puerto Rico. Zwischen Dezember und April."
"Und danach?"
"Danach waren diese Ausflüge unter Strafe gestellt, Sir. Bis zu fünf Jahre Gefängnis, nach den US-Neutralitätsgesetzen."
Er zündete die Zigarette an, wobei seine Hände eine Muschel formten, als müsse er die Flamme vor Wind schützen. Das Streichholz ließ er zu Boden fallen, wo es andere aufheben mochten. "Die Gesetze gibt es nicht erst seit April."
Das klang wie eine Warnung; es schien zu bedeuten, dass er über die Aktionen nichts zu hören wünschte, weil ihn das zwingen könnte, gegen mich zu ermitteln. Ich antwortete nicht, obgleich sich dazu manches sagen ließ. Vor elf Monaten noch war John F. Kennedy im Orange-Bowl-Stadion vor vierzigtausend Exilcubaner hingetreten, die Fahne der Landungsbrigade in der Hand, um unter tosendem Beifall zu rufen: "Ich versichere euch, diese Fahne wird der Brigade in einem freien Habana zurückgegeben werden!" Im April jedoch hatte Kennedy die CIA zurückgepfiffen und einen Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats herbeigeführt, der die Angriffe auf Cuba unterband. Sein Bruder Robert, der Justizminister, hatte das FBI beauftragt, nach illegalen Waffenlagern zu fahnden. Von da an wurde der See- und Luftraum vor Florida streng überwacht, und fünfundzwanzig maßgebliche Leute – darunter Héctor und Rafael – durften den Distrikt Miami nicht mehr ohne Polizeigenehmigung verlassen. Viele Emigranten empfanden das als Verrat, und sie hatten es dem Präsidenten nie verziehen.
"Mr. Varona, besaßen Sie oder einer Ihrer Landsleute hier irgendwann einmal einen Mauser-Karabiner vom Kaliber sieben Komma fünfundsechzig oder ein kleinkalibriges Mannlicher-Carcano-Gewehr?"
"Nein, uns interessierten nur Kaliber von zwanzig Millimeter an aufwärts."
"Wo waren Sie am Freitag voriger Woche, dem zweiundzwanzigsten November?"
"Hier in der Stadt, Sir."
"Sie sind jetzt ohne Beschäftigung, haben Sie einen Zeugen?"
"Nicht für die ganze Zeit. Morgens meine Zimmerwirtin... am Nachmittag ein Mädchen; abends im 'El Chico'..."
"Was taten Sie am Vormittag?"
"Nichts, Oberst. Aber Dallas liegt drei Flugstunden weg."
Diesmal kam sein Lächeln langsam. "Sie müssen ja nicht dort gewesen sein." Er blickte mich freudlos an, ein Mann ohne Trümpfe, der alles seiner Zähigkeit verdankt. "Aber wo waren Sie wirklich?"
"Ich bin herumgebummelt."
Der Kerl neben mir knipste eine der Fotolampen an und richtete sie auf mich; plötzlich prasselten die Fragen: "Sie erwähnten Ihre hungernde Familie. Die blieb da, während Sie emigrierten?" – "Wo waren Sie, als die Mordnachricht durchkam?" – "Wann haben Sie Castro durchschaut, was gab den Ausschlag?" – "Wer war das Mädchen vom Freitagnachmittag?" – "Die Hälfte der Aktionen, an denen Sie teilnahmen, soll gescheitert sein..."
"Wundert Sie das?", rief ich. "Ihr habt uns doch fallenlassen, habt uns bei Norman's Key sogar die Briten nachgehetzt..."
Der Oberst unterbrach mich. "Diese Passage löschen", befahl er seinem Assistenten; das Verhör wurde also aufgezeichnet. Es waren vor allem die Fragen dieses katzenhaften Helfers im geschlitzten Sakko, die mich störten. Keine wog, für sich genommen, besonders schwer, aber sie zielten wie gebündelte Pfeile alle in eine Richtung. Ich hoffte, dass er sie blind abschoss, wich ihnen so knapp wie möglich aus. Jemand hatte mir eingeschärft: Keine unnötige Auskunft, nie mehr sagen, als du musst.
5
Nach etwa vierzig Minuten – mir erschienen sie wie vier Stunden – öffnete sich eine der schmalen Türen, hinter denen ich Umkleidekabinen vermutete. Ein schlanker, sehr aufrechter Mann kam um die Bambusstangen herum, vorbei an den Schlingpflanzen, die diesen Teil des Raums in einen Dschungel verwandelten, und ließ sich auf einem türkischen Kissen nieder. Er trug kein Jackett, seine Hemdärmel waren umgeschlagen und zeigten viel Haar auf den Handgelenken. Die Lampe blendete, deshalb erkannte ich ihn nicht gleich, unseren Beschützer, den wir seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hatten: Major Malone oder wie immer sein echter Name lauten mochte, damals Leitoffizier im Cuba-Dezernat der CIA – es gab ihn also noch! "Major", sagte ich im Vorgefühl einer Chance, "erinnern Sie sich an mich? Leutnant Varona, Unternehmen 'Zuckerhut'..."
Er fixierte mich kalt, dann lächelte er den anderen zu. Mir war, als gebe er ihnen zu verstehen, dass er keinesfalls für mich bürgen werde, dass sie beliebig verfahren könnten.
"Sie wissen, Sir, ich bin für fast alles zu haben, solange es gegen Castro geht. Aber ein Präsidentenmord liegt nicht in meiner Linie – bitte, erklären Sie das Ihren Kameraden vom FBI."
"Schreien Sie hier nicht herum", sagte der Oberst.
Aber ich hatte genug, das Kreuzverhör war scheußlich, und ich fand ihre Taktik, ständig das Thema zu wechseln und alte Fäden wieder aufzunehmen, hinterhältig. Ich brauchte Malones Beistand. "Sie sollten etwas für mich tun, Major", rief ich ihm zu. "Wer tritt denn sonst für uns ein? Gibt's zum Beispiel einen Konsul? Wir haben doch niemanden mehr! Erst wird uns untersagt, eine Exilregierung zu bilden, dann bekommen wir keine Arbeit, dann werden unsere Aktionen gestoppt, und nun auch das noch, Mordverdacht..." Meine Stimme klang schrill, es musste ihm auf die Nerven gehen. "CIA, das hieß doch mal soviel wie 'Cuban Invasion Army'!"
Malone betrachtete mich mit der Miene eines Mannes, der gebeten worden ist, einen Preis für etwas zu nennen, das er nicht kaufen will. Hätte ich geahnt, woran er wirklich dachte, wäre ich wohl verstummt. So aber fuhr ich fort, ihn zu reizen: "Man könnte sagen, wir haben die Knochen hingehalten, Major. Siebzehnter März, das Feuer auf dem Zuckerfrachter 'Lgow', mitten im Hafen von Isabela. Zehn Tage später in Caibarién, die Sprengladung an der 'Baku', ein mannshohes Loch im Bug, haha! Und die vierzehntausend Sack Zucker von der 'Streatham Hill'?" Ich wandte mich an den Oberst. "Ein britischer Frachter, den die Sowjets gechartert hatten. Er war vor Puerto Rico auf ein Riff gelaufen und kam ins Dock; vorher musste er den Zucker entladen..."
"Halten Sie den Mund", fauchte der Kerl neben mir.
Der Major sah jetzt aus, als habe er von dem Zucker gekostet, den wir am Pier von San Juan, Puerto Rico, mit Chemikalien bestreut und hoffnungslos vergällt hatten. Es musste ihm peinlich sein, hier an Dinge erinnert zu werden, denen das Bundeskriminalamt nachzugehen hatte. Und nicht nur das, der Zuckercoup galt intern als schwerster Fehlgriff des Majors. Geheimdienstdirektor McCone war deswegen vom US-Präsidenten getadelt worden. Als nämlich Kennedy in der morgendlichen "Intelligence Check List" darauf stieß, befahl er, die Sache zu bereinigen: sonst drohe Vergeltung, ein chemischer Sabotagekrieg.
Es waren düstere Stunden für das Kommando Alpha. Süß machen konnten wir den Zucker nicht wieder, also musste Malone seine Verschiffung nach Leningrad verhindern. Er stoppte das Beladen der reparierten "Streatham Hill" durch einen rasch gelegten Brand und besorgte sich – im Namen des enteigneten Plantagenbesitzers – einen gerichtlichen Pfändungsbeschluss auf cubanisches Staatseigentum; der ehemalige Eigentümer saß in Miami. Alles vergebens, der Kreml protestierte beim State Department: Die Kauforder lautete "ab Habana", es war kein cubanischer, sondern russischer Zucker gewesen. Dem Major blieb nichts übrig, als einen Weiterverkauf der 14 000 Sack "zur Abdeckung der Lagergebühren" vorzutäuschen. Die CIA kaufte den verdorbenen Zucker selbst; manch kleineren Geheimdienst hätte das wohl ruiniert. Und noch prozessierte Moskau um eine weitere Million Dollar, der Weltzuckerpreis war inzwischen auf 13 Cents für das Pfund gestiegen. Eine schmähliche Geschichte. Malone konnte nicht wünschen, sie auch noch im FBI-Protokoll zu sehen.
Er musste mich einfach herausholen – und es geschah sofort. Malone selbst knipste die Vernehmungslampe aus. "Der Mann bleibt natürlich in der Stadt, Oberst, zu Ihrer ständigen Verfügung", versicherte er und winkte mir, ihm zu folgen.
Ich lief hinter meinem Retter her. Obwohl der Major sich sehr gerade hielt, war etwas Bewegliches an ihm, eine Lockerheit der Schultern und Hüften, so als boxe er oder sei mit der See vertraut. "Du hättest den Mund nicht so aufreißen müssen, Junge", sagte er auf der Schwelle und gab mir einen vertraulichen Stoß; das machte mich stutzig. Nahm er die kleine Erpressung nicht übel?
Im Vorzimmer wartete Héctor unter einem obszönen Foto, das ein kopfloses Mädchen zeigte. Er sprach auf einen Detektiv ein, wobei ihm die Zigarre als Zeigestab diente, als Verlängerung der kurzen Finger, mit denen er seinen Protest unterstrich. Vor Rafael hatten sie vielleicht haltgemacht, wegen seiner Verbindungen; aber Héctor saß hier und würde meine Erfahrung teilen.
"Grüßen Sie Rafael", sagte ich im Vorbeigehen. "Das Dinner war hervorragend."
"Wir sprechen uns noch, Tony", fauchte er.
Doch wir sollten uns niemals wieder sehen.
6
Manchmal im Leben kommt ein Augenblick, von dem an man nicht mehr umkehren kann; es geht dann nur noch vorwärts. Überseeflieger nennen das den "point of no return", den Punkt in der Mitte des Fluges. Ist er überschritten, wird jeder Versuch sinnlos, im Gefahrenfall zu wenden. Der Pilot kennt den Moment, er hat seine Karte. Gewöhnlich aber bleibt er einem verborgen.
Auch mir war nicht bewusst, dass ich diesen Punkt angesteuert hatte. Ich wollte, dass Malone mich aus der Mühle zog, und er tat es gründlich. Genauso entschieden hatte er damals gegen Héctors Widerstand meine Aufnahme in das Kommando durchgesetzt. Eine unpersönliche Zuneigung – sie ergab sich aus meiner Laufbahn, soweit er sie kannte. Die CIA bevorzugt drei Arten von Mitarbeitern: Intellektuelle, radikale Rechte und abtrünnige Linke aller Schattierungen. Ich war Student gewesen und – für Malone – ein ehemaliger Roter; das machte mich hinreichend interessant.
Nach meiner Erfahrung liebt der amerikanische Geheimdienst seine Eierköpfe aus zwei Gründen: Er hält sie für lebende Informationsspeicher, und er begreift sich selbst als einsamen Autodidakten, als den genialen, oft verkannten Ratgeber der Regierung, auf den sie nicht hört, weil er niemals Zeit fand, ehrbar zu werden und seinen Doktor zu machen. Das CIA-Management überspielt gern seinen Komplex. Es ist stolz darauf, dass es Professoren genug für eine ganze Universität hat. Die Hälfte der Leute im offiziellen Dienst hat einen akademischen Grad, ein Drittel hat promoviert. Der Apparat lechzt nach Spezialisten, nach wissenschaftlichen Helfern, nach Elektronik. Man pflegt den akademischen Jargon neben der Sprache Al Capones. Mit ehemaligen Batista-Männern wie Héctor sprach der Major knapp wie ein Gangster, für die anderen hatte er einen veredelten Wortschatz, mit Wendungen aus dem Reich der Kybernetik. Begriffe der Steuerungstechnik wie "Informationsfluss", "optimale Variante" oder "Verflechtungsmodell" gingen ihm da leicht von der Zunge.
Im Augenblick redete er gar nicht, sein Fahrer raste durch die Randbezirke. Es ging schon auf elf, ich fragte mich, ob er noch in die Dienststelle wollte. Rafael hatte einmal gesagt, die CIA unterhalte in mehr als dreißig amerikanischen Städten getarnte Residenzen. Ihre Telefonnummern sind unter "Central Intelligence Agency" aufgeführt, aber ohne Anschrift. Wer die Anschrift wissen will, muss den Namen des Direktors kennen. Von den Alpha-Leuten kannte ihn nur Rafael.
Der Wagen verlangsamte das Tempo, er glitt an einem drei Meter hohen, von einer Hecke durchwachsenen Maschendrahtzaun entlang. Auf ein Signal des Fahrers öffnete sich ein Gittertor; der Lichtkegel stieß, vom Regen schraffiert, gegen granitgraue Wände. Niemand erwartete uns. Ich glaubte eine Radioantenne zu sehen, doch die Garagentür rollte zu. Jetzt bellte draußen ein Hund.
Malones Arbeitszimmer im ersten Stock war kalt möbliert – Bürostahl, Schaumgummi, indirektes Licht –, aber so groß, dass zu vermuten war, er sei im Rang gestiegen. Hatte ihm die Zuckeraffäre denn nicht geschadet? Womöglich trug jemand in Washington die Verantwortung dafür, und mein Bohren vorhin in der Fotoschule hatte Malone gar nicht berührt...
Er setzte sich hinter den aufgeräumten Schreibtisch und drückte eine Sprechtaste. "Schicken Sie Doktor Stewart zu mir", hörte ich ihn sagen. "Ja, mit Gerät. Danach den Arzt. Inzwischen lässt Wyler einen Identitäts-Check machen zu Nummer..." Er nannte eine sechsstellige Zahl, ließ die Taste los und sah mich an. "Sie sind doch gesund, Tony, nicht wahr?"
"Absolut, Sir." Die Station schien vollbesetzt, um diese Zeit. Ein Einsatz, durchfuhr es mich, er schickt dich auf Einsatz, allein, ohne Alpha! Das hatte es noch nie gegeben. Und es war gut für mich, ich musste heraus, Rafael wurde gefährlich, ebenso das FBI. Aber Malone hatte doch versichert, ich bliebe in der Stadt? Die Art allerdings, in der er herumkommandierte, wies ihn als Mann aus, der sich über die Polizei auch hinwegsetzen konnte. Mir kam der Gedanke, er selbst könne hier Resident geworden sein, "Chief of Station", wie sie es nannten. Und nun entdeckte ich auf der blanken Tischplatte einen Beweis. In den goldenen Aschenbecher war ein Bibelspruch eingraviert: "Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Joh. 8, 32". Wer solchen Text zur Schau zu stellen wagte, war Boss.
7
Dr. Stewart war ein hagerer Mann mit langen, nervösen Fingern. Als Vollakademiker gehörte er sicherlich zur mittleren Gehaltsklasse; die Leute im inneren Dienst beziehen zwischen 4000 und 21 000 Dollar im Jahr. Urlaub, Versicherung und Altersversorgung gleichen denen der Staatsbeamten, doch können sie stündlich ohne Angabe von Gründen gefeuert werden. Dr. Stewart sah aus, als sei er sich dessen ständig bewusst.
"Ich möchte in der Lage sein, einen Bericht über Sie zu schreiben, der ein gutes, sauberes Bild besonders hinsichtlich Ihrer Aufrichtigkeit gibt", sagte er, während er den Apparat aufstellen ließ. Seine Stimme war so dünn und gebildet wie der ganze Mann, ohne Ausdruck und Gefühl. "Wenn Sie mir dabei helfen, Tony, werde ich immer voll und ganz hinter Ihnen stehen."
"Ist das ein Lügendetektor, Sir?"
"Wir sagen Polygraph dazu." Dr. Stewart hüstelte trocken und griff nach einem Gummischlauch, an dem ein Kabel hing. Sein Assistent stöpselte es ein. Malone hatte den Raum verlassen. Er mochte hinter dem Wandspiegel stehen, der bestimmt nur auf einer Seite als Spiegel wirkte. Wahrscheinlich aber kümmerte er sich um die "background"-Ermittlung und den Identitäts-Check.
"Dies ist ein wissenschaftliches Gerät, das unfreiwillige Veränderungen im menschlichen Körper anzeigt, falls jemand die Unwahrheit sagt", bemerkte der Assistent recht formelhaft. "Es reagiert in unserer Hand mit absoluter Genauigkeit." Das klang nicht überzeugend – die üblichen Einleitungsphrasen, mit denen sie klarmachen wollten, dass ihr Apparat unfehlbar sei.
Wir setzten uns.
"Ein hübscher transportabler Kasten", sagte Dr. Stewart im Plauderton. "Vor vier Jahren flog einer meiner Kollegen damit von Tokio nach Singapur. Er kam gerade noch rechtzeitig in sein Hotelzimmer, um eine Verabredung einzuhalten. Er schloss das Gerät an die überlastete Stromleitung – es gab einen Kurzschluss, im ganzen Hotel ging das Licht aus."
Ich lächelte höflich, der Assistent kicherte, obschon er die Geschichte kaum zum ersten Mal hörte. "Das Ergebnis war ein Skandal", fuhr Dr. Stewart fort, "der unseren Botschafter in größte Verlegenheit brachte, London in Wut versetzte und Dean Rusk zwang, sich schriftlich bei Singapurs Premier zu entschuldigen."
"Was passierte Ihrem Kollegen?", fragte ich.
"Als es zum Kurzschluss kam, wurden er und sein Helfer entdeckt, dazu der Agent von MI sechs, den sie anwerben sollten. Die drei fanden sich im Gefängnis wieder. Angeblich sind sie gefoltert worden. Es war dann von einem Lösegeld die Rede, aufgemacht als Zuschuss zur Wirtschaftshilfe... Natürlich wurden sie entlassen."
Er sprach ungezwungen, wie zu einem Gleichgestellten, und schien es zu genießen, dass sein Apparat nicht in Singapur stand. Es war wie ein Wechselbad von Strenge und Entkrampfung.
"Wir sind alle keine Engel", erklärte der Assistent großzügig. "Jeder von uns hat so seine persönlichen Geheimnisse; die wollen wir gar nicht hervorlocken."
"Wir ersuchen Sie nur, ganz ehrlich zu sein", sagte Dr. Stewart. "Jetzt nenne ich Ihnen einige der Fragen, die Sie später gestellt bekommen. Können Sie eine davon nicht uneingeschränkt wahrheitsgemäß beantworten, so sagen Sie es mir, und ich will dann versuchen, die Frage anders zu formulieren."
Das klang sehr entgegenkommend; es gab mir die Möglichkeit, vorweg ein freiwilliges Geständnis abzulegen, in milderem Klima. Vor einem Jahr im Aufnahmelager waren sie nicht so raffiniert gewesen. Auch ohne Detektor hatte der Test schon begonnen.
"Tony, Sie sind achtundzwanzig?"
"Ja, Sir."
"Zur Zeit in guter körperlicher Verfassung?"
"Unbedingt."
"Nervliche Schäden, sind die vorhanden?"
"Ich nehme an, nein."
"Verheimlichen Sie Ereignisse oder Veranlagungen, derentwegen Sie erpresst werden könnten?"
"Keineswegs."
"Beunruhigen Sie manchmal Gefühle der Einsamkeit, Schuldgefühle, Angstträume?"
"Sehr selten."
"Wie oft haben Sie unter Verdauungsstörungen zu leiden?"
"So gut wie nie."
"Schon mal tüchtig betrunken gewesen?"
"Nein, Sir."
"Ihre Familie lebt in Cuba?"
"Ja."
"Sie stehen nicht mit ihr in Verbindung?"
"Kaum. Gelegentlich ein Lebenszeichen."
"Sie haben Journalistik studiert?"
"Ja – ohne Abschluss; ich wurde Soldat."
"Weshalb möchten Sie für uns arbeiten?"
"Ich bin hergekommen, um zu kämpfen."
"Haben Sie noch andere Gründe?"
"Gut – ich liege hier auf der Straße."
"Verbinden Sie persönliche Ziele mit einem solchen Einsatz?"
"Ja, Sir. Wenn es klappt, hoffe ich auf ein Stipendium."
"Verbergen Sie etwas vor uns, was in der Befragung nicht berücksichtigt wurde?"
"Nein, nicht, dass ich wüsste."
"Okay."
Sie begannen, mir ihr Gerät zu erklären – den ziehharmonikaähnlichen Schlauch zur Atmungskontrolle, die Manschette zum Messen von Blutdruck und Puls, die Elektroden für Schweißabsonderung. Ein Ritus der Einschüchterung wie das Vorzeigen des Folterwerkzeugs im Mittelalter. Der Assistent legte mir den Schlauch um die Brust und bat mich, den linken Ärmel hochzurollen. "Bald kommt ein verbessertes Modell", sagte er wie ein Vertreter. "Es registriert auch die Hirnströme und den Lidschlag..." Er zog die Manschette an und klemmte die Elektroden an meinen Händen fest.
Nun wurde es ernst. Ich konnte sehen, wie die drei Schreibstifte auf dem Messpapier zitternde Linien zogen. Sie drehten meinen Stuhl herum, so dass ich die Wand anstarrte, und befahlen mir, mich nicht zu rühren. Eine jähe Hitzewelle ging über mich weg. Nach allem, was im "El Chico", im "Garten" und beim FBI geschehen war, konnte ich nicht mehr in bester Verfassung sein.
"Tony, sehen Sie sich jemals eine Fernsehsendung an?"
Anscheinend eine Testfrage, um den Normalausschlag der Nadeln zu bekommen.
"Sahen Sie zufällig, wie Ruby den Oswald niederschoss?"
Mein Gott, fingen Sie hier auch noch damit an?
"Wie viel Mädchen hatten Sie schon in Miami?"
Wozu das jetzt? Die Fragen flogen von hinten auf mich zu, ich sah sie nicht mehr kommen. Ich machte mir klar, dass der Detektor etwas völlig Normales war, ein Teil des amerikanischen Alltags. Vor ein paar Jahren noch hatte ihn nur die Polizei benutzt, heute siebte die Industrie damit Bewerber aus. Viele große Firmen schnallten ihr leitendes Personal regelmäßig auf den Stuhl.
"Weshalb wollten Sie vorhin den Eindruck erwecken, das Gerät nicht zu kennen? Sie wurden doch vor einem Jahr mit dem Polygraphen durchleuchtet!"
"Stehen Sie mit Ihren Leuten in Verbindung?"
"Auf welchem Umweg verkehren Sie mit Ihrem Land?"
Es fiel mir plötzlich schwer, mich auf die Fragen einzustellen. Wir hatten das zu Hause oft geprobt, sogar mit demselben Detektortyp. Aber hier war es anders – der Unterschied zwischen Manöver und Krieg. Ein paar Schweißtropfen rannen mir über den Rücken, kitzelnd und kalt wie Schrot. Nicht an Habana denken, auch wenn sie gar nichts konnten, am wenigsten Gedankenlesen. "Und werdet die Wahrheit erkennen..." Sinnlos wiederholte ich den Satz, Malones Motto ging einfach nicht aus meinem Kopf.
"Tony, was verheimlichen Sie uns?"
"Sagt Ihnen der Name Lopez etwas?"
"Fühlen Sie sich müde, schlapp, nervös?"
"So, als ob Sie aufgeben sollten?"
"... und die Wahrheit wird euch frei machen." Dr. Stewarts Hüsteln, dann das Geräusch reißenden Papiers. Jemand schnallte mich los.
"Das sieht aber gar nicht so gut aus", hörte ich den Assistenten sagen. Er kam hinter dem Tisch hervor und raschelte mit dem Kurvenpapier. "Sir, sehen Sie einmal den Impuls bei vierzehn, dann bei zweiundzwanzig und bei vierzig! Eindeutig Schock, Herzreaktion und Schweißausbruch. Dieser Impuls kam bei der Frage: 'Was verheimlichen Sie?' Da geht der Ausschlag bis an den Rand."
"Tony", riet Dr. Stewart, "geben Sie's auf. Ihre Kurve ist schrecklich. Sie können dieses Instrument nicht überlisten. Es hat Sie überführt."
Auch das gehörte dazu, sie spielten das Stück komplett durch. Es war wie in einem der knallharten Schocker aus dem Regionalprogramm, und ich wusste, es musste so sein. Dann war es vorbei, sie boten mir etwas zu trinken an, das ich ablehnte, und eine Zigarette, die ich nahm. Ein paar ihrer Fragen steckten mir wie Pfeile im Fleisch, doch sie ahnten nicht, welche.
8
Malone brachte den Arzt mit, einen Mann meines Alters, flink, rothaarig und sommersprossig. Sie sprachen lebhaft miteinander, in dem üblichen Jargon. "Das Image der Agency in diesem Teil der Welt könnte kaum schlechter sein", hörte ich den Arzt sagen. Anscheinend hielt sich das Gespräch auf wissenschaftlicher Ebene.
"Immerhin wird deutlich", bemerkte der Major, "dass man strukturelle Probleme nicht mit Geld allein lösen kann.
Das führt zu motivierter Schwäche, Doc. Es müssen dauerhaftere Formen des Einflusses gefunden werden."
"Na, ich denke, Sir, mit Dollars und Cadillacs haben wir die anderen Interessenten dort noch immer überspielt." Der Arzt öffnete seine Tasche und entnahm ihr mehrere Instrumente, darunter einen kleinen Hammer. "Die Stimmen für Cyrille Adoula wurden doch damals auch von uns zusammengekauft."
"Gekauft?" Malone lachte kurz. "Die kleinen Häuptlinge vielleicht. Die großen kann man nicht mal für einen Nachmittag mieten."
Dieser Absturz war typisch für ihre Unterhaltungen. Von den Höhen bürokratischen Gedankenaustauschs fielen sie jäh in den Stil Chicagos. Da ich nicht wusste, wovon sie sprachen, achtete ich auf die Ausdrucksweise, den Unterton. Der Major wirkte aufgeräumt, gelöst, so als ginge es ihm nach Wunsch. Jetzt drehte er sich zu der Detektormannschaft um, die eben ihren Koffer schloss. "Nun, wie sind Sie mit Tony zufrieden?"
"Das detaillierte Gutachten liefern wir in einer Stunde, Sir", antwortete Dr. Stewart. "Sein Intelligenzquotient liegt ungefähr bei hundertneunzig."
IQ 190 – 40 Punkte oberhalb der Geniegrenze! Das klang schmeichelhaft, war aber offenbar ein Code, der alles Mögliche bedeuten konnten. "Hundertneunzig", wiederholte Malone ohne besonderen Ausdruck. "Danke, meine Herren, das wär's!" Die Mitteilung schien ihm zu genügen. Er setzte sich auf den Schreibtisch und zog die Beine an, eine recht leichtfertige Haltung für einen Mann seines Ranges.
Die Detektorleute gingen, der Arzt fing an, mich abzuklopfen. Dann lauschte er meinem Herzschlag – vielleicht nur eine Formalität, doch man hätte sich die Mühe gespart, wäre der Test schlecht ausgefallen. "Ist Ihnen die Gallenblase entfernt worden?". fragte er.
"Nein, Sir, ein Steckschuss; vor zweieinhalb Jahren."
Er drückte auf der Narbe herum und brummte etwas Kritisches über die cubanische Chirurgie. Malone sah auf die Uhr. Ich hatte den Eindruck – oder redete mir ein –, dass auch das Übrige günstig verlaufen sei: die Identitätskontrolle und die Hintergrundprüfung. Meine Identität stimmte, dennoch war ich beunruhigt. Tarnung ist nie Lüge, nur Verlängerung der Wahrheit, aber irgendwo sitzt der Knick. Hatten sie die Bruchstelle entdeckt? Niemand wusste, was sie inzwischen an neuem Material angehäuft hatten, an Protokollen, in denen mein Name stand. Nur am Rande vielleicht, als Mosaikstein, der entweder in das bestehende Bild passte oder nicht. Auch Malone hatte es vorhin noch nicht gewusst. All die Cubaner, die seit März durch das Aufnahmelager geschleust worden waren: Ein paar davon mussten mich kennen, aus der Straße, von der Universität oder der Armee. Ein Computer hatte das Archiv sekundenschnell nach mir durchforscht, die Hinweise zusammengestellt, und man hatte sie Malone im Extrakt vorgelegt.
"Tony", sagte er, während der Arzt meinen Kniereflex prüfte, "Sie beklagen sich – keine Arbeit, keinen Einsatz, auf Eis gelegt, nicht wahr?"
"Genauso ist es doch, Sir."
"Brauchte es aber nicht. Es muss ja nicht immer Castro sein..." Er wandte sich an den Arzt: "Lassen Sie sein Knie heil, Doc, kann sein, er will noch mal auf Berge klettern."
"Ich bin gleich mit ihm fertig, Sir."
Es ging schon auf Mitternacht. Warum taten sie alles auf einmal, wozu diese Hast? Plötzlich verstand ich, dass Malone mich in ein fremdes Land schicken wollte und es furchtbar eilig hatte. Es muss nicht immer Castro sein... Was sonst sollte das bedeuten? Die Möglichkeit erschreckte mich. Niemand hatte sie vorausgesehen, als ich von Habana wegging. Damals gab es täglich konterrevolutionäre Aktionen, vielgestaltiges Vorspiel zur großen Invasion. Ich sollte herausfinden, wann und wo Überfälle drohten, eine andere Art Einsatz war keinem von uns in den Sinn gekommen. Ich hatte keinerlei Weisungen für diesen Fall. Zum Teufel, was tun, wenn er mir ein solches Angebot machte?
"Major", fragte ich, "soll es nicht gegen Castro gehen?"
"Wir haben auch da bald wieder grünes Licht."
"Ist Cuba jetzt nicht mehr Ihr Sachgebiet, Sir?"
"Tut mir leid, Tony, ich kann Ihnen unmöglich hier das Organisationsschema geben."
"Es täuscht sicherlich", sagte der Arzt, "aber Sie sind nicht in der Mayo-Klinik."
Wohin wollten sie mich schicken? Auf Berge klettern... Mir fiel der Kongo ein; aber gab es da Berge? Sie hatten vorhin Adoula erwähnt, den dortigen Regierungschef. In Miami hielt sich das Gerücht, die CIA werbe Piloten an für Übersee. Alberto war kürzlich spurlos verschwunden, und dann kam von ihm eine Postkarte aus Léopoldville. Das alte B-26-Personal, das in der Schweinebucht versagt hatte, sollte befragt worden sein, ob es sich Versorgungsflüge für südafrikanische und rhodesische Söldner zutraue; man habe praktisch die Luftherrschaft. Cubaner auf Kampfeinsatz im tiefsten und dunkelsten Afrika! Das Spiel der Agency war maßlos und schwarz wie der Kongo selbst; man schrieb ihr allgemein die Ermordung Lumumbas und die Verhaftung Gizengas zu. Sie hatte Adoula lanciert, der mit der Ostprovinz nicht fertig wurde, und demnächst würde sie auf Tshombe setzen; von ihm erhoffte man sich mehr.
"Ziehen Sie sich an", sagte der Arzt und packte seine Instrumente ein. Nein, es konnte sich nicht um den Kongo handeln. Ich war kein Pilot, ich sprach nicht französisch, und Malone hatte wohl auch nichts damit zu tun. Afrikanische Unternehmungen wurden schwerlich von Miami aus gelenkt; er sah aber aus, als sei er dabei, etwas zu starten und zu steuern. Sie sprachen außerdem von Dingen, die sie selbst dirigierten, nie im Klartext. Sie hätten Adoula nicht beim Namen genannt, sondern ein Tarnwort für ihn gehabt: unser Freund im Süden oder der Kupferscheich am Fluss; das etwa war ihr Stil.
Ein wenig atmete ich auf. Aber was planten sie wirklich, und wie sollte ich mich herauswinden? War das überhaupt möglich, und war es wünschenswert?
9