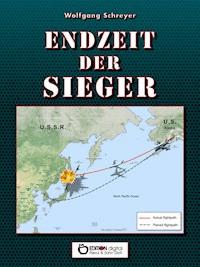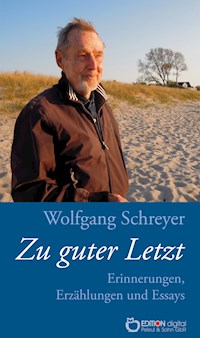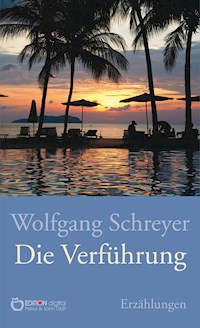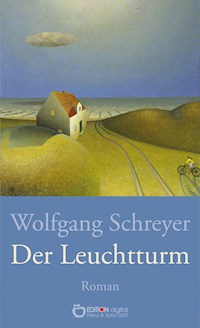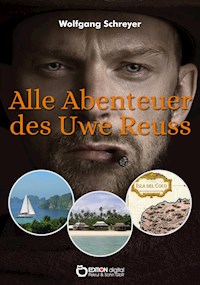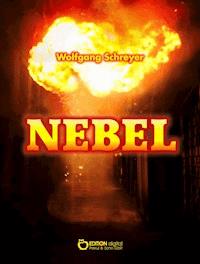
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Wer mit Sprengstoff hantiert, der fliegt leicht selber in die Luft", hatte der Schriftsteller Richard Nebel kurz vor seinem plötzlichen Tod zu dem Kriminalisten Wendt gesagt. Hatte er da vielleicht auch an den Stoff für seinen geplanten Politthriller gedacht? Dann hätte ihm das Wissen um die Gefahr allerdings wenig genützt. Christian Wendt jedenfalls hat Zweifel an einem Unfalltod Nebels und mit einem Mal den Verdacht, dass in dem Land, dem er mit Leib und Seele dient, das staatlich organisierte Verbrechen längst eine feste Größe ist. Christian Wendt, mit Leib und Seele Polizist, schließt ein Verbrechen nicht aus und gerät bei dem Versuch, zwei Herren zu dienen - der Wahrheit und seinem »Staat« -, in ein Netz von Erpressung und Betrug, Lüge und Mord, von Bestechung und Angst und schließlich in die Fänge jener Organisation, der womöglich auch Nebel zu nahe gekommen ist. Das erstmals 1991 veröffentlichte Buch (das zweite über Kriminalkommissar Wendt) war das erste, dass die 1989/1990er Ereignisse in der DDR noch einmal hautnah miterleben lässt, in der von Wolfgang Schreyer gewöhnten Spannung und Detailtreue.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Nachwort
Wolfgang Schreyer
E-Books von Wolfgang Schreyer
Impressum
Wolfgang Schreyer
Nebel
Kriminalroman
ISBN 978-3-86394-817-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1991 im Verlag Das Neue Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. - Aber wo geht sie hin? Ja, wo geht sie wohl hin? Irgendwo geht sie doch hin! Der Polizist geht aus dem Haus. - Aber wo geht er hin? usw.
Bertolt Brecht
Der Skandal beginnt, wenn die Polizei ihm ein Ende macht.
Karl Kraus
1. Kapitel
Eine Woche nach Pfingsten, am Montag, dem 22. Mai 1989, wurde Hauptmann Christian Wendt zu seinem Vorgesetzten bestellt, dem Leiter des Dezernats II (Untersuchungen) der Kriminalpolizei des Bezirkes Rostock. Oberstleutnant Fink eröffnete ihm, er müsse gleich mal für Major Grote einspringen, das Haupt der Pressestelle, und einen Romanautor namens Richard Nebel empfangen. Der sei mit Grote um elf verabredet, und leider habe Grotes Sekretärin übersehen, dass heute dessen Lehrgang begann, die Schulung in puncto Öffentlichkeitsarbeit. Verschieben lasse sich der Termin nicht mehr. Man habe versucht, Nebel noch zu stoppen, doch der hebe nicht ab, sei also schon unterwegs. Und wegschicken könne man ihn schlecht, er komme aus Cumin im Landkreis N., drei Stunden Fahrt für den Mann.
»Worum geht es ihm denn?«, fragte Wendt lustlos. Bei ihm häufte sich die Arbeit, Finks Tisch hingegen war wie üblich spiegelblank, bis auf das Telefon und den Halter für seinen Tagesplan so aufreizend leer, als würde dort ab und zu ein Flugzeug landen ... Leute mit leerem Schreibtisch waren Wendt verdächtig. Entweder stopften sie alles in die Schubladen, um souverän zu wirken, oder auch die waren leer, und wozu brauchten sie dann einen Schreibtisch?
»Na, warum schon«, sagte Fink. »Um ein bisschen Fachkram. Damit sie die gröbsten Fehler vermeiden, mit etwas Wissen glänzen und dazu noch erzählen können, wir billigten ihr Zeug. Es legitimiert sie vor ihrem Verlag und den Lesern, glaube ich. Sie kennen doch die Brüder.«
»Ich hab' vor Jahren mal einen Drehstab beraten.«
»Ganz abgesehen davon, was so ein Künstler von uns will, wir haben auch ein Ziel dabei. Und zwar ein ernsthafteres als jemand, der darauf aus ist, seinem Affen Zucker zu geben.«
»Nämlich?«, fragte Wendt, obgleich er wusste, was kam.
Ein Lächeln glitt über Finks rundes, straffes Gesicht. Dann sah er wieder gequält drein, als hätte ihm der Chefarzt des Polizeikrankenhauses gerade einen schlimmen Befund mitgeteilt - chronische Fettsucht zum Beispiel. »Der Mann sucht Nervenkitzel, damit verdient er sein Geld. Wir aber informieren ihn über die Wirksamkeit unserer Arbeit, damit das, was er daraus macht, den Eindruck vermittelt: Verbrechen lohnt sich nicht, die Polizei kommt stets dahinter! Genosse Wendt, heutzutage sollten wir jede Chance nutzen, darauf Einfluss zu nehmen, wie man uns in der Öffentlichkeit darstellt. Das ist unser Ziel bei jedem derartigen Gespräch. Ich bin sicher, Sie sind dafür bestens motiviert.«
Wendt sagte nichts. Es gab Aussprüche, die ließen keine Antwort zu. Der Oberstleutnant plusterte sich wieder einmal auf. Er nannte Motivation, was sonst Überzeugung hieß. Verkündete Bekanntes und folgte seiner Gewohnheit, dies durch Klopfzeichen zu unterstreichen, als seien es Worte von hohem Erkenntniswert. Er hatte kurze, kräftige Finger, an den Kuppen stempelartig verdickt. Ihr Pochen gab seinen Mitteilungen stets etwas Endgültiges, die Weihen psychologischer Führungskunst. Mit einiger Menschenkenntnis hätte ihm aber klar sein müssen, dass solches Getue seinem Vortrag die Wirkung nahm. Neben dem Mangel an Denkvermögen und Originalität. Nicht nur Finks Schreibtisch, auch sein Kopf war aufgeräumt - die Prinzipien hübsch darin verteilt, ansonsten eher leer.
»Also, ich verlasse mich auf Sie.«
Das klang abschließend, der Hauptmann stand auf. Öffentlichkeitsarbeit gehörte nicht zu den Aufgaben eines Leiters der Morduntersuchungskommission, doch war Widerspruch zwecklos.
»Wie steht es mit den Schmierereien?«, fragte Fink. »Kommen die Ermittlungen voran?«
Wendt blieb stehen. Auch etwas, was man ihm aufgehalst hatte. Drei Wochen nach den Kommunalwahlen tauchten vereinzelt Parolen auf, nachts an irgendwelche Wände gesprüht (das Kurhaus von Cumin fiel ihm ein). Sprüche wie Gorbi, hilf, die Perestroika forderten oder auf ungelenke Art das Wahlergebnis in Zweifel zogen. Und obwohl sich schon die Genossen der Staatssicherheit darum kümmerten, drängte Fink darauf, denen zuzuarbeiten und einen sichtbaren Beitrag zu leisten durch eigenes Nachforschen, Spurensicherung seitens der Kreisämter, den Einsatz von Fährtenhunden. Festnahmen mit all dem Papierkram, der sich bei ihm staute, als gäbe es nichts anderes zu tun. - »Nichts Neues«, meldete er. »Sämtliche Inschriften sind entfernt und zwei der Schmierer gefasst worden.«
»Das reicht mir nicht. Kein befriedigendes Resultat! Das schreckt keinen ab. Bei dieser Dunkelziffer darf es uns nicht wundern, wenn die Sache eskaliert, ich sage Ihnen, wir müssen die Aufklärung intensivieren.«
»Die K-Leiter in den Kreisämtern tun ihr Bestes.«
Wendt nahm wieder Platz und ging, wie gewünscht, ins Detail. Knapp ein Dutzend Fälle, die hatte er parat. Und während er dies vortrug, war ihm, als höre er Jenny, seine Ehefrau, wieder sagen: Ihr denkt, da steckt wer weiß was dahinter, dabei geschieht es spontan, ohne zentrale Weisung, meiner Ansicht nach ... Mir ist allerdings klar, warum das nicht in euren Kopf geht. Ihr seid Geschöpfe einer straffen Organisation, der Polizeibürokratie. Da denkt ihr euch den Gegner halt als Mitglied eines ähnlichen Vereins, das macht es irgendwie erträglicher, ja? Es gibt euch die Hoffnung, den Kampf zu gewinnen, wenn ihr das kriminelle Haupt aufspürt, das nach eurer Vorstellung die Befehle erteilt und das Geschehen in der oppositionellen Szene lenkt.
»Sind Sie fertig?«
Wendt merkte auf. Der Ton verriet ihm, er hatte etwas davon einfließen lassen - die Spur eines Zweifels an der Organisiertheit, an der hierarchischen Ordnung beim Feind. »Nein, Genosse Oberstleutnant. Aber ich mache gern Pause, wenn Sie etwas sagen wollen.«
»Nur ein persönliches Wort zum Schluss.« Fink senkte die Stimme. »Zufällig sah ich neulich Ihre Gattin draußen auf Sie warten.« (Unheimlich - als könne er Gedanken lesen.) »Mit einer Plakette am Revers. Sie wissen schon, diesem Gorbatschow-Kopf, und zwar extragroß. Erscheint Ihnen das als passend bei der Frau eines Offiziers in verantwortlicher Position?«
»Ich hab's ihr nicht ausreden können. Es ist unser bester Freund, hat sie mir gesagt.«
Fink nickte düster, als habe sich ihm ein Verdacht bestätigt. Der Verdacht, man habe die eigene Frau nicht im Griff und sei machtlos gegen solch eine Provokation. Aus seiner Sicht erübrigte sich da jeder Kommentar. »Danke«, sagte er, »das war alles.«
Bis zur Tür spürte Wendt den Blick in seinem Rücken, die Missbilligung. Finks Fischaugen, wässrig grau - nun, die hatte er nie gemocht. Und der Kopf über dem stumpfbraunen Anzug mit Schlips und weißem Hemd - blass, in gesundes festes Fett verpackt; weiß Gott kein angenehmes Gesicht. Ein schwieriger Vorgesetzter, der ihn wenig schätzte. Die Leistung wohl noch, kaum die Person. Eigentlich schon immer und besonders seit der Heirat mit Jenny im April.
Tatsächlich. Fink hatte seine Wahl missfallen. Er ließ ihn merken, was er von der Ehe eines Offiziers der K mit einer Vorbestraften hielt. Jennys Verurteilung wegen der zwei Einbrüche, von ihm selbst aufgedeckt, lag fünfeinhalb Jahre zurück. Für den Oberstleutnant offenbar so etwas wie eine Bombe mit Zeitzünder, der noch tickt. Als könnte sie jederzeit rückfällig werden und den Ruf der Behörde beschmutzen.
Und in diesem Moment, hier im Korridor auf dem Weg in sein Dienstzimmer, dämmerte Wendt, die zwanzig Monate Haft, restlos von ihr verbüßt, führten offenbar gegen jede Vernunft zu einem Karriereknick bei ihm. Seit 15 Jahren war er Hauptmann der K und würde es auch bleiben. Obwohl niemand das zugab, Jennys Delikt wirkte sich auf seine Laufbahn aus. Unter Fink und seinesgleichen stieg er in der Behörde nicht mehr auf ... Zwar lag er mit seinen Ergebnissen als Leiter der Morduntersuchungskommission ziemlich vorn, im Urteil vieler Genossen. Um aber befördert zu werden, so wurde ihm angedeutet, hätte er sich in einem Lehrgang qualifizieren müssen. Wie der stramme Major Grote, den er jetzt vertreten durfte.
Mit anderen Worten, man ließ ihn nicht hochkommen. Das folgte allein schon aus den Regeln der formalen Logik. Da er nämlich, Spitzenmann seines Fachs, den Lehrgang selbst hätte abhalten müssen, schien für ihn das Ende der Fahnenstange erreicht. Kein Mensch konnte Vorträge halten und zugleich lernend daran teilnehmen. Alles sprach gegen sein Fortkommen - die formale Logik, das dialektische Wechselspiel von Ursache und Wirkung sowie auch »das Räderwerk der Bürokratie«, wie es in Jennys Sprache hieß.
Aber er würde es überstehen. Nicht aus jedem Hauptmann wurde ein Major. Je höher man stieg im Apparat, desto intensiver der Papierkrieg, der einen von den wirklichen Dingen fernhielt. Von der operativen Arbeit, die ihm Befriedigung bot, sooft sich ein Erfolg einstellte. Er liebte seinen Beruf, seine Frau und diese Stadt; würde also auch nicht, wie damals nach der Scheidung von Helga, um Versetzung bitten. Kein Mensch war allzeit auf Rosen gebettet.
2. Kapitel
Wenn es stimmt, dass Richard Nebel bereits über 60 ist, dachte Wendt, dann wirkt er für sein Alter noch recht frisch. Mit dem Vollbart, grau durchsetzt, mochte er zwar einer von denen sein, die da etwas verbargen, unschöne Zähne etwa oder die Neigung, spöttisch zu grinsen. Aber er war drahtig, er trug Jeans und eine blaue Jacke, die Jugend vortäuschte und gleichsam hier komme ich pfiff. (Ringsum erging man sich ja von Amts wegen in mutlosen Grautönen oder stieg gar, wie der K-Leiter, in seriöses Kakaobraun mit Nadelstreifen.) Nebel roch nach Kiefernholz, er hatte ungeputzte Schuhe und den Teint eines Menschen, der viel Zeit im Freien verbringt. Hinter seiner runden Nickelbrille, auch sie eine Abweichung vom Erscheinungsbild seiner Generation, glänzten graugrüne Augen. Die Lider hingen schräg, was ihm etwas Verschmitztes gab.
Der Mann wirkte ganz locker und spontan. Unfeierlich sprach er drauflos, ohne erkennbare Taktik. Von ihm ging wenig Würde oder Ehrgeiz aus. Nebel tat, als kenne er kein Tabu, als gelte für ihn allein das Lustprinzip, beruflich wie privat. Alles machte ihm Spaß, er war kein aggressiver Mensch, und seine Eitelkeit war schwach entwickelt oder gut versteckt. Es störte ihn offenbar kaum, dass Wendt von seinem Werk außer einem Mafiaroman fast gar nichts kannte. Er schien mehr darauf stolz zu sein, dass er noch so fit war, so vital. Er gestikulierte lebhaft, als habe ihn beim Schreiben des Romans die Mentalität der Sizilianer angesteckt. Sprach er von Problemen beim Recherchieren, bei der Materialbeschaffung - andere Schwierigkeiten gab es für ihn nicht -, verdrehte er zum Beispiel die Hände wie beim Öffnen einer Thermosflasche. Fakten, an die er schwer herankam, schienen für ihn Leckerbissen, die wahren Freuden des Lebens zu sein.
Wendt studierte ihn mit Sympathie, nicht ohne Sinn für die Komik der Szene. Der Autor versuchte, klarzumachen, wie wichtig Unterstützung für ihn sei, wenn er nun von Palermo nach Rostock ging mit den Kindern seiner Fantasie. Das unterstrich er durch Gebärden, dabei glitt sein Ärmel zurück, es blinkte am Handgelenk ein Goldkettchen, nicht recht passend zur Erscheinung (zu seinem Look oder Outfit, hätte Jenny gesagt). Es amüsierte Wendt, am Rande doch das aufleuchten zu sehen, was Nebel sorgsam heraushielt aus seinem Auftritt. Das Dandyhafte des Künstlers lugte da hervor! Dieser alleinstehende Mann vom Jahrgang 1927 wollte durchaus noch gefallen, wem wohl, wenn nicht Frauen? Vielleicht war's auch bloß ein Strohhalm, nach dem er griff. Das Kettchen zeugte von Widerstand: gegen sein Altern, die Müdigkeit, das Vergessenwerden; letzten Endes gegen den Tod. Jeder brauchte eine Illusion.
»Ich kann Ihnen natürlich zu Akteneinsicht verhelfen«, sagte Wendt, belustigt durch die Gier des Mannes, nach Schwerkriminalität zu fischen und zugleich den Aufbau des Polizeiapparats zu begreifen, dessen Wirkungsweise in solchen Fällen.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
»So viele Morde wie auf Sizilien passieren hier nicht, das werden Sie uns verzeihen«, fuhr der Hauptmann fort. »Aber was wir geklärt haben von den Tötungsverbrechen der letzten zehn Jahre, nämlich fast alle, das kann Ihnen der Bezirksstaatsanwalt zugänglich machen. Er sitzt gleich nebenan, praktisch im selben Haus. Sie müssten nur bereit sein, die Namen und Details so zu verändern, dass man später keinen der Beteiligten erkennt, und über all das zu schweigen. Dies wäre Bedingung. Ich nehme doch an, das ist nicht zu viel verlangt?«
»Nein, keineswegs«, erwiderte Nebel. »Aber vielen Dank ... Nach dem, was Sie da sagen, liegen Affekthandlungen vorn: Tötung im Streit, aus Eifersucht, in betrunkenem Zustand, durch Rowdytum, nicht wahr? Oft als Gewalt innerhalb der Familie. Vorbedachter Mord scheint selten zu sein. Und auch der passiert stets vor einem rein persönlichen Hintergrund.«
»So ist es. Uns reicht das durchaus. Ihnen nicht?«
»Nein. Der Täter hat immer ein Motiv, das ausschließlich in seiner Person liegt. Es sind ganz isolierte Delikte, wie es mir erscheint. Sie gehen nie auf Straftaten anderer zurück.«
»Jede Straftat ist ein individueller Vorgang«, bemerkte Wendt, wie er selber fand, eher vage und töricht. Er hörte seinen Chef sagen: Der Mann sucht Nervenkitzel, damit verdient er sein Geld, wir aber zeigen ihm die Qualität unserer Arbeit ... Diesmal hatte Fink vermutlich recht.
»Nicht Ihrer Meinung. Sehen Sie, ich bin jemand, der politisch denkt. Mord und Totschlag an sich reizen mich nicht. Solange ein Bezug aufs große Ganze fehlt, die gesellschaftliche Dimension.«
»Es tut mir leid, mit organisiertem Verbrechen kann ich Ihnen noch nicht dienen. Vielleicht im nächsten Jahrtausend, Herr Nebel.« Wendt sagte dies teils als Scherz, den er gern herausließ; teils aber auch, weil sein Instinkt ihm riet, den Mann nicht zu unterschätzen, ihm also nicht das Märchen aufzutischen, man sei hier gegen die schlimmsten Spielarten des Verbrechens grundsätzlich gefeit, da schwappe allenfalls etwas vom Klassenfeind herein, zumal über die elektronischen Medien. Er hatte das einst so gelernt, es viele Jahre lang auch geglaubt, die fromme Legende, Banditentum sei dem Sozialismus wesensfremd. Im Kern hielt Major Grote daran fest, die These galt noch offiziell, nach außen hin wurde sie beharrlich vertreten - obwohl seit einiger Zeit widerlegt durch das, was die sowjetische Presse fortlaufend enthüllte von der Bandenkriminalität in Gegenden, die weder ein fremdes Fernsehbild noch ausländische Gangster kannten. - »Uns schützt da die Mauer«, fügte er entschuldigend hinzu. »In deren Schatten gedeiht ja wenig, die Kriminalität kommt nicht so recht voran. Schlechte Nachrichten für Sie, ich verstehe ... Bisher haben wir kein Weltniveau.«
»Manche Bruderländer sind da weiter.«
»Sie meinen das Bandenwesen, die Drogenkriminalität bei den sowjetischen Freunden? Na ja, das ist ein Riesenreich, ein Vielvölkerstaat, ganz unvergleichbar. Je größer das Land, desto größer die Probleme - auf jedem Feld.« Dabei beließ es Wendt, er führte den Gedanken nicht fort. Nach seiner Meinung gab es auch für die Größe und Bevölkerungszahl der Staaten ein Optimum, und von jenem Bestwert hatte die Sowjetunion sich weit entfernt; doch das war nicht das Thema des Gesprächs.
»Und das kleine Bulgarien mit seinem Rauschgifttransfer? Die Tschechoslowakei mit ihrem Export von Waffen?«
»Pardon, da geht Ihnen wohl etwas durcheinander. Was hat denn staatlicher Waffenhandel, falls es den dort geben sollte, mit Kriminalität zu tun?«
»Das ist eine gute Frage, wirklich! Ich würde sagen, die Nähe zum Verbrechen. Sie gucken skeptisch, Herr Wendt? Nein, ich rede doch nicht von moralischen Kategorien. Nur von der Tatsache, dass im Waffengeschäft, egal ob privat oder staatlich, die Lebenserwartung der Beteiligten deutlich unter dem statistischen Durchschnitt liegt. Wer mit Sprengstoff hantiert, der fliegt leicht selber in die Luft. Nach meiner Beobachtung geschieht das auffallend häufig.«
»Ist mir neu. Weshalb sollte das so sein, auch im staatlichen Handelssektor?«
»Keiner weiß es«, sagte Nebel, und es war, als krieche ihm ein Lächeln aus dem Bart. »Es muss sich um eine Berufskrankheit handeln. Sie hat wohl ganz entfernt auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Wie es schon bei Shakespeare heißt: >Der Spaß ist, wenn mit seinem eigenen Pulver der Feuerwerker auffliegt.< Hamlet, dritter Aufzug, vierte Szene. Bemerken Sie die Schadenfreude?«
»Um die zu erkennen, muss man kein Experte sein. Ich habe den Eindruck, Sie träumen von einem Utopia, einer waffenfreien Welt.«
»Es gibt da bestimmte Vorstellungen, wenn auch erst in Ansätzen. Wissen Sie, mir schwebt ein Sozialismus vor, der völlig gewaltfrei ist, nach außen wie nach innen, und in dem der Wunsch, Güter zu erwerben, nicht mehr die treibende Kraft darstellt. Wir sollten unseren Wert weniger darin suchen, was wir besitzen und uns geschaffen haben, wie es so schön heißt. Wer und wie wir sind und was wir können, das gibt doch Selbstbestätigung genug! Und es wäre gut, uns auf die Lebensgrundlagen zu besinnen, also die nötige Energie lieber dem Wind und der Sonne zu entnehmen, anstatt fortzufahren, die Umwelt zu zerstören, durch das Abbaggern von Braunkohle, ihr Verfeuern und das Verbrennen von Benzin.«
»Sind Sie nicht im Auto hergekommen?«
»Nein, mit der Bahn. Ich hab kein Auto, bloß ein Segelboot und ein Fahrrad. Mir scheint, auf lange Sicht wird unser Haupttransportmittel das Fahrrad sein. Wie in China, wo sich jetzt so viel bewegt.«
»Das Fahrrad?«
»Das Fahrrad. Zwei Räder und ein Sattel. Das Fahrrad.«
Wendt fasste den Mann scharf ins Auge. Machte der sich lustig über ihn? Offenkundig nicht. Er hatte in diesem Haus noch nie einen Grünen gesehen. Auch keinen Pazifisten. Jenny, die Kontakt zu Kirchenkreisen hielt, hätte mit ihm harmoniert. »Sind Sie religiös?«, fragte er.
»Was verstehen Sie darunter?«
»Na, an Gott glauben. An irgendeinen.«
»Vielleicht sollte ich das«, sagte Nebel. »Aber um nicht Ihre Zeit zu stehlen, zurück zum Zweck meines Besuchs. Sie sind also überzeugt, in Ihrem Bereich bleibt es bei isolierten Straftaten nach dem Motto: Jeder stiehlt für sich allein. Ein derart saftiger Romanstoff wie momentan auf Kuba ist hier nicht in Sicht?«
»Keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»Von dem Drogenkrimi, der seit vier Wochen in Havanna läuft. Dort hat Fidel Castro am 24. April eine Sonderkommission gebildet, die gegen Teile der Armeeführung ermittelt, wegen Rauschgift- und Waffenhandels in großem Stil. Das Ausmaß von Verkommenheit eines Dutzends hoher Militärs schreit zum Himmel. Auch das Innenministerium soll verstrickt sein, der Geheimdienst. Bis zu zehn Luxuskarossen für die Chefs, goldene Telefone. Villen und Hochseejachten. Diamanten, Elfenbein, Edelhölzer, Flugbenzin. Weiber und natürlich Kokain, geschmuggelt für tausend Dollar das Kilo. Alles in einer Zeit, da ganze Staaten wie Kolumbien und Panama dabei sind, den Drogenkönigen in die Hand zu fallen, und Havanna so stolz auf seine weiße Weste war.«
»Woher haben Sie das? Im Neuen Deutschland stand davon kein Wort.«
»Ja. Ich weiß. Das mutet man uns ungern zu. Ich hab da meine Quellen, das gehört zum Job. Und ich werde das Gefühl nicht los, es könnte bei uns mal was Ähnliches geschehen, wenn auch nicht in solch bizarrer Form. Meine Sorge ist, würde das hier passieren, es käme nie ans Licht. Da bliebe hübsch der Deckel drauf.«
»Wie kommen Sie denn zu der Befürchtung?«
»Nach vierzig Jahren kenne ich mein Land. Als bei uns in Cumin ein Bürgermeister tausend Mark unterschlug, stand selbst das nicht in der Zeitung. Man erzählt sich, Herr Wendt, Sie haben den Kerl überführt. Wie war Ihnen zumute, als es zu keiner öffentlichen Verhandlung kam? Jede Kassiererin, jeden Arbeiter hätte man gnadenlos verdonnert, wenn die so hingelangt hätten, der Heini war tabu, ein Funktionär immerhin, wenn auch am unteren Rand der Skala unserer Würdenträger. Bequem, es unter den Teppich zu kehren, aber festigt das wirklich die Ordnung, stärkt es das Rechtsgefühl? Der Bürger stumpft ab, die Strolche grinsen und bedienen sich weiter aus dem großen Topf.«
Wendt schwieg. Im Stillen gab er Nebel recht, zugleich fiel der ihm lästig. Natürlich wurde beschönigt, immer schon, das Bild retuschiert, manch ein Sachverhalt verschleiert. Der Zwang, möglichst positiv zu sein, und der Mangel an Transparenz störten selbst die Polizeiarbeit. Nach dem letzten Tötungsdelikt, einem Doppelmord, hatte es eines Schrittes des Ersten Bezirkssekretärs in Berlin bedurft, damit die Lokalpresse überhaupt darüber schreiben durfte. Aber das war banal - etwas, was jeder wusste und keiner ändern konnte. Seit Jahrzehnten lebte man damit, hatte sich daran gewöhnt, wozu rieb der Mann es einem unter die Nase? »Was kann ich noch für Sie tun?«, fragte er.
»Na, mich ins Bild setzen über Ihre Methoden, die Mittel bei der Mordaufklärung, die polizeilichen Befehlswege, Unterstellungsverhältnisse und Strukturen. Wie das funktioniert, wenn Sie Ihr größtes Rad drehen.«
»Ihr Wissensdurst ist ja beachtlich.«
»Bei mir entwickeln sich Einfälle nur aus den Fakten. Es klingt paradox, Herr Wendt, aber der Sicherheitsapparat in Bogota, wo ich nie gewesen bin, ist mir besser bekannt als der in Rostock. Die Stärke, Gliederung und Ausrüstung jeder westlichen Polizei erfährt man aus offenen Quellen - Presse, Lexika, Monografien. Und hier? Versuchen Sie mal als Buchautor, den Aufbau der K zu erfragen.«
»Da kann ich Ihnen leider wenig sagen. Das Organisationsschema ist vertraulich, nicht zur Veröffentlichung frei.«
»Nur für den Dienstgebrauch. Genau das hab ich mir gedacht. Es hat sich nichts geändert ... Sehen Sie, in den Fünfzigerjahren gehörte der Kripochef von Magdeburg zu meinem Bekanntenkreis. Er ist inzwischen tot, es schadet ihm nichts mehr, wenn ich das erwähne. Damals nahm er mich mit zum Pistolenschießen, ja auch auf die Jagd ...«
»Sie sind Jäger?«
»Nein. Er auch nicht. Wir haben regelrecht gewildert dort im Harz. Zum Beispiel ein Reh geblendet und es abgeknallt, heute schäme ich mich dafür.«
»Fahren Sie ruhig fort, diese Dinge sind verjährt.«
»Wir sind halt Freunde gewesen, zu meinem ersten Krimi schrieb er das Nachwort, mit Erlaubnis seiner Hauptverwaltung in der Glinkastraße, Berlin. Die Akten abgeschlossener Fälle kriegte ich frei Haus von ihm: Leichenfund im Grenzgebiet, Förstermord. Totschlag eines Liebespaares im Wald ... Aber kein Sterbenswort über, sagen wir mal, den Ablauf des 17. Juni in unserer Heimatstadt. Wo ja auch Blut geflossen ist!
So was war einfach tabu. Nun wissen Sie, weshalb es mich westwärts zog, rein stofflich. Hier wären mir aus Unkenntnis bloß Fehler passiert.«
»Wir helfen Ihnen gern, die zu vermeiden. Reichen Sie uns Ihr Manuskript ein, wir schlagen Ihnen dann vor, wie es vielleicht verbessert werden kann.«
Der Autor zog die Schultern hoch, es schüttelte ihn kaum merklich. »Gutachten? Die sind ein Frosthauch, der jede Kreativität erstarren lässt. So wird das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Mir geht's nicht um Korrekturen hinterher, sondern um Startschub, Herr Hauptmann.«
»Sie sind schwer zu befriedigen. An was für einen Stoff denken Sie überhaupt?«
Nebel atmete hörbar, er zögerte, sich zu offenbaren. Ein komplizierter Mensch. 17. Juni, dachte Wendt. Da war er gerade zwölf gewesen, es gab kein Bild in seinem Gedächtnis von diesem peinlichen Tag. Ihm saß da ein Fossil gegenüber, ein Greis mit jugendlichem Touch, ein Mann mit zu viel Erinnerungen, die ihn bedrängten, sich ständig in seine Überlegungen mischten und verhinderten, dass er frisch ans Werk ging, unbefangen. Sein Handicap war, zu allem und jedem fiel ihm etwas ein, was er früher einmal gehört, geschrieben, erlebt oder getan hatte. Dies lenkte ihn ab, ließ ihn weitschweifig werden und belastete das Gespräch.
»Was mir vorschwebt, ist ein Knüller«, sagte Nebel endlich. Er sprach ein bisschen heiser, wie geschlagen, als weiche er innerem Druck - dem Strom seiner Fantasie, die ihn vermutlich überschwemmte. »Sitzen Sie gut? Sonst haut es Sie womöglich noch vom Stuhl. Ich stelle mir nämlich vor, irgendwo bei Wismar, ländlich abgeschieden, vielleicht auf der Insel Poel, befindet sich ein getarntes Warenlager. Hinter einer harmlosen Fassade, ein paar Schuppen zur Altstofferfassung, Kartons voller Medikamente, wertintensiv in Ihrer Sprache, abgezweigt bei unserer Pharmaindustrie.«
»Und das wird nun verschoben? Todsicher über See.«
»Gewiss.« Nebel nickte freundlich. »Sie denken mit. So läuft das all die Jahre, bis ein Unfall geschieht.«
»Die Zollverwaltung merkt nichts. Das Hafenamt ist blind. Die Volkspolizei ist instinktlos, der Gemeinderat dem Trunk verfallen. Die Grenzbrigade Küste schläft. Die Volksmarine dreht Däumchen. Die Staatssicherheit ist umnachtet ...«
»Nein, die drückt ein Auge zu.«
»Wie bitte?«
»Nun ja«, sagte Nebel etwas kleinlaut, »ich hab's halt so erfunden. Man wird doch wohl noch spinnen dürfen? Fiktion kann, auf der Basis von Fakten, treffender sein als Reportage. Ich will fiktiv eine Realität hinblättern, etwas beschreiben, was dem Leser unter die Haut geht.«
»Da sind keine Fakten. Es ist nicht real, glaube ich.«
»So, Sie glauben.« Nebel nahm die Brille ab, er behauchte und putzte sie, wie um ein Lächeln zu kaschieren, das sein Bart nicht ganz verbarg. »Der Glaube versetzt Berge oder erweist sich als Aberglaube.«
»Was deuten Sie mir damit an?«
»Nichts, Herr Wendt. Es gibt da übrigens noch ein Missverständnis. Sie denken offenbar - und nach meiner Erfahrung glaubt das beinah jeder Kriminalist -, organisiertes Verbrechen sei unbedingt an ganz schwere und abstoßende Delikte geknüpft. Es habe immer mit Gewalt und letztlich eben Mord zu tun. Das war zu keiner Zeit und nirgends so. Selbst nicht in Chicago oder auf Sizilien.«
»Ich höre Ihnen zu. Bitte klären Sie mich auf.«
»Die Regel drüben ist eine Vielzahl kleinerer Delikte. Dinge wie Glücksspiel. Einbruch in leer stehende Wohnungen. Autodiebstahl. Schutzgelderpressung oder Prostitution. AI Capone hing jahrelang vor Bordellen herum und zischte den Passanten zu: Girls, girls, beautiful girls. Ein kleiner Zuhälter, bis es ihm gelang, seine Geschäftsbasis zu verbreitern und im Alkoholhandel Fuß zu fassen. Dann freilich hat er morden lassen. Die heroische Zeit der Bandenkriege ... Heute wird das große Geld eher unblutig gemacht, auf dem weiten Feld der Wirtschaftskriminalität.«
»Und die findet bei Ihnen in Wismar statt. Ein kühner Plan! Ehrlich gesagt, mir sträuben sich die Haare. Was macht denn unsere Medikamente für den internationalen Arzneimittelschwarzmarkt dermaßen interessant?«
»Das muss man tatsächlich bedenken. Sie treffen wieder den Punkt. Herr Wendt. Es wäre schön, mit Ihrer Hilfe das Buch zu schreiben. Aber zur Sache. Es könnten Amphetaminkombinationen oder auch Grundstoffe zur Drogenherstellung sein.«
»Synthetisches Rauschgift?«
»Ja. Meine Partnerin hat mich da beraten, sie kommt aus dem Gesundheitswesen. Speed heißt das Zeug in den USA, es wird auch Angeldust genannt, Engelsstaub. Ist dasselbe wie PCP, davon kostet im New Yorker Großhandel das Kilo 40.000 Dollar. Ziemlich preiswert also. Noch billiger scheint LSD zu sein. Die CIA hat vor ein paar Jahren zehn Kilo LSD-25 für knapp eine Viertelmillion gekauft. Es lohnt sich trotzdem, zu dealen, die Profitraten sind fantastisch. Diese zehn Kilo übrigens reichen hin, hundert Millionen Menschen auf einen Trip zu schicken.«
»Herr Nebel, wenn das in Wismar spielt, glaubt es Ihnen kein Schwein.«
»Schlimmer noch, derzeit würde es mir erst gar nicht gedruckt. Aber da bin ich optimistisch. Wissen Sie, die Kulturpolitik lockert sich allmählich. Ist das Manuskript dann fertig, naht das Ende der Zensur. Von der die Verfassung ja sagt, dass sie ohnehin nicht stattfindet. Mit der Mehrheit meiner Berufskollegen hoffe ich auf diesen Tag.«
Wendt vermied es, sich zu dieser Mitteilung zu äußern. Auch ohne Finks Hinweise kannte er den offiziellen Standpunkt, den die Pressestelle der BDVP zu verbreiten hatte. Langsam ging ihm auf, wofür Major Grote sein Geld bekam und weiterer Schulung bedurfte. Obschon Grotes Gesprächspartner gewöhnlich Journalisten waren, Leute mit Sinn für das Machbare, die sich kaum so weit verstiegen wie dieser seltsame Kauz. »Wenn Ihr Manuskript vorliegt, stehen Sie vielleicht mit etwas da, was weder eine zeitlose Utopie ist noch ein realistischer Roman. Ich fürchte, Sie setzen sich zwischen zwei Stühle. Was bleibt von Ihrer Arbeit dann eigentlich noch übrig?«
»Eine lehrreiche Geschichte, hoffentlich.«
»Nur leider nicht sehr plausibel.«
»Dann helfen Sie mir doch, glaubhaft zu sein, durch Ihren Rat - bis in die Einzelheiten Ihrer Arbeitsweise.«
»Aber solche Details sind doch bloß die Oberfläche! Was nützt Ihnen das Äußerliche des Ablaufs, wenn die ganze Richtung nicht stimmt, in der sich Ihr Entwurf bewegt? Das ist gerade so, als lackierten Sie ein Boot, und das Holz darunter ist morsch ... Ich glaube kaum, dass es uns leichtfallen wird, Ihr Projekt zu unterstützen. Wir haben da nämlich einen Ruf zu verlieren.«
»Ich auch«, sagte Nebel. »Meine Leser wollen Geschichten, hart und handfest, nicht unbedingt verfasst zum Lob der Polizei. Gebe ich ihnen die, dann schätzen sie mich. Und ich will, dass sie mich schätzen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, er braucht auch Reputation.«
Wendt spürte in sich einen Groll aufsteigen, dessen Druck ihn verblüffte. Es war, als trete ihm Galle in den Magen. Er hatte nur noch den Wunsch, diesen Mann halbwegs höflich loszuwerden. -
»Schön, ich sage Ihnen, was geschieht, falls wir Wind kriegen von Ihrem erdachten Drogenlager. Ich gehe mit dem Sachverhalt zum K-Leiter, und der meldet das vorläufige Ermittlungsresultat dem Chef der BDVP, Generalmajor Siegfried Hadler. Dieser unterrichtet seinerseits Ernst Timm, den Ersten Sekretär der Bezirksleitung der Partei sowie Generalleutnant Rudolf Mittag, den Chef der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit. Es folgt eine Besprechung bei Timm im Parteihaus An der Reiferbahn oder bei Mittag in der August-Bebel-Straße 15. Beides nur ein paar Minuten, ein paar Hundert Schritte von hier.«
Nebel schrieb das auf. Die ganze Zeit über hatte er sich Notizen gemacht, und zwar so, dass es kaum auffiel. »Rostocks eisernes Dreieck«, murmelte er.
»Dann wird Berlin informiert«, sagte Wendt beherrscht, trotz des Eindrucks, dass der Mann ihn mit dieser Bemerkung ärgern wollte. »Unsere Hauptverwaltung, der Innenminister, die Sicherheitsabteilung im ZK, die Stasizentrale in der Normannenstraße. Oben an der Spitze wird über das weitere Vorgehen entschieden. Aber was hilft es Ihnen, das zu wissen? Es rettet nicht Ihre Story.«
»Herr Hauptmann, ich bedanke mich.« Nebel lachte freundlich, er stand auf, recht behände für sein Alter. »Sie haben mir bereits geholfen, sehr sogar, vielen Dank! Wenn mein Text vorliegt, melde ich mich wieder; Sie bekommen ihn als Erster.«
Wohl kaum, dachte Wendt beim Händedruck, der fest wirkte, fair wie ein Marinegruß. Das ist dann Grotes Bier ... Bei all seinem Verständnis für Exzentriker, Nebels rascher Aufbruch freute ihn. Dessen Haltung gab ihm das Gefühl, der Mann nehme ihm nichts krumm, er bleibe in Fühlung zur K, obschon die seinen Einfall, einen Pharmaschmuggel zu inszenieren, als absurd verwarf. Verliebt in seine Schnapsidee, mochte es ihm schwer sein, zu sehen, was Sache war, und das Endgültige des Urteils zu begreifen. Oder er tat nur so - war bloß ein guter Verlierer. Unter seinesgleichen, den reizbaren, egozentrischen Kulturschaffenden, wäre das ja auch schon was gewesen.
Doch der Autor rief nicht wieder an; auch nicht bei Major Grote, als der den Lehrgang beendet hatte. Entweder kam Nebel mit der Sache nicht weiter, weil er einsah, dass dies ein Fehlstart war, ein Projekt, das jeder Grundlage entbehrte. Oder er wich einer Beratung aus, die mit den Füßen am Boden blieb und ihn daran hinderte, sich literarisch zu entfalten und emporzuschwingen ins Reich seiner kriminellen Träume ... Es sollten fünf Monate vergehen - ein ganzer Sommer, der letzte der 80er Jahre -, bis Christian Wendt noch einmal von Richard Nebel hörte.
3. Kapitel
Zwei Wochen darauf, am 5. Juni, war Jennys Geburtstag. Sie wurde 31 und hatte so, aus Wendts Sicht, das ideale Alter erreicht. Die Frau sollte halb so alt sein wie der Mann, plus sieben Jahre; eben das war jetzt der Fall. Anlass für ihn, sein Sparbuch zu plündern, alte Beziehungen zu beleben und ihr eine exotische Reise zu schenken: Drei Wochen Kuba im September, nachdem ihm im Amt erklärt worden war, Jugoslawien oder Zypern komme für sie beide nicht infrage. Mehr als 13.000 Mark, er war ruiniert und freute sich riesig, als sie ihm um den Hals fiel. Legte er ihr doch, einmal im Leben etwas Großartiges zu Füßen, das ferne Tropenreich! (Von dem Nebel Hässliches behauptet hatte - nach wie vor kein Wort davon in den Medien, sicherlich ersponnen von dem Mann.)
Man feierte in kleinster Runde, zum Teil, er wusste es wohl, mit Rücksicht auf ihn. Von den Jugendfreunden vor ihrer Haft hatte Jenny sich so klar getrennt wie von der Näherei und den Modenschauen; einst ihre große Leidenschaft. Vergessen das Partyvolk von Cumin, der Berliner Kreis und die Mischpoke des Städtchens N.; ihre Ehe mit Jack Franke, dem Komplizen, und all den fidelen Bekannten. Kaum dass Jenny dort noch ihre Eltern sah. Und ihrer neuen Clique zu begegnen, das ersparte sie Wendt, so schien es stumm vereinbart zwischen ihnen. Der Klüngel, zu dem sie seit der Übersiedlung nach Rostock gestoßen war, was zum Teufel gab ihr der? Wenigstens brachte sie niemand davon mit ins Haus, junge, staatsverdrossene Leute, meist sogar jünger als sie. Menschen, die religiös gebunden waren oder sich doch - dies leuchtete mehr ein und zog den Graben tiefer - unter dem Dach der Kirche zum stillen Protest gegen die Ordnung versammelten, für die er täglich eintrat und geradestand.
Wer blieb übrig? Das Ehepaar Zelter, unterhaltsam, kultiviert und erstaunlich tolerant. Uta Zelter war in Jennys Klasse gegangen, ihre beste Freundin von der Erweiterten Oberschule in N., nun die Einzige in Rostock, die restlos akzeptabel war. Ihr Spitzname war Juno, nach der römischen Himmelsgöttin. Eine üppige, schwarzhaarige Schönheit - dichtes, seidiges, natürliches Schwarz. Sie hatte dunkle Augen, dramatisch geschminkt, volle Lippen und einen tiefen Schwerpunkt, wie Wendt fand, ohne dies je zu äußern. Mit ihrer langen Taille und den vergleichsweise kurzen Beinen eigentlich nicht sein Typ. Aber ihr Mienenspiel, die Kurven, das Gesicht! Es strahlte eine Sinnlichkeit aus, die ihn gelegentlich versengte. Er war ja nie ein Frauenheld gewesen. Utas Nähe machte ihn befangen.
»Was glotzt du die Lady so an?«, hatte Jenny zu Beginn der Bekanntschaft spät nachts im Bett einmal gefaucht. »Eine Augenweide, he?«
»Aus gutem Grund ist Juno rund«, gab er zurück. Der Spruch einer Zigarettenreklame aus der Vorkriegszeit. Aber sein Scherz erhielt nicht den verdienten Applaus, da er zufällig ins Schwarze traf.
»Mag sein, mein Lieber«, sagte Jenny mit einer Stimme, der man anhörte, dass sie in dem Punkt nicht mit sich spaßen ließ. »Aber falls du mit ihr ins Heu gehst, kratze ich euch die Augen aus! Erst dir, dann ihr.«
Er verkniff sich die Frage, weshalb in dieser Reihenfolge. Sie war zu ärgerlich gewesen. So schlug, war in ihr ein Nerv berührt, Jennys arglose, manchmal verträumte Art, mit ihm zu reden, abrupt in knallharte Sprache um. Wahrhaftig ein strenges Wort. Aber solche Ermahnungen führten, wie es schien, nur zu unerwünschten Gedankenspielen. Sie machten ihn empfänglich für Utas junonischen Reiz, befruchteten dauerhaft seine Fantasie.
Während Wendt ihr zuhörte am Kaffeetisch - Uta gab den Ton an, sie sprach wie ein Wasserfall von Theater und Literatur, über Leute, die er nicht kannte, geschweige denn gelesen hatte, Hein und Scherzer und Lambrecht, Männerbekanntschaften, freimütige Protokolle -, während das an ihm vorbeirann, rief er sich unwillkürlich ihr erotisches Vorleben ins Gedächtnis. Nein, er kam davon nicht los. Juno hatte zu den armen Kindern gehört, die unter ihrem Namen leiden. Als junges Mädchen hieß sie Huschebett, was unvermeidlich Gespött nach sich zog und in ihr den Wunsch weckte, durch Heirat einen Makel abzustreifen, der anders nicht zu tilgen war in einem Land, das sich mit Namensänderungen derart schwertat.
Aber die Namen der frühen Liebhaber Junos (laut Jenny hießen die ersten drei: Notdurft, Bauchrucker und Krokoschinski) waren so unerfreulich, dass die erweiterte Oberschülerin den Hilmar Zelter festhielt, als der in ihr Leben trat. Ein gut gebauter und strebsamer Mann. Elektroingenieur ursprünglich, nur zwei Jahre älter als sie. Dabei sei ihr ganz entgangen, hatte Jenny vermerkt, was ein Zelter wirklich war. Kein Campingfreund, wie man meinen könne, sondern ein speziell auf Passgang abgerichtetes Reitpferd für Damen. Die Wortbedeutung, sagte sie, sei dank der Motorisierung etwas in Vergessenheit geraten.
Eine klügere Frau, dachte Wendt, hätte dergleichen verschluckt. Man sprach nicht alles aus, was einem durch den Kopf ging, auch nicht zwischen Mann und Frau. Alle zwei Wochen nämlich, wenn die Zelters zu Besuch kamen oder man selbst zu ihnen ging, stellte er sich nunmehr, wenn auch nur manchmal, schwelgerisch vor, wie die Göttin auf ihrem Zelter ritt. Und malte sich ein bisschen aus, wie es mit Juno sein würde. Oft kam bei frechen Bemerkungen ja so etwas heraus.
Übrigens galt Jennys Spitze weniger ihrer Freundin als deren Mann, der das Plaudern der Frauen da gelassen ertrug, selber mehr an Fußball interessiert. Hilmar hatte babyhelle Augen und flachsfarbenes Haar, er war ein geduldiger Zuhörer. Manchmal wölbte er die Hand und fuhr sich über den wohlgeformten Kopf, wie um sicherzustellen, dass die flotte Frisur und seine professionelle Tarnung noch am rechten Fleck saßen ... Doch, auch Jenny fand ihn nett, sie hatte nur etwas gegen seinen Beruf. Er war Offizier der Staatssicherheit, und das reichte ihr, ihn madig zu machen.
So ungerecht konnte sie sein! Hilmar war ein feiner Kerl, eher zufällig dabei wie viele, bloß aufgrund seiner Kaderakte, der proletarischen Herkunft. Weiß Gott kein Fanatiker, ein ganz normaler Mann. Sein Vater war Volkspolizist gewesen, da hatte es sich so ergeben. Als Uta Hilmar kennenlernte, hatte es ihm noch genügt, ein Motorrad, eine Stereoanlage und ein tolles Weib zu haben und dieses Glück durch Feierabendarbeit ein wenig zu mehren. Doch während seiner Wehrdienstzeit, drei Jahre im Wachregiment des MfS, war man an ihn herangetreten und hatte seinen Ehrgeiz geweckt. Mit der Aussicht auf Karriere durch ein Fernstudium in Kriminalistik an der Humboldt-Universität und ein Direktstudium an der Juristischen Hochschule in Potsdam-Eiche (auf dem Gelände der früheren General-Weber-Kaserne, in keinem Hochschulverzeichnis auffindbar).
Ein saftiger Köder für jeden gescheiten jungen Mann. Das Studium halte Hilmar hinter sich, eines Tages würde er sogar noch promovieren und dann Stabsoffizier sein - ein Lokalmatador an der unsichtbaren Front in Jennys Sprache. Und schon als Oberleutnant kam er in Besoldungsstufe elf auf ein Nettogehalt von gut 2.000 Mark. Rund 500 Mark mehr als Wendt, der wesentlich älter und fast dreimal so lange im Dienst war. Uta war dort, in der August-Bebel-Straße 15, als Sekretärin angestellt, für 850 Mark plus Kleidergeld. Die zwei verdienten zusammen so viel wie ein Professor an der Universität.
Schlich sich da bei ihm Missgunst ein? Vielleicht, wer war schon frei von Neid. Die bessere Besoldung lag an der Zuweisung wesentlich höherer Planstellen in allen Bereichen, vom Sachbearbeiter bis zum Leiter. Das führte leicht zu Arroganz. Für das MfS waren VP-Angehörige die Bürgermeisterschutztruppe; manchmal auch nur die Grünen genannt. Wenn er, Wendt, der Stasi etwas neidete, dann deren technischen Standard, den Wagenpark, das eigene Telefonnetz und das viele Personal; auch die 24 bis 42 Tage Urlaub im Jahr und die zahlreichen Ferienheime. Knapp 4 000 Mann arbeiteten im Bezirk Rostock, hatte Hilmar ihm geflüstert, mit den neun Kreisdienststellen ein hübscher Apparat. Die treuen Söhne der Arbeiterklasse waren bei der VP und die treuesten beim MfS. Die Polizei ergriff Straftäter, grob gesagt, das MfS schlug den Klassenfeind. Manch einem schwoll da der Kamm vor elitärem Selbstverständnis. Hilmar nicht, der blieb ein Kumpel, frei von Überheblichkeit ... Bis auf seltene Momente, etwa wenn er einem steckte, er schätze den Jahresetat der August-Bebel-Straße auf hundert Millionen Mark; was seine eigene Bedeutung ja dick unterstrich.
Es war gegen halb neun und das Abendbrot schon abgeräumt - launisches Juniwetter, anheimelnd klopfte Regen ans Fenster -, als der Streit begann. Nachdem Jenny an den Kommunalwahlen herumgenörgelt hatte, ohne Zustimmung zu finden, sprang sie jäh in den Fernen Osten.
»Habt ihr gelesen, was das Neue Deutschland zu der Tragödie in Peking schreibt?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Das Blutbad auf dem Platz des Himmlischen Friedens sei die Antwort gewesen auf den Putschversuch einer konterrevolutionären Minderheit. Mit Extremisten und Verbrechern werde kein Dialog geführt.«
»Hm. Ja. Stimmt ...« Uta lächelte so verkrampft, als erzähle man ihr einen peinlichen Witz. »Lass uns von was anderem reden, bitte. Das passt nicht zum Geburtstag, geht uns aufs Gemüt.«
Aber Jenny sprach schon weiter. Sie setzte eine enttäuschte, ungläubige Miene auf und fuhr fort, die Tagespresse zu zitieren - aus dem Kopf. Dadurch wirkte es abgekartet, als habe sie sich das nur Hilmars wegen eingeprägt. Seit Kurzem war es ihre Art, ihn herauszufordern.
Langsam versteinerte sein Gesicht. »Regt dich das wirklich so auf?«, fragte er, rutschte im Sessel herum und spreizte die Oberschenkel, als kneife es ihn im Schritt.
»Nein«, sagte sie, »nicht ernstlich. Denn ich meine mit Stalin: Ein Tod ist Tragödie, tausend Tode sind Statistik.«
»Das Riesenland, eine Milliarde, schwer regierbar«, brummte er. »Da fließt schon mal Blut, was willst du machen?« Es klang, als hätte er gesagt: Halt's Maul.
»Ach, weil's so viele sind, kommt's auf ein paar Tausend nicht an, dort hinter der großen Mauer?«
»In China war das immer so. Bei den Massen ufert jeder Impuls aus wie die Riesenflüsse dort. Entweder Diktatur oder Anarchie.«
Stille. Man wartete auf Jennys Antwort, doch sie schwieg. Wendt wusste, es fiel ihr leicht, Hilmar zu reizen. Sie genoss bei ihm Narrenfreiheit, er mochte sie - nicht ihre Zunge, aber die Erscheinung. Außerdem hatte er Stil, nie würde es ihm einfallen, Privatgespräche ins Amt zu tragen. Das wäre in seinen Augen ekelhaft gewesen. Doch man sah, dass er schluckte und vor Ärger beinah das Glas umwarf. Jenny ging zu weit. Ihr Verhalten wurde peinlich, selbst in diesem vertrauten Kreis. Und nun wandte sie sich achselzuckend, die Brauen hochgezogen, von ihm ab. »Du hast recht, Juno«, sagte sie. »Angesichts der geheimen Mächte, die über uns herrschen, sollten wir schleunigst das Thema wechseln.«
»Was für geheime Mächte denn?«, fragte Uta.
»Na, die der Männer. Ihre Machtlust, ihr Sexismus. Diese Machos zeigen uns ganz offen ihre Freude an der Ordnung, erzielt durch nackte Gewalt. Sie haben's nicht nötig, Ergebenheit zu heucheln wie wir armen Weiber.«
»Beruhige dich doch ...« Uta sah hilfeflehend zu ihrem Mann.
»Die Partei dort«, sagte der, »wird das Problem schon lösen.« Seine Stimme klang, als könne sie allein durch ihren Nachdruck den Lauf der Dinge ändern, unabhängig vom gesprochenen Text.
»Die Partei löst kein Problem, sie ist das Problem.«
Hilmar zündete sich, was nur noch selten geschah, eine Zigarette an. Und er vergaß zu fragen, ob es erlaubt sei. Der Lack blätterte ab.
Wendt musterte ihn beklommen, er sah die abweisenden Falten um Hilmars Mund und dachte mit einem Ausdruck Finks: Es eskaliert. Jetzt blickte sein Gast auf, sie nickten sich leidgeprüft zu. Wie nur gestandene Männer es können, fast ranggleiche Offiziere - Kriminalisten, die auch dann, wenn ihre Frauen stänkern, genug Besonnenheit und Solidarität aufbringen, um sich gegenseitig anzuerkennen und zu stützen.
»Genug, Kinder«, sagte Wendt in jenem Ton, bei dem die Mitarbeiter der Mordkommission regelmäßig verstummten. »Hört euch lieber mal an, was mir neulich im Präsidium passiert ist ...« Er improvisierte. Es war nicht seine Absicht gewesen, den Besuch Richard Nebels zu erwähnen. Die Grenze zur Vertraulichkeit ließ sich schwer ziehen, alles Dienstliche blieb sonst bei ihm im Amt zurück. Aber nun, um den dummen Clinch zu beenden, erzählte er die Sache doch.
»Wieso kam der Mann zu dir?«, fragte Uta.
»Christian«, sagte Jenny, »war im Mai kommissarischer Leiter der Beschwichtigungsabteilung.«
»Sie meint die Pressestelle«, seufzte Wendt.
»Dieser Nebel traut sich was«, sagte Uta. »Schwer vorstellbar, die Sache mit den Drogen.«
»Schwer vorstellbar?«, fragte ihr Mann. »Absurd ist das ... Saugt sich da was aus den Fingern und donnert es zur Gruselstory hoch.«
»Unter Rauschgift tut er's nicht«, sagte Wendt. »Sonst kann ihn wenig reizen, es muss schon organisiertes Verbrechen sein.«
»Irgendwie ist mir der Name im Ohr«, brummte Hilmar.
»Hat er nicht Amok geschrieben? Die Abschlachtung der indonesischen Kommunisten. Und Gaukler doch auch. Sehr wichtig, das Buch! Rechnet glasklar mit Solschenizyn ab, dem Verräter.«
Uta sagte: »Du verwechselst ihn mit Harry Thürk.«
Hilmar lachte großmütig, es genierte ihn nicht. Man sah ja ein, dass er - außer dem Schriftverkehr im Amt - nie etwas anderes als Sportberichte, zwei Seiten im Neuen Deutschland und Gebrauchsanweisungen las. Mehr zu verlangen wäre unbillig gewesen. Nur ein Fünftel der lesefähigen Bevölkerung (Wendt wusste es von Jenny) griff zweimal die Woche oder gar noch öfter zu einem literarischen Werk: Das Ministerium für Kultur hatte dies ermittelt. Hilmar war Teil der absoluten Mehrheit, kein Grund für ihn, zerknirscht zu sein.
»Zwei Mafiageschichten sind von ihm«, sagte Wendt. »Eine spielt in Kolumbien. Daher seine Idee mit dem Drogenexport hier.«
»Kolumbien, da fällt bei mir der Groschen. Jetzt hat's geklingelt, ich ahne, wer das ist. Hauptmann Helmholz sagt, der Mann schreibt fast so gut wie Thürk, ihm fehlt nur dessen ...« Er suchte nach dem rechten Wort.
»Spannung?«, fragte Wendt. »Faktentreue?«
Hilmar schüttelte den Kopf.
»Kampfszenen?«, schlug ihm Jenny vor. »Sex und flotte Miezen? Tötungsakte? Oder das Bordellmilieu?«
»Bringt ihn doch nicht in Verlegenheit«, bat Uta. »Woher soll Hilmar das wissen? Er gibt doch nur Helmholzens Meinung wieder.«
»Bordellszenen«, beschwichtigte Wendt, »stehen massenhaft bei Graham Greene. Hier verlegt, durchaus keine Pornografie.«
»Was hat dein Hauptmann an Nebel nun vermisst?«, bohrte Jenny. »Die Parteilichkeit? Den festen Klassenstandpunkt?«
»Das ist es«, sagte Hilmar erlöst. »Seine Haltung soll unklar sein. Objektivismus ist das Wort, das mir auf der Zunge lag. Und noch etwas, jetzt weiß ich es wieder - der kolumbianische Geheimdienst heißt bei ihm immer >Staatssicherheit<. Hat die Genossen sehr befremdet. Die Originalbezeichnung ist Seguridad Nacional. Das hätte sich weniger anzüglich übersetzen lassen, finden wir.«
»Das klingt ja«, warf Jenny ein, »als seht ihr darin ein Zeichen für versteckte Feindschaft? Kein Patriot demnach? Steht nicht zum Sozialismus in den Farben der DDR?«
Sie legte sich schon wieder mit ihm an, Hilmar aber wich ihr pfiffig aus. Vielleicht um den Kampf dort zu vermeiden, wo er das Feld nicht übersah. »Dafür ist er Dichter«, sagte er verschmitzt. »Der Erste sogar.«
»Des Landes?«, fragte seine Frau, hörbar in Furcht vor der nächsten Blamage. »Hilmar, du irrst dich.«
»Der Welt natürlich. Denn es steht geschrieben: >Dichter Nebel lag auf dem Wasser.< Damit geht sein Ursprung auf den ersten Schöpfungstag zurück. Auch Nebels Neigung zum Wassersport ist in dem Satz erfasst.«
Der Witz zündete nur schwach. Wendt sah Hilmar mit beiden Füßen dort gelandet, wo keiner ihn hinhaben wollte - in Lauerstellung gegenüber der Kirche, bereit zum Schlag auf die Religion. Die Fettnäpfchen vermehrten sich derzeit rapide ... Eilig goss er Sekt nach und hob sein Glas: »Auf unsere Frauen, auf alle zwischen dreißig und fünfzig, was ihre schönste Zeit sein soll. Amüsieren wir uns, tun wir was Gutes!«
Aber zu spät, Jenny griff bereits nach einem Buch in der Schrankwand, gewiss um Hilmar zu ärgern. »>Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die ganze Welt<«, las sie vor. »>Auf der Erde war es noch wüst und unheimlich; es war finster, und Wasserfluten bedeckten alles. Über dem Wasser schwebte der Geist Gottes.< Also du warst schon witziger, Hilmar. Von Nebel keine Spur.«
»Das ist doch die Ausgabe in heutigem Deutsch«, sagte Uta.
»Als zweite mögliche Übersetzung steht in der Fußnote: >Ein gewaltiger Sturm brauste über das Wasser.< Wieder kein Nebel, tut mir leid.«
»Ihr lest die Bibel?« Hilmar war perplex. »Ich wusste gar nicht, dass ich unter Bibelforschern bin.«
»Schau ruhig mal rein«, riet ihm Jenny. »Und nicht erst, wenn sie dich zu dem Trupp versetzen, der damit befasst ist, die Kirche zu unterwandern. In deinem Fach muss man vielseitig sein.«
»Da lese ich noch eher den Kram von Richard Nebel.«
»Warum nicht? Im Knast ist er sehr beliebt gewesen. Ihr wisst doch, das letzte halbe Jahr durfte ich dort in der Bibliothek arbeiten. Nebels Mafiaschmöker waren dauernd ausgeliehen.«
In der plötzlichen Stille hüstelte Uta, als habe sie sich an dem Sekt verschluckt, und Hilmars Blick schien auf einen Punkt außerhalb des Zimmers gerichtet. Es war zum Verzweifeln, mutwillig hatte Jenny ein Tabu verletzt. Ihre Haftzeit wurde vor anderen nie erwähnt, schon gar nicht gegenüber den Zelters. Natürlich wussten die Bescheid, es hatte sich trotz ihres Umzugs nach Rostock herumgesprochen: Aber es war ihnen peinlich, daran erinnert zu werden. In ihren Augen eine Schande, die man tunlichst verbarg ... Wieder lief das Schiff bedrohlich aus dem Ruder, mit einem Ruck riss Wendt es herum.
»Als dieser Nebel vor mir saß«, sagte er. »Da wusste ich nicht, ob ich über ihn lachen oder weinen sollte. Für den war das ja kein Ulk, der hat's ganz ernst gemeint.«
»Die Grenze vom Komischen zum Ernsthaften ist durchlässig«, sagte Jenny. »Wir passieren sie heute dauernd.«
»Komm, komm«, sagte Hilmar. »Du vielleicht. Du bist ja der ideologische Grenzgänger hier.«
»Besser als ein Blindgänger.«
»Damit bin wohl ich gemeint?«
»Nur in Sachen Kunst. Ansonsten steckst du uns glatt in den Sack, mit all deiner Schulung. Du nimmst nämlich instinktiv an, die Kunst hat der Partei und dem Staat zu dienen. Nicht wahr, das glaubst du doch? Bei euch dient alles der Partei.«
»Wem sonst, Mädchen?«
»Na, der Gesellschaft. Schlag doch mal in der Verfassung nach.«
»Entschuldige, Jenny, das ist ein verträumtes Politikverständnis.« Hilmar sprach rau wie ein Mann, der es satt hat, sich kränken zu lassen und dabei noch nett zu sein. »Christian und ich, wir gucken doch nicht morgens in die Verfassung und kümmern uns dann um die große Zielsetzung. In Wirklichkeit ist das ein Feuerwehrjob. Da hetzt du atemlos vom Deichbruch zum Brand, vom Leck zum Unfall und wieder zurück zur Panne im Amt. Zuerst kommt der Staat, das merke dir!« Er schnipste mit den Fingern, als wollte er sagen: Das ist geklärt und abgehakt, das hat sie kapiert.
Aber Jenny gab keinen Zoll nach. »Statt dem Volk zu dienen«, sagte sie, »kontrolliert und beherrscht ihr es.«
»Du, sei bitte fair«, rief Uta. »Stell uns nicht ins Abseits! Du brauchst Sicherheit genauso wie Brot oder Kunstgenuss.«
»Ja. Aber mehr Rechtssicherheit als Staatssicherheit.«
An diesem Punkt überkam Wendt das Gefühl, so habe er seine Frau noch nie erlebt. Das war nicht mehr der Film, der zu ihrem Geburtstag lief. Jemand putscht sie auf, hat daran gedreht. Einer, den es wegtreibt, dessen Bindung an unser Land sich gelockert hat. Irgend so ein Typ vom Schlage Richard Nebels.
Als die Gäste weg waren, sagte er: »Die zwei sehen wir so schnell nicht wieder. Jenny, musste das sein? Uta war deine beste Freundin, und Hilmar ist ein patenter Kerl, nie strapaziös, lammfromm, fast unpolitisch, wenn man ihn nicht piesackt.«
»Ja, bewundernswert. So seriös und konservativ. Seine Stimme hat mich gleich begeistert. Kompetent und gebieterisch. Die Stimme des Profis, des satten Beamten. Merkst du nicht, wie er Juno damit dirigiert? Und das ist mal ein netter Junge gewesen, als er noch Elektriker war. Macht korrumpiert, das siehst du an ihm. Aber ich, ich denke nicht daran, vor ihm zu kuschen. Ich hab' keine Lust mehr, mich zu verstellen! Ich bin einunddreißig und für solche Feigheit längst zu alt.«
Sie standen, die Hände voll Seifenschaum, nebeneinander am Abwaschbecken. »Das sind nun die Letzten, mit denen wir verkehren«, sagte Wendt zu seiner eigenen Überraschung. »Ein Paar wie wir, das kaum noch gemeinsame Freunde hat, was ist das denn noch für ein Paar?«
»Ziemlich gute Frage, Christian.«
»Und deine Antwort?«
»Lass uns die Zelters vergessen. Demnächst schleppe ich dir mal ein paar Leute von mir an, wenn du's nur erlaubst.«
»Ach, Jenny«, seufzte er, »kann das funktionieren?«
»Doch«, sagte sie und gab ihm einen Kuss aufs Ohr. »Pass auf, das sind prima Kumpel, du. Alles wird gut.«
4. Kapitel
Neue Freunde für die Wendts, das klang einfach und erwies sich doch als schwer. Jenny schaffte es halt nicht, die prima Kumpel für ein Gespräch mit Christian zu begeistern. Die jungen Oppositionellen aus dem Umfeld der Petrikirche, der Universität und des Antiquariats, in dem sie tätig war, brannten nicht gerade darauf, einen Hauptmann der Kripo kennenzulernen. Auch wenn sie hervorhob, ihr Mann kläre Tötungsverbrechen auf, mit politischen Straftaten habe er überhaupt nichts zu tun. Und Akademiker sei er auch, Diplomkriminalist nach seinem Fernstudium an der Humboldt-Uni! Schließlich hatte er nicht bloß die Polizeischule Aschersleben absolviert.
Peinlich, solche Beteuerungen. Selbst Andy und dessen Freundin Birgit gaben ihr einen Korb, mit Ausflüchten verziert. Es schien, als meine man im Kreis der stillen Protestanten, ein Händedruck Christians könne sie beflecken. Oder - da stelle die Staatsmacht ihnen eine Falle; das Misstrauen war groß. Der Riss zwischen Staat und Gesellschaft, der durch das Land lief, schon immer oben von unten trennte, wurde zum Graben. Auf beiden Seiten Hochmut und Berührungsangst, wie sollte ihr der Brückenschlag gelingen?
Eines Tages kam Uta ins Antiquariat, das sie noch nie betreten hatte. Der Kladde nach, die Jenny dort führte, geschah das am 14. Juni, einem Mittwoch. Gebrauchte Bücher mochte Uta nicht, die fand sie »unästhetisch«, sie suchte auch gar keins, sondern brachte selbst eins an, aus eigenem Besitz. Das Phantom von Richard Nebel, neuwertig, augenscheinlich ungelesen. Unter solch abgeschmacktem Titel hatte dieser Mann der kolumbianischen Drogenmafia ein Denkmal gesetzt. Ediert vom Verlag Das Neue Berlin in einem gelben Schutzumschlag, auf dem ein Soldat am Fallschirm hing. Wohl, weil das einem breiten Publikum eine Portion Nervenkitzel versprach. Oder auch, weil im Drogengeschäft massenhaft Militärpersonen, Waffen aller Art und Kriegshandlungen vorkamen.
Das Buch war Uta, so sagte sie, in ihrer Potsdamer Zeit vom Rektor der Pädagogischen Hochschule, dem sie Briefe und Listen tippte, als Auszeichnung überreicht worden. Sie hatte es aber kaum angerührt. Abenteuerschwarten gaben ihr nichts, darin kam die Liebe stets zu kurz. Zum Sex verknappt, diente sie dem Verfasser bloß dazu, die knallharte Handlung zu kontrapunktieren, also wie ein Weichmacher das Geschehen duftig aufzulockern, durch Szenen, denen Leben einzuhauchen ihnen nicht gegeben sei. Ja, der Liebesakt, die schwerste Übung des Schreibers! Über das Buch hinweg strahlte sie Jenny an und zeigte ihre schönen Zähne, das Lächeln der Eingeweihten, einer Frau, die weiß, worauf es ankommt letzten Endes ... Ohne die Reibungen vom Geburtstag zu streifen, sprach sie die nächste Einladung aus, kassierte sechs Mark für den Schmöker und schritt mit schwingenden Hüften hinaus in den Sonnenschein.
Jenny schrieb den Verkaufspreis auf den Innendeckel, sie legte Das Phantom gleich aus. Aber Andy, der in der Kunstabteilung wenig zu tun hatte, blätterte darin; er fand ein paar Bleistiftstriche, die man wegradieren musste. Sie sah ihm über die Schulter, in dem Gefühl, die Striche stammten von Hilmar. Sollte das Gespräch ihn so neugierig gemacht haben, dass er seine Scheu vor Romanen überwand? Sehr merkwürdig. Und weshalb hatte Juno sie beschwindelt? Laut Impressum war das Buch erst letztes Jahr erschienen, da konnte es ihr schwerlich von der Hochschule geschenkt worden sein, die sie 1986 verlassen hatte.
Jedenfalls war das Gekritzel nicht von ihr. Denn alles Markierte hing mit Hilmars Hobby zusammen, dem Fußball. Glaubte man Nebel, wurden Kolumbiens Kicker von der Unterwelt regiert. Die steckte ihr schmutziges Geld, sogenannte Narco-Dollar, nämlich in Klubaktien oder in den Ankauf ausländischer Spieler und wusch es so recht elegant. Dick unterstrichen der Satz: »Dank teurer Profis aus Uruguay und Argentinien stießen zweitklassige Vereine in die Oberliga vor.«
Am Rande Ausrufungszeichen der Empörung. Angekreuzt auch dies: »Als die Schiedsrichter nicht gehorchten, entführte die Mafia deren Spitzenmann und setzte ihn nach Tagen mit der Botschaft Wer schlecht pfeift, wird ausgelöscht wieder auf freien Fuß. Und es blieb nicht bei der Drohung, drei Pistoleros fingen Alvaro Ortega vor seinem Hotel ab und erschossen ihn, weil der Linienrichter ...« Ein fetter Strich am Rand, schief wie in Rage, dann folgte nichts mehr. Offenbar halte Hilmar das Buch verärgert zugeklappt und sein Weib beauftragt, es aus dem Haus zu schaffen.
Eine weitere Seltsamkeit war die eingedruckte Zueignung des Autors. Andy wies verdutzt darauf hin. Nebel hatte sein Buch einem berühmten Kollegen gewidmet, dessen Name sich mit oppositionellen Regungen verband. Für Stefan Heym. Durch häufiges Erscheinen des heymschen Charakterkopfes im Westfernsehen und das, was er dort äußerte, klang der Name wie ein alternatives Programm. Es hieß so viel wie: Für demokratischen Sozialismus. Das hätte man dem Nebel freilich nicht gedruckt. Jenny fand es schon erstaunlich, dass der Spruch in dieser Hülle durch die Zensur gerutscht war.
»Sehr hübsch«, nuschelte Andy dicht an ihrem Ohr, und wieder einmal glaubte sie zu spüren, dass er bei all der zur Schau gestellten Schnoddrigkeit im Grunde ein schüchterner Mensch war. »Der liest demnächst in der Kirche, wir holen ihn ab. Hast du Lust mitzukommen, Jenny?«
»Von wo holt ihr ihn ab?«
»Er macht Urlaub in Cumin.«
»Mein Gott, das ist mir zu weit.«
»Aber es ist doch am Samstag ...«
»Keine Zeit. Da sind wir selber eingeladen.«
»Bei der Lady von vorhin?«, fragte er enttäuscht. Es hörte sich an, als habe er etwas aufgeschnappt.
»Siehst du, Andy, so kommt das. Weil ihr euch so schwer damit tut, uns mal zu besuchen, müssen wir halt woanders hin. Mein Mann will auch nicht immer dieselben Gesichter sehen. Er arbeitet hart und hat daher ein bisschen Abwechslung nötig.«
»Bring ihn doch mit zum Heym-Abend in die Kirche.« Andy grinste so zaghaft zu seiner Frechheit, dass es schwer war, ihn nicht ein wenig sympathisch zu finden, skeptisch und einsam, wie er da stand, in seine Ideen versponnen. »Das wär schon mal 'ne Abwechslung für ihn. Oder verbietet es ihm sein Rang in der Hierarchie, mit unerwünschten Elementen öffentlich gesehen und vielleicht sogar von seinen Genossen fotografiert zu werden?«
»So ist es«, sagte sie. »Das hätte ihm gerade noch gefehlt. Du, er ist schon mit mir hinreichend gestraft. Aber was anderes wäre es, mal privat mit Christian zu sprechen. Ich an eurer Stelle täte es.«
»Aus humanitären Gründen?«
»Nein, aus politischen. Es wäre überhaupt nicht verkehrt, mit Polizisten zu reden und sich vielleicht sogar anzufreunden, wo das möglich ist.«
»Solange das Sein das Bewusstsein bestimmt, dürfte das unmöglich sein. Nur du hast es geschafft, Jenny. Das ist ja eben das Bewundernswerte an dir, das dunkle Geheimnis.«
»Das dir keine Ruhe lässt, weil du es ergründen willst?«, fragte sie mit sicherem Instinkt und genoss es, ihre Macht an ihm zu erproben, wenn auch nur für einen Augenblick.
»Na ja, das weißt du doch ...« Die Stimme sackte ihm weg. Er wandte sich um und wich in seine Kunstabteilung zurück, wo gar kein Kunde war.
Warum, überlegte sie, macht es solchen Spaß, ab und zu ein Biest zu sein? Manchmal sprang ein Funke über, es knackte richtig auf der Haut, und die Luft blieb ihr weg.
Drei Tage darauf saß sie in dem lärmenden Trabant, der Andys Vater gehörte. Christian war nach kurzem Zank allein zu den Zelters gegangen, nur geringfügig verstimmt. Er hatte eingelenkt, ihr aber - und das war sein gutes Recht - das Auto verweigert.
»Mir ist klar, weshalb du's mir nicht gibst«, hatte sie beim Abschied gesagt, froh, dass er sie ziehen ließ. »Falls der Dichter das Kirchenvolk aufwiegelt, die Christenheit anstiftet zu Handlungen gegen den Geist und Buchstaben des Marxismus-Leninismus, dann wäre dein Lada ein Tatwerkzeug, das polizeilich beschlagnahmt werden müsste, ja?«
»So könnte man's sehen«, erwiderte er leicht verkniffen.
»Nun verrat mir auch noch, falls der Mann mit dem Zug kommt, und es hätte schlimme Folgen - Zusammenrottung, Verächtlichmachung, Ehrabschneidung, Herabminderung und Rowdytum, du weißt schon -, legt ihr dann den Waggon still, in dem er gesessen hat?«
Mit Hinweisen auf den Gesetzestext bewies er ihr, dass sie Unsinn redete, und beschwor sie etwas nervös, sich zurückzuhalten und in nichts hineinziehen zu lassen: Sonst falle ihre Vorstrafe erschwerend ins Gewicht.
»Na schön, du hast mich überzeugt«, sagte sie schließlich. »Ich werde nur beten und singen. Und sämtliche Stoppschilder beachten, die du vorsorglich errichtet hast.«
»Ich hab' dir nur die Rechtslage erläutert.«
»Okay. Es haut einen immer wieder um zu sehen, was ein Polizist bewirken kann, wenn sonst niemand die Paragrafen kennt.«
»Vergiss sie ruhig: Das ist zu abstrakt für dich. Denk lieber an unsere Kubareise. Die wär nämlich zuerst im Eimer.«
»Beim Militär heißt das abgestufte Vergeltung. Hut ab vor deinem Staat! Was für ein Drohpotenzial er doch hat.«
»Es ist auch deiner, immer noch! Und er ist gar nicht so robust und brutal, wie du glaubst. Freiheit und Verantwortung sind im labilen Gleichgewicht, überall auf der Welt. Drückst du die eine Seite der Waage runter, hebelst du die andere aus, und wir haben Anarchie.«
»Wie schlimm«, hatte sie darauf gesagt, einigermaßen freundschaftlich, wie ihr schien, auf der Kippe zwischen Angriffslust und Leisetreterei. »Staatskunst als Nummer auf dem Hochseil. Die Balance zwischen Ordnung und Chaos, nur von Artisten zu meistern, den Weisen im Oberbüro. Stimmt bloß nicht bei uns, Christian. Hier bewegt sich doch nichts mehr! Ihr habt die rechte Waagschale so mit Sicherheit befrachtet, dass sie ganz unten ist und von der linken alles runterrutscht, was man draufpacken will. Freiheit findet bloß noch im Saal statt, unter dem Dach der Kirche, das ziemlich löchrig ist ...«
Und war gegangen in dem Gefühl. Flagge gezeigt zu haben, die Würde gewahrt, ihre Identität, das neue Selbstverständnis, ohne provokant zu sein. Christian hatte es selber schwer, das sah sie ja ein. Er hatte es nicht verdient, dass man ihn verletzte. Er war ihr Mann, sie liebte ihn trotz allem; und so sollte es bleiben.
Die Fernverkehrsstraße 105 war so voll wie an jedem sonnigen Tag in der Saison, obschon am Wochenende kaum Lastwagen fuhren. Erst in Vorpommern, wo sie dreispurig wurde, glückte es Andy, einen Konvoi von Anfängern schneidig zu überholen. Von da an warb er um ihre Aufmerksamkeit, indem er verhalten über Frauen sprach; die schwierige Doppelrolle der Frau als erotische Partnerin und als menschliches Wesen, das sie, wie er gern einräumte, ja außerdem war. Freigebig verstreute er die Schätze seiner Erfahrung, 24 Jahre, höchstens ein Drittel davon aktiv. Keineswegs grub er die Episoden mühsam aus, sie drängten vielmehr von selbst ans Licht ... Eine neue Seite an ihm. Wie leicht ihm dies von der Zunge ging! Es war, als befreie ihr Dabeisein all das aus einem rätselhaften Archiv, wo nichts von dem, was ihm jemals widerfuhr, verloren ging.
Sooft der Verkehr es zuließ, hingen seine Augen an ihr, um zu sehen, wie sie es aufnahm. Sie hatte den Eindruck, er wolle ihr auf möglichst dezente Art das Gefühl vermitteln, ein guter Liebhaber zu sein, zärtlich, erfahren, geduldig und voller Respekt ... Zwischendurch schwieg er, entweder um das nachwirken zu lassen, was er ihr da aufgetischt hatte, oder um einen Sonntagsfahrer auf den zweiten Platz zu verweisen, ihn mit der Kraft seiner 27 PS (waren es soviel?) zu deklassieren und - in der Sprache seiner Birgit, die er nicht mitgenommen hatte - Gummi riechen oder am Auspuff schnüffeln zu lassen.
»Und mit all diesen Mädchen«, fragte sie scheinheilig, »bist du intim gewesen, Andy?«
»Ich war mit den meisten im Bett, das ja«, brummte er und schlug, ein Chauvi der Landstraße, noch vorm Bahnübergang einen lästigen Mitbewerber um den Grand Prix der F 105. »Intim möchte ich nicht sagen.«
Andy verstummte, und wieder streifte sie sein Blick. Seine Pausen waren einzigartig. Er schien dann nur schwach mit der Realität verknüpft zu sein, mit dem, was hinter den Eierschalen der Plastwände auf ihn lauerte und sie beide riskant umgab. »Ist das nicht dasselbe?«, fragte sie.
»Nein ... Intim würde ich mit dir gern sein.« Er starrte geradeaus, sein Adamsapfel glitt hoch und runter, und die Knöchel seiner Fäuste, die das Lenkrad hielten, wurden weiß.
Jenny war baff. So viel Direktheit hatte sie ihm nicht zugetraut. »Ich mag dich ja auch, wirklich«, sagte sie zu ihrer eigenen Verblüffung. »Aber mehr ist ausgeschlossen. Weißt du, ich bin ein treues Weib. Wir haben reiflich überlegt und nicht etwa geheiratet, weil ein Kind unterwegs war; ich will nämlich gar keins. Meine Ehe ist also kein notwendiges Übel.«
»Im Prinzip sind Ehen mehr übel als notwendig«, sagte er und grinste frech,
Solch ein Absturz war typisch für seine Gespräche. Von der Höhe des Gedankens, oder auch der Leidenschaft, kippten sie schnell mal ins Geistlose. Doch sie verzieh ihm auch das. Man konnte ihm einfach nicht böse sein. »Lass uns aufhören. Wenn du über so was reden willst, solltest du dich an jüngere Damen wenden.«
»Du bist die beste Adresse dafür.«
»Nein, wir lassen's besser. Wir wissen beide, wie das meistens endet. Und wie willst du mit deinem fotografischen Gedächtnis, geschult an den Kunstwerken bei uns im Laden, eine Frau wie mich dann jemals vergessen?«
Bis hinter Stralsund schwieg er, betroffen, aber nicht gekränkt. Sie hatte es ins Komische gezogen und so den Stachel entfernt. Andy tat ihr leid, nicht nur wegen seiner Verliebtheit. Gehörte er doch zu den Nachdenklichen und Empfindsamen, die rasch an den Rand geraten, vermutlich in jeder Gesellschaft, da es ihnen so elend schwerfällt, sich anzupassen. Der geborene Nonkonformist. An der Uni hatte dieser Druck ihn wund gerieben, bis er im letzten Winter das Handtuch schmiss. Er stand bereits kurz vorm Examen, als der Sektionschef seine Diplomarbeit zurückwies. Und zwar, weil der Dozent, der sie betreut hatte, im Westen geblieben war; worauf man das ganze Thema pauschal verwarf.