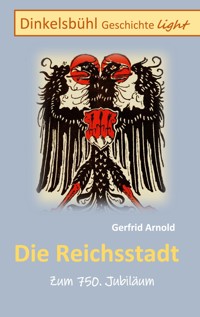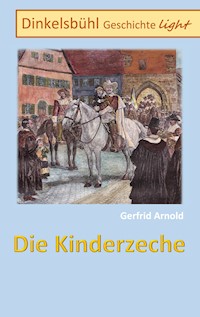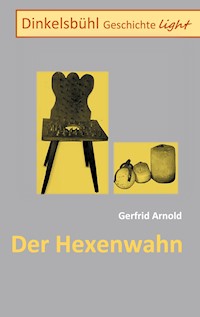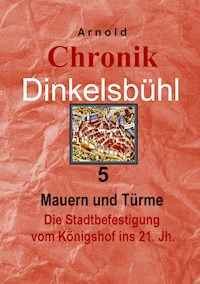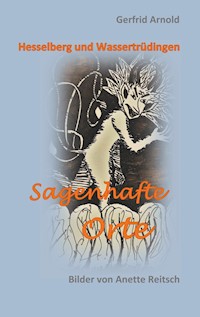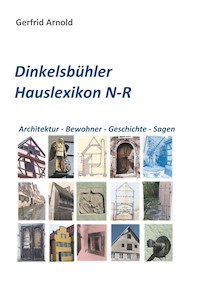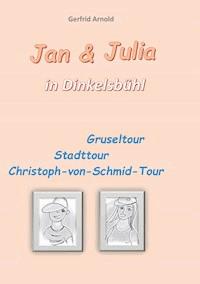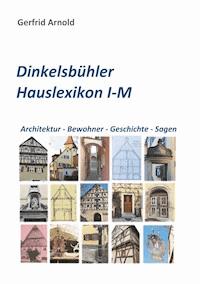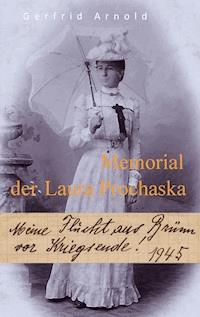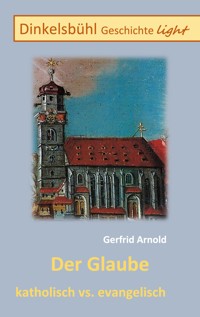
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der blühende Reichsstadtstaat Dinkelsbühl zerbrach nach Martin Luthers Reformation. Die Bürgerschaft scheiterte am Konflikt, der sich aus einer evangelischen Landeskirche und den katholischen Kaisern als Reichsobrigkeit ergab. Der Streit um den rechten Glauben und die Errettung der Seele spaltete das Sozialgefüge, es folgte ein bürgerlicher Kampf Gut gegen Böse. Der Machtanspruch beider Konfessionen ließ keine Toleranz zu. Katholikenrat und Protestantenrat wechselten sich ab und unterjochten die Andersgläubigen. Bald waren die Stadtkirche St. Georg und die Spitalkirche evangelisch, bald katholisch. Die Vormacht weniger katholischer Familien traumatisierte die überwiegend evangelische Einwohnerschaft. Der unheilige Glaubenszwist, alltäglich mit boshafter Leidenschaft betrieben, prägte die Dinkelsbühler Geschichte und führte in den wirtschaftlichen Ruin der Stadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Glaube
katholisch vs. evangelisch
Die Spaltung
Die Alte Kirche um 1500
Das Kaplanwesen
Die Missstände
Die Prädikanten
Die Neue Kirche Martin Luthers 1517
Im Treuekonflikt 1517 ff.
Im Glaubenskonflikt 1517 ff.
Die Dinkelsbühler Reformation 1517-1523
Eine Evangelische Landeskirche entsteht 1524-1529
Die evangelische Kirchenhoheit 1524/1525
Ein Stadtstaat mit zwei Religionen 1525
Das katholische Pfarramt verkommt 1525-1529
Bauern stehen auf gegen Obrigkeit und Kirche 1525
Dinkelsbühl in Zwangslage 1525
Dinkelsbühl schließt sich den Bauern an 1525
Dinkelsbühl muss büßen 1525 ff.
Die Evangelische Landeskirche besteht 1525-1531
Die Rekatholisierung misslingt 1529-1531
Dinkelsbühl stimmt katholisch ab 1529
Dinkelsbühl stimmt für das Reformationsende
1530
Hetzpredigten in der Pfarrkirche 1531
Der Gegenreformator Brecheisen wird entlassen 1531
Dinkelsbühl widersetzt sich dem Kaiser 1531
Der Kaiser muss einlenken 1531
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche lebt auf 1531
Die Stadt erkauft sich die Kirchenhoheit 1528-1532
Der Rat will das Besetzungsrecht erwerben 1528-1530
Die Spitalgeistlichen werden von der Stadt belehnt 1530
Kaufverhandlungen mit dem Kloster Mönchsroth 1530/31
Die Stadt kauft die Pfarrei St. Georg 1532
Dinkelsbühl wird evangelisch 1533/1534
Eine erste evangelische Kirchenordnung 1533
Katholische Geistliche treten über 1533/1534
Kaplanbruderschaft und Seelhäuser lösen sich auf 1534
Eine Evangelisch-Lutherische Staatskirche 1534/1535
Reformator Magister Bernhard Wurzelmann 1534
Die Stadtpfarrei wird reformiert 1534
Das Landkapitel wird reformiert 1535
Die Spitalkirche ist evangelisch 1535
Kirchliche Sittenstrenge kehrt ein
Das Schulwesen
Zwei Reformationsaltäre 1537
Die Abendmahlaltäre 1537
Der Schrift-Bild-Altar der Heiliggeistkirche im Spital 1537
Altarhistorie 1537-1930/31
Weder im katholischen noch im protestantischen Bund 1535-1539
Dinkelsbühl ist eine evangelische Reichsstadt 1541
Evangelische Feldschlange „Dinkelbäuerlein“ 1542
Der Kaiser mahnt zur Treue 1544-1546
Kaiser Karl V. beruhigt den Protestantenrat 1544-1546
Die Bürger wollen den Schmalkaldischen Bund 1546
Schicksalswende im Schmalkaldischen Krieg 1546
Der Bund lagert bei Dinkelsbühl 1546
Ein folgenschwerer Krieg 1546
Dinkelsbühl ist den kaiserlichen Truppen ausgeliefert 1546
Wurzelmann schürt den Widerstand 1546
Dinkelsbühl kapituliert 1546
Eine bikonfessionelle Reichsstadt 1546
Die Evangelischen leisten Widerstand 1546-1548
Keine Simultankirche St. Georg 1546
Kaiserliche Besatzungen üben Druck aus 1546-1548
Die Gemeinschaftsmesse 1548
Das kaiserliche Interim 1548
Der Rat verzögert die Gemeinschaftsmesse 1548
Drei christliche Gottesdienste in St. Georg 1548/1549
Der Augsburger Bischof katholisiert Dinkelsbühl 1548
Katholische Messfeier in St. Georg 1549
St. Georg wird Simultankirche 1549
Getrennte Gotteshäuser 1549
Die Pfarrkirche St. Georg wird katholisch 1549
Die Heiliggeist-Spitalkirche wird evangelisch 1549
Evangelisches Taufverbot 1549
Der Rat verbietet die evangelische Taufe 1549
Die Zünfte bitten vergeblich um Tauferlaubnis 1549
Den Evangelischen bleibt die Interimsmesse 1549
Beginn der katholischen Ratsherrschaft 1550-1552
Der Kaiser setzt die evangelischen Räte ab 1550
Der Katholikenrat lässt Zunftmeister nicht zu 1550
Das Karmeliterkloster wird zurückerstattet 1550
Nur Katholischer Gottesdienst 1550/1551
Die evangelische Taufe wird erneut verboten 1550-1552
Eine katholische Stadtverfassung 1552
Der Kaiser ändert die Stadtverfassung 1552
Die republikanische Verfassung von 1387
Die Katholikenverfassung schafft die Zünfte ab 1552
Die oligarchische Katholikenverfassung 1552-1649
Die Katholiken regieren zweieinhalb Monate 1552
Der protestantische Fürstenaufstand 1552
Die Spitalkirche und Taufe sind wieder evangelisch 1552
Die Stadtpfarrkirche St. Georg ist wieder evangelisch 1552
Ein Protestantenrat hat zwei Monate Ratsmacht 1552
Passauer Religionsfrieden: 3 Jahre Toleranz 1552-1555
Im Reich wird die Interimsmesse aufgehoben 1552
Der Katholikenrat regiert wieder 1552
Evangelischer Gottesdienst in der Spitalkirche 1552
Eine gewisse konfessionelle Toleranz 1552-1555
Der Existenzkampf der Evang. Gemeinde 1555-1566
Der Augsburger Religionsfrieden 1555
Der Katholikenrat entlässt evangelische Pfarrer 1555/1556
Elf Jahre ohne evangelische Geistliche 1556-1566
Acht Jahre ohne evangelisches Gotteshaus 1559-1566
Der Katholikenrat manipuliert eine Wahl 1560
Jahre der Verfolgung 1556-1566
Jahre der Rechtssuche 1556-1565
Der steinige Weg zur Evang. Landeskirche 1566-1567
Kampf um ein Bittgesuch an den Kaiser 1566
Erste Zugeständnisse des Katholikenrats 1566
Reformator Johann Knauer gründet die Gemeinde 1567
Der Katholikenrat behindert die junge Gemeinde 1567
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche entsteht 1567
Kirchenpfleger übernehmen die Kirchenleitung 1567
Die evangelische Spitalkirche ist zu klein 1567
Der Katholikenrat verhindert evang. Ratsherren 1567
Der Katholikenrat hemmt die Gleichstellung 1568-1572
Der Katholikenrat bedrängt die Evangelischen 1568-1572
Eine kaiserliche Kommission soll schlichten 1568
Die Evang. Landeskirche erweitert ihre Leitung 1570
Die kaiserliche Schlichtungskommission scheitert 1571
Der Katholikenrat bricht erneut die Verhandlung ab 1571
Der Katholikenrat widersetzt sich dem Kaiser 1572
Der Katholikenrat verbietet die erweiterte Leitung 1572
Das Reichskammergericht bestätigt das Ratsverbot 1572
Evangelische regieren 20 Jahre mit 1572-1598
Der Kaiser ändert seine Meinung 1572/1573
Die Evangelischen haben die Seinsheimer Rechte 1573
20 Jahre gemeinsame Regierung 1575-1595, 1598
Probleme der Evangelischen Landeskirche 1566-1607
Die Finanzierung 1576-1607
Die Schulfrage bleibt ungelöst 1566-1575
Die Kalenderreform spaltet den Alltag 1582-1634
Die Evangelischen widersetzen sich dem Rat 1583-1602
Die Evangelischen bleiben uneinsichtig 1602-1634
Der Rat regiert katholisch 1599-1632
Die Katholiken erstarken 1599
Gründung der protestantischen Union im Reich 1608 und der katholischen Liga 1609
Städter sollen katholisch werden 1599-1632
Evangelische in Bedrängnis 1599-1619
Die Kinderzeche, Kind des Glaubensstreits 1610-1654
Kapuzinerkloster, Zentrum der Katholisierung 1622-1626
Gewaltsame Katholisierung der Städter 1624-1632
Landuntertanen sollen katholisch werden 1627-1631
Verhärtete Fronten im Glaubenskrieg 1618-1648
Der Dreißigjährige Krieg beginnt 1617-1620
Protestantische Schweden besetzen die Stadt 1632-1634
Evangelische übernehmen die Stadtherrschaft 1632-1634
Eine evangelische Stadtverfassung 1632
Der Protestantenrat will sich rächen 1632-1634
Das Ende der evangelischen Ratsherrschaft 1634
Der Katholikenrat herrscht wieder 1634
Finanznot 1634-1712
Die Evangelischen müssen zahlen 1634-1640
Die Juden bessern die Finanzen auf 1636-1712
Die Städter sollen katholisch werden
1634-1640
Die Kirchengemeinde wird unterdrückt 1634-1639
Die Kirchengemeinde befürchtet ihr Ende 1640
Landuntertanen sollen katholisch werden 1640
Ein brüchiger bürgerlicher Stadtfrieden 1641-1645
Wechselnde Stadtbesatzungen 1645-1648
Die Konfessionen ringen um den Frieden 1645-1648
Der westfälische Friedenskongress 1645-1648
Evangelische kämpfen um die Gleichstellung 1645-1647
Kriegsfriede ohne Stadtfrieden 1648-1654
Der Katholikenrat lehnt die Parität ab 1648
Vier Bürgermeister regieren paritätisch 1649
Die Stadtkirche St. Georg bleibt katholisch 1649
Eine evangelische Lateinschule 1654
Parität und Normaljahr verhindern den Stadtfrieden
Die Spaltung
Am Ende des Mittelalters hatte die Reichsstadtrepublik Dinkelsbühl geordnete Finanzen, eine weitgehende Selbstverwaltung und ein florierendes Gewerbe. Es gab eine einvernehmliche Bürgerschaft, die ihre von Königen und Kaisern zugesicherten Freiheiten zu behaupten wusste.
In der Neuzeit zerbrach das Sozialgefüge in Stadt und Land irreparabel: „Die Reformation spaltete die Bürgerschaft in zwei Parteien, und aus tiefen Wunden blutend, in ihrer Lebenskraft gelähmt, schleppte sich die Stadt durch die religiösen Wirren hindurch, ein Bild der Verworrenheit, des Jammers und des Elends“, schrieb Lehrer Lorenz Beck 1886 in seiner „Übersicht über die Geschichte“.
Die Glaubensspaltung, die in einem Machtkampf europäischer Herrscher im Deutschen Reich ausgetragen wurde, fand im Reichsstadtstaat Dinkelsbühl fokussiert und dauerhaft statt. Katholiken und Evangelisch-Lutherische bekriegten sich: Feindseligkeiten zwischen Ratsherren, Geistlichen und Gläubigen beherrschten den Alltag bis in das 19. Jahrhundert.
Der Konfessionskonflikt wurde zum Dreh- und Angelpunkt im Reichsstadtstaat, er bestimmte den Verlauf seiner Geschichte. Der Streit um den rechten Glauben und die Regierungsmacht prägte und traumatisierte Dinkelsbühl.
Als Obrigkeit beteiligt waren auf katholischer Seite Kaiser und König des Reichs, der Bischof von Augsburg und die katholischen Ratsherren, bei den Evangelischen waren es protestantische Fürsten, die Kirchenpfleger und Ratsherren.
Durch die Reformation entwickelte sich ein evangelisch-lutherischer Reichsstadtstaat mit einer evangelischen Landeskirche, vorübergehend sogar mit Staatskirche. Die Stadt erwarb die Pfarreirechte und beanspruchte die Stadtpfarrkirche St. Georg für sich. Doch der Schmalkaldische Krieg von 1546, in dem sich Dinkelsbühl gegen den Kaiser erhob, änderte dies radikal.
Von nun an existierten im Reichsstadtstaat Dinkelsbühl zwei Konfessionen, im Konfessionellen Zeitalter (1550-1650) eine historische Besonderheit. Denn im Reich bestimmte seit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 die Landesherrschaft eine einzige Religion im Territorium nach dem Rechtsgrundsatz „cuius regio eius religio“.
Seit der Kaiser 1552 in Dinkelsbühl eine katholische Verfassung verfügt hatte, bildeten - mit kurzen Unterbrechungen - im bikonfessionellen Stadtstaat die Katholiken eine Machteinheit mit dem Stadtstaat. Aus der Bürgerrepublik wurde eine katholische Oligarchie, eine Herrschaft weniger Familien. Das kaiserlich angeordnete katholische Minderheitsregiment, vertrat damals nur ein Zehntel der Bevölkerung, was die wirtschaftliche Entwicklung hemmte und das Staatswesen ruinierte. Beispielsweise setzte der Katholikenrat den Augsburger Religionsfrieden von 1555 nicht um, der den evangelischen Gläubigen Toleranz zusicherte. Sie blieben politisch entmachtet und ein Jahrhundert von der Regierung Dinkelsbühls ausgeschlossen.
Ein tiefsitzender Gram, den die Machtübernahme und der Besitz der Stadtpfarrkirche während der Schwedenherrschaft im Dreißigjährigen Krieg von 1632 bis 1634 nicht lindern konnten. Es gelang dem Katholikenrat nicht, die Bevölkerung mit gegenreformatorischen Zwangsmaßnahmen zu rekatholisieren. Die vor dem Untergang stehende Evangelische Kirchengemeinde konnte sich behaupten und nach Beendigung des Dreißigjährigen Kriegs die Parität, also die numerische Gleichberechtigung bei Mitregierung und Verwaltung erhalten.
Im Friedensvertrag des Dreißigjährigen Kriegs von 1648 wurde für einige bikonfessionelle Reichsstädte festgelegt, den kirchlichen Besitzstand herzustellen, wie er am 1. Januar 1624 gewesen war. So durfte die katholische Minderheit die Stadtpfarrkirche St. Georg behalten, während sich die große evangelische Gemeinde mit der kleinen Hospitalkirche begnügen musste. Eine Ungerechtigkeit, der die Evangelischen bei jedem Kirchgang bis zur Einweihung ihrer neuen Hauptkirche 1843 erbitterte.
Vergleich des großen Innenraums der St. Georgskirche mit dem der Hospitalkirche.
Mit dem Friedensvertrag konnten sich die amtierenden katholischen Ratsherren nur schwer abfinden. Man protestierte gegen die zahlengleiche Besetzung der Ratsgremien und städtischen Ämter mit evangelischen Bürgern, obgleich nicht einmal dies gerecht war. Dem Zweidrittel der evangelischen Bevölkerung stand nur die Hälfte der Ratsherren und der Verwaltungs-Bediensteten zu.
Die katholische Ratsfraktion vereitelte zwei Jahre die herkömmlichen Ratssitzungen. In mehreren städtischen Friedensverträgen mussten die Evangelischen nachverhandeln, um die ihnen zustehend Parität in Politik, Verwaltung und Glauben zu erreichen. Schließlich konnte man eine Lateinschule eröffnen, weshalb man ein Schulfest wie bei den Katholiken abhielt. Es entstand die evangelische Kinderzeche, die die katholische Schulzeche der Lateinschüler übertrumpfte und sich zum Heimatfest entwickelte.
Trotz der Not der Einwohner nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte sich die Feindschaft zwischen Katholiken und Evangelischen unversöhnlich fort. Die Menschen hatten „nichts gelernt und nichts vergessen“, schrieb Lehrer Lorenz Beck 1886 in seiner „Übersicht über die Geschichte“, „überall waltete tiefes Misstrauen, Unehrlichkeit und Heuchelei. Neid und Eifersucht führten Auftritte herbei, die uns unglaublich erscheinen würden, wenn sie nicht aktenmäßig beglaubigt wären.“
Die Reformation und Gegenreformation hatten die Menschen in einen Glaubenskonflikt gestürzt und traumatisiert. Das Erdenleben war ein zeitlich befristetes Durchgangsstadium und im Vergleich zur Ewigkeit bedeutungslos. Es ging um das persönliche Seelenheil, um Erlösung oder Verdammnis, was unumgänglich nur in einer der beiden christlichen Religionen zu finden war. Für die Protestanten waren die Katholiken teuflische Götzendiener, bei den Katholiken galten die Lutheraner als irrgläubige Ketzer. Die polemische Herabsetzung des anderen Glaubens war Alltäglichkeit.
Zwei Jahrzehnte nach Einführung der konfessionellen Parität entstand ein Bild, das Martin Luther von der rettenden Himmelskette in den Höllenschlund stürzen lässt. Gehalten wird die Kette von Maria Mutter Gottes und Petrus, in Vertretung des Stuhls Petri, des Papstes. Im Begleittext bezieht man sich auf den Abzug der Schweden im Dreißigjährigen Krieg 1634: Dass die Evangelischen die St. Georgskirche wieder zurückgeben mussten, „schneidet ihnen ins Herz, und sie knirschen mit den Zähnen gegen uns und hoffen, dass dereinst in einem günstigen Augenblick in unserer Kirche wieder ihre Lehre verkündet werde“.
Bildtext: Die Porten der Hölle werden sye nit übergewaltigen.Ehemaliges katholisches Pfarrarchiv Dinkelsbühl.
Im Alltag herrschte in der Einwohnerschaft Boshaftigkeit. Man hielt die Mussfeiertage der Andersgläubigen nicht ein, man musizierte während des katholischen Gottesdiensts auf dem Marktplatz, der evangelische Türmer arbeitete auf dem Kirchturm von St. Georg, während der Priester die Messe zelebrierte. Die Geistlichen hielten auf der Kanzel Schmähpredigten gegeneinander, die Almosen des Bettelhaufens wurden konfessionell halbiert anstatt numerisch aufgeteilt.
Die Uneinigkeit der evangelisch-lutherischen und der katholischen Rathausfraktionen, die ihre jeweilige Religion vertraten, führte zum desaströsen Niedergang des Reichsstadtstaats. Die kleinkarierten Konflikte des Dinkelsbühler Magistrats wurden zum Reichsgespött, wenn „Dinkelsbühl“ wieder einmal gegen „Dinkelsbühl“ vor dem Reichskammergericht klagte.
Bereits ein halbes Jahrhundert nach Einführung der paritätischen Regierung wurden kaiserliche Kommissionen eingesetzt, die geordnete Verhältnisse herstellen sollten. Der katholische Ratsteil beschwerte sich 1696 beim Kaiser. Als sie nämlich für die Fronleichnamsprozession ihr Gras auf das „paritätische Pflaster“ gestreut hatten, waren die evangelischen Bewohner „aus ihren Häusern mit Besen und Rechen herausgeloffen und haben nicht allein selbiges via facti hinweggerechet und -gekehret, sondern auch mit Schimpf- und Spottreden der ganzen Prozession nachgeschrien und gepfiffen“. Martin Luther lehnte das Herumtragen der Monstranz ab.
Ein Jahr danach befasste sich eine kaiserliche Kommission mit dem Vorfall, und regelte u.a. die Einhaltung der Feiertage. Sie setzte sich für mehr Toleranz bei der Bevölkerung ein, und den Geistlichen wurden „Schmähungen und Anzüglichkeiten, welche zu einiger Verbitterung Anlass geben“, gegen die andersgläubigen Amtsbrüder verboten.
Außerdem bemängelte die Kommission, dass es auch für wichtige Amtsvorgänge keine Dokumente oder Akten gab. Sie prangerte die Unehrlichkeit der Stadtverwaltung in allen Bereichen an. Der Eigennutz von Ratsherren und städtischen Bediensteten war Gewohnheitsrecht geworden.
So bediente man sich beim bäuerlichen Großbetrieb des Spitals mit Milch, Rahm, Butter und Schmalz. Die als Spitalpfleger eingesetzten Ratsherren und Schreiber genehmigten sich Spanferkel, Kapaune, Mastgänse, Schinken und Speck, Mehl, Kraut und Rüben. Die Spitalleitung entwendete Futter für private Schweine und Geflügel. Für die Erledigung eigener Geschäfte holte man städtische und spitalische „Knecht, Mägd, Pferd, Schiff und Geschirr“. Darüber hinaus „vergaß“ man, Steuern zu zahlen.
Die Paritätsverfassung schrieb bei öffentlichen Ämtern die gleiche Stellenzahl für beide Konfessionen vor. Die Doppelbesetzung erfolgte alle zwei Jahre neu. War für eine Amtsstelle nur eine Person vorgesehen, musste der Nachfolger andersgläubig sein. Das blähte die Stadtverwaltung auf, machte sie handlungsunfähig und belastete den Haushalt.
Eindringlich wies die Kommission auf die nachteiligen Folgen „der Blutsfreund-, Schwäger- und Gevatternwirtschaft“ hin und ordnete an, „nur allein auf die Qualitäten und Tüchtigkeiten“ zu achten. Das aber war bei einer konfessionellen Gleichstellung wegen des kleinen katholischen Einwohneranteils undurchführbar, verfassungsgemäß musste bei Vergabe städtischer Arbeiten oder Pacht die abwechselnde Religionszugehörigkeit beachtet werden. So blieb alles beim Alten.
Eine andere Kommission kapitulierte 1721 vor der Vielzahl gegenseitiger Beschwerden: Allein die Evangelischen brachten 51 „Gravamina“ vor.
Rechthaberisch zogen die Evangelischen den Paritätsgedanken ins Lächerliche. Unter anderem stritt man um Wirtshausnamen, es gab eine evangelische und eine katholische „Rose“. Sie forderten einen evangelischen Arzt oder einen eigenen Apotheker, evangelische Stadtmusikanten und Singschüler, eine evan gelische Hebamme oder einen Brunnenschmecker, einen Stadtziegler, einen Scharfrichter und einen evangelischen Schweinehirten.
Vor allem störten sich die Evangelischen an den öffentlich aufstellten katholischen Kruzifixen und kostbaren religiösen Gemälden und Statuen, die „gar keine Proportion mit dem geringen Vermögen der Stifter“ hatten, und das „darin verwandte viele Geld öfters weit nötiger zu ihrem Gewerb und Nahrung“ gewesen wäre.
Mehrmals kritisierte der Kaiser „den zerrütteten Zustand und das im Grund verdorbene Regiment der Stadt“. Die von 1722 bis 1734 eingesetzte kaiserliche Kommission kostete die Stadt die enorme Summe von 68 331 Gulden 21 Kreuzer – nach ihrer eigenen Berechnung, andere schätzten sie auf mehr als 100 000 Gulden.
Immerhin schaffte es die Kommission, 1731 das gesamte Verwaltungswesen mit einer Bau-, Polizei- und Forstordnung, Kanzlei-, Konkurs-, Zoll- und Ungeldordnung, einer Schrannenordnung, Besoldungstabellen und anderem mehr zu erneuern.
Die Kreuzkapelle am Kapuzinerweg beim Kloster, erbaut 1729.
Maria Immaculata, Unbefleckte Jungfrau Maria, am Haus Ledermarkt 6, angebracht mit kirchlicher Unterstützung um 1750.
Heiliger Rochus als Jakobspilger, am Haus Weinmarkt 6, 17. Jh.
Heiliger Nepomuk, am Haus Weinmarkt 12, um 1725.
Ungeachtet der neuen Verwaltungsordnung wollte kein Nutznießer die Vetternwirtschaft beenden oder die unnötigen Mahlzeiten, Zechereien, Hochzeits- und Taufgeschenke vermissen. Die Geldverschwendung blieb.
Die Verkündung der neuen Verwaltungsordnung wurde 1738 gefeiert, als wäre der Stadtstaat schuldenfrei: Der Innere Rat wurde im Goldenen Kreuz für je 3 Gulden bewirtet, sämtliche Musikanten spielten auf, in einem anderen Gasthaus verzehrte der Große Rat für 1 Gulden 30 Kreuzer pro Person, eben so viel erhielten die Stadtbediensteten in einem dritten Wirtshaus. Bei den Getränken waren 2 Maß Wein frei, das übrige musste aus eigener Tasche gezahlt werden. Den vier Herren Geistlichen schickte man je vier Maß Wein vom Besten. Auch an die Bür gerschaft wurde gedacht, pro Kopf wurden 15 Kreuzer spendiert, um „sich in welchem Wirtshaus sie wollen, dafür lustig zu machen“.
Ebenfalls großartig beging die evangelische Kirchengemeinde zehn Jahre später das 100-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens, in dem man die Parität erhalten hatte. Zur Erinnerung daran wurde 1748 eine Gedenkmünze mit der Inschrift geprägt: „Die Parität und Libertät gottlob nun 100 Jahr hier steht.“
Die Feierlichkeiten begannen am Sonntag, wobei an den „folgenden 2 Tagen Jung und Alt ihre ganz außerordentliche Freude bezeugten“, berichtete der Zeitgenosse Gabler in seiner Chronik. Das Triumphieren über die Katholiken gipfelte am Schweinemarkt in einem Schießen mit 1000 Schuss täglich.