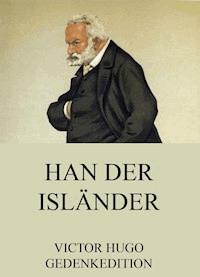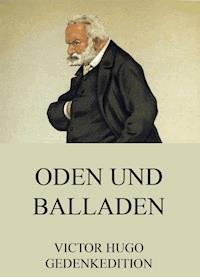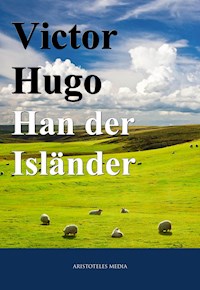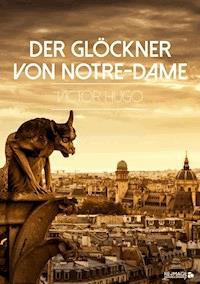
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Re-Image Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Glöckner von Notre-Dame ist ein 1831 erschienener historischer Roman des französischen Schriftstellers Victor Hugo. Im Mittelpunkt steht die aufwändig geschilderte Kathedrale Notre-Dame de Paris. In ihr spielen die wichtigsten Teile der Romanhandlung, vor allem das Geschehen um die Gestalt des Quasimodo, des Glöckners von Notre-Dame.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Glöckner von Notre-Dame
Victor Hugo
Re-Image Publishing
Copyright: This work is available for countries where copyright is Life+70 and in the USA
Inhaltsverzeichnis
Der große Saal
Peter Gringoire
Der Herr Kardinal
Meister Jakob Coppenole
Quasimodo
Die Esmeralda
Von der Szylla in die Charybdis
Der Grèveplatz
Besos para golpes*
Entstehende Ungelegenheiten, wenn man einem hübschen Mädchen des Nachts in den Straßen nachläuft
Der zerbrochene Krug
Die Brautnacht
Die Kirche Notre-Dame
Gute Herzen
Claude Frollo
Immanis pecoris custos, immanior ipse*
Der Hund und sein Herr
Abbas Beati Martini
Dies wird jenes töten
Unparteiischer Blick auf den alten Richterstand
Das Rattenloch
Geschichte eines Maiskuchens
Eine Träne für einen Tropfen Wasser
Es ist gefährlich, einer Ziege ein Geheimnis anzuvertrauen
Priester und Philosoph sind zweierlei
Die Glocken
‘ANAGKH
Die beiden Schwarzröcke
Sieben Flüche in freier Luft und ihre Folgen
Das Gespenst
Vom Nutzen der Fenster, die nach dem Flusse hinausgehen
Der verwandelte Taler
Lasciate ogni speranza*
Die Mutter
Drei verschieden gebildete Männerherzen
Das Fieber
Bucklig, einäugig, hinkend
Taub
Steingut und Kristall
Der Schlüssel der roten Tür
Gringoire hat mehrere gute Einfälle
Werde Landstreicher!
Es lebe die Lust!
Ein ungeschickter Freund
Ludwig XI. in der Bastille
Der kleine Schuh
La creatura bella bianco vestita*
Des Phoebus Heirat
Im Tode vereint
Der große Saal
Am Morgen des 6. Januar 1482 erwachten die Pariser beim Lärm aller Glocken, die im dreifachen Bereiche der Altstadt, der Universität und der Südstadt sämtlich und laut erklangen. Übrigens ist dies kein Tag, dessen die Geschichte einer Erwähnung würdigte. In dem Ereignis, das seit der Morgenröte Bürger und Glocken von Paris in Bewegung setzte, lag eben nichts Außerordentliches, das der Aufzeichnung wert war. Es galt weder einen Sturm der Picardier oder Burgunder, noch einen Einzug unseres sehr gefürchteten Herrn, des Königs, noch endlich ein Hängen von Dieben oder Diebinnen von seiten der Gerichtsbarkeit zu Paris. Es war nicht einmal der einer Gesandtschaft, mit Stickerei und Federbüschen geschmückt. Erst vor zwei Tagen hatten die flamländischen Gesandten, welche die Ehe des Dauphins und der Margarete von Flandern schließen sollten, zum großen Verdruß des Kardinals von Bourbon ihren Einzug in Paris gehalten; denn dieser mußte dem König zu Gefallen den bäurischen Schwarm flamländischer Bürgermeister mit heiterem Antlitz empfangen und sie in seinem Hotel von Bourbon mit einem sehr schönen Moralitäts-, Lust- und Possenspiel bewirten, während ein Platzregen seine prächtigen Wandteppiche vor seiner Tür überschwemmte.
Am 6. Januar war das ganze Volk von Paris, wie Jehan von Troyes erzählt, durch eine doppelte, seit undenklichen Zeiten vereinigte Feier in Bewegung gesetzt, durch den Tag der heiligen drei Könige und das Narrenfest. An dem Tage brannte ein Freudenfeuer auf dem Grèveplatz; ein Maibaum war an der Kapelle von Braque aufgepflanzt, und ein Mysterium wurde im Justizpalast gegeben. Am Tage vorher war dies auf den Kreuzwegen von den Leuten des Herrn Prévot, in schönen Röcken von veilchenblauem Kamelott mit weißen Kreuzen auf der Brust, öffentlich ausgerufen worden. Häuser und Buden waren geschlossen und das Gedränge der Bürger und Bürgerinnen wogte schon seit dem Morgen von allen Seiten auf einen der bezeichneten Orte zu. Jeglicher hatte sich seinen Platz schon gewählt, der eine das Freudenfeuer, der andere den Maibaum, ein anderer das Mysterium. Zum Ruhme des alten gesunden Menschenverstandes der Pariser Maulaffen müssen wir hier berichten, daß der größere Teil des Gedränges zum Freudenfeuer, das für die Jahreszeit durchaus sich geeignete, oder zum Mysterium hinwogte, das im wohlverschlossenen und bedeckten Hauptsaale des Palais gegeben werden sollte. Die Neugierigen waren sämtlich übereingekommen, den armen Maibaum ohne Blütenschmuck ganz allein im Januarwinde auf dem Kirchhof der Kapelle von Braque klappern zu lassen.
Hauptsächlich strömte das Volk in die Zugänge des Justizpalastes; denn man wußte, die vor zwei Tagen angekommenen flamländischen Gesandten würden bei der Vorstellung des Mysteriums und bei der Wahl des Narrenpapstes, die ebenfalls im Hauptsaal des Palais geschehen sollte, gegenwärtig sein.
Es war nicht leicht in das Innere zu dringen, obgleich der Saal damals für den größten bedeckten Raum in der ganzen Welt galt. Der mit Volk gefüllte Platz vor dem Palast bot den Neugierigen an den Fenstern der Häuser den Anblick eines Meeres, wohin fünf oder sechs Straßen, gleich Mündungen von Flüssen, stets neue Fluten von Köpfen ausgossen. Die Wogen dieses stets schwellenden Gedränges brachen sich an den Ecken der Häuser, die hier und da gleich Vorgebirgen in das unregelmäßige Becken des Platzes vorsprangen. Im Mittelpunkt der gotischen Vorderseite des Palastes wogte auf der großen Treppe ein doppelter Strom Hinauf- und Hinabsteigender auf und nieder, der, nachdem er sich unter dem mittleren Auftritt gebrochen, in breiten Wellen die Seitenabhänge hinabfloß. So rieselte es die Haupttreppe hinab unaufhörlich auf den Platz, wie ein Wasserfall in einen See. Geschrei, Lachen, Trampeln von tausend Füßen erweckte ungeheuren Lärm. Von Zeit zu Zeit ward dieser verdoppelt; der Strom, der das Gedränge zur Haupttreppe trieb, brauste zurück und wirbelte. Der Rippenstoß eines Bogenschützen oder das Pferd eines Sergeanten der Prévoté, der die Ordnung wiederherstellte, verursachte diese Wirren. An den Türen, an den Fenstern, zu den Dachluken heraus, auf den Dächern wimmelten zu Tausenden wackere Bürgerfiguren, ruhig und ehrenfest, den Palast, die Menge anguckend, ohne weitere Ansprüche; denn von der Pariserschaft begnügt sich die Mehrzahl, nur die Zuschauer zu beschauen; eine Mauer, hinter der sich irgend etwas ereignet, ist für uns schon ein hinreichender Gegenstand der Neugier.
Wenn der Leser damit einverstanden ist, so wollen wir versuchen, den Eindruck wiederzugeben, der auf ihn gewirkt hätte, wenn er, mit uns über die Schwelle jenes großen Saales treibend, mitten in das Gewühl geraten wäre. Im ersten Augenblick summt es uns in den Ohren, schwimmt es uns vor den Augen, über unsern Häuptern erhebt sich ein doppeltes Spitzgewölbe, mit hölzernen Bildwerken ausgetäfelt, mit goldnen Lilien auf azurnem Grunde bemalt; unsere Füße betreten einen Estrich von wechselweis gelegten, schwarzen und weißen Marmorplatten. Einige Schritte weit von uns erhebt sich ein ungeheurer Pfeiler, weiterhin ein zweiter, – ein dritter, – in der ganzen Länge des Saales sieben, die in der Mitte seiner Breite die Kerne des Doppelgewölbes stützen. Rings um die vier ersten Pfeiler Kaufbuden voll Glaswaren und Flitterstaat; um die drei letzteren sehen wir Eichenbänke, abgerieben und blankgeputzt von den Hosen der Prozessierenden und von den langen Röcken der Anwälte. Die hohen Mauern des Saales rings entlang, in den Räumen zwischen den Türen, den Fenstern, den Pfeilern zeigen sich in unabsehbarer Reihe die Bildsäulen aller Könige von Frankreich seit Pharamund, – einige faulenzerisch-schlaftrunken mit niedergeschlagenen Blicken und schlaff herabhängenden Armen, – so viele andere wieder gewaltig und kriegerisch, Haupt und Hände gen Himmel gewandt. Ferner blendet uns aus den langen in Spitzbogen auslaufenden Fenstern der tausendfarbige Glanz der Glasmalerei; an den weiten Ausläufen des Saales prunken die reichen, mit feiner Bildhauerarbeit geschmückten Pforten. Den Eindruck zu vollenden schimmert alles – Gewölbe, Pfeiler, Mauern, Gesims, Getäfel, Türen, Statuen – von oben bis unten in der Farbenpracht des Goldes und Azurs, – obgleich schon in jenem Zeitpunkt, da wir den Saal in Gedanken betreten, etwas angedunkelt.
Man versetze sich nun in diesen unermeßlichen länglichen Saal, erhellt von dem bleichen Lichtschimmer eines Januartages, gewaltsam in Besitz genommen von einer buntscheckigen lärmenden Menge, die die sieben Pfeiler umflutet, – und man wird eine, wenn auch noch etwas wirre Vorstellung von dem ganzen Gemälde haben, dessen sonderbare Einzelheiten wir alsobald genauer anzugeben versuchen wollen.
Von den beiden Enden dieses ungeheuren Vierecks nahm das eine jene berühmte Marmorplatte aus einem einzigen Stück ein, die so lang, so breit und so dick war, daß (um uns des Stils der alten Schriften zu bedienen, der einem Gargantua Appetit gemacht hätte) „eine ähnliche Marmorschnitte“ auf der ganzen Welt nicht wieder zu finden war; am andern Ende sah man die Kapelle, in der Ludwig XI. sich, kniend vor der heiligen Jungfrau Maria, in Stein hatte abbilden lassen, und wohin er auch, ohne sich darum zu kümmern, das in der Reihe der königlichen Bildsäulen nunmehr zwei Blenden leer blieben, die Standbilder Karls des Großen und Ludwigs des Heiligen schaffen ließ, zweier Heiligen, von denen er annahm, daß sie, als Könige von Frankreich, im Himmel großes Ansehen haben müßten. Diese Kapelle atmete ganz jenen reizenden Geschmack der kostbaren Baukunst, der wunderbaren Skulptur, der feinen und grundgediegenen Meißelarbeit, in der wir den Charakter der Endzeit gotischer Kunst erkennen und der bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts sich selbst noch in den phantastischen Werken des damals modern gewordenen Stils findet. Ein besonderes Meisterstück, was Zartheit und Grazie betraf, war die kleine gotische Rose über dem Portal, – man nannte sie einen Stern mit Kanten. In der Mitte des Saales, gegenüber der großen Türe, lehnte sich eine mit Goldstoff behangene Estrade an die Wand; man hatte für die Estrade vermittelst eines Fensters, das zu dem heimlichen Gang der goldenen Kammer gehörte, einen eigenen Eingang hergerichtet; sie war zu Plätzen für die zum Besuch des Mysteriums eingeladenen flamländischen Gesandten und für andere hohe Personen bestimmt. Die früher benannte Marmorplatte war der Ort, wo man herkömmlicherweise das Mysterium aufführte; von früh an war sie zu diesem Zwecke hergerichtet worden; die prachtvolle, aber von den Absätzen der Parlamentsschreiber bereits ganz zerkratzte Riesentafel trug jetzt ein ziemlich hohes Holzgerüst, dessen obere Fläche den Blicken aller Zuschauer im ganzen Saal gleich günstig gelegen, als Bühne dienen sollte, während das Innere, durch Teppichwände verkleidet, den bei der Darstellung beteiligten Schauspielern eine Art von Garderobe bieten mußte; eine ganz naiv von außen angelegte Leiter vermittelte den Verkehr zwischen der letzteren und der Bühne und gab ihre steilen Sprossen für die Auftritte und Abgänge der Handelnden her; da gab es doch wirklich kein so unvorhergesehenes Kommen, keine so unerwartete Entwicklung, keinen so heimlich vorbereiteten Knalleffekt, der nicht gehalten gewesen wäre, sich auf dieser Leiter hinauf zu bemühen. Unschuldig ehrwürdiges Kindesalter der Kunst und der Maschinerie!
Vier Sergeanten des Bailli vom Palast standen, als beeidigte Aufseher aller Volksfreuden, an Festtagen wie bei Hinrichtungen, an den vier Ecken der Marmorplatte. Erst mit dem zwölften Glockenschlage der Mittagstunde, nach der großen Uhr des Palastes, sollte die Vorstellung beginnen; – ohne Zweifel ziemlich spät für eine Bühnenvorstellung; indessen, man mußte nun einmal die den Gesandten gelegene Stunde wählen.
Jene ganze Volksmenge wartete nun schon seit Tagesanbruch. Eine gute Anzahl dieser wackern Schaulustigen klapperte seit so geraumer Zeit aus Frost mit den Zähnen vor der großen Treppe des Palastes; etliche versicherten sogar, die Nacht unter dem großen Tor zugebracht zu haben, um ja gewiß zuerst hineinzukommen. In jedem Augenblick schwoll die Menge an und begann, wie ein Gewässer, das seine durchschnittliche Höhe überschritt, längs der Wände emporzusteigen, rings um die Pfeiler anzuwachsen, sich über die Gesimse, Fensterbrüstungen, über alle architektonischen Vorsprünge, über alle Reliefs der Skulptur zu verbreiten. Da mußten dann Unbequemlichkeit, Ungeduld, Langweile, da mußte die Freiheit eines Tages des Zynismus und der Narretei, die durch Ellenbogenstöße oder Tritte wohlbeschlagener Schuhe aufgerüttelten Händel, die Ermüdung als Folge des langen Wartens dem unruhigen Lärmen dieser eingeschlossenen, festgepfropften, gepreßten, zerwalkten, beinahe erstickenden Menschenmenge den Charakter von Bitterkeit aufprägen. Man hörte nichts als Klagen und Flüche über die Flamländer, den Prévot des Handelsstandes, den Kardinal von Bourbon, den Hausvogt vom Palast, Frau Margarete von Österreich, die bestockten Trabenten, über Kälte, Hitze, schlechtes Wetter, – und über den Bischof von Paris, den Narrenpapst, die Pfeiler, die Statuen, über die geschlossene Tür hier, über das offene Fenster dort, – alles zum großen Spaß der Banden von Studenten und Lakaien, die in der Menge hin und wieder wie ausgesät waren, unter das allgemeine Mißbehagen noch ihre besonderen Einfälle und Spötteleien mengten und dadurch die allgemeine üble Laune noch sozusagen wie mit Nadelstichen spickten.
Ein Rudel solcher lustigen Kobolde hatte, nachdem sie die Scheiben eines Fensters eingeschlagen, verwegen auf einem Gesimse Posten gefaßt und trieb von da aus, alles musternd, seinen Spott mit allem, was drinnen und draußen im Saal und auf dem Platze wimmelte. Aus ihren Grimassen, aus ihrem schallenden Gelächter, aus ihren drolligen Zurufen, die sie von einem Ende des Saales zum andern an ihre Kameraden richteten und von diesen erwidert bekamen, ließ sich leicht abnehmen, daß diese jungen Musensöhne die Langeweile und Ermüdung der übrigen Anwesenden nicht teilten und es verstanden, zu ihrer besonderen Ergötzlichkeit einstweilen das, was unter ihren Augen vorging, zu einem Schauspiel zu gestalten, wobei sie das andere geduldig erwarten konnten.
„Bei meiner Seele, das seid Ihr, Johannes Frollo de Molendino!“ schrie einer von ihnen, ganz von der Art eines kleinen blonden Kobolds, von einem netten spitzbübischen Wesen, der sich an das Akanthus-Schnitzwerk eines Kapitäls angerankt hatte; „mit Recht heißt Ihr Johann von der Mühle, denn Eure zwei Arme und zwei Beine haben ganz das Ansehen von vier Windmühlenflügeln, die just im Gange sind. Wie lange seid Ihr denn schon hier?“
„Bei des Teufels Mitleid!“ versetzte Johannes Frollo, „über vier Stunden schon, und ich hoffe, daß sie mir einst an meiner Zeit im Fegefeuer abgezogen werden; ich hörte die acht Sänger des Königs von Sizilien den ersten Vers des Siebenuhr-Hochamts in der heiligen Kapelle anstimmen.“
„Nette Sänger!“ nahm der andere das Wort, „haben Stimmen, noch spitzer als ihre Mützen. Der König hätte, bevor er dem heiligen Johannes eine Messe stiftete, doch zuerst anfragen sollen, ob dieser ehrliche Mann – der heilige Johann – den lateinischen Psalmgesang im provenzalischen Akzent vertragen kann?“
„Das ist nur, damit diese verdammten Sänger des Königs von Sizilien angestellt wurden; deshalb hat er’s getan“, belferte ein altes Weib in der Menge unten am Fenster. „Ich bitt Euch nur: tausend Pariser Livres für eine Messe! Und noch obendrein auf den Pacht der Halle der Seefische in Paris.“
„Still, Alte!“ beschwichtigte ein dicker gewichtiger Mann, der an der Seite einer Fischverkäuferin sich die Nase zuhielt. „Das war ganz in der Ordnung, die Messe zu stiften. Oder wollt Ihr, daß der König in seine Krankheit zurückfallen sollte?“
„Brav gesprochen, Meister Gilles Lecornu, königlicher Hofkürschner“, schrie der kleine Student, der sich am Kapitäl angeklammert hielt. Ein lautes Gelächter aller Studenten bewillkommnete den verdrießlichen Namen des armen Kürschners der Röcke des Königs.
„Lecornu! (Der Gehörnte.) Gilles Lecornu!“ riefen die einen. – „Cornutus et hirsutus!“* sagte ein anderer. – „Ja gewiß!“ begann der kleine Teufel des Kapitäls aufs neue. „Was lacht ihr? Das ist der ehrsame Mann Gilles Lecornu, Prévot vom Hotel des Königs, Sohn des Meisters Mahiet Lecornu, ersten Hüters des Waldes Vincennes, sämtlich Bürger von Paris, sämtlich vom Vater bis auf den Sohn verheiratet.“
(* Lateinisch: Der Gehörnte und der Struppige)
Das Gelächter ward verdoppelt. Ohne ein Wort zu erwidern, bemühte sich der dicke Kürschner, sich den von allen Seiten auf ihn gerichteten Blicken zu entziehen; allein er schwitzte und schnaubte vergeblich; er glich einem Keil, der ins Holz getrieben wird; alle seine Bemühungen befestigten nur um so mehr sein breites, apoplektisches, von Ärger und Zorn glühendes Gesicht zwischen den Schultern seiner Nachbarn. Endlich kam einer von diesen, ebenso dick, kurz und ehrwürdig wie er selbst, ihm zu Hilfe.
„Verflucht! Studenten sprechen so unverschämt mit Bürgern! Zu meiner Zeit hätte man sie mit Knütteln geprügelt und dann auf den Prügeln verbrannt!“
Der ganze Haufe brach in Gelächter aus.
„Holla! He! Wer plärrt dieses Lied? Wer ist der Uhu des Unheils? – Wart, ich erkenne dich! Du bist Meister Andry Musnier. – Weil er einer von den vier geschworenen Buchhändlern der Universität ist. – In seiner Bude ist überall die Zahl vier. Vier Nationen, vier Fakultäten, vier Feste, vier Prokuratoren, vier Wähler, vier Buchhändler. – Ja, ja“, fiel Jehan Frollo ein, „wir müssen Ihnen vier Teufel auf den Hals schicken. Musnier, wir verbrennen deine Bücher, – Musnier, wir prügeln deinen Bedienten, – Musnier, wir zerzausen deine Frau – die gute dicke Oudarde – die so frisch und munter ist, als wäre sie schon Witwe.“
„Der Teufel mag Euch holen“, brummte Meister Andry Musnier.
„Meister Andry, schweig“, fiel Jehan ein, der noch immer auf dem Kapitäl hing, „oder ich falle dir auf den Kopf.“
Meister Andry schlug die Augen auf, schien einen Augenblick lang die Höhe des Pfeilers und die Schwere des Schelms zu messen, multiplizierte diese Schwere mit dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit und schwieg.
Jehan fuhr triumphierend fort, als Herr des Schlachtfeldes: „Ja, ja, das tu ich, ob ich auch der Bruder eines Archidiakonus bin.“
„Schöne Herren, unsere Oberen in der Universität! Sie machen nicht einmal an einem Tage, wie heute, unsre Privilegien geltend! Maibaum und Freudenfeuer in der Stadt, Mysterien, Narrenpapst und flamländische Gesandte in der Altstadt, in der Universität nichts!“
„Der Platz Maubert ist ja groß genug“, bemerkte einer der Schreiber, über das Fensterbrett gebeugt. – „Nieder mit dem Rektor, den Wählern und Prokuratoren!“ rief Johannes. – „Heute abend“, fiel ein anderer ein, „muß man auf dem Champ-Gaillard von den Büchern des Meisters Andry ein Freudenfeuer machen! – und mit den Pulten der Schreiber! – und mit den Stäben der Pedelle! – und mit den Spucknäpfen der Dekane – und mit den Schränken der Prokuratoren – und mit den Backtrögen der Wähler! – und den Fußschemeln des Rektors!“
„Nieder mit ihnen!“ begann der kleine Jehan aufs neue kreischend, „nieder mit Meister Andry! Nieder mit den Pedellen und Schreibern, Theologen, Ärzten und Dekretisten! Nieder mit den Prokuratoren, Wählern und dem Rektor!“
„Das Ende der Welt ist nah“, brummte Meister Andry, sich die Ohren verstopfend. – „Beiläufig gesagt, da kommt der Rektor über den Platz“, rief einer von denen, die am Fenster saßen.
Alle wandten sich dem Platze zu. – „Ist es wahrhaftig unser ehrwürdiger Rektor, Meister Thibaut?“ fragte Jehan Frollo de Moulin, der, an einen Pfeiler im Innern geklammert, nicht sehen konnte, was außerhalb vorging.
„Ja, ja“, erwiderten alle andern, „er ist’s, Meister Thibaut, der Rektor.“ Wirklich war es der Rektor mit allen Würdenträgern der Universität, die in Prozession der Gesandtschaft entgegengingen und in dem Augenblick über den Platz des Palais kamen. Die in das Fenster gedrängten Studenten empfingen sie im Vorbeigehen mit Spott und ironischem Beifallgeklatsch. Der Rektor, der an der Spitze marschierte, erhielt die erste Lage. Sie war heftig. „Guten Tag, Herr Rektor! Hallo! He! Guten Tag! – Der alte Spieler, wie kommt’s, daß er hier ist! Er hat seine Würfel verlassen können! – Wie er auf dem Maultier trottet! Dies hat nicht so große Ohren, wie er selbst. – Hallo! He! Guten Tag, Herr Rektor! Tybalde aleator! Alter Pinsel! Alter Pinsel! Gott schütze dich hast du oft gestern nacht die doppelte Sechs geworfen? – Wohin, Thibaut? Was drehst du der Universität den Rücken und trottest zur Stadt?“ – „Gewiß sucht er eine Wohnung in der Straße Thibautodé!“ rief Jehan de Moulin. Die ganze Bande wiederholte den Witz mit Donnerstimme und wütendem Händeklatschen.
Dann kam die Reihe an die übrigen Würdenträger. „Nieder mit den Pedellen, nieder mit den Stabträgern! – Sage doch, Robin Poussepain, wer ist doch der da? – Gilbert de Suilly, Gilbertus de Soliaco, Kanzler des Kollegiums von Autun. – Hier ist mein Schuh; du hast einen besseren Platz, als ich, schmeiß ihn dem da an den Kopf. – Nieder mit den sechs Theologen und ihren weißen Oberkleidern! – Das sind Theologen? „Ich dachte, es wären sechs weiße Gänse! – Nieder mit den Ärzten! – Nieder mit den Kardinal- und Quodlibetar-Disputationen! – Da! Ein Kopfputz von mir, Kanzler von G. Geniève; du hast mir unrecht getan. – Ja, ja. Er gab meine Stelle in der Normandie dem kleinen Ascanio Falzaspada, der zur Provinz Bourges gehört, weil er Italiener ist.“ – „Das ist nicht recht!“ riefen alle Studenten. „Nieder mit dem Kanzler von G. Geniève! – Ho! He! Meister Joachim Ladehors! Ho! He! Louis Dahuille! Lambert Hoctement! – Der Teufel erwürge den Prokurator der deutschen Nation! – und die Kapläne der Sainte-Chapelle mit ihren grauen Pelzen! – Seu de pellibus grisis furratis!* – Hallo! He! Die Meister in den Künsten! Alle schönen schwarzen und alle schönen roten Kappen! – Der Rektor hat an ihnen einen schönen Schweif. – Jehan, die Kanonici von S. Genoveva!“ –
(* Lateinisch: Oder in ihren grauen Pelzmänteln.)
„Wie glücklich sind doch jene, alles zu sehen“, sagte seufzend Johannes de Molendino, noch immer auf dem Kapitäl sitzend.
Endlich neigte sich der geschworene Buchhändler der Universität, Meister Andry Musnier, zum Ohre des Kürschners der Kleider des Königs mit den Worten:
„Ich sage Euch, Herr, das Ende der Welt ist nahe. Man sah nie solche Ausgelassenheit der Studenden. Die verfluchten Erfindungen des Jahrhunderts richten alles zugrunde, die Kanonen, Serpentinen, Bombarden und vor allem die Buchdruckerkunst, diese andere Pest aus Deutschland. Keine Manuskripte! Keine Bücher! Der Druck tötet den Buchhandel! Das Ende der Welt ist nah.“
„Das sehe ich auch am Absatz der Sammetstoffe“, sagte der Kürschner.
In dem Augenblick schlug die Glocke zwölf Uhr. Die ganze Masse stieß mit einer Stimme ein „Ah“ aus. Die Studenten schwiegen. Plötzlich entstand eine große Umwandlung, eine große Bewegung der Hände und Füße, ein allgemeines Donnern von Schnupfen und Husten, alles stellte sich zurecht, reckte, richtete und gruppierte sich. Dann herrschte tiefes Schweigen, alle Hälse blieben ausgestreckt, jeder Mund stand offen, alle Blicke wurden zur Marmortafel gerichtet – nichts erschien. Die vier Sergeanten des Bailli standen starr, unbeweglich, wie vier mit Farbe bestrichene Statuen, da. Alle Augen richteten sich hierauf zu der den flamländischen Gesandten zurückbehaltenen Estrade. Die Tür blieb verschlossen. Die Estrade leer. Seit dem Morgen erwartete die Volksmenge drei Dinge, den Mittag, die flamländische Gesandtschaft, das Mysterium. Nur der Mittag hatte sich pünktlich eingestellt.
Das war zuviel auf einmal. Man wartete eine, zwei, drei, vier, fünf Minuten, eine Viertelstunde. Nichts kam zum Vorschein. Der Ungeduld folgte Zorn. Heftige Reden gingen herum, allerdings nur mit leiser Stimme. – „Das Mysterium, das Mysterium!“ murmelte man dumpf. Die Köpfe gerieten in Gärung. – Ein Sturm, der freilich nur dumpf brüllte, schwebte über der Volksmasse. Jehan de Moulin schlug die ersten Funken.
„Das Mysterium! Zum Teufel mit den Flamländern!“ rief er mit aller Kraft seiner Lungen, indem er sich wie eine Schlange um das Kapitäl wand.
Das Volk klatschte mit den Händen. „Das Mysterium!“ rief es ihm nach, „und Flandern hole der Teufel!“
„Das Mysterium! Zum Teufel mit den Flamländern“, schrie er aufs neue, „oder mir scheint es zweckmäßig, zum Ersatz und anstatt der Komödie und Moralität den Bailli des Palais zu hängen.“ –
„Schön gesagt“, schrie das Volk, „beginnen wir das Hängen mit den Sergeanten!“
Es folgte ein lauter Zuruf. Die vier armen Teufel wurden blaß und sahen einander an. Die Volksmenge setzte sich gegen sie in Bewegung, und sie sahen schon, wie das gebrechliche hölzerne Geländer, das sie von ihr trennte, sich bog und unter dem Druck der Masse zu brechen schien.
Der Augenblick war kritisch. „Nieder mit ihnen! Nieder mit ihnen!“ rief man von allen Seiten.
In dem Augenblick erhob sich der Vorhang des Ankleidezimmers, das wir oben beschrieben haben, eine Person trat hervor, deren Anblick allein plötzlich die Menge aufhielt und wie durch einen Zauber ihren Zorn in Neugier verwandelte.
„Still! – Still!“ –
Die Person trat, an allen Gliedern zitternd und ohne das geringste Zeichen von Gemütsruhe, mit vielen Verbeugungen, die, je mehr sie vortrat, desto mehr Kniebeugungen glichen, bis an den Rand der Marmortafel. Unterdes hatte die Ruhe sich allmählich wieder eingefunden. Nur jenes leichte Geräusch war zurückgeblieben, das auch beim Schweigen der Menge stets emporsteigt.
„Ihr Herren Bürger und ihr Frauen Bürgerinnen“, sprach jener, „wir werden die Ehre haben, vor Seiner Eminenz dem Kardinal eine sehr schöne Moralität, welche heißt ‚Das gute Urteil der Frau Jungfrau Maria‘, zu deklamieren und darzustellen. Ich gebe den Jupiter. In diesem Augenblick begleitet Seine Eminenz die sehr achtbare Gesandtschaft des Herrn Herzogs von Österreich, um die Rede des Herrn Rektors der Universität am Tore aux Baudets zu hören. Sobald Seine Eminenz erschienen ist, wollen wir anfangen.“
Gewiß konnte nur Jupiters Dazwischentreten die vier armen unglücklichen Sergeanten des Bailli vom Palais retten. Übrigens war der Anzug des Herrn Jupiter sehr schön und hatte dadurch, daß er alle Aufmerksamkeit der Menge auf sich zog, nicht wenig dazu beigetragen, das Volk zu beruhigen. Jupiter trug ein von schwarzem Samt bedecktes Panzerhemd mit vergoldeten Nägeln; seinen Kopf schmückte ein mit vergoldeten Silberknöpfen gezierter Helm und ohne den roten dicken Doppelbart, der beide Hälften seines Gesichts umhüllte, ohne die Rolle von vergoldeter Pappe, die, besät mit Flittern und starrend von langen Stücken Rauschgold, in seiner Hand ruhte, und worin die Kenneraugen sehr leicht den Donnerkeil erkannten, endlich ohne seine fleischfarbenen und mit Bändern auf griechische Weise geschmückten Füße, hätte er mit einem bretagnischen Bogenschützen vom Korps des Herrn Herzogs von Berry, in aller Strenge des Anzugs, den Vergleich aushalten können.
Peter Gringoire
Während seiner Ansprache verminderte sich indes von Wort zu Wort die durch das Kostüm hervorgerufene Befriedigung und Bewunderung; als er vollends an die unglückseligen Schlußworte kam: „Sobald Seine Eminenz, der Herr Kardinal, eingetroffen sein werden, werden wir anfangen“, verschlang lautes Spottgelächter seine Stimme.
„Beginnt auf der Stelle! Das Mysterium! Augenblicklich das Mysterium!“ schrie das Volk. Aus allen Stimmen heraus aber hörte man hauptsächlich unsern Johannes de Molendino, dessen Kehlenlaute den Spektakel durchgellten wie die Querpfeife bei einer Katzenmusik von Nîmes. „Fangt auf der Stelle an“, kreischte der Student.
„Fort mit Jupiter und dem Kardinal von Bourbon!“ brüllte Robin Poussepain und die andern Musensöhne, welche am Fenster saßen.
„Augenblicklich die Moralität!“ wiederholte die Menge, „gleich auf der Stelle! Sack und Strick für die Komödianten und den Kardinal!“ Der arme Jupiter ließ, ganz verstört, bestürzt und erblassend unter seiner Schminke, seinen Blitz fallen, nahm seinen Helm in die Hand, verbeugte sich und stammelte zitternd: „Seine Eminenz … die Gesandten … Frau Margarete von Flandern.“ … Er wußte, aus Furcht, gehängt zu werden, im Grunde nicht, was er sagen sollte. Vom Volk zum Hängen bestimmt – fürs Wartenlassen; vom Kardinal, wenn er nicht wartete: sah er zu beiden Seiten einen Abgrund oder vielmehr eine Galgen.
Glücklicherweise riß ihn plötzlich ein anderer aus der Verlegenheit und aus der Verantwortlichkeit. Eine Person, die bisher diesseits der Balustrade, in dem rings um die Marmortafel frei gehaltenen Raum gestanden, und die noch von niemand bemerkt worden war, weil der Durchmesser des Pfeilers, an den sie sich gelehnt hatte, ihre lange dünne Figur von jedermanns Gesichtskreis abschnitt, näherte sich jetzt, dem armen Schlachtopfer auf der Bühne ein Zeichen gebend, der Marmorplatte; es war ein großer, magerer, blasser, junger Mensch, der gleichwohl auf der Stirn und Wangen schon Runzeln hatte, seine Blicke leuchteten, um seine Lippen schwebte ein Lächeln, er trug eine schwarze, vom vielen Tragen glänzend geriebene Jacke. Der arme Schelm auf der Bühne aber bemerkte ihn nicht gleich.
Der neue Ankömmling trat einen Schritt näher und sprach: „Jupiter, mein lieber Jupiter.“ Der andere hörte ihn noch immer nicht.
Endlich schrie ihm der lange Blondkopf beinahe dicht unter die Nase:
„Michel Gilborne!“
„Wer ruft mich?“ erwiderte Jupiter, wie aus Träumen emporfahrend.
„Ich“, erwiderte der Mann in der schwarzen Jacke.
„Ach“, stöhnte Jupiter.
„Fangt nur gleich an“, fuhr der andere fort, „stellt das Publikum zufrieden, ich will’s auf mich nehmen, den Herrn Bailli zu besänftigen, und der wird mit dem Kardinal ein gleiches tun.“
Jupiter schöpfte wieder Luft.
„Meine Herren Bürger“, schrie er mit aller Kraft seiner Lunge zu der noch immer tobenden Menge, „augenblicklich werden wir anfangen.“
„Evoe, Jupiter! Plaudite cives!“ brüllten die Studenten, und das Volk jauchzte hintendrein.
Ein donnergleich betäubendes Händegeklatsch begleitete den Jubel, daß der Saal davon noch zitterte, selbst als Jupiter schon hinter seinem Teppich verschwunden war. Inzwischen hatte sich der Unbekannte, der wie durch Zauberei den Sturm (um mit unserem alten Corneille zu sprechen) so schnell in Meeresstille verwandelt, bescheiden ins Halbdunkel seines Pfeilers zurückgezogen und wäre daselbst ohne Zweifel ebenso unsichtbar, unbeweglich und stumm wie früher geblieben, hätten ihn nicht zwei junge Mädchen, die in den ersten Reihen der Zuschauer saßen und sein Gespräch mit Michel Gilborne-Jupiter belauscht hatten, aus seinem Versteck hervorgebeten.
„Meister!“ rief die eine. – „Schweigt, liebe Liénarde“, sagte ihre hübsche, blühende, geputzte Nachbarin. „Er ist kein Kleriker; er ist ein Laie; Ihr müßt nicht Meister, sondern Herr sagen.“ „Herr“, sagte Liénarde.
Der Unbekannte trat an das Geländer. „Was wünscht ihr Damen?“ fragte er mit dem Ausdruck eifriger Dienstfertigkeit.
„Oh nichts“, erwiderte Liénarde verlegen, „meine Nachbarin Gisquette wollte Euch etwas sagen.“
„Nein“, sagte Gisquette errötend, „Liénarde redete Euch Meister an; ich belehrte sie, sie müsse Herr sagen.“
Die beiden Mädchen schlugen die Augen nieder. Der Angeredete, welcher nichts anders wünschte, als ein Gespräch anzuknüpfen, betrachtete sie lächelnd.
„Ihr habt mir also nichts zu sagen, meine Damen?“
„Oh, durchaus nichts“, sagte Gisquette.
„Nichts“, sagte Liénarde.
Der schlanke blonde Mann trat ein wenig zurück; allein die beiden neugierigen Mädchen hatten keine Lust, die Gelegenheit zu schwatzen sich entschlüpfen zu lassen.
„Herr“, sagte Gisquette lebhaft, mit dem Ungestüm einer geöffneten Schleuse oder einer Partei ergreifenden Frau, „Ihr kennt also den Soldaten, der die Rolle unserer Frau, der heiligen Maria, im Mysterium spielt?“
„Ihr, meint die Rolle Jupiters“, erwiderte der Unbekannte.
„Ja“, sagte Liénarde, „wie dumm ist die! Ihr kennt also Jupiter?“
„Den Michel Giborne?“ fragte der Ungenannte. „Ja, meine Damen.“
„Wie prächtig ist sein Bart“, fragte Liénarde.
„Werden die schöne Sachen sprechen?“ fragte furchtsam Gisquette.
„Oh, sehr schöne, meine Damen“, erwiderte der Ungenannte ohne Bedenken.
„Was ist das Stück?“ fragte Liénarde.
„Das treffliche Urteil der Frau Jungfrau Moralität, meine Dame.“
„So, das ist was anderes“, erwiderte Liénarde.
Es folgte eine kurze Pause. Der Unbekannte unterbrach sie: „Es ist eine ganz neue und noch nicht aufgeführte Moralität.“
„Es ist also nicht dieselbe“, begann Gisquette aufs neue, „die man vor zwei Jahren beim Einzuge des Herrn Legaten hielt, wo drei schöne Mädchen auftraten …“
„Sirenen“, unterbrach sie Liénarde.
„Ganz nackte Mädchen“, fügte der junge Mann hinzu.
Liénarde schlug schamhaft die Augen nieder; Gisquette sah sie an und tat dann dasselbe.
Er fuhr lächelnd fort: „Das war schön anzuschauen. Aber heute gibt man eine Moralität, die für die Prinzessin von Flandern ganz besonders geschrieben wurde.“
„Werden Schäferlieder da gesungen?“ fragte Gisquette.
„Pfui“, antwortete der Unbekannte, „in einer Moralität! Ihr müßt die verschiedenen Arten des Schauspiels nicht verwechseln; das gehört in eine Posse.“
„Wie schade!“ begann Gisquette aufs neue. „Am Springbrunnen der Klapprose kämpften an dem Tage wilde Männer und Frauen in schönen Stellungen und sangen kleine Verschen und Schäferlieder.“
„Was sich für einen Legaten schickt, schickt sich nicht für eine Prinzessin“, sagte der Unbekannte in trockenem Ton.
„Neben ihnen“, erzählte Liénarde, „spielten Instrumente schöne Weisen. Und um die Vorübergehenden zu erfrischen“, sagte Liénarde, „spritzte der dreifache Mund des Springbrunnens Wein, Milch und Muskateller; jeglicher trank, der Lust hatte. Und nicht weit von der Klapprose, bei der Dreifaltigkeit, ward eine Passion von nicht redenden Personen gegeben.“
„Ob ich mich dessen erinnere!“ rief Gisquette. „Gott am Kreuz und die beiden Schächer rechts und links.“
Hier fingen die beiden Gevatterinnen, erhitzt von der Erinnerung an den Einzug des Legaten, zugleich zu sprechen an.
„Und bei dem Springbrunnen St. Innocenz stand ein Jäger, der beim Lärm der Hunde und Jagdhörner eine Hirschkuh verfolgte.“
„Und bei den Schlächterbuden standen die Gerüste, die die Bastille von Dieppe darstellten.“
„Weißt du noch, Gisquette, als der Legat vorrüberzog, lief man Sturm und schnitt allen Engländern die Kehlen ab.“
„Und als der Legat über sie hinschritt, ließ man mehr als zweihundert Dutzend aller Arten Vögel fliegen. Das war sehr schön, Liénarde.“
„Heute wird’s noch schöner sein“, unterbrach sie der junge Mann.
„Ihr versprecht uns das Mysterium wird schön sein?“ fragte Gisquette.
„Gewiß“, sagte er; dann fügte er mit nachdrücklichem Ton hinzu: „Ich bin der Dichter!“
„Wahrhaftig?“ fragten die beiden Mädchen voller Staunen.
„Wahrhaftig!“ erwiderte der Dichter, sich leicht räuspernd. „Das heißt, wir sind zwei, Jehan Marchand, der die Bretter fügte, das Gerüst aufschlug, und ich, der das Stück dichtete, ich heiße Peter Gringoire.“
Der Dichter des Eid hat gewiß nie mit größerem Stolze gesagt: Pierre Corneille. Inzwischen wartete die noch vor einigen Minuten so unruhige Volksmasse sanftmütig und traute dem Worte des Schauspielers; denn es ist eine ewige Wahrheit, und man kann sich noch täglich auf unseren heutigen Theatern erproben: das beste Mittel, ein Publikum zum geduldigen Warten zu bringen, ist die Versicherung, daß man sogleich anfangen wolle.
Der Student Johannes war aber nicht eingeschläfert. „Holla he!“ rief er plötzlich in die Stille der Erwartung hinein, die auf den Lärm gefolgt war. „Jupiter, Frau Jungfrau, Taschenspieler des Teufels! Foppt ihr uns? Das Stück! Das Stück! Fangt an oder wir fangen wieder an!“
Mehr war nicht erfordert. Eine Musik von hohen und tiefen Instrumenten ließ sich aus dem Innern des Gerüstes vernehmen, vier buntscheckig geputzte und geschminkte Gestalten traten hervor, klommen die steile Leiter hinan und stellten sich, als sie oben das Gerüst betreten hatten, vor dem Publikum, das sie mit tiefer Verbeugung grüßten, in einer Reihe auf. Das Mysterium begann.
Die vier Personen, nachdem sie für ihre Verbeugungen reichliche Bezahlung in Beifallklatschen erlangt hatten, begannen unter andächtigem Schweigen einen Prolog, mit dem wir den Leser gern verschonen. Übrigens beschäftigte sich das Publikum, wie dies heutzutage noch oft zu geschehen pflegt, mehr mit dem Anzug als mit der Rolle des Schauspielers; und in Wahrheit, dies war gerecht. Alle trugen halb weiß, halb gelbe Kleider, die sich nur durch den Stoff unterschieden. Der Rock des ersten war von Silber- und Gold-Brokat, der des zweiten von Seide, der des dritten von wollenem Tuch, der des vierten von Leinwand. Der erste Schauspieler hielt in der rechten Hand ein Schwert, der zweite ein Paar goldner Schlüssel, der dritte eine Wage, der vierte einen Spaten. Um auch den trägeren Auffassungsgaben, welche diese Attribute nicht gleich deuten könnten, zu Hilfe zu kommen, konnte man in großen, schwarzen und gestickten Buchstaben lesen, am Saume des Brokatkleides: Ich heiße Adel, am Saume des seidenen Rockes: Ich heiße Geistlichkeit, am Saume des wollenen: Ich heiße Kaufmannsstand, und am Saume des leinenen: Ich heiße Bauernstand. Das Geschlecht der beiden männlichen Allegorien war dem Scharfblick des Zuschauers durch kürzere Röcke und ein Barett angedeutet, während die beiden weiblichen Allegorien ein längeres Kleid und eine Haube auf dem Kopfe trugen.
Nur Böswillige konnten aus der Poesie des Prologs nicht entnehmen, daß Ackerbau an Handelsstand, Adel an Geistlichkeit vermählt war, daß beide glückliche Paare einen schönen Delphin von Gold gemeinschaftlich besaßen, den sie nur der Schönsten zusprechen wollten. Sie durchwandelten die Welt und suchten die Schönheit, und als sie nacheinander die Königin von Golconda, die Prinzessin von Trebisund, die Tochter des Groß-Khans der Tartarei verschmäht hatten, waren Bauernstand und Geistlichkeit, Adel und Kaufmannsstand nach Paris gekommen, ruhten aus auf der Marmortafel des Justizpalastes, und gaben dem ehrenwerten Publikum so viel schöne Sprüche und Sentenzen zum Besten, als man damals nur bei irgendeinem Examen, eine Disputation oder einer Feierlichkeit der Fakultät der Künste, wo die Magister und Baccalaurei zu Doktoren wurden, nur immer vorbringen konnte.
Alles war auch wirklich sehr schön. Aber es gab im ganzen Gedränge, über das die vier Allegorien ihre Flut von Metaphern wetteifernd hingossen, kein aufmerksameres Ohr, kein heftiger klopfendes Herz, kein heller blitzendes Auge, keinen weiter vorgestreckten Hals, als das Auge, Ohr, Herz und Hals des Dichters, jenes rechtschaffenen Peter Gringoire, der einen Augenblick vorher der Freude, seinen Namen den beiden hübschen Mädchen zu nennen, nicht hatte widerstehen können. Er war einige Schritte zurück hinter den Pfeiler getreten, dort sah, hörte und genoß er sein Werk in vollen Zügen. Das wohlwollende Klatschen, womit sein Prolog begrüßt war, durchzuckte noch immer seine Nerven, und er war in jene Art entzückter Selbstbetrachtung versunken, womit ein Schriftsteller zu horchen pflegt, wie alle seine Gedanken, einer nach dem andern, aus dem Munde des Schauspieles in das schweigende Publikum fallen. Oh du würdiger Mann, Peter Gringoire!
Es tut uns sehr leid, berichten zu müssen, jenes erste Entzücken ward sehr bald gestört. Kaum hatte Gringoire seine Lippen an den berauschenden Becher der Freude und des Triumphes gesetzt, als ein Tropfen Bitterkeit sich in den Trank mischte. Ein zerlumpter Bettler, der, in der Masse verloren, keine Einnahme hatte halten können und ohne Zweifel keine hinreichende Entschädigung in der Tasche seiner Nachbarn fand, war auf den Einfall gekommen, sich auf irgendeinen hervorragenden Punkt zu setzen, um Blicke und Almosen auf sich hinzulenken; deshalb war er mit Hilfe der Pfeiler der hinteren Erhöhung bis zum Karnies hinaufgeklettert, das das Geländer am unteren Teil umzog; dort saß er und nahm die Aufmerksamkeit und das Mitleid der Menge mit seinen Lumpen und einem scheußlichen Geschwür in Anspruch, das seinen rechten Arm bedeckte. Übrigens sagte er kein Wort.
Sein Schweigen ließ den Prolog ohne Hindernis seinen Fortgang nehmen, und es wäre keine unangenehme Störung dazwischengekommen, hätte es ein unglückliches Verhängnis nicht gewollt, daß der Student Johannes von der Höhe seines Pfeilers herab den Bettler mit seiner Ziererei bemerkte. Der junge Spaßvogel brach in schallendes Gelächter aus und rief, ohne sich um die Unterbrechung des Schauspiels und der allgemein gespannten Aufmerksamkeit zu kümmern, spöttisch aus: „Seht da den Krüppel von Bettler!“
Jeder, der einen Stein in einen Sumpf voller Frösche warf oder ein Gewehr in einen Vogelschwarm abschoß, kann sich einen Begriff von der Wirkung machen, die diese Worte brachten. Gringoire wurde wie durch einen elektrischen Schlag geschüttelt. Der Prolog ward abgebrochen; alle Köpfe wandten sich unruhig auf den Bettler, der, weit davon entfernt, sich aus der Fassung bringen zu lassen, in jenem Vorfall nur eine Veranlassung zu reichlicher Ernte sah und mit halbgeschlossenen Augen und kläglicher Stimme die Worte sprach: „Habt Erbarmen!“
„Bei meiner Seele“, erwiderte Johannes, „es ist Clopin Trouillefou. Holla, Freund! Dein Geschwür war dir am Bein unbequem; du hast es auf den Arm gelegt!“
Nach diesen Worten warf er mit der Geschmeidigkeit eines Affen einen kleinen Groschen in den schmierigen Filz, den der Bettler mit seinem kranken Arme hinhielt. Der Bettler empfing gleichgültig das Almosen wie den Spott und fuhr mit kläglicher Stimme fort: „Habt Erbarmen!“
Dieses Zwischenspiel hatte die Aufmerksamkeit der Zuhörer beträchtlich vom Stücke abgelenkt. Viele Zuschauer, Robin Poussepain und alle Gerichtsschreiber klatschten dem sonderbaren Zwiegespräch lauten Beifall, das mitten im Prolog der Student mit seiner kreischenden Stimme und der Bettler mit seinem einförmigen Geplärr soeben zum besten gaben. Gringoire war darüber sehr verdrießlich. Wie er sich vom ersten Erstaunen erholt hatte, ermannte er sich und rief den vier Personen auf der Bühne zu: „Fahrt fort! Zum Teufel! Fahrt fort!“ Die beiden Unterbrecher würdigte er nicht einmal eines verächtlichen Blickes.
In dem Augenblick fühlte er, wie man ihn an dem Zipfel seines Überrocks zupfte. Es war der schöne Arm der Gisquette, der durch das Gitter gedrungen war und auf diese Weise seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.
„Herr“, sagte das Mädchen, „spielen jene weiter?“
„Gewiß“, erwiderte Gringoire, über die Frage etwas betroffen.
„In dem Fall, Herr“, fuhr sie fort, „haben Sie die Güte, mir zu erläutern …“
„Was sie sagen werden?“ unterbrach sie Gringoire. „Sehr gern; hört!“
„Nein, was sie bis jetzt gesagt haben.“
Gringoire tat einen Satz zurück, wie ein Mann, den man an einer Wunde empfindlich berührt hat.
„Der Teufel hole das dumme Mädchen!“ brummte er zwischen den Zähnen. Von dem Augenblick an hatte Gisquette bei ihm verspielt.
Unterdes hatten die Schauspieler seiner Ermahnung gehorcht, und das Publikum schickte sich wieder zum Hören an, als es bemerkte, sie setzten sich wieder in Bereitschaft zu deklamieren. Viele Schönheiten gingen ihm zwar bei der Lötung verloren, womit jene die beiden Teile des also gröblich durchgeschnittenen Stückes wieder zusammenbrachten. Gringoire hegte auch diesen bitteren Gedanken. Die Ruhe stellte sich aber allmählich wieder her; der Student schwieg, der Bettler zählte einiges Geld in seinem Hute, und das Schauspiel erhielt wieder die Oberhand.
Es war wirklich ein schönes Werk, und man könnte, wie es scheint, vermittels einiger Veränderungen noch jetzt damit Erfolg haben. Die Einleitung, ein wenig gedehnt und leer, das heißt hinsichtlich der Regeln, war einfach und Gringoire bewunderte ihre Klarheit vor dem aufrichtigen Heiligtum seines inneren Richterstuhls. Wie man sich denken kann, waren die vier Personen von ihrer Reise durch die vier Erdteile, auf der sie keine Gelegenheit fanden, sich ihren goldenen Delphin auf gute Manier vom Halse zu schaffen, ein wenig müde. Damit war denn ein Lob des wunderbaren Fisches und tausend zarte Anspielungen auf den jungen Bräutigam der Margarete von Flandern verbunden, der damals in trauriger Abgeschiedenheit zu Amboise lebte und sich nicht einfallen ließ, daß Bauernstand und Geistlichkeit, Adel und Kaufmannsstand um seinetwillen eine Reise um die Welt gemacht hatten. Genannter Delphin also war jung, schön, stark und vor allem der Sohn des Löwen von Frankreich, ein herrlicher Vorsprung aller königlichen Tugenden! Ich gestehe, diese kühne Metapher ist bewunderungswürdig, und die Naturgeschichte des Theaters wird an einem Tage der Allegorie und der königlichen Hochzeitsfeier auf keine Weise von einem Delphin, Sohn des Löwen, sich abschrecken lassen. Das ist eben das seltene und Pindarische Gemisch, das den Enthusiasmus beweist. Dennoch, um auch der Kritik ihren Teil zu lassen, hätte der Dichter diese schöne Idee in weniger als zweihundert Versen entwickeln können. Aber das Mysterium sollte von zwölf Uhr mittags bis vier Uhr nachmittags, nach dem Befehle des Herrn Prévot, dauern, und es mußte also doch etwas gesagt werden. Übrigens hörte man mit aller Geduld zu.
Plötzlich öffnete sich, mitten in einem Streite zwischen Madame Kaufmannsstand und Madame Adel, als Meister Bauernstand den wunderbaren Vers sprach:
Nie sah man in dem Wald ein mut’ger Tier, die Tür nach der unbesetzten Galerie, die bis dahin auf so ungeziemende Weise geschlossen blieb, auf eine noch bei weitem mehr ungeziemende Art, und die laute Stimme des Türhüters rief: „Seine Eminenz der Kardinal von Bourbon!“
Der Herr Kardinal
Armer Gringoire! Der Lärm aller doppelten Petarden am St. Johannistage, die Salve von zwanzig Hakenbüchsen, das Auffliegen des Pulvermagazins am Tore du Temple hätte ihm nicht so schmerzhaft die Ohren verletzt, als in diesem feierlichen und dramatischen Augenblick die wenigen Worte im Mundes des Torhüters: „Seine Eminenz der Kardinal von Bourbon!“
Peter Gringoire freilich hegte weder Furcht noch Verachtung gegen den Kardinal. Er besaß weder jene Schwäche, noch diese Frechheit. Ein wahrer Eklektiker, wie man gegenwärtig sagen würde, gehörte er zu den erhabenen und festen Geistern, die immer fest, ruhig und gemäßigt, stets in der Mitte bleiben und von Vernunft und liberaler Philosophie übersprudeln, aber zugleich die Kardinäle auch hoch zu achten wissen. Ein treffliches und nie unterbrochenes Geschlecht von Philosophen, denen die Weisheit gleich einer zweiten Ariadne ein Knäuel gab, das sie seit Anfang der Welt im Labyrinth der menschlichen Dinge entwickeln, findet man sie in allen Zeiten als dieselben, das heißt mit einigen Veränderungen nach den Zeitverhältnissen wieder.
In dem unangenehmen Eindruck, den des Kardinals Gegenwart bei Peter Gringoire erweckte, lag also weder Haß noch Verachtung; allein der Dichter fürchtete eine abermalige Störung des Stückes. Seine Besorgnis ward nur zu bald verwirklicht. Das Erscheinen Seiner Eminenz brachte das Publikum in Aufruhr. Alle Köpfe wandten sich zur Galerie. Keiner wollte weiter hören. „Der Kardinal! Der Kardinal!“ ertönte es aus jedem Munde; der unglücklich Prolog ward zum zweiten Male unterbrochen.
Der Kardinal verweilte einen Augenblick auf der Schwelle der Galerie. Während er seinen ziemlich gleichgültigen Blick auf das Publikum warf, verdoppelte sich der Lärm. Jeder wollte ihn besser sehen; es schien, jeder wollte seinen eigenen Kopf auf die Schultern seines Vordermannes stellen. Er war auch wirklich ein hoher Herr, und sein Anblick mußte wohl jedes andere Schauspiel aufwiegen. Karl, Kardinal von Bourbon, Erzherzog und Graf von Lyon, Primas von Gallien, war durch seinen Bruder Pierre, Herrn von Beaujeu, der die älteste Tochter des Königs geheiratet hatte, und seine Mutter Agnes von Burgund zugleich mit Ludwig XI. und mit Karl dem Kühnen verwandt. Der vorherrschende Charakterzug dieses Primas war der Sinn eines Höflings und Ergebenheit gegen die Gewalt. Man mache sich deshalb eine Vorstellung von den zahllosen Verlegenheiten, die ihn diese doppelte Verwandtschaft schuf, und von den zeitlichen Klippen, zwischen denen seine gleistliche Barke lavieren mußte, um weder an Ludwig, noch an Karl zu scheitern, jener Szylla und Charybdis, die den Herzog von Nemours und den Connetable von Saint-Pol bereits verschlungen hatte. Dem Himmel sei Dank, er hatte die gefährliche Fahrt glücklich vollbracht und war ohne Hindernis nach Rom gelangt. Allein ob auch im Hafen, erinnerte er sich eben, weil er im Hafen war, nie ohne Unruhe der Gefahren seines so lange unruhigen und mühsamen politischen Lebens.
Übrigens war er ein gutmütiger Mann; er führte das Leben eines lustigen Kardinals, erheiterte sich gern mit dem königlichen Gewächs von Challoan, gab hübschen Mädchen weit lieber Almosen als alten Weibern, und war deshalb beim Pariser Volke sehr beliebt. Wenn er ausging, umgab ihn stets ein kleiner Hof von Bischöfen und Äbten aus hohem Stamm, mit munterm und galantem Sinn, die im Notfall auch ein gutes Mahl nicht verschmähten; mehr als einmal nahmen die trefflichen und andächtigen Frauen von St. Germain d’Auxerre gar großes Ärgernis, wenn sie des Abends bei den erleuchteten Fenstern des Palais Bourbon vorüberwandelten und von denselben Stimmen, die ihnen die Vesper gesungen hatten, beim Gläserklang die bacchischen Worte Benedikts XII. vernahmen: „Bibamus papaliter.“
Ohne Zweifel bewahrte ihn diese durch so gerechte Ansprüche erworbene Volkstümlichkeit vor jedem üblen Empfang der Menge, die den Augenblick vorher noch so unzufrieden und zur Achtung gegen einen Kardinal um so weniger gestimmt war, da sie an demselben Tage sich einen Papst wählen wollte. Jedoch hegen die Pariser keinen langen Groll; außerdem hatten die guten Bürger über den Kardinal dadurch gesiegt, daß sie das Stück zur Aufführung brachten, und mit diesem Triumph waren sie zufrieden. Außerdem war der Herr Kardinal ein schöner Mann; er trug ein prächtiges rotes Kleid und nahm sich sehr gut darin aus; das heißt, er hatte alle Frauen für sich, folglich die bessere Hälfte des Publikums. Gewiß wäre es ungerecht und ein Zeichen von schlechtem Geschmack, einen Kardinal auszupfeifen, weil er im Schauspiele auf sich hatte warten lassen, wenn er ein schöner Mann war und sein rotes Kleid geschmackvoll trug.
Er trat also ein, grüßte die Versammlung mit jenem Lächeln der Großen für ihr Volk, das jene seit undenklichen Zeiten für die Menge voneinander geerbt haben. Langsamen Schrittes ging er auf seinen Sessel von Scharlachsamt zu und schien seinen Mienen nach an ganz andere Dinge zu denken. Sein Gefolge, das wir gegenwärtig seinen Generalstab von Bischöfen und Äbten nennen würden, brach in die Galerie, nicht ohne Verdoppelung des Lärms und der Neugier des Parterres, ein. Alle suchten sie sich einander zu zeigen und zu nennen. Keiner sparte Verachtung und Schimpfwörter. Die Studenten fluchten. Es war ihr Tag; der Tag der Narrheit, der jährlichen Saturnalien und Orgien der Parlamentsschreiber und Studenten. Jede Schändlichkeit war an diesem Tage geheiligt und erlaubt. Jeder hatte sich einen der neuen Ankömmlinge der Galerie zur Zielscheibe genommen, einen schwarzen, grauen, weißen oder violetten Chorrock. Johannes Frollo von Molendino hatte, als Bruder des Archidiakons, sich keck einen roten auserkoren und sang kreischend mit frechen Blicken auf den Kardinal: „Cappa repleta mero!“
Alle diese Einzelheiten, die wir hier zur Erbauung des Lesers genau berichten, wurden so sehr von dem allgemeinen Lärm verschlungen, daß sie in ihm untergingen, bevor sie zur Galerie gelangten. Übrigens hätte der Kardinal sich darum nicht gekümmert; denn die Freiheit dieses Tages lag in den Sitten. Übrigens bekümmerte ihn auch eine andere Sorge, und seine Mienen zeigten durchaus, wie sehr er davon eingenommen war, nämlich die Gesandtschaft von Flandern, die fast zugleich mit ihm die Galerie betrat. Er war zwar kein großer Politiker und überrechnete auch nicht die möglichen Folgen der Heirat seiner Kusine Madame Margarete von Burgund mit dem Dauphin von Vienne; auch nicht, wie lange das zusammengeleimte Einverständnis zwischen dem Herzog von Österreich und dem König von Frankreich währen würde; auch die sehr geehrte Gesandtschaft des Herrn Herzogs von Österreich machte dem Kardinal keine Sorgen, aber sie war ihm in jeder Hinsicht lästig. Es war in der Tat ein wenig hart, daß er, Karl von Bourbon, unbekannte Bürgersleute wohl empfangen und bewirten mußte; er, ein Kardinal, keine höheren Personen als Schöffen, er, ein Franzose und munterer Gesellschafter, Flamländer und Biertrinker, die sich ihres Gerstensafts nicht einmal öffentlich schämten. Dies war gewiß eine der langweiligsten Fratzen, die er zum Vergnügen des Königs schneiden mußte.
Er wandte sich mit genau berechneter Grazie (denn er hatte lange darauf studiert) zur Tür, als der Türhüter in lautem Baß hineinrief: „Die Herren Abgesandten des Herrn Herzogs von Österreich!“
Hierauf traten mit einem Ernst, der dem munteren geistlichen Gefolge des Kardinals in grellem Kontrast stand, die achtundvierzig Gesandten Maximilians von Österreich paarweise ein. An ihrer Spitze wandelten der ehrwürdige Vater in Gott, Jehan, Abt von Saint-Bertin, Kanzler des goldenen Vlieses, und Jacques de Goy, Herr Dauby, Hochamtmann von Gent. In der Versammlung herrschte eine von unterdrücktem Lachen begleitete Stille, um alle die sonderbar klingenden Namen und bürgerlichen Würden zu vernehmen, die jeglicher dieser Personen in unerschütterlicher Ruhe dem Türhüter mitteilte, der sie dann verstümmelt durcheinander ins Publikum hineinwarf. Es waren Meister Loys Roelof, Schöffe der Stadt Löwen; Herr Paul von Baeust, Herr von Voirmizelle, Präsident von Flandern; Meister Jehan Coleghens, Bürgermeister von Antwerpen; Meister Georg de la Moere, erster Schöffe der Kuen der Stadt Gent; Meister Gheldorf van der Haye, ein anderer Schöffe der genannten Stadt usw., Amtsleute, Schöffen, Bürgermeister; Bürgermeister, Schöffen, Amtsleute; sämtlich steif, schwerfällig, geputzt mit Samt und Damast, gehüllt in schwarzseidene Oberkleider mit dicken goldenen Quasten, übrigens gutmütige flamländische Köpfe, würdige und strenge Gestalten. Einer war jedoch davon ausgenommen. Seine Gesichtszüge waren fein, listig, klug, sein Mund zur Hälfte der eines Affen, zur andern Hälfte der eines Diplomaten. Der Kardinal ging ihm mit drei Schritten und einer tiefen Verbeugung entgegen, und dennoch hieß er nur Wilhelm Rym, Rat und Pensionär der Stadt Gent.
Wenige Personen wußten, was er war. Ein seltener Geist, wäre er in den Zeiten einer Revolution im Strome vorangeschwommen; allein im fünfzehnten Jahrhundert ward er auf schleichende Intrigen und auf ein Leben in den Minen beschränkt, wie der Herzog von St. Simon sagt. Übrigens wußte der erste Minierer Europas ihn nach Verdienst zu schätzen. Rym intrigierte mit Ludwig XI. auf vertrautem Fuße und steckte oft seine Hand in die geheimen Arbeiten des Königs. Allein alle diese Dinge waren der Volksmenge unbekannt, die über die Höflichkeit des Kardinals gegen diese schmächtige Gestalt erstaunte.
Meister Jakob Coppenole
Während der Ratsherr von Gent und die Eminenz beide eine tiefe Verbeugung austauschten und mit leiser Stimme einige Worte wechselten, erschien ein Mann von hohem Wuchs, mit breiten Schultern und großem Gesicht zugleich neben Rym, um einzutreten; er glich einem Bullenbeißer neben einem Fuchs. Seine Mütze von Filz und sein ledernes Wams stachen sonderbar gegen Samt und Seide ab, die ihn umgaben. Der Türhüter hielt ihn für einen verirrten Reitknecht und wies ihn zurück.
„He, Freund, bleibt zurück!“
Der Mann mit dem ledernen Wams stieß ihn mit der Schulter.
„Was will der Schuft!“ rief er mit so lauter Stimme, daß die Worte im ganzen Saale widerhallten, während das Publikum auf dies sonderbare Zwiegespräch aufmerksam lauschte.
„Siehst du nicht, wer ich bin?“
„Euer Name?“ fragte der Türhüter.
„Jakob Coppenole.“ – „Euer Stand?“ – „Strumpfmacher, im Schilde der drei Kettchen zu Gent.“ – Der Türhüter fuhr zurück. Es war noch erträglich, Schöffen oder Bürgermeister anzukündigen; aber einen Strumpfmacher, wie hart! Der Kardinal stand auf Dornen. Das ganze Publikum horchte und schaute. Schon zwei Tage quälte sich die Eminenz, jene flamländischen Bären zu lecken, um ihnen den notwendigen Anstand zu erteilen, dessen sie bedurften, um im Publikum zu erscheinen, aber jener Tölpel war doch zu hart! Wilhelm Rym aber nahte sich dem Türsteher mit seinem feinen Lächeln.
„Kündigt Meister Jakob Coppenole, den Schreiber der Schöffen der Stadt Gent, an“, sagte er ihm ins Ohr. – „Türsteher“, rief der Kardinal mit lauter Stimme, „kündigt Meister Jakob Coppenole an, den Schreiber der Schöffen der durchlauchtigen Stadt Gent.“
Das war ein Fehler. Wilhelm Rym hatte ganz allein die Schwierigkeit beseitigt, aber Coppenole hatte die Worte des Kardinals vernommen. „Nein, bei Gottes Kreuz“, rief er mit einer Donnerstimme; „Jakob Coppenole, Strumpfmacher! Hörst du, Türsteher? Nichts mehr, nichts weniger. Gottes Kreuz! Strumpfmacher ist schon genug. Der Herr Erzherzog hat mehr als einmal in meinem Laden seine Handschuh gekauft.“
Gelächter und Beifallklatschen vernahm man von allen Seiten. Ein Witz wird stets in Paris verstanden und entbehrt deshalb nie des Beifalls. Hierzu kam noch, daß Coppenole zum Volke gehörte, und daß das ihn umgebende Publikum aus dem Volke bestand. Auch kam ihr gegenseitiges Verständnis schnell, elektrisch zustande, gleichsam als befänden sich alle auf einem ebenen Boden. Die hochfahrende Tölpelei des flamländischen Strumpfmachers, wie er die Hofleute in Verlegenheit brachte und demütigte, hatte in allen plebejischen Gemütern ein unbestimmtes und im fünfzehnten Jahrhundert noch nicht deutliches Gefühl von Würde erweckt. Jener Strumpfmacher war ja ihresgleichen und hielt dem Herrn Kardinal die Stange. Gewiß, ein süßer Gedanke für arme Teufel, die an Gehorsam und Achtung gegen die Diener der Sergeanten des Bailli, des Abtes von Ste. Geneviève, des Schleppenträgers Sr. Eminenz gewöhnt waren.
Coppenole grüßte stolz die Eminenz, die dem mächtigen und von Ludwig XI. gefürchteten Bürger den Gruß erwiderte, während Wilhelm Rym, der verständige und boshafte Mann, wie Phillipp von Comines ihn nennt, beide mit spöttischem und überlegenem Lächeln betrachtete. Der Kardinal war außer Fassung und verdrießlich; Coppenole ruhig und hochfahrend, dachte vielleicht, sein Titel als Strumpfmacher sei ebensogut wie jeder andere, und Marie von Burgund, Mutter jener Margarete, die Coppenole heute verheiratete, hätte vielleicht ihn als Kardinal weniger gefürchtet, wie als Strumpfmacher; denn kein Kardinal hätte die Genter gegen die Günstlinge der Tochter Karls des Kühnen in Aufruhr gebracht, kein Kardinal hätte die Volksmasse mit einem Wort gegen ihre Bitten und Tränen gestählt, als die Herrin von Flandern ihr Volk am Fuße des Schafotts um ihr Leben anflehte; während der Strumpfmacher nur seinen Ellenbogen zu erheben brauchte, damit die Köpfe der erlauchten Herren Guy von Hymbercourt und Kanzler Wilhelm Hugonet auf den Boden rollten.
Übrigens war für den armen Kardinal noch nicht alles vorbei; er mußte den bittern Kelch, in so schlechter Gesellschaft sich zu befinden, bis auf die Hefe leeren. Der Leser hat gewiß den frechen Bettler noch nicht vergessen, der im Anfange des Gesprächs sich an die Fransen der Galerie des Kardinals angeklammert hatte. Die Ankunft der erhabenen Gäste brachte ihn durchaus nicht dahin, sie loszulassen; während die Prälaten und Gesandten sich als flamländische Heringe auf den Stühlen der Tribüne zusammenpackten, hatte er seine Beine gemächlich über den Balken gekreuzt. Die Unverschämtheit war unerhört; auch war er niemand im ersten Augenblicke, solange die Aufmerksamkeit von andern Dingen in Anspruch genommen wurde, aufgefallen. Er seinerseits merkte durchaus nichts; er wiegte sein Haupt mit der Sorglosigkeit eines Neapolitaners und wiederholte von Zeit zu Zeit maschinenmäßig: „Habt Erbarmen!“ Auch war er wahrscheinlich der einzige im ganzen Publikum, der bei dem Zank des Türstehers mit Coppenole nicht einmal geruht hatte, das Haupt zu wenden. Nun wollte der Zufall, daß der Meister Strumpfmacher aus Gent, mit dem das Volk schon so lebhaft sympathisierte, in der ersten Reihe der Galerie und zwar gerade über dem Bettler sich niedersetzte. Man erstaunte nicht wenig, als man erblickte, wie der flamländische Gesandte, nachdem er den Bettler unter seinen Augen genau betrachtet hatte, ihn freundschaftlich auf die mit Lumpen bedeckte Schulter klopfte. Der Bettler drehte sich um, Überraschung, Wiedererkennung, Herzensergießung prägte sich auf beiden Gesichtern aus; dann knüpfte der Strumpfmacher mit dem Bettler leise ein Gespräch an, ohne sich um die übrigen Zuschauer zu bekümmern; beide drückten sich die Hände, und die Lumpen Clopins brachten, auf dem goldgewirkten Brokat der Estrade ausgebreitet, denselben Eindruck hervor, wie eine Raupe auf einer Orange.
Die Neuheit dieses sonderbaren Auftritts erweckte einen so fröhlichen Lärm im Saale, daß der Kardinal ihn bald bemerken mußte; er lehnte sich hinüber, und da er von seinem Sitze aus nur unvollkommen den schmutzigen Kittel des Bettlers sehen konnte, glaubte er natürlich, der Bettler bitte um Almosen, und rief, empört über die Keckheit: „Herr Bailli des Palais, werft den Schuft in den Fluß!“
„Gottes Kreuz, Herr Kardinal“, rief Coppenole, ohne die Hand Clopins fahren zu lassen, „er ist einer meiner Freunde!“
„Brav! Brav!“ rief die Masse, und von dem Augenblick an besaß Meister Coppenole in Paris wie in Gent großen Kredit beim Volk; denn Leuten nach seinem Schnitt bleibt er nie aus, wenn sie so täppisch sind, wie Philipp von Comines sagt. Der Kardinal biß sich auf die Lippen. Er neigte sich zu seinem Nachbar, dem Abt von Ste. Geneviève, und sagte mit halblauter Stimme: „Schöne Gesandten schickt uns der Herr Erzherzog, um Madame Margarete anzukündigen.“ – „Eure Eminenz“, erwiderte der Abbé, „verliert Ihre Höflichkeit bei diesen flamländischen Schweinerüsseln. Margaritas ante porcos.“
„O nein“, sagte lächelnd der Kardinal. „Porcos ante Margaritam.“
Der kleine Hof im Chorrock war über dies Wortspiel entzückt; der Kardinal fühlte einige Erleichterung, denn mit Coppenole war er quitt; auch sein Witz fand Beifall.
Jetzt mögen diejenigen unserer Leser, die imstande sind, sich ein Bild oder eine Idee zu verallgemeinern, wie es im heutigen Stile heißt, die Frage erlauben, ob sie sich eine deutliche Vorstellung von dem Schauspiele bilden, welches das weite Rechteck des großen Saales in dem Augenblicke, bei dem wir verweilen, darbot. Mitten im Saal stand, an die westliche Mauer gelehnt, eine prächtige und breite Galerie mit Goldbrokat, auf die eine Menge von ernsten Personen, angekündigt von der kreischenden Stimme des Türhüters, durch eine kleine gotische Tür eingetreten waren. In den ersten Reihen saßen viel ehrwürdige Personen, in Hermelin, Samt und Scharlach gehüllt. Um die Galerie, die schweigend und ernst blieb, herrschte unten großer Lärm und großes Gedränge. Gewiß, das Schauspiel war merkwürdig und verdiente wohl die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Was sollte aber dort unten, ganz am Ende, jene Bühne, mit vier buntscheckig gekleideten Personen oben und vier andern unten? Was bedeutete an der Seite der Bühne ein Mann mit blassem Gesicht und schwarzem Kleid? Ach, lieber Leser, es war Peter Gringoire und sein Prolog.
Von dem Augenblick an, wo der Kardinal hereintrat, hatte Gringoire sich unaufhörlich um das Heil seines Prologs gequält; zuerst hatte er den plötzlich abbrechenden Schauspielern eingeschärft, fortzufahren und die Stimme zu erheben; als er aber sah, daß niemand hörte, bat er sie selbst zu schweigen; seit einer Viertelstunde, ungefähr während der Zeit, während der die Unterbrechung dauerte, hatte er unaufhörlich mit dem Fuße gestampft, Gisquette und Liénarde angeredet; seine Nachbarn zur Fortsetzung ermutigt; alles vergeblich; keiner ließ vom Kardinal, der Gesandtschaft und der Galerie ab, dem einzigen Zentrum des ungeheuren Zirkels aller Blicke. Man muß auch glauben, und wir sagen es mit Bedauern, daß der Prolog in dem Augenblick lästig zu werden anfing, als Seine Eminenz erschien und auf so furchtbare Weise Störung verursachte. Übrigens wurde auf der Marmortafel, wie auf der Galerie, dasselbe Schauspiel gegeben, ein Konflikt zwischen Bauernstand und Geistlichkeit, zwischen Adel und Kaufmannsstand. Und viele Leute zogen es vor, ihn lebend, atmend, handelnd, sich stoßend, als Fleisch und Knochen in der flamländischen Gesandtschaft, dem bischöflichen Hofe, unter dem Kleid des Kardinals und Coppenoles Wams zu schauen, als geschminkt, geputzt, in Versen redend und in gelbe und weiße Tuniken, worein ihn Gringoire gesteckt hatte, eingewickelt. Als aber unser Dichter sah, die Ruhe sei ein wenig hergestellt, verfiel er auf eine Kriegslist, die alles hätte retten können. Er wandte sich zu einem Nachbar, einer braven, breiten und geduldigen Gestalt, mit den Worten: „Herr, wenn man doch wieder anfinge!“ – „Was?“ fragte sein Nachbar. – „Nun, das Mysterium.“ – „Wie es Euch beliebt, Herr.“ –
Dieser halbe Beifall genügte Gringoire. Er betrieb sein Geschäft selbst, mischte sich so gut wie möglich unter die Menge und fing an zu schreien: „He! Fangt wieder an! Fangt wieder das Mysterium an!“
„Teufel!“ rief Johannes von Molendino, „was singen die dort hinten? (Gringoire machte Lärm für vier.) Sagt, Kameraden, ist das Mysterium nicht schon aus? Die wollen wieder anfangen! Das ist nicht recht!“
„Nein, nein!“ riefen alle Studenten, „nieder mit dem Mysterium!“ Aber Gringoire vervielfältigte sich und schrie nur um so stärker: „Fangt wieder an!“
Dies Geschrei zog die Aufmerksamkeit des Kardinals auf sich. „Herr Bailli des Palais“, sagte er zu einem großen schwarzen Mann, der nicht weit von ihm entfernt stand, „riechen die Teufel den Weihkessel? Sie machen einen Höllenlärm.“
Der Bailli des Palais nahte sich Ihrer Eminenz und setzte ihr stotternd den Zwiespalt im Volk auseinander, nicht ohne ihr höchstes Mißvergnügen zu befürchten: wie Mittag vor Ihrer Eminenz da war, und wie die Schauspieler gezwungen wurden, anzufangen, ohne Ihre Eminenz erwarten zu können. Der Kardinal lachte laut. „Meiner Treu“, sagte er, „der Herr Rektor der Universität hätte wohlgetan, es ebenso zu machen. Was meint Ihr, Meister Wilhelm Rym?“
„Durchlauchtiger Herr“, erwiderte Wilhelm Rym, „seien wir zufrieden, der einen Hälfte glücklich entgangen zu sein. So haben wir immer gewonnen.“ – „Dürfen die Schurken ihre Posse fortspielen?“ fragte der Bailli. – „Nur weiter, mir gilt es gleich; ich will unterdes in meinem Brevier lesen.“
Der Bailli trat an den Rand der Galerie und rief, nachdem er durch eine Bewegung der Hand Stillschweigen geboten: