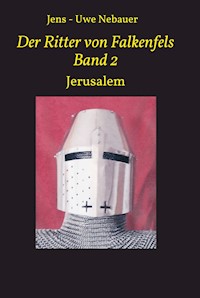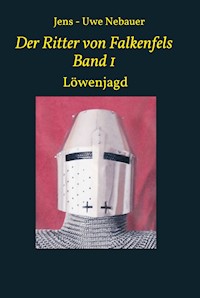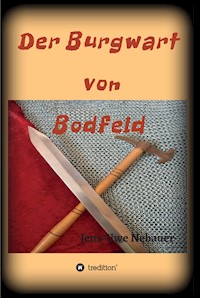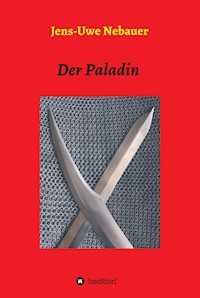9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ehemalige Seeräuber Leonidas aus Mytilene muss in Rom als Gladiator in der Arena fechten. Doch als es ihm eines Tages gelingt, nacheinander zwei Gegner zu besiegen, fordern die begeisterten Zuschauern in Anerkennung seiner Kampfkunst seine Freilassung, was ihm der Veranstalter der Spiele schließlich auch gewährt. Noch in derselben Stunde wird Leonidas von dem zwielichtigen Ägypter Plotinos als Leibwächter angeheuert. Auf der Reise zu der Stadt Pompeji in der römischen Provinz Kampanien freundet sich der Mytilener mit Achillas, dem zweiten Leibwächter des Ägypters und der Sklavin Anippe an. In Pompeji kommt Leonidas einer Verschwörung von Gegnern der in Rom herrschenden Senatspartei auf die Spur. Dabei lernt er Laodica, eine Prostituierte aus einem pompejanischen Bordell kennen und die beiden beginnen sich ineinander zu verlieben. Dadurch aber geraten sie in große Gefahr, denn als Plotinos Laodicas Liebesdienste erzwingen will, wird er von Leonidas aus Eifersucht erstochen. Nun droht ihnen der Tod am Kreuz, doch mit Hilfe seiner Freunde gelingt es dem ehemaligen Gladiator den Mord zu vertuschen und das ihnen drohende Verhängnis abzuwenden. Danach verlassen Leonidas, Laodica, Achillas und Anippe heimlich Pompeji und machen sich auf den Weg nach Capua. In der dortigen Gladiatorenschule, in der er sich als freier Kämpfer anwerben lässt, lernt Leonidas den Thraker Spartacus kennen, erlangt dessen Vertrauen und wird von ihm in die Pläne eines in Kürze bevorstehenden Ausbruchs der "Gerstenfresser" genannten Gladiatoren eingeweiht. Doch ihr Vorhaben wird durch unglückliche Umstände aufgedeckt und nur schnelles Handeln kann die Verschwörer noch retten. So ruft Spartacus seine Gefährten zum Aufstand und nach blutigem Kampf befreien sich die Fechtersklaven von ihren Peinigern. Nach dem gelungenen Ausbruch flüchten sich siebzig überlebende Gladiatoren in die Wälder des Vesuvs, auch Laodica, Achillas und Anippe schließe sich den Rebellen an. Die mutige Tat der Schwertkämpfer verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wodurch in ganz Kampanien die Fackeln des Aufruhrs entfacht werden und täglich immer neue, ihren Herren entflohene Sklaven im Lager der Aufständischen eintreffen. Doch der Gegenschlag der Römer lässt nicht lange auf sich warten und so beginnt ein zweijähriger Krieg zwischen den befreiten Sklaven und ihren Unterdrückern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Autor
Jens - Uwe Nebauer wurde am 5. Juni, dem Pfingstsonntag des Jahres 1960, in Magdeburg geboren.
Nach erfolgreich bestandenem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg. Als Diplomingenieurökonom arbeitete er dann jahrelang im Anlagenbau und später auch in anderen Berufen.
Der Autor interessiert sich seit seiner Kindheit für Geschichte. Der Besuch von Burgen, Schlössern und Museen mit seinen ebenfalls geschichtsinteressierten Eltern weckte in ihm schon früh diese Vorliebe. Später spezialisierte er sich auf das europäische Mittelalter und die Zeit der römischen Antike.
Seine Kreativität hat er bereits im Kindergarten entdeckt, denn da er während des verordneten Mittagsschlafes nie müde genug war, um einschlafen zu können, begann er damit sich die Langeweile durch das fantasievolle Erfinden und „Sich-selbst-erzählen“ von kleinen oder größeren Geschichten zu vertreiben.
Später ging er dann dazu über, seine Interessen beim Schreiben zu verarbeiten und verfasste u. a. die historischen Romane „Der Ritter von Falkenfels“, „Die Kreuzfahrer“, „Der Burgwart von Bodfeld“ und „Der Paladin“.
Der große Krieg derGladiatoren
Die Erinnerungen eines Schwertkämpfers
von
Jens – Uwe Nebauer
Mein besonderer Dank gilt Ilona und Thomas
© 2022 Jens – Uwe Nebauer
Umschlaggestaltung: Nebauer
ISBN
Softcover
978-3-347-58020-6
Hardcover
978-3-347-58021-3
E-book
978-3-347-58022-0
Großdruck
978-3-347-58023-7
Druck und Verlag:
tredition GmbH, Halenreie 40 - 44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
In Odessos
Ein Mann aus Ägypten
Der Thraker
Der Ausbruch
Der Berg des Vulcanus
Neue Siege
Konsularische Heere
Zurück nach Süden
Der Wall des Crassus
Die Schlacht am Silarus
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis
Worterklärungen
Karten
Crassus ist tot!
Ich hatte es gerade auf dem Marktplatz von einem Kaufmann aus Alexandria gehört, dessen Schiff vor einer Stunde in den Hafen von Odessos eingelaufen war.
Im Reich der Parther, bei einem Ort namens Carrhae, hatten die Reiter des Königs Orodes den römischen Feldherrn und seine sechs Legionen umzingelt und schwer zusammengeschlagen. Crassus selbst wurde bei den Kapitulationsverhandlungen getötet. Die Sieger schlugen seinem Leichnam den Kopf ab und sandten ihn an den Hof des Königs, wo er bei einer Aufführung von Euripides Theaterstück „Die Bacchien“ den Zuschauern vorgeführt worden war.
Das Heer der Parther wurde von einem Mann namens Surenas angeführt und ich fragte mich, ob es wohl derselbe Surenas sein könnte, der mit uns aus Capua ausgebrochen war und zwei Jahre an unserer Seite gekämpft hatte. Möglich wäre es durchaus, denn er gehörte, ebenso wie ich, zu den wenigen unserer Gefährten, die aus der vernichtenden Schlacht am Silarus entkommen waren.
Crassus! Der Geldmann und Schlächter, der vor sieben Jahren mit dem nicht minder mörderischen und ruchlosen Pompeius und mit diesem Caesar, der jetzt in Gallien Krieg führt, ein Triumvirat zur Beherrschung Roms geschlossen hatte.
Ein Jahr lang waren die Gedanken der Anführer unseres Sklavenheeres, zu denen auch ich gehörte, immer wieder um diesen Römer gekreist und um das, was er gegen uns unternehmen würde, bis uns am Ende die schiere Übermacht seiner Legionen erdrückte.
Und nun war auch er durch das Schwert gestorben, und ich sage es ganz offen heraus, dieser Mann hatte seinen, hatte diesen Tod verdient und ja, ich empfand Freude darüber und Genugtuung, denn er hatte tausende unserer gefangenen Brüder und Schwestern entlang der Via Appia ans Kreuz schlagen lassen, kaltherzig und gnadenlos.
Das musste ich sofort Laodica erzählen!
Auf dem Rücken meines weißen Hengstes verließ ich Odessos und sprengte zu unserer Villa, die sich eine halbe Meile nördlich der Stadt, welche uns seit siebzehn Jahren zur Heimat geworden war, auf einem Hügel über dem Meer erhebt.
Laodica saß auf der Terrasse unseres Hauses auf einer bequemen Kline. Ihre Beine, die immer noch so schön sind wie vor zwanzig Jahren, als ich ihr das erste Mal begegnete, hatte sie von sich gestreckt und die nackten Füße übereinandergelegt. Ein Schirm schützte sie vor der stechenden Mittagssonne.
Oh ja, es geht uns gut hier! Wir haben uns einen gewissen Wohlstand geschaffen und sind niemandes Untertan. Ich bin Eigentümer einer Fechtschule, der einzigen, die es zwischen Odessos und Mesembria gibt, während Laodica einen erfolgreichen Handel mit Wein und Öl betreibt. Wir haben alles, was wir brauchen, nur Sklaven gibt es in unserem Haus keine und wird es auch nie geben.
„Nun ist das Schwein also in den Hades gefahren“, sagte Laodica mit derselben Genugtuung in der Stimme, die auch ich gespürt hatte, „Es wurde auch Zeit. Und ich hoffe, dass auch der Pompeius bald diesen Weg gehen wird!“
Wir öffneten einen versiegelten Krug mit altem Samoswein und ließen ihn uns schmecken. Danach begaben wir uns in unser Schlafzimmer und liebten uns so leidenschaftlich, wie schon seit langem nicht mehr. Wahrscheinlich war dies das Beste, was Marcus Publius Crassus jemals hervorgerufen hat.
In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Alles war plötzlich wieder da, als ob es gestern gewesen wäre. Meine Zeit als Gladiator, der Ausbruch aus dem Ludus von Capua, unser Krieg gegen die Römer, angeführt von dem besten Mann, den die Sonne je gesehen hat.
Gegen Mitternacht bemerkte ich, dass auch Laodica nicht schlief. Wir setzten uns auf und begannen zu erzählen, erst ich, dann sie, dann wieder ich und mit jeder Stunde die verging, fügten sich unsere Erinnerungen zu einem immer größer und bunter werdenden Mosaik zusammen.
Der Mann aus Ägypten
Durch das kleine vergitterte Fenster in der Tür des Holzkastens schwappte das Geschrei des enthemmten Pöbels so abstoßend und widerlich wie stinkendes Kloakenwasser.
Bei allen Göttern, wie sehr hasste ich diese Römer! Nicht nur die dreimal verfluchten Lanistas und die reichen Patrizier oder Ritter, die diese Kämpfe, die sie so verharmlosend Spiele nannten, bezahlten, sondern auch den Arena-Mob, der sich an Blut und Tod ergötzte wie normale Menschen an Kunst, gutem Essen, schönen Frauen und gutem Wein.
Wir saßen zu viert in dem schuppenartigen Verschlag, zwei Thraker und zwei Gallier, und wir warteten darauf, dass sich die noch verschlossene Tür, die für die Gladiatoren den einzigen Zugang zu der von Zuschauertribünen umschlossenen Arena bot, öffnen würde.
Das aus Balken und Brettern errichtete Amphitheater - zu dieser Zeit gab es in ganz Italien nur wenige fest gemauerte Arenen - stand sinnigerweise auf dem Forum Boarium, dem Viehmarkt nahe einer alten Tiberfurt, die einst den römischen Hirten als Übergang zu den Weiden außerhalb der Stadt gedient hatte.
Eigentlich war das größere Forum Romanum aus Platzgründen für die Abhaltung der Gladiatorenkämpfe besser geeignet als das Forum Boarium und wurde daher auch meistens dafür genutzt, doch wegen irgendwelcher Baumaßnahmen dort hatten die Veranstalter der Spiele mit dem alten Veranstaltungsort vorliebnehmen müssen.
Als das Geschrei der Zuschauer seinen Höhepunkt erreicht hatte, verdunkelte die Gestalt eines Aufsehers das kleine Fenster, dann schurrte ein Riegel, und gleich darauf wurde die Tür des Holzkastens geöffnet. Einer nach dem anderen betraten wir die mit einer leichten Schicht Sand bedeckte Arena und stellten uns auf.
Zu dieser Zeit wurde noch nicht so viel Aufhebens um unsere Ausrüstung gemacht wie in der heutigen Zeit. Wir kämpften einfach mit den Waffen des Volksstammes, denen man uns zugeordnet hatte. Als Thraker, der ich eigentlich nicht war, trug ich einen ledernen Helm auf dem Kopf, ein Schwert mit einer leicht nach hinten gebogenen Spitze in der rechten und einen runden Schild in der linken Hand. Bekleidet waren wir nur mit dem von den Römern Subligares genannten, von einem schmalen Gürtel gehaltenen Lendenschurz und mit einfachen Sandalen.
Wenn ich heute höre, dass die Thraker in der Arena jetzt mit einer in der Mitte stark abgewinkelten Sica kämpfen, kann ich nur lachen. Niemandem wäre es eingefallen, mit so einer Waffe in einen echten Krieg zu ziehen - ein solches Monstrum kann man ja nicht einmal in eine Scheide stecken, um es vor Schmutz, Nässe und Rost zu schützen!
Der Arenasprecher trat in die Mitte des Platzes, breitete seine Arme in einer theatralischen Geste weit aus und kündigte mich mit weithallender Stimme an: „Bürger von Rom, der edle Dolabella gibt euch Leonidas, Sieger in neun Kämpfen, Thrax!“
Die Zuschauer klatschten und johlten, viele der Frauen auf den Rängen warfen mir Kusshände zu. Durch meine Siege war ich in Rom schon so etwas wie ein Heros, nicht wenige der Römer hatten auf meinen Sieg gewettet.
„Gegen ihn tritt an, Acco, Gallier aus Capua, zwei Siege!“
So hieß also mein Gegner. Wie fast alle Gallier oder Germanen war er ziemlich groß und dazu auch sehr muskulös. Er hielt ein langes Schwert und einen ovalen Schild in den Händen und trug einen Eisenhelm mit Flügeln daran auf dem Kopf.
Auch der andere Gallier, er wurde Brennus genannt, stammte aus dem Ludus von Capua. Ihm stand Philippos gegenüber, der wie ich aus der Schule von Rom kam.
Ich war - und bin es noch heute - ohne mich allzu sehr rühmen zu wollen - sehr geschickt mit dem Schwert, schließlich war ich in Mytilene, der Stadt in der ich geboren und aufgewachsen war, bei einem der besten Fechtmeister in die Lehre gegangen. Von frühester Jugend an hatte ich mich in der Handhabung des griechischen Hoplitenschwertes, des römischen Gladius und des thrakischen Schwertes geübt und es darin - wie ich gewiss behaupten darf - zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, nur mit der iberischen Falcata habe ich mich nie richtig anfreunden können.
Leider wurde ich schon allzu bald - ich zählte damals noch nicht einmal siebzehn Jahre – gezwungen, meine Fechtkunst in einem echten Kampf zu erproben, denn die Römer, die meine Heimatstadt dafür züchtigen wollten, dass wir in unverbrüchlicher Treue dem König Mithridates anhingen, bestürmten unsere Mauern. Trotz tapfersten Widerstandes konnten wir ihnen nicht lange standhalten, die Legionäre drangen in die Stadt ein und metzelten die ganze Bevölkerung nieder.
Auch meine gesamte Familie fiel den Bestien zum Opfer. Nur ich konnte entkommen, und da ich nicht wusste, wohin ich gehen und was ich nun tun sollte, heuerte ich schließlich bei den kilikischen Piraten an. Auch dort bestand ich so manchen Seekampf, bis es dem römische Admiral P. Servilius Vatia vier Jahre später gelang, einige unserer Schiffe aufzubringen und viele von uns, auch mich, gefangen zu nehmen.
Normalerweise gab es für gefangene Piraten nur die Todesstrafe, doch ich hatte Glück im Unglück, statt hingerichtet zu werden, wurde ich schon in Ostia durch einen Mittelsmann des schlauen Admirals dem Lanista Marcus Rosanus angeboten und der kaufte mich für seinen Ludus bei Rom.
Mein mir gegenüberstehender gallischer Gegner sah sehr selbstbewusst aus, so als hätte er nicht nur zwei, sondern bereits zwanzig Siege auf seiner Tafel. Gleich nachdem der Ausrufer das Zeichen zum Beginn des Kampfes gegeben hatte, ging er zum Angriff über. Er setzte vor allem auf seine Armkraft und die Wucht, mit der seine Schläge meinen Schild trafen, hätte einen weniger erfahrenen Fechter zermürben und in Angst versetzen können.
Doch mich beeindruckten seine Bemühungen wenig, ich setzte seiner puren Kraft meine Beweglichkeit, Schnelligkeit und die ganze Vielfalt meiner Fechtkunst entgegen, die aus sicheren Paraden, gekonnten Finten, blitzschnellen Angriffen, rechtzeitigem Rückzug und plötzlichen Ausfällen bestand.
Vor allem meine schnellen Gegenangriffe nach der Abwehr seiner Attacken machten dem Gallier zu schaffen, er hatte Mühe, die zielsicheren Stiche zu parieren oder ihnen auszuweichen. Immer wieder brachte ich ihn so in Bedrängnis, bis ich schließlich eine Lücke hart neben seinem Schildrand fand und ihm die Spitze meiner Klinge tief in die Seite stieß.
Der Gallier wankte, dann fiel ihm das Schwert aus der Hand und er sackte tödlich getroffen zu Boden.
Doch bevor er seinen Geist aufgab, öffnete er noch einmal seinen Mund und ich erkannte, dass er mir etwas sagen wollte. Also beugte ich mich zu ihm herab und brachte mein Ohr ganz nah an seinen Mund.
„Wenn du frei sein willst“, flüsterte er mit ersterbender Stimme, „dann suche den Thraker in Capua!“
Ich verstand nicht, was er damit meinte und hatte in diesem Augenblick auch keine Zeit darüber nachzudenken, denn als ich aufblickte, sah ich, dass der Gallier Brennus meinem Ludusgefährten Phillipus schwer zusetzte. Dieser hielt sich nur noch mit Mühe auf den Beinen und schon holte der Gallier aus, um ihm den tödlichen Stoß zu versetzen.
Da ich ihn anders nicht mehr erreichen konnte, stieß ich mein Schwert in die Erde, zog den Schild vom Arm und schleuderte ihn mit der rechten Hand in die Richtung des blonden Galliers.
Obwohl ich es bei der Entfernung von zehn Doppelschritten kaum zu hoffen gewagt hatte, traf der sich wie eine Wurfscheibe drehende Schild die Schwerthand des überraschten Capuaners und warf sie zur Seite, so dass sein Stoß fehlging. Während Phillipus ermattet auf die Knie sank, stürmte ich auf Brennus zu und forderte ihn zum Kampf.
Die Menge auf den Tribünen schrie auf.
Der Gallier wandte sich von Phillipus ab und seinem neuen Gegner zu. Natürlich versuchte er den Vorteil, dass ich ohne Schild war, auszunutzen und deckte mich sofort mit einem Hagel von Schlägen ein. Doch ich stellte mich immer so, dass ich ihm nur meine rechte Seite mit dem Schwertarm bot und wehrte alle Angriffe ab.
Als der Capuaner schließlich erkannte, dass er mir trotz des fehlenden Schildes nicht beikommen konnte, begann er die Geduld zu verlieren und Fehler zu machen. Nachdem er zum dritten Mal versucht hatte, mich mit einem geraden Stich in den Hals oder den Oberarm zu treffen, machte ich einen schnellen Schritt zur Seite, ging etwas in die Knie und stieß ihm die Spitze meines Schwertes in den linken Oberschenkel.
Sofort drang das Blut aus der tiefen Wunde hervor und Brennus wusste, dass er in Kürze verbluten musste, wenn er versuchen würde den Kampf fortzusetzen. Sein Leben konnte nur noch gerettet werden, wenn die heftige Blutung so schnell wie möglich gestoppt werden würde.
Da gab er auf, ließ sich auf sein rechtes Knie nieder, legte das Schwert ab und hob die Hand, um bei den Zuschauern um Gnade zu bitten. Ich stellte mich neben ihn, richtete die Spitze meiner Klinge auf seinen Hals und schaute zu dem dicken, in eine Rittertoga gehüllten Dolabella, der in der ersten Zuschauerreihe saß.
Die Zuschauer zeigten sich gnädig und riefen ziemlich einhellig „mitte“ und „missum“ und so gab schließlich auch Dolabella seine Zustimmung. Schnell eilten zwei der Betreuer aus Capua herbei, banden Brennus getroffenes Bein ab und trugen ihn aus der Arena.
Ich aber lief mit erhobenem Schwert eine Runde an den Tribünen entlang und schrie meinen Triumph in wortlosem Gebrüll heraus, denn ich hatte soeben meinen zehnten und elften Sieg errungen.
Inzwischen hatte sich auch Phillipus wieder erholt und sich, wenn auch noch etwas mühsam, aufgerichtet. Die Römer waren begeistert von dem ungewöhnlichen Kampf, sie jubelten und brüllten, und plötzlich begann sich über den Rängen der Ruf „Freiheit“ zu erheben, „Freiheit für Leonidas!“
Ich erstarrte. Sollte das tatsächlich wahr sein?
Der dicke Dolabella verzog das Gesicht. Offensichtlich mochten die Zuschauer den Ritter trotz seiner gewiss nicht geringen Ausgaben für die Abhaltung dieser Spiele nicht wirklich und wollten seinen Geldbeutel noch ein wenig schmälern, denn schließlich würde er meinem Lanista ein erkleckliches Sümmchen für den durch die Freilassung eines seiner besten Kämpfer verursachten Verlust, zahlen müssen.
Doch da die Rufe nicht abebbten, konnte er nicht umhin, dem Willen des Pöbels nachzugeben. Mit einer herrischen Handbewegung winkte er den Ausrufer zu sich und rief ihm etwas zu, woraufhin der Sprecher in die Mitte der Arena zurückkehrte und verkündete: „Freiheit, Freiheit für den tapferen Leonidas! Der edle Dolabella schenkt Leonidas die Freiheit!“
Während ich noch wie benommen dastand, kam Phillipus zu mir, dankte mir und beglückwünschte mich zur Erlangung meiner Freiheit. Trotz der Aussicht auf einen hochangesetzten Schadenersatz aus der Schatulle Dolabellas gratulierte mir kurz darauf auch mein Lanista Marcus Rosanus, jedoch mit etwas säuerlicher Miene, denn schließlich gab es Kämpfer wie mich nicht wie Sand an den Stränden bei Ostia.
Ich verließ die Arena durch den hölzernen Kasten, gab meine Waffen ab und wusste erst einmal überhaupt nicht, wie es nun weitergehen sollte. Nur eines wusste ich mit Sicherheit, in den Ludus Rosanus brauchte ich nur noch ein einziges Mal zurückzukehren, um mir den Rudis, das hölzerne Schwert, welches den freigelassenen Gladiatoren kennzeichnete, abzuholen.
Auf dem Markt hinter dem Amphitheater drängten sich viele Leute um mich, vor allem Frauen mit lüstern geröteten Gesichtern und flackernden Augen, die mich berühren wollten und danach gierten, von einem siegreichen Gladiator, der doch eigentlich auf der untersten Stufe der römischen Rangordnung stand, gevögelt zu werden.
Doch dann stand plötzlich ein Mann vor mir, mittelgroß, hager, mit schwarzen Haaren, einem spitzen Kinn und der braunen Haut der Bewohner der Länder am südlichen Rand des großen Meeres. Er trug einen weißen, griechischen Chiton und einen Gürtel an dem ein Gladius hing.
„Ich heiße Achillas“, sagte er kurz und bündig, „mein Herr, der Ägypter Plotinos will dich sprechen.“
In alter Gewohnheit warf ich einen fragenden Blick auf Marcus Rosanus und der nickte zustimmend. Und da der Lanista stets sehr neugierig war, schloss er sich Achillas und mir an.
Der edle Plotinos, saß in einer Sänfte die von acht bedauernswerten Männern getragen wurde, denn der Ägypter erfreute sich einer mehr als beachtlichen Leibesfülle. Er mochte gut und gern fünf Kenenarion wiegen, hatte ein ausgeprägtes Doppelkinn und trug eine schwarze Perücke auf dem wohl glattrasierten Schädel. Auch seine runden, in Fettpolster eingebetteten Schweinsäuglein, seine knubblige Nase und die rotgefärbten Lippen machten ihn nicht ansehenswerter.
„Tapferer Leonidas“, begann er in salbungsvollem Ton, „ich habe dich eben kämpfen sehen und du hast mir gefallen. Und da ich einen neuen Leibwächter benötige, weil sich einer meiner beiden Beschützer bei einer Tavernenschlägerei hat abstechen lassen, will ich dich in meinen Dienst nehmen, insofern du keine anderen Vorhaben hast. Du bekommst zwanzig Denare im Monat, dazu freies Essen und freie Unterkunft.“
Obwohl ich nicht allzu viel darüber wusste, was diese zwanzig Denare in Rom wert waren - schließlich war ich ja als Sklave hierhergebracht worden - hörte sich das von dem Ägypter Gesagte doch alles in allem nach einem passablen Angebot an.
„Zuerst reisen wir auf der Via Appia nach Pompeji, dann mit dem Schiff nach Brindisi und weiter nach Alexandria“, fuhr Plotinus fort, während sich sein scharfer Blick in meine Augen bohrte. „Also, gilt der Handel?“
„Er gilt!“, stimmte ich ohne zu zögern zu. Die Aussicht, nach so langer Zeit endlich wieder einmal mit einem Schiff über das große Meer fahren zu können, war allzu verlockend für mich.
Der Ägypter griff unter eines der Kissen, mit denen seine Sänfte verschwenderisch ausgestattet war, holte einen seidenen Beutel, in dem es metallisch klimperte, hervor und warf ihn mir zu.
„Kauf dir ein Schwert und etwas zum Anziehen“, sagte er gönnerhaft. „Und sei morgen bei Sonnenaufgang an der Porta Capena.“
Dann gab er seinen Trägern einen Befehl in einer Sprache die ich nicht verstand und entschwand.
Am kommenden Morgen stand ich noch vor dem Hellwerden am Capenischen Tor. Ich trug eine neue weiße Tunika, einen breiten Ledergürtel, an dem ein römischer Gladius in roter Scheide hing und in dem der Rudis steckte. Diesen hatte mir Rosanus ausgehändigt, allerdings nicht ohne den Versuch zu machen, Plotinos zu überbieten und mich als freien bezahlten Kämpfer für seinen Ludus zu gewinnen, was ich dankend abgelehnt hatte.
Die Sänfte meines neuen Dienstherrn erschien erst eine Stunde später, was mir Gelegenheit gab, mit den Torwächtern einen kleinen Schwatz über die Götter und die Welt zu halten. Neben Plotinos, dem Leibwächter Achillas und den acht Sänftenträgern gehörte nun auch noch Anippe, ein blutjunges, schlankes Mädchen, das wie Plotinos und Achillas aus Ägypten stammte, zu unserer kleinen Reisegesellschaft. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit dunkelbraunen Augen, lange schwarze Haare, schmale Hüften und flache, fast knabenhafte Brüste. Während der Reise ging sie stets links neben der Sänfte, fächelte Plotinos Luft zu und wischte ihm mit parfümierten Tüchern den reichlich vergossenen Schweiß vom Gesicht.
Die acht Sänftenträger hatten keine Namen, nur Nummern. Die Eins ging vorne links, die Acht hinten rechts. Sie waren allesamt kräftig gebaut, was sie bei dem Gewicht, das sie Tag für Tag zu tragen hatten, auch sein mussten, und nie sprach einer von ihnen ein Wort, so dass ich schon befürchtete, man habe ihnen die Zungen herausgeschnitten.
Als wir Rom verließen, erzählte mir Achillas, dass wir bis zu unserem Ziel Pompeji gut hundertzwanzig Meilen zurücklegen mussten, für die wir etwa zwölf Tage benötigen würden. Da die Träger ein besonderes, gleichmäßiges Schrittmaß hatten, mit dem sie das Tempo unserer Reise bestimmten, liefen Achillas und ich die meiste Zeit hinter der Sänfte her, was uns die Gelegenheit gab, uns besser kennenzulernen.
Auf den ersten Meilen wurde die Via Appia, die am Capenischen Tor ihren Anfang nahm, auf beiden Seiten von schattenspendenden Zypressen, Pinien und Eichen, sowie einer Vielzahl von mehr oder weniger prächtigen Grabmälern gesäumt. Danach führte sie durch ein flaches ländliches Gebiet, in dem vor allem Wein, Obst und Oliven angebaut wurden, geradewegs auf die sich südlich von Rom erhebenden Albanerberge zu.
Wenn man den Römern für etwas Bewunderung zollen will, dann sind es ihre Straßen. Bessere und haltbarere gibt es - über solche Entfernungen - wohl nirgends auf der Welt. Das trifft natürlich auch auf die Via Appia zu, doch trotz der landschaftlichen Schönheit, die sie auf ihrem langen Weg umgibt, kann ich bis heute - ob der sechstausend dort ans Kreuz geschlagenen Gefährten - nur mit Grausen an sie denken.
Während der ganzen Reise übernachteten wir zumeist in Gasthäusern, bei deren Auswahl Plotinos eine seltsame Neigung zur Heruntergekommenheit, ja, Verkommenheit entwickelte. Je schäbiger die Behausung war, desto besser erschien sie ihm.
Mir machte das nichts aus, ich war viel Schlimmeres gewohnt, doch ich wunderte mich, dass ein in so feine seidene Kleider gehüllter Mann keine der durchaus vorhandenen luxuriösen Unterkünfte, auswählte.
An den Abenden, sobald es dunkel geworden war, musste dann immer Anippe in das Zimmer des Dicken kommen und schon nach kurzer Zeit hörten wir ihn grunzen und auf wollüstige Weise stöhnen.
„Was treibt er denn da mit ihr?“, fragte ich Achillas, mit dem ich mich bereits angefreundet hatte, noch am ersten Tag, „Der fette Kerl muss das arme Mädchen doch erdrücken!“
„Sie muss auf ihm reiten bis es ihm kommt“, gab der Ägypter zurück. „Und wenn sie ihre Blutungen hat, dann muss sie ihn mit der Hand oder dem Mund befriedigen.“ An dem bitteren Ton seiner Stimme und seinem zwischen Traurigkeit und Grimm wechselnden Mienenspiel erkannte ich, dass auch ihm selbst das Mädchen nicht gleichgültig war.
Danach erzählte er mir, dass er und Anippe, deren Namen „Tochter des Nils“ bedeutete, wie Plotinos aus Alexandria stammten. Er hatte als Enomotarch in der ägyptischen Armee gedient, bis er entlassen wurde, weil er einen Lochagos der Unterschleife beschuldigt hatte. Dieser jedoch war der Lieblingsneffe eines Polemarchen, weshalb nicht der von Achillas Beschuldigte, sondern er selbst, die Truppe in Unehren verlassen musste und schließlich als Leibwächter bei Plotinos anheuerte. Anippe dagegen war schon als Kind von ihren eigenen Eltern in die Sklaverei verkauft worden und auf verschlungenen Wegen als Lustsklavin zu dem Dicken gekommen.
„Wie kam es eigentlich dazu“, fragte ich, vor allem um ihn von den Gedanken an die kleine Anippe abzulenken, „dass Plotinus ausgerechnet mich als Leibwächter ausgewählt hat?“
„Nachdem Pawero, dein Vorgänger, in einer Taverne hinterrücks erstochen worden war, hatte Plotinos den Einfall, die Spiele zu besuchen und den besten der dort auftretenden Schwertkämpfer zu kaufen. Und dann hat er gesehen, dass du gefochten hast wie dein Namensvetter bei den Thermopylen und sofort den Entschluss gefasst, dich zu kaufen. Doch nachdem das Volk deine Freilassung erwirkt hatte, schickte er mich sofort zu dir, um dich für ihn anzuwerben.“
„Hoho!“, rief ich, „Den Besten wollte er kaufen! Solche Männer sind aber nicht billig!“
Achillas zuckte mit den Schultern. „Nun, der Dicke ist stinkreich, viele Talente schwer. Ich denke, dass er viele der römischen Senatoren locker in die Tasche steckt!“
Am zweiten Tag unserer Reise erreichten wir Velletri, eine in einem Tal der Albanerberge liegende Stadt, die sich rühmte, einmal größer und bedeutender als Rom gewesen zu sein. Heute aber diente sie vor allem den reichen Römern, die im Sommer der Hitze und der stickigen Luft in ihrer Stadt entfliehen wollten, als Ort, in dem sie sich vom Geld raffen, Kriege anzetteln und dem Zusehen blutiger Spiele erholen, Orgien feiern oder Ausflüge zu dem nahegelegenen Albanersee und dem Nemisee unternehmen konnten.
Manchmal, wenn auch selten, hatte ich während unserer Reise Gelegenheit, mit Anippe ein paar Worte zu wechseln. Recht freimütig erzählte sie mir, dass Plotinos über eine beachtliche Schwanzlänge verfügte, was es ihr erleichterte, sich auf ihn zu schwingen und ihn zu reiten.
Ihre Eltern, die mit weit mehr Kindern als Einkommen gesegnet waren, hatten sie schon mit sechs Jahren an einen Landbesitzer verkauft, bei dem sie auf den Feldern und in den Dattelhainen hatte arbeiten müssen. Als sie elf war, hatte sie der vorbeireisende Plotinos gesehen und sofort gekauft, und eine ältere Frau, ihre Vorgängerin, hatte sie in die Verrichtungen eingeweiht, die nötig waren, um es ihrem neuen Herrn ordentlich zu besorgen.
Seitdem folgte sie Plotinos auf seinen vielen Reisen und sorgte nahezu jeden Abend für die Befriedigung des Dicken.
Hinter Velletri verlief die Straße wieder, wie an der Schnur gezogen, durch eine breite Ebene mit großen Landgütern und kleinen, von Getreide- und Gemüsefeldern oder Obstbaum- und Olivenhainen umgebenen Bauernhöfen. Auf dem ganzen Weg begleiteten uns auf der Sonnenaufgangsseite langgestreckte Bergzüge, während ein stetig wehender, frischer Wind von der Nähe des nur einige Meilen entfernten Meeres zeugte.
Gegen Mittag belebte sich die Straße zusehends mit Karren und Wagen, die Waren aus dem Land in die Städte und die größeren Orte brachte.
Nach gut sechzig Meilen, die wir in vier Tagen zurücklegten, erreichten wir das - zwischen dem Tyrrhenischen Meer und den Aurunker-Bergen mit ihren weißgrauen, mit grünen Tupfern übersäten Hängen - schön gelegene Formia. Wie schon Velletri war auch Formia bei den wohlhabenden Römern sehr beliebt, von denen viele hier prächtige Villen besaßen.
Zum ersten Mal seit man mich in Ostia als Sklaven verkauft hatte, stand ich hier wieder am Gestade des Meeres, ließ mir den frischen Seewind ins Gesicht wehen, sog den Geruch von Salz und Tang in die Nase und ließ meine Füße von dem in weißgekrönten Wellen heranrollenden Meerwasser umspülen. Herrlich!
Von Formia bis zur Grenze zwischen Latium und Kampanien folgte der Weg dem nach Osten gerichteten Verlauf der Küste, dann entfernte er sich vom Meer und bog nach Südosten ins Landesinnere ab.
Am zweiten Tag nach unserem Aufbruch von Formia erreichten wir Capua. Die immer noch bedeutendste und reichste Stadt Kampaniens lag inmitten einer vom Volturnus durchströmten großen Ebene, die im Osten von den hohen, dicht bewaldeten Tifatabergen begrenzt wurde. Lange Zeit konnte Capua in Italia selbst mit Rom wetteifern, und auch heute noch vermochten die Capuaner vom Getreideanbau, der Parfümherstellung und der Bronzeschmiedekunst gut zu leben.
Doch ihre Unabhängigkeit hatte die Stadt längst eingebüßt. Von dem vernichtenden Sieg des großen Hannibals über die Römer bei Cannae verführt, hatten die Capuaner das Lager gewechselt und waren zu dem siegreichen Punier übergegangen.
Später behaupteten die Leute, dass das punische Heer, welches in Capua Winterquartiere bezog, aufgrund der dort vorherrschenden prunksüchtigen, verweichlichten Lebensweise seine einzigartige Kampfkraft verloren hätte. Einige Jahre danach umschlossen die Römer dann das abtrünnige Capua und die Stadt musste nach langer Belagerung kapitulieren. Die Sieger erlegten den Capuanern einen hohen Tribut auf und ersetzten ihre selbständige Stadtregierung durch römische Verwalter.
Beim Anblick der Stadt mit dem großen, sich vor den nördlichen Wehrmauern erhebenden, steinernen Amphitheater kamen mir wieder die Worte des Galliers Accos in den Sinn: „Wenn du frei sein willst, dann suche den Thraker in Capua!“
Was oder wen er wohl damit gemeint hatte? Gab es in Capua tatsächlich einen besonderen Mann, der in der Lage war, anderen Gladiatoren die Freiheit zu geben? Wenn dies der Wahrheit entsprach, dann musste dieser Thraker allem Anschein nach auf irgendeine Weise mit einer der Gladiatorenschulen in Capua in Verbindung stehen, sei es als Lanista, Ausbilder oder Kämpfer.
Nun, ich war jetzt frei, auch wenn ich in den Diensten eines reichen Mannes stand, und ich würde das Geheimnis des seltsamen Thrakers nicht lüften müssen.
Sobald wir Capua nach einem Tag Aufenthalt wieder verließen, wuchs aus der Ebene, die vor uns lag, ein gewaltiger Bergkegel in die Höhe, der weithin zu sehen war.
„Das ist der Vesuv“, erklärte mir Achillas, „ein Berg des Gottes Vulcanus, der früher einmal Feuer gespien und rotglühendes Gestein ausgeworfen hat. Doch jetzt hat er schon seit vielen hundert Jahren Ruhe gegeben.“
Wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich beinahe denselben Weg, den wir jetzt beschritten, schon in wenigen Wochen noch einmal zurücklegen würde, und dass dabei auch der geheimnisvolle Thraker einen nicht unbedeutenden Anteil daran hatte, ich hätte ihn ausgelacht.
Als wir am übernächsten Tag den Fuß des dicht mit grünem Buschwerk und dichtem Wald bedeckten Berges erreichten, erzählte uns Plotinos, dass sich rechts von uns die Phlegräischen Felder, eine unwirtliche, verbrannte, nach Schwefel stinkende Landschaft mit vielen rauchenden Kratern erstreckte, von der sich die Menschen besser fernhalten sollten.
Von hier aus war es nicht mehr weit bis Pompeji und ich muss sagen, dass ich heilfroh über unsere Ankunft dort war, denn ich war so langes Laufen nicht gewohnt. Schließlich bin ich ja viele Jahre Seefahrer gewesen und auch als Gladiator hatte ich nie lange Wege zurücklegen müssen. Meine Beine schmerzten und auch meine Füße waren schon in einem wesentlich besseren Zustand gewesen.
Wir betraten Pompeji durch das Vesuv-Tor und Plotinos, der sich hier offensichtlich gut auskannte, ließ uns gleich bei der ersten Straßenkreuzung nach links in den nördlichen Stadtteil abbiegen, in dem sich eine Vielzahl von großen Villen aneinanderreihte.
Vor einer der Villen, sie stand fast am Ende der Straße, hielten wir an und Achillas klopfte an das zweiflüglige Portal.
Neben der Eingangstür wurde die schmale Vorderfront des Hauses nur von je einem winzigen Fenster zur linken und zur rechten der Pforte durchbrochen. Der untere Teil der Außenwände der Villa war rot, der obere gelb angestrichen, die Dächer waren mit roten Ziegeln gedeckt.
Ein Haussklave mit schütterem grauen Haar öffnete die Tür und fragte nach unserem Begehr.
„Der edle Plotinos wünscht den edlen Publius Secundus Maius zu sprechen!“, gab Achillas Auskunft.
„Ich werde euch sogleich anmelden“, erwiderte der Türöffner, neigte sein Haupt und verschwand im Inneren des Hauses.
Inzwischen hatte sich Plotinos aus der abgestellten Sänfte gewuchtet und war in den Schatten des Eingangs getreten. Fast im selben Augenblick erschien auch schon der Hausherr, ein etwa vierzigjähriger drahtiger Mann mit dunklen Haaren und dunklem Bart, um den Ägypter wie einen alten Bekannten zu begrüßen und ihn zu bitten, ihm in sein bescheidenes Heim zu folgen. Zuvor aber gab er dem Türsklaven noch die Anweisung, unsere Sänftenträger mitsamt ihrem Tragestuhl zu einem Gelass unweit des Hauses zu bringen, wo sie bleiben sollten, bis der Ägypter wieder nach ihnen rufen lassen würde. Das alles sah mir stark danach aus, dass dies nicht der erste Besuch des Alexandriners bei Publius Maius war.
Durch einen schmalen Innenflur, an den sich links die Kammer des Türöffners und rechts ein kleiner Aufenthaltsraum für wartende Clienten anschloss, betraten wir das Atrium, einen großen Raum, um den sich eine Reihe von anderen, meist deutlich kleineren Räumen gruppierten. In der Mitte dieses Raumes war das Impluvium, ein quadratisches Regenwasserauffangbecken, in den Fußboden eingelassen worden, über dem es eine Dachöffnung mit nach innen geneigten Dachschrägen in der Größe des Beckens gab, durch die Licht und Regen in die Halle eindringen konnten.
Die Säulen, die an den vier Ecken des Impluviums standen und das Dach stützten, waren aus kostbarem weißen Marmor gefertigt. Am Boden des halbvoll mit Wasser gefüllten Beckens war ein Mosaik zu erkennen, das einen Delphin und mehrere andere Fische zeigte.
Der Fußboden des Atriums war zum Teil mit großen Marmorplatten, zum Teil mit buntgefärbten Terrakottafliesen ausgelegt, während die ebenfalls marmorverkleideten Wände mit Weinranken und anderen üppig wachsenden Pflanzen bemalt waren.
Auf der linken Seite schlossen sich an die große Empfangshalle zuerst ein kleinerer Schlafraum, dann die große Küche, aus der es verführerisch nach gebratenem Fleisch und Fisch duftete, und das Triklinium, der Speiseraum der Hausbewohner und ihrer Gäste, an. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich zwei weitere kleinere Räume, zwischen denen der Hausaltar mit kleinen Götterstatuen stand und ein Treppenaufgang, der zu den im oberen Stockwerk befindlichen Schlafräumen führte.
In der Mitte zwischen dem Triklinium und der Treppe öffnete sich das Tablinum, das als Durchgang zum Peristyl, jedoch auch als Besprechungsraum diente. Vom Tablinum konnte man bis in das von einem Säulengang umgebene Peristyl schauen, in dessen Mitte einige kurzgehaltene Buchsbaumhecken, kleine Lorbeerbäume und verschiedenartige Blumen wuchsen.
Zum Atrium hin war das Tablinum, in dem einige aus Weidenruten geflochtene Sessel und ein kleines rundes Tischchen standen, nur durch einen Vorhang abgeteilt.
Während sich Plotinos und Maius auf den Sesseln niederließen - der Sessel des Ägypters ächzte und knarrte erbärmlich, hielt der auf ihm ruhenden Last aber stand - schickte man mich, Achillas und Anippe zunächst in den Clientenwarteraum, wo wir von den Küchensklaven mit Speise und Trank gut versorgt und ansonsten von unserem Herrn in Ruhe gelassen wurden. So verging der Tag für uns in weitgehender Ereignislosigkeit.
Erst am Abend wurde die Eintönigkeit plötzlich durchbrochen, als zwei weitere Gäste vor dem Haus von P. Maius erschienen. Von unserem Aufenthaltsraum aus hörten wir, wie Maius den einen mit der Anrede: „Mein sehr geehrter Diotoros“ und den anderen mit: „Mein sehr geehrter Aeneas“ begrüßte.
Nur mäßig neugierig schaute ich zur Tür, doch als ich gleich darauf den einen der beiden neuen Gäste durch den Flur schreiten sah, riss ich erstaunt die Augen auf.
Diesen Mann kannte ich!
Auch wenn er, ebenso wie sein Begleiter, in prachtvolle Gewänder gehüllt war, wie man sie an den Höfen der Könige von Pontus und Armenien trug, so war er doch ein Kilikier, ein Pirat, wie ich einer gewesen war!
Zwar gehörte dieser Aeneas nicht zu den Männern, die selbst mit dem Schwert oder dem Beil in der Hand auf den Schiffsplanken standen, doch auch so war er Teil unserer Gemeinschaft, denn er diente uns als Unterhändler, Spion und Verkäufer unserer Beute.
Doch was um alles in der Welt hatte er ausgerechnet hier zu suchen?
Nun, ich brauchte nicht lange zu überlegen um mir einen ungefähren Reim auf das Zusammentreffen dieser Männer machen zu können. Da der andere Gast, Diotoros, aussah wie ein pontischer Adliger, lag es nahe, dass es hier um irgendwelche unsauberen Geschäfte zwischen einem Abgesandten des Königs Mithridates von Pontus, den kilikischen Piraten und einem Händler aus Pompeji ging.
Neugierig geworden spitzte ich die Ohren und versuchte, einiges von den Gesprächen der vier Männer aufzuschnappen, doch vergebens. An diesem Abend wurde nicht über Geschäfte geredet. Stattdessen ertönte bei Einbruch der Nacht erneut ein lautes Klopfen an der Pforte und nachdem der Türsklave geöffnet hatte, betraten ein kleingewachsener Pompejaner in einer zitronengelben Tunika, ein muskulöser Schwarzer mit grimmig verzogener Miene und sechs junge Frauen das Atrium, welche sich vor dem Impluvium in einer Reihe aufstellten. „Mein lieber Plotinos, mein lieber Diotoros, mein lieber Aeneas, da ich es als meine Pflicht als pater familias ansehe, alles erdenklich Gute für euer Wohlbefinden zu tun, habe ich euch von unserem, in allen Liebesdingen erfahrenen Afranius die besten Lupas seines in ganz Kampanien bekannten Hauses bringen lassen, damit ihr mit ihnen eine leidenschaftliche Nacht verbringen könnt“, sprach Maius in salbungsvollem Ton, „Möget ihr nun eure Auswahl treffen. Afranius, stell uns deine Freudenspenderinnen vor!“
Der Kleine verneigte sich und gab den sechs Frauen ein Zeichen, woraufhin sie ihre Überwürfe ablegten, unter denen sie bis auf die aus durchsichtigem Flor bestehenden Brustbänder und die eng geschnittenen Subligares nichts anderes trugen. Sogleich erfüllte der Duft von schwerem Parfüm das Atrium.
„Diese hier heißt Kallipygos“, begann Afranius und wies auf die ganz links in der Reihe stehende Frau, „Sie ist Griechin und wie es ihr Name bereits sagt, mit einem besonders prachtvollen Hinterteil ausgestattet.“
Ohne von ihrem Besitzer dazu aufgefordert werden zu müssen, drehte sich die Griechin sogleich um und bot den Männern einen Blick auf ihr gepriesenes Körperteil, welches wirklich ganz entzückend aussah.
Die zweite Lupa war eine Jüdin namens Rebecca, die dritte hieß Rega und kam aus Iberien - auch diese beiden stellten ihre Körper auf aufreizende Weise zur Schau. Dann folgten die schwarzhäutige Malissa, die blonde, vollbusige Germanin Guta und als Letzte in der Reihe eine junge Frau, die Afranius als „Laodica, die Blume von Kreta“ vorstellte.
Ich starrte die junge Lupa an, wie die gerade dem Schaum des Meeres entstiegene Aphrodite. Sie war vielleicht sechzehn Jahre alt und hatte ein wunderschönes herzförmiges Gesicht mit feinen Zügen, dunkelbraunen Augen, vollen roten Lippen und blauschwarzen, in zierliche Locken gelegten Haaren, deren Farbe in auffälligem Widerstreit mit ihrer sehr hellen Haut stand.
Aber auch ihre Figur war von einer Art, die Männer um ihren Verstand bringen kann. Ihre langen wohlgeformten Beine, die sanft geschwungenen Hüften und die schmale Taille fügten sich ebenso selbstverständlich und mühelos, wie ihre herrlich gerundeten Brüste, deren Fülle und Spannkraft einer Göttin zur Ehre gereicht hätten, in das Bild einer Frau, der eine besondere Gnade der Venus zuteilgeworden war.
Während sich meine bewundernden Blicke noch immer nicht von der jungen Kreterin lösen konnten, hatte sich der Kilikier Aeneas bereits für die vollbusige Germanin und Diotoros für die hübsche Jüdin entschieden. Plotinos Wahl aber fiel, nach einer eingehenden Musterung der sechs Lupas, ausgerechnet auf die schöne Laodica, was in mir, so unsinnig das auch war, ein eifersüchtiges Gefühl aufkommen ließ.
Ohne weitere Worte von sich zu geben, stiegen Diotoros und Aeneas gleich darauf mit ihren Beischläferinnen die Treppe zum Obergeschoss hinauf, während Plotinos Laodica zu einem der kleinen Zimmer neben dem Hausaltar zog. Das alles erschien mir so, als ob sich die drei Männer hier bestens auskannten und nicht zum ersten Mal die Gesellschaft und die Dienste der Frauen aus dem Hause des Afranius genossen.
Doch dann änderte sich für mich alles, denn noch in der Tür des Zimmers drehte sich Plotinos plötzlich wieder um, kam zu uns - wir hatten die ganze Zeit im Flur gestanden und dem seltsamen Schauspiel zugesehen - und sagte: „Ich nehme doch lieber meine kleine Anippe, nimm du die schöne Kreterin, mein treuer Leonidas, und geh mit ihr in das kleine Zimmer dort neben der Küche. Du hast doch bestimmt schon seit Wochen bei keinem Weib mehr gelegen.“
Als er Achillas säuerliche Miene sah - mein Freund konnte seine Gefühle für Anippe immer schwerer verbergen - befahl er ihm: „Und du, mein Achillas, geh zum Hafen und sieh nach, ob unser Schiff bereits dort vor Anker liegt! Danach hast du frei bis morgen früh.“
Er zog einen Golddenar aus einem Beutel, den er am Gürtel trug und drückte ihm dem Alexandriner in die Hand. „Amüsiere dich nach Kräften, in den Hafenschenken gibt es guten Wein, gutes Essen und willige Weiber.“
Ich weiß nicht, aus welcher Laune heraus er gerade mir Laodica überließ, aber ich war dem Dicken in diesem Augenblick aus tiefstem Herzen dankbar.
Nachdem Achillas sich wortlos dem Ausgang zugewandt hatte, betraten Laodica und ich den kleinen Schlafraum, in dem ansonsten wohl nur ausgewählte Gäste des Hausherrn eine Ruhestätte fanden. Der geringen Größe des Zimmers entsprechend fand sich darin außer dem Bett nur noch ein dreibeiniger runder Tisch, auf den die ansonsten fast unsichtbaren Haussklaven während der Vorstellung der sechs Lupas einen Krug mit Wein und zwei Becher sowie eine brennende Öllampe gestellt hatten, deren leicht flackerndes Licht den Raum mit einer unsteten Helligkeit erfüllte.
Ich hatte kaum den Vorhang, der das Zimmer vom Atrium abtrennte, hinter uns zugezogen, als Laodica auch schon ganz geschäftsmäßig ihr Brustband löste, ihr Subligar abstreifte, ihre Sandalen von den Füßen schüttelte und sich mit leicht gespreizten Beinen auf das Bett legte.
„Warte, warte“, sagte ich, während ich mich neben sie legte, „wir brauchen nichts übereilen, wir haben die ganze Nacht Zeit.“
Sie sah mich etwas merkwürdig an, überlegte einen Moment lang, dann sagte sie: „Wie du willst. Die meisten Freier wollen immer gleich zur Sache kommen, und auch Afranius und seine Rausschmeißer sorgen stets dafür, dass sich die Böcke nicht lange bei uns aufhalten, damit der nächste zahlungskräftige Freier seine Asse und seinen Samen bei uns loswerden können.“
„Wie viele Freier hast du denn heute schon gehabt?“, fragte ich, nur um irgendetwas zu sagen, obwohl ich gerade das eigentlich gar nicht wissen wollte.
„Nur drei“, erwiderte sie gelassen. „War ein ruhiger Tag. Sonst sind es sieben oder acht.“
„Du bist so schön“, versetzte ich mit rauer Stimme, „sicher wollen alle Männer immer nur zu dir.“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, nein, ich entspreche eigentlich nicht der Art von Frau, die hier am meisten verlangt wird. Die Böcke wollen lieber Lupas mit großen dicken Ärschen und kleinen Titten, so wie Kallipygos. Die ist die Königin in unserem Haus, die hat oft zehn oder mehr Freier am Tag.“
„Und wenn du mit den Freiern schläfst“, erkundigte ich mich neugierig, „hast du dann auch immer einen orgasmós?“
„Du meinst das schöne Gefühl?“
„Ja.“
„Manchmal, aber nur sehr selten.“
„Wie lange bist du schon bei Afranius?“
„Vor fünf Sommern - ich war damals zehn oder elf Jahre alt - haben die verfluchten Seeräuber mein Dorf an der Südküste von Kreta überfallen und mich geraubt und versklavt. Ein Händler brachte mich hierher und Afranius kaufte mich für sein Lupanar. Zuerst war ich Haussklavin, habe die Kammern saubergemacht, die Wäsche gewaschen und beim Kochen geholfen. Dann, so etwa vor drei Jahren, als ich meine ersten Blutungen hatte und meine Brüste anfingen zu wachsen, versteigerte Afranius meine Jungfernschaft für fünfundzwanzig Denare an einen Getreidemühlenbesitzer aus Herculaneum. Und seitdem bin ich eine Lupa.“
Bei der Erwähnung der Piraten überkam mich ein ungutes Gefühl. Schließlich hatte ich ja auch mehrere Jahre zu den Kilikiern gehört, und was wir dort getan hatten, war ganz gewiss nicht immer alles besonders ehrenhaft gewesen. Doch das verschwieg ich ihr vorerst lieber …
Um meine Verlegenheit zu verbergen, stand ich auf, füllte mit dem Wein aus dem Krug die beiden Becher und reichte ihr einen davon.
„Wir müssen das nicht machen“, erklärte ich, nachdem wir getrunken hatten, so als könnte ich damit eine Schuld gutmachen, „nur weil uns die Laune meines Herrn zusammengeführt hat.“
Das ein Mann ihre Liebesdienste nicht in Anspruch nehmen wollte, schien Laodica etwas völlig Neues zu sein. Sie sah mich nachdenklich an und fragte: „Also stimmt es nicht, was der dicke Herr gesagt hat, dass du seit Wochen keine Frau gehabt hast?!“