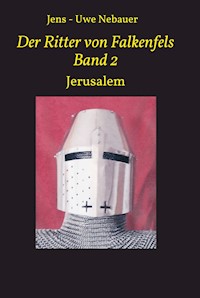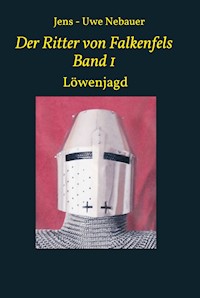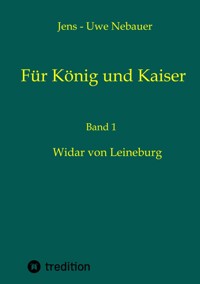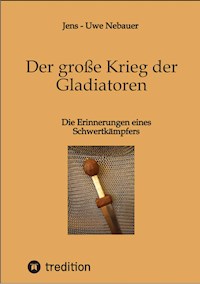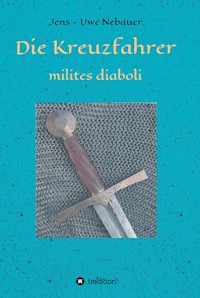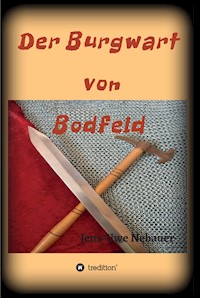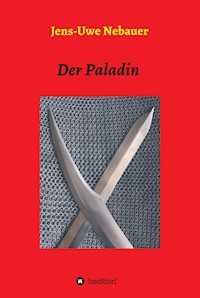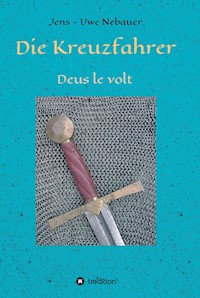
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach kräftezehrenden Märschen durch steinige Wüsten und über himmelhohe Gebirge, nach unsäglichen Strapazen und verlustreichen Kämpfen, stehen die Kreuzfahrer endlich vor den Toren Jerusalems, zu dessen Eroberung sie vor drei Jahren aufgebrochen sind. Am 15. Juli 1099 erstürmen die Krieger Christi die verbissen verteidigten Mauern der Heiligen Stadt und richten unter der einheimischen Bevölkerung ein blutiges Massaker an. Erschüttert und abgeschreckt von dem grausamen Gemetzel verlässt der Kreuzfahrer Gerold von Falkenburg mit seinen Gefährten die in Blut getauchte Stadt und kehrt noch im selben Jahr wieder in seine Heimat zurück. Mit seiner auf dem Kreuzzug gemachten, reichen Beute erwirbt der Ritter ein Stück Land am Rand des Harzgebirges und lässt darauf eine neue Burg erbauen. Bei einem Treffen mit befreundeten Adligen begegnet er Margarete, der Schwester seiner früheren Geliebten Mathilde, die ihm schon von Kindheit an in schwärmerischer Liebe zugetan ist. Gerold verliebt sich in die schöne Jungfrau und hält mit ihrem Einverständnis bei ihrer Familie um Margaretes Hand an. Doch bevor er das Glück seiner neuen großen Liebe genießen kann, hat er noch eine Aufgabe zu erfüllen: er muss die Schuldigen am Tod seiner Brüder ihrer verdienten Strafe zuführen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Autor
Jens - Uwe Nebauer wurde am 5. Juni, dem Pfingstsonntag des Jahres 1960, in Magdeburg geboren.
Nach erfolgreich bestandenem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg. Als Diplomingenieurökonom arbeitete er dann jahrelang im Anlagenbau und in anderen Berufen.
Der Autor interessiert sich seit seiner Kindheit für Geschichte. Der Besuch von Burgen, Schlössern und Museen mit seinen ebenfalls geschichtsinteressierten Eltern weckte in ihm schon früh diese Vorliebe. Später spezialisierte er sich auf das europäische Mittelalter und die Zeit der römischen Antike.
Seine Kreativität hat er bereits im Kindergarten entdeckt, denn da er während des verordneten Mittagsschlafes nie einschlafen konnte, begann er damit sich die Langeweile durch das fantasievolle Erfinden und „Sich-selbst-erzählen“ von kleinen oder größeren Geschichten zu vertreiben.
Später ging er dann dazu über seine Interessen beim Schreiben zu verarbeiten und verfasste u. a. die historische Romane „Ritter von Falkenfels“ „Die Kreuzfahrer “ und „Der Burgwart von Bodfeld“.
Nun liegt die Fortsetzung von „Die Kreuzfahrer“ vor.
Die Kreuzfahrer
Deus le volt
von
Jens – Uwe Nebauer
Meinen Enkeln Lena und Ole Frederic gewidmet
© 2017 Jens – Uwe Nebauer
Umschlaggestaltung: Nebauer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-1659-7
Hardcover
978-3-7345-1660-3
e-Book
978-3-7345-1661-0
Druck und Verlag:
tredition GmbH, Halenreie 40 - 44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Der Autor
Was bisher geschah
Alles tot in Civetot
Viel Steine gibt‘s
Bis die Gäule torkeln
Ein Stück rostiges Eisen
Straße zur Hölle
Blut, gemischt in strömende Tränen
Der soll ein König sein
Gewalt fährt auf der Straße
Ich bin Margarete
Amboss waren wir lange genug
So wohlgestalt und ohne Fehl
Ein kaltes Gericht
Verzeichnis der wichtigsten Personen
Worterklärungen
Was bisher geschah:
Im ausgehenden 11. Jahrhundert herrscht im Heiligen Römischen Reich Krieg zwischen Kaiser Heinrich IV. und Ekbert von Meißen, der sich zum Gegenkönig ausrufen lassen hat.
Während der Belagerung der Ekbert gehörenden Burg Gleichen durch den Kaiser, geraten die Ritter Gottfried und Gunthard von Falkenburg in einen heftigen Streit mit ihren Nachbarn, den Herren von Spatenburg. Der Streit wandelt sich zu offener Feindschaft, als die Spatenburger bei dem nächtlichen Überfall eines markgräflichen Entsatzheeres fliehen, ohne den heftig bedrängten Falkenburgern Hilfe zu leisten.
Einige Monate später wird Gerold, der jüngere Bruder, der nur mühsam aus dem Kampf entkommenen Falkenburger, in der Nähe der Burg Regenstein Zeuge der versuchten Gefangennahme des Edelfräuleins Mathilde von Konradsburg durch einige Gefolgsleute des Herrn von Regenstein. Nachdem er die Verfolger des Fräuleins vertrieben hat, erfährt Gerold, dass der Regensteiner Mathildes zukünftige Schwägerin Mechthild von Heimburg entführen lassen hat, um sie zur Ehe zu zwingen.
Von Gerold und Mathilde alarmiert, bereiten sich die Konradsburger, der mit ihnen verschwägerte Graf von Mansfeld und die Heimburger auf die Erstürmung der Burg Regenstein vor, die dank einer List auch gelingt. Die Gefangene wird unbeschadet befreit, der Regensteiner von Gerold im Zweikampf getötet.
Bei der sich daran anschließenden Siegesfeier entspinnt sich, trotz eines von Mathilde schon vor Jahren dem Herrn von Arnesberg gegebenen Eheversprechens, eine heimliche Liebesbeziehung zwischen dem Fräulein und dem Jungherrn von Falkenburg.
Als Gerold zur Hochzeit von Mathildes Bruder Otto mit der befreiten Mechthild unterwegs ist, trifft er in einer Mühle im Selketal zufällig auf den dort rastenden Markgrafen von Meißen. Mit Hilfe einiger durchziehender Waffenknechte der Äbtissin von Quedlinburg überfällt er den Meißner und dessen Gefolge und erschlägt den Gegenkönig.
Einen der verwundeten Begleiter des Markgrafen, den noch heimlich dem Glauben an die germanischen Götter anhängenden, hünenhaften Aribo, macht Gerold zu seinem Knappen. Mit der gewonnenen Beute, der Ausrüstung und dem Pferd des Grafen zählt er nun zu den wohlhabenderen Herren, doch an seiner Beziehung zu Mathilde ändert dies nichts, da deren gegebenes Eheversprechen aus Gründen der Familienehre nicht zurückgezogen werden darf. Mathilde muss den Arnesberger heiraten, doch zuvor vereinigt sie sich mit Gerold in leidenschaftlicher Liebe.
Als ein treu zu dem von Kaiser Heinrich bekämpften Papst Urban II. stehender Mönch, Gerold die Absolution für die Erschlagung Ekberts von Meißen, verweigert, verprügelt ihn der Falkenburger in einem Anfall von Jähzorn. Da aber der Mönch zur Verwandtschaft der Herren von Spatenburg gehört, verwandelt dieser Zwischenfall die Feindschaft zwischen den Adelsgeschlechtern zu einer erbittert geführten Fehde.
Die Absolution wird Gerold erst einige Zeit später zuteil, als der Priester und kaiserliche Emissär Vizelin auf der Falkenburg erscheint und nach mehreren, der Erkundung der politischen Lage dienenden Reisen durch das Herzogtum Sachsen, immer wieder dorthin zurückkehrt.
In dieser Zeit nimmt auch die Liebe zwischen Gerold und Mathilde, die nun in der Nachbarschaft der Falkenburger lebt, einen neuen Anfang. Nach einer Begegnung bei einem, von Mathildes Gemahl ausgerichteten Fest, treffen sich die Beiden mehrmals in einem Waldversteck in den Bergen der Hainleite.
Währenddessen wird die Fehde zwischen den Falkenburgern und den Spatenburgern immer gewalttätiger, bis sie in einem Überfall der Spatenburger auf ein Dorf der Falkenburger ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Bei dem Überfall wird die ganze Familie der Bauerntochter Wibke erschlagen und ihr Hof niedergebrannt, so dass sie sich als Magd auf der Falkenburg verdingen muss.
Gerade als sich die Situation durch Vermittlung des Abtes des Klosters Göllingen etwas beruhigt hat, ereilt die Falkenburger ein weiteres Unglück, als sich der immer mehr zu einem väterlichen Freund Gerolds werdende Vizelin, bei einer Jagd einem Gerold angreifenden Keiler entgegen wirft und dabei schwer am Bein verletzt wird. Da ihm auf der Falkenburg niemand helfen kann, lässt Gerold den Verletzten von Aribo und Wibke zu deren Tante Walburga bringen, die am südwestlichen Rand des Harzes als Heilerin lebt.
Auch die zuletzt immer seltener werdenden Treffen mit Mathilde nehmen ein jähes Ende, als die Edelfrau erkennt, dass sie ein Kind ihres Mannes erwartet. Noch einmal bestellt sie Gerold zu einem letzten Treffen, um ihm ihre Entscheidung mitzuteilen, doch dann wird sie daran gehindert, die Verabredung wahrzunehmen. Gerold, der vergeblich auf sie gewartet hat, verbringt die Nacht enttäuscht und verbittert in ihrem ehemaligen Waldversteck.
Als er am nächsten Morgen in die Falkenburg zurückkehrt findet er seine Brüder und alle Burginsassen im Schlaf ermordet vor. Auch er selbst wird von einigen Bewaffneten angegriffen und verwundet, doch er kann die Angreifer in die Flucht schlagen. Vom Blutverlust und vom Wundfieber geschwächt macht er sich auf den Weg zu der Höhle, in der Aribo, Wibke und Vizelin mit der Heilerin Walburga hausen. Dank der Heilkunst der weisen Frau überlebt er das Wundfieber und gesundet wieder vollständig.
In der darauffolgenden Zeit denkt der Falkenburger daran Rache für seine ermordeten Brüder zu nehmen, doch obwohl klar zu sein scheint, dass die Spatenburger hinter dem Anschlag stecken, hat er keinerlei Beweise dafür.
Vizelin, der in Walburgas Höhle eine Silberader entdeckt hat, fordert Gerold immer wieder auf, mit ihm zum Kaiser nach Italien zu ziehen, um von diesem eine Untersuchung des Falles zu fordern, doch beim Bekanntwerden des Aufrufes Papst Urbans II. entschließt sich Gerold, sich stattdessen dem Kreuzzug zur Befreiung des Heiligen Grabes in Jerusalem anzuschließen.
Um seine Reisekasse aufzufüllen, verkauft er seine Güter an den Grafen von Mansfeld und begibt sich mit Vizelin, Aribo und Wibke im August des Jahres 1096 auf die große Pilgerfahrt Christi nach Jerusalem.
Unterwegs stoßen die Vier schon bald auf eine, von dem Ritter Dankward von Mühlenberg angeführte Schar von Pilgern, die sich ihnen anschließen und Gerolds Befehl unterstellen. Bei Würzburg treffen die Falkenburger mit dem Heer des Herzogs Gottfried von Niederlothringen zusammen und werden in dessen Gefolgschaft aufgenommen.
Während des Marsches entlang der Donau stößt der ostmärkische Ritter Tassilo von Pernstein zu ihnen und in Konstantinopel, das die Kreuzfahrer zu Weihnachten erreichen, wird die Schar Gerolds noch durch den von seiner Familie verstoßenen, griechischen Jüngling Andronikus vergrößert.
Die unvergleichliche Metropole am Bosporus fasziniert die Kreuzfahrer mit ihrer Größe und Pracht, doch nachdem die vielfältigen Ränkespiele zwischen den Anführern des Kreuzzuges und dem byzantinischem Kaiser den Weitermarsch nach Jerusalem immer wieder verzögert haben, sind die Pilger Christi froh, als sie im April 1097 von der kaiserlichen Flotte endlich nach Kleinasien übersetzt werden.
Als der bärtige Mann mit den langen, dunklen Haaren, dem kurz geschorenen Bart und dem weißen Gewand mit seinen zwölf Begleitern den Fuß des großen, von Ölbäumen bewachsenen Berges erreichte, wandte er sich zu den beiden, ihm am nächsten stehenden Gefährten um und sagte: „Geht sogleich in das Dorf, das vor uns liegt, meine Freunde; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Diese sollt ihr mir bringen.“
„Aber wenn uns jemand fragt, mit welchem Recht wir diese Eselin mit uns nehmen, was sollen wir dann tun?“ fragte einer der Beiden.
„Dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen!“
Gehorsam gingen die beiden Männer in das Dorf und als sie das von ihrem Meister angekündigte Grautier fanden, banden sie es los und nahmen es mit. Nachdem sie zu ihren Gefährten zurückgekehrt waren, legte einer von ihnen seinen Mantel über den staubigen Eselsrücken und der Mann im weißen Gewand setzte sich darauf.
Als sie sich wenig später den Toren der Stadt des Tempels näherten, liefen viele Menschen, Frauen und Männer, zusammen und manche von ihnen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, über die die Eselin schritt. Andere schnitten grüne Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.
Die Leute aber, die sich dem Mann im weißen Gewand und seinen Gefährten angeschlossen hatten, riefen aus vollem Halse: „Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna!“
Und die Tore Jerusalems standen offen und die Wachen traten beiseite als der von der Menge geehrte und gefeierte Menschensohn in die Stadt einzog - ohne Waffen und mit friedfertig ausgebreiteten Armen.
Alles tot in Civetot
(7.April 1097- 25. Juni 1097)
Knochen, Knochen, Knochen ...
Ein Feld voller weißer, menschlicher Knochen.
Rings um das ehemalige byzantinische Feldlager Civetot und weiter entlang des Weges der in südlicher Richtung zu dem Engpass führte, in dem Peters und Walters Leute zugrunde gegangen waren, war die Erde von heilen oder zertrümmerten Schädeln, von zerknickten, zerbrochenen Brustkörben und Becken, von zerschlagenen oder zerbissenen Bein - und Armknochen bedeckt.
Knochen von Männern, Frauen und Kindern, wahllos über das Blachfeld verstreut.
Hin und wieder klebten noch einige Hautfetzen und Haarbüschel an den Schädeln, hing noch ein Rest ehemaliger Kleidung an den Skeletten und die eine oder andere Knochenhand hielt noch eine zerbrochene Waffe umklammert.
An dem Ort an dem sie niedergemetzelt worden waren, hatten die Sieger sie liegengelassen, dort war ihr Fleisch den Geiern, den Schakalen und Wildhunden zum Fraß geworden.
Und diese hatten ganze Arbeit geleistet. Keines der Skelette der Erschlagenen war noch vollständig, an vielen der Knochen waren die Bissspuren der Aasfresser zu erkennen.
Bedrückt und von tiefem Mitleid bewegt, knieten die Pilger Christi im Angesicht dieses Ackers des Todes nieder und bekreuzigten sich. Manch einer der hartgesottenen Krieger wischte sich die herabrinnenden Tränen von den stoppligen Wangen, andere murmelten inbrünstige Gebete oder riefen mit klagender Stimme Gott Vater, den Sohn und alle Heiligen um Beistand an.
Doch schnell erwachten in den Kreuzfahrern auch der Zorn und die Rachsucht, und sie begannen, gegen die Mörder ihrer Brüder und Schwestern in Christo heftige Verwünschungen und wilde Drohungen auszustoßen.
Viele von ihnen wären am liebsten sofort weitergezogen, um den verfluchten Sarazenen an die Gurgel zu gehen, doch die Heerführer bewahrten kühlen Kopf und ließen, unweit des großen Gebeinfeldes, das Lager aufschlagen.
Nach der Überquerung des Bosporus waren das Heer Gottfrieds und die kleine byzantinische Abteilung unter General Manuel Butumites von Chalkedon sofort zu dem dreißig Meilen entfernten Feldlager bei Pelekanon weitergezogen. Dort hatten sie zwei Wochen gelagert, bevor sie, der Küste des Marmarameeres folgend, nach Nikomedia weiter marschiert waren. In der verlassenen Stadt hatten die Kreuzfahrer noch einige Hundert versprengte Wallfahrer aus den geschlagenen Haufen des Eremiten und des Habenichts angetroffen und die reichlich entmutigten Männer und Frauen in ihre Reihen aufgenommen.
Als die Heerführer von kaiserlichen Boten benachrichtigt wurden, dass sich das Heer Bohemunds näherte, hatten sie drei Tage in der früheren Kaiserstadt gewartet, bis die Normannenarmee zu ihnen aufgeschlossen hatte. Das Heer stand unter dem Befehl von Bohemunds Neffen Tankred, da der Tarenter noch in Konstantinopel weilte. Gemeinsam waren sie dann um den nikomedischen Meerbusen herum zu dem am südlichen Ufer des schmalen Golfs gelegenen Civetot gezogen, wo sie auf die Spuren der verheerenden Niederlage ihrer Glaubensbrüder gestoßen waren.
Sobald Herzog Gottfried den Befehl zum Aufschlagen des Lagers gegeben hatte, verließen Gerold und Tassilo die Marschkolonne an der Spitze des Heeres und begaben sich eiligst zu ihren Leuten. Als sie nach dem üblichen viertelstündigen Suchen zu dem Lagerplatz kamen, den man den Falkenburgern zugewiesen hatte, musterte der Ritter seine kleine Schar mit aufmerksamen Blicken. Die Knechte waren zwar ob des Grauens, das sie umgab, eine Spur blasser um die Nasen, doch tapfer verbargen sie ihr Entsetzen und stellten eine kaltblütige, männliche Gleichgültigkeit zur Schau.
Die Gesichtsfarbe der drei Frauen dagegen unterschied sich kaum von dem Weiß der sonnengebleichten Knochen. Wibkes Augen schwammen in Tränen, Agnes schlug ein Kreuz nach dem anderen und murmelte leise Gebete dazu und Gesa hielt die Hand auf den Mund gepresst, um sich nicht übergeben zu müssen. Doch da war schon Andronikus bei ihr und legte seinen Arm um sie.
Der Romäer, dessen Miene keinerlei Ängstlichkeit oder Erschütterung zeigte, führte das Mädchen zur Seite und ließ sie sich vor einem der Wagenräder niedersetzen. Dann hockte er sich neben sie, drückte sie an sich, streichelte ihre Wangen, strich ihr über das braune Haar und flüsterte ihr beruhigende Worte ins Ohr.
Nicht zum ersten Mal in diesen Tagen beglückwünschte sich Gerold, dass er den Romäer in seine Schar aufgenommen hatte. Schon bei der Vorbereitung der Einschiffung auf das Transportschiff, mit dem der Falkenburger und seine Gefährten die Meerenge passieren wollten, hatte sich der Jüngling als äußerst nützlich erwiesen. Vor allem, weil er mit seiner Beredsamkeit und seiner erstaunlichen Hartnäckigkeit dafür gesorgt hatte, dass der Kapitän des großen Schiffes auch ihre beiden Wagen samt Ladung und das sonstige Gepäck mit an Bord nahm.
Viele der Wallfahrer Christi hatten auf Zureden der Schiffsführer, die Frachtraum sparen wollten, ihre Wagen und einen Teil ihres Proviants und ihrer Ausrüstung im Lager vor Konstantinopel stehen gelassen. Doch Andronikus hatte dem aus Venedig stammenden Capitano solange in den Ohren gelegen, bis dieser schließlich entnervt nachgegeben hatte.
Zuvor hatte der Bursche - eingedenk seiner Kenntnisse über die Widrigkeiten, die ihnen bei dem bevorstehenden Marsch durch das Innere Kleinasiens vermutlich begegnen würden - dafür gesorgt, dass Gerold nicht nur zwei große Fässer und etliche Wasserschläuche aus Ziegenbälgern, sondern zusätzlich auch noch ein Fass voller süßer, klebriger Datteln erworben hatte, die auch bei großer Hitze nicht so schnell zu verdarben und in den Zeiten der Not als letzte Ration für Mensch und Pferd dienen konnten.
Während sich die Kreuzfahrer bei Civetot zur Nacht einrichteten, trafen die Heerführer im Zelt Herzog Gottfrieds zu einer Beratung zusammen. Der tatendurstige Tankred wäre am liebsten ungesäumt weitergezogen, doch General Butumites widerriet einer solchen Forderung mit dem Hinweis, dass der Weg über das Arganthonion-Gebirge - welchem bereits die Kreuzfahrer Peters und Walters gefolgt waren, und dem nun auch Tankred folgen wollte - für ein so großes Heer wie das ihre nicht passierbar war.
Gewarnt durch den vermeidbaren Untergang ihrer Vorgänger ließ sich Herzog Gottfried von dem in wohlgesetzte Worte gekleideten Rat des Generals überzeugen. Statt sofort aufzubrechen, beschloss er, dreitausend Männer mit Äxten, Hacken und Spaten auszuschicken, die einen von den romäischen Kundschaftern ausgewählten Weg über das Gebirge verbreitern und von wild wucherndem Eichengestrüpp befreien sollten.
Kurz nach den Wegebauern verließ am darauffolgenden Morgen noch eine zweite mit Schaufeln und Hacken ausgerüstete Schar das Lager. Angeführt von sämtlichen Priestern des Heeres zogen die mehr als tausend Kreuzfahrer auf das weitläufige Schlachtfeld und begannen damit, die Überreste ihrer gefallenen Brüder und Schwestern zusammenzutragen und ehrenvoll zu bestatten.
Währenddessen gingen die Arbeiten an der für den Marsch nach Nikäa vorgesehenen Strecke zügig voran. Als die Trasse nach nur zwei Tagen zum größten Teil passierbar gemacht worden war, ließ Gottfried - wiederum auf Anraten von General Butumites – entlang der Straße eine Reihe von großen, hölzernen Kreuzen aufstellen, die den ihnen nachfolgenden Kreuzfahrern als Wegweiser dienen sollten.
Nachdem die Heerführer von den in Richtung Nikäa ausgesandten Spähern die Nachricht erhalten hatten, dass ihre Anwesenheit von den Seldschuken noch unbemerkt geblieben war, ließen sie am Morgen des dritten Tages nach ihrer Ankunft in Civetot zum Aufbruch blasen und begaben sich auf den Marsch durch die vor ihnen aufragenden Berge.
***
Zu der Zeit, in der die Lothringer noch bei Pelekanon lagerten, waren mit Bohemund von Tarent und Raimund von Toulouse zwei weitere Heerführer der Kreuzfahrer in Konstantinopel erschienen, allerdings noch ohne ihre Heere, denen sie vorausgeeilt waren.
Der Normanne und der Okzitanier wurden von Alexios I. ehrenvoll empfangen und standesgemäß untergebracht. Doch als der Kaiser von ihnen die Huldigung und den Lehnseid verlangte, erhielt er von Raimund eine strikte Abfuhr, wie zuvor schon von Gottfried, Balduin und Hugo de Vermandois.
Anders jedoch als bei Gottfried von Lothringen war die Verweigerung des Herrn von St. Gilles weniger einer von ihm tief empfundenen Abneigung gegenüber dem Basileos, als vielmehr einem tiefen Misstrauen gegenüber den geheimen und offenen Vorhaben Bohemunds geschuldet.
Der Tarenter und seine Normannen, die vor Jahren noch Krieg gegen den Kaiser geführt hatten, hatten während ihres Marsches durch byzantinisches Gebiet gegenüber den Romäern bis dahin ein weitgehend untadeliges Verhalten an Tag gelegt. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, enthielten sich die Krieger Bohemunds, jeglicher Übergriffe und Plünderungen und suchten auch keine gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den byzantinischen Truppen.
Dies war zuallererst den eindeutigen Befehlen des Tarenters zu verdanken, dem sehr an einem guten Verhältnis zu Alexios I. gelegen war, da er insgeheim die Absicht verfolgte, vom Kaiser zum Oberbefehlshaber des ganzen Feldzuges ernannt zu werden. So leistete er dem Komnenen dann auch ohne zu zögern den Lehnseid und zeigte sich bei dem sich daran anschließenden Gastmahl so liebenswürdig und weltgewandt, dass selbst die Kaisertochter Anna Porphyrogeneta in ein heimliches Schwärmen für der rauen Kriegsmann geriet.
Als der Normanne jedoch am Tag darauf von Alexios zu einem Gespräch unter vier Augen eingeladen wurde, ließ er nun schon reichlich unverblümt durchblicken, dass er sich für den einzig geeigneten Mann hielte, der den bevorstehenden Kriegszug zum Erfolg führen könnte, und dass er vom Autokrator Christi erwarte, zum obersten Anführer aller Kreuzfahrer ernannt zu werden.
Der Kaiser jedoch misstraute dem ehrgeizigen Normannen und hielt ihn mit allerlei Ausflüchten hin. Dennoch verbreitete sich in Konstantinopel bereits das Gerücht, dass der Normanne aus dem Süden Italiens vom Imperator in dem anstehenden Krieg mit den Seldschuken eine hohe Befehlsstelle erhalten sollte.
Raimund, der sich als Kreuzfahrer der ersten Stunde und mit dem päpstlichen Legaten Adhemar von Le Puy an seiner Seite jedoch selbst schon als legitimen obersten Anführer der Wallfahrt Christi sah, hegte für den Fall, dass sich die ihm zu Ohren gekommenen Gerüchte bewahrheiteten, die Befürchtung, dass er nach geleistetem Lehnseid unter die Befehlsgewalt des Normannen geriet. Da er einen solchen Tort jedoch unter allen Umständen zu vermeiden trachtete, verschloss er seine Ohren vor allen Versuchen, ihn zur Eidesleistung zu überreden.
Nachdem alle Beredsamkeit der kaiserlichen Räte ergebnislos geblieben war, wurden selbst Gottfried und Balduin für kurze Zeit nach Konstantinopel zurückgeholt, um den Grafen von Toulouse umzustimmen.
Doch der sträubte sich weiter, bis er in einer intimen Unterredung mit dem Kaiser von diesem höchstselbst erfuhr, dass der Basileos zu keiner Zeit ernsthaft eine Erhöhung des Normannen über die anderen Kreuzfahrerfürsten in Erwägung gezogen hatte.
Um auch noch die letzten Befürchtungen des Grafen zu zerstreuen, erfanden die kaiserlichen Räte für den Herrn von St. Gilles eine Eidesformel, die nicht mehr von ihm verlangte, als Leben und Ehre des Kaisers zu achten und nichts zu unternehmen, was ihm zum Schaden gereichen könnte. Da er damit keine Unterstellung unter den Befehl Bohemunds von Tarent mehr zu fürchten brauchte, gab Raimund nun endlich seinen Widerstand auf und leistete dem Kaiser den geforderten Treueid.
Sobald seine zahlreichen Ritter, Knappen und Knechte vor Konstantinopel eingetroffen waren, ließ er sich mit ihnen gemeinsam nach Asien übersetzen, um sich den gegen Nikäa marschierenden Kreuzfahrern anzuschließen.
Einige Tage später trafen als letzte der ausgezogenen Fürsten nun auch Robert von Flandern, Stephan von Blois und Robert Kurzhose mit ihren Flamen, Nordfranzosen und Normannen in Konstantinopel ein.
Anders als Gottfried und Raimund schworen die drei Heerführer sofort, und ohne zu zögern oder zu feilschen, den geforderten Lehnseid und huldigten dem Kaiser als ihrem Herrn. Und Alexios, der froh darüber war, endlich einmal einigen verständigen, keinen Ärger machenden Franken zu begegnen, beschenkte sie noch reicher als ihre Vorgänger und lud sie mehrmals zu sich in den Palast ein.
Nachdem die drei Fürsten zwei Wochen lang ausgiebig dem byzantinischen Wohlleben gefrönt hatten, ließen auch sie sich schließlich mit ihren Heeren nach Bithynien übersetzen.
Kurz nach ihnen kam auch der Kaiser höchst selbst über das Meer, doch er blieb mit seiner Waräger-Garde in Pelekanon zurück, wo er sein vorläufiges Hauptquartier einrichtete.
***
Der grauschuppige Lindwurm des christlichen Heeres wand sich auf dem von sechstausend fleißigen Händen vorbereiteten Weg über die bithynischen Berge. Die hoch in einem wolkenlosen Himmel stehende Sonne warf ihre Strahlen wie Speere auf die Krieger Christi herab und ließ ihre Waffen und Helme blitzen.
Die eisenbeschlagenen Hufe der Ritterpferde schlugen Wolken von Staub aus dem trockenen Boden und das laute, die vorwärts strebenden Kolonnen begleitende Poltern, Scharren, Rasseln und Klappern sowie das Rufen und Wiehern von Mensch und Tier ließen die neugierigen Schakale erschreckt Zuflucht in Höhlen und versteckten Schluchten suchen. Unter Ausnutzung des die Nacht erhellenden, silbernen Mondlichts marschierten die Kreuzfahrer auch nach dem Einbruch der Abenddämmerung ungesäumt weiter, nur einige kurze Ruhepausen gönnten die Anführer ihren Männern, bevor am Vormittag des kommenden Tages der Abstieg des Heeres von den Bergen in das kleine, fruchtbare Tal von Nikäa begann.
Die gut dreißig römische Meilen von der Küste des Marmarameeres entfernt gelegene Hauptstadt des Seldschuken-Sultans Kilidsch Arslan, erhob sich auf einem flachen Gelände am östlichen Ufer des Askan-Sees. Sie war stark befestigt. Ihre, ein unregelmäßiges Fünfeck bildenden Umfassungsmauern, waren vier Meilen lang und mit zweihundertvierzig viereckigen oder halbrunden Wachtürmen besetzt.
Im Osten lehnte sich die Stadt an einen steilen, kahl geschlagenen Berg, im Westen erhoben sich ihre hohen Mauern geradewegs aus dem seichten, saphierblauen Wasser des Askanischen Sees.
Außer im Osten besaß Nikäa auch im Norden und im Süden je ein großes, von Bastionen flankiertes Tor. Von dem letzteren nahm die uralte Straße ihren Anfang, die bis zu dem fast siebenhundert Meilen entfernten Antiochia führte.
Begleitet vom Klang der Trompeten und Hörner und dem drängenden Rhythmus der Trommeln wälzten sich die ehernen Kohorten der Kreuzfahrer wie eine unaufhaltsame Lawine in das vor ihnen liegende, grüne Tal und nahmen ihre schon auf dem letzten Kriegsrat in Civetot festgelegten Stellungen ein.
Die Lothringer und Rheinländer unter der Fahne Gottfrieds von Bouillon sowie die Romäer des Generals Butumites richteten ihr Lager vor der Nordmauer Nikäas ein, die Normannen Tankreds schlugen ihre Zelte vor der Ostmauer auf. Der noch unbesetzt gebliebene Abschnitt vor der südlichen Stadtmauer sollte von dem Heer, das von Herrn Raimund von Toulouse und dem Bischof Adhemar von Le Puy angeführt wurde, gesichert werden, sobald dieses eingetroffen war.
Von den byzantinischen Spionen wussten die Heerführer, dass sich der Sultan Kilidsch Arslan viele Tagesmärsche entfernt im Osten aufhielt, wo er sich mit einem benachbarten Fürsten um den Besitz einer Stadt namens Melitene stritt. Nach seinem leichten Sieg über die Männer Peters und Walters nahm der Sultan die Bedrohung durch die Kreuzträger offensichtlich auf die leichte Schulter.
So hatte er sogar seine Hauptfrau und seine Kinder sowie den größten Teil seines Staatsschatzes in Nikäas zurückgelassen.
Was für ein Akt unverzeihlichen Leichtsinns!
Dass sich hinter den ockerfarbenen Mauern, auf denen die Köpfe und die Lanzen vieler Verteidiger zu erkennen waren, all die märchenhaften Schätze des Heidenherrschers befanden, sprach sich bei den einfachen Wallfahrern Christi schneller herum als eine Marienerscheinung.
Die Anführer des Heeres sahen dies nicht ohne Zufriedenheit, wussten sie doch, dass sich die Aussicht auf eine erkleckliche Beute noch nie lähmend auf den Tatendrang von Kriegsleuten ausgewirkt hat. Dabei hätte es durchaus keiner weiteren Anstöße bedurft, um die Kampfeswut der Kreuzfahrer zu befeuern, hatten doch schon allein die wie Nadeln in den Himmel stechenden, schlanken und spitzen Türme, die von den Sarazenen Minarette genannt wurden und von denen die Priester der Sarazenen ihren falschen Gott und ihren noch viel »falscheren « Propheten anriefen, die Christen in eine kaum zu zügelnde Angriffslust versetzt. Als dann auch noch das weit schallende Rufen der Muezzins bis in das Christenlager drang, waren die Männer kaum noch zu halten.
Viele der Kreuzfahrer stürmten ungeachtet der sarazenischen Bogenschützen bis nah an die Stadtmauern heran und Tausende drohend erhobene Fäuste und Waffen wurden gegen die auf den Wehrgängen Nikäas patrouillierenden Muselmänner geschüttelt. Diese jedoch schienen von den wütenden Giaurs wenig beeindruckt, denn sie beantworteten die Drohgebärden der Nazarener mit lautem Gebrüll und obszönen Gesten.
Im Angesicht solcher frechen Herausforderungen brauchte es schon einige Zeit, bis sich die Gemüter der zornigen Christen wieder beruhigten. Dazu trug auch die Erkenntnis bei, dass sie, so ganz ohne Leitern und ohne Belagerungsgerät, den Höllenhunden da oben nicht wirklich beikommen konnten. So kehrten die Männer schließlich wieder zu ihren Zelten zurück und begannen sich auf eine langwierige Belagerung einzurichten.
Gerold, der dem Treiben vor den Mauern aus einiger Entfernung und mit verschränkten Armen zugesehen hatte, wischte sich mit dem Ärmel seines Hemdes den Schweiß von der Stirn. Obwohl der Wonnemond erst einige Tage alt war, herrschte eine Hitze, wie daheim nur an den wärmsten Tagen des Sommers. Zum Glück schwebten einige große Wolken am hellblauen Himmel, die von Zeit zu Zeit die Kraft der Sonne dämpften. Auch wehte von Westen her ein frischer Wind in das Tal.
»Herr Gerold.«
Als der Ritter seinen Namen hörte, wandte er sich um und wäre
beinahe gegen die hinter ihm stehende Agnes gestoßen. Wie so oft während der nun schon zehn Monde andauernden Pilgerfahrt war es der stimmgewaltigen Magd auch hier vor Nikäa gelungen, für ihre kleine Schar einen günstigen Lagerplatz nahe des sanften Abhangs eines Berges zu ergattern, auf dem schattenspendende Pfirsichbäume und Sträucher mit verschiedenfarbigen Blüten wuchsen. Von besonderem Vorteil aber war der unweit der Wagen und Zelte der Falkenburger vorüberfließende Bach, der sein kühles und klares Wasser in den nahegelegenen See ergoss.
Dennoch sah die Köchin, der die schweißgetränkte, rostbraune Cotta an den unvermindert gut ausgeprägten Körperrundungen klebte, mit einer so sorgenvollen Miene drein, dass Gerold nicht umhin kam zu fragen: »Was hast du? Fehlt irgendetwas? «
Die Magd schnaufte und strich sich eine Strähne ihrer schwarzen, etwas fettigen Haare aus dem roten Gesicht. »Noch nicht, Herr, aber schon bald könnte unser Brot knapp werden. Stellt Euch vor, vorhin verlangten die Brotverkäufer schon zehn Denare für einen Laib!«
»Zehn Denare?«, fragte Gerold erstaunt. »Sind diese Halsabschneider denn verrückt geworden?! Wer soll denn solche Preise bezahlen?!«
»Die Preise werden noch steigen«, prophezeite Agnes, »wenn uns der Romäerkaiser nicht bald Nachschub schickt. Wir haben zwar, Gott sei Dank, noch einige Vorräte an Korn und Mehl auf den Wagen und kommen schon noch ein paar Tage zurecht, aber danach ...« Sie hob ihre Schultern und verzog ihr rundes Gesicht zu
einer Miene, die ihre völlige Hilflosigkeit ausdrücken sollte.
»Dann wird uns schon etwas einfallen«, erwiderte der Ritter leichthin und klopfte der Köchin auf die Schulter. »Außerdem hat uns Herr Balduin versprochen, dass mit den Truppen des Grafen aus Toulouse, auch neuer Proviant herangeschafft wird.«
»Geb’s Gott«, brummte Agnes mit einem Gesichtsausdruck, der vermuten ließ, dass sie an den Versprechungen des Boulogners einige Zweifel hegte.
»Das wird er«, schloss Gerold kurzerhand das Gespräch ab, »Das wird er. So, und jetzt geh ich baden. Das solltest du übrigens auch einmal tun.«
»Ihr habt gut reden, junger Herr«, murmelte die Frau, nachdem sich der Falkenburger weit genug entfernt hatte. »Ihr braucht euch ja nicht darum zu kümmern, dass den verfressenen Kerlen jeden Tag ihre Schalen gefüllt werden. Und zum Dank für all meine Mühen, wollt Ihr Euch noch nicht einmal dazu herablassen, eure königliche Lanze in mich zu stecken, um mir wenigstens in der Nacht ein Lützel Spaß zu gewähren. Ach, ihr Heiligen, warum habe ich mich bloß auf dieses Abenteuer eingelassen?!«
Sie schnaubte wie ein Pferd und als sie eine kurze Zeit später bemerkte, dass sich Otto der Dürre, der ewig Hungrige, an dem Fass mit den süßen Datteln zu schaffen machte, da entlud sich ihr aufgestauter Zorn in einem gewaltigen Donnerwetter, welches dem armen Knecht so laut in den Ohren hallte, wie die Posaunen von Jericho.
Reichlich unbelastet von den durchaus berechtigten Sorgen der Köchin hatte Gerold unterdessen mit Tassilo einen Platz am nicht weit entfernten Ufer des Askan-Sees aufgesucht, der von den Pfeilen der Stadtverteidiger nicht zu erreichen war.
Gesa und Andronikus waren bereits dort, doch während von dem Romäer nur noch der Kopf und die winkenden Arme aus dem Wasser schauten, stand das Mädchen mit ihrem grauen, bis zu den Waden reichenden Hemd noch etwas ängstlich auf dem feuchten Ufersand, wo das kühle Nass gerade einmal ihre Füße benetzte.
Schnell und unbefangen legten Gerold und Tassilo ihre Kleider ab und liefen in den See, sodass das flache Uferwasser nur so spritzte. Obwohl das Seewasser einen eigenartigen Geruch verströmte und auch nicht besonders gut schmeckte, lachten und prusteten die beiden Ritter ausgelassen und bespritzten sich gegenseitig wie zwei kleine Kinder.
Erfrischt an Körper und Geist kehrten sie erst zu den Zelten zurück, als die sinkende Sonne die dunkle Silhouette der im Westen aufragenden Berge berührte.
***
Seit der Ankunft der Lothringer und der Normannen vor Nikäa waren einige Tage vergangen. Von den Kreuzfahrern neugierig beäugt, hatten die Byzantiner in einer für die Franken unglaublichen Schnelligkeit aus einem Wirrwarr von mitgeführten Einzelteilen eine große Anzahl von Kriegsmaschinen zusammengebaut und sie vor den Mauern und Toren Nikäas in Stellung gebracht. Nach noch nicht einmal zwei Tagen waren die Ballisten und Katapulte, die gewaltigen Petrariae und die kleinen Skorpione einsatzbereit und die Belagerer begannen damit, die Stadt mit melonengroßen Steinen und mit dickschäftigen Pfeilen zu beschießen.
Die Antwort der Seldschuken ließ nicht lange auf sich warten, und sie erfolgte in gleicher Weise, denn auch auf den Türmen Nikäas standen Wurfmaschinen byzantinischer Bauart. Schon bald gab es auf beiden Seiten die ersten von den Geschossen Getroffenen und das laute Schmerzensgeschrei der Verwundeten mischte sich mit dem Triumphgeheul der erfolgreichen Schützen.
Am zweiten Tag der Beschießung unternahmen die Kreuzfahrer einen plötzlichen Angriff, der sich gegen die Umgebung der Stadttore im Norden und im Osten richtete. Hier hatten die Pilger Christi an mehreren Stellen die Gräben zugeschüttet und Wege für die Rammböcke und die noch im Aufbau befindlichen Belagerungstürme geebnet. Unter dem Schutz von tragbaren, mit nassen Fellen bespannten Dächern drangen die Christen bis an den Fuß der Stadtbefestigungen vor, wo sie damit begannen, mit Brecheisen und Spitzhacken Steine aus der Mauer zu brechen.
Die Seldschuken begegneten dem Ansturm der Franken mit heftigem Widerstand. Sie verschossen ganze Wolken von Pfeilen, warfen Steine und mit eisernen Spitzen versehene Balken auf die Angreifer hinab und gossen große, mit heißem Pech und kochendem Wasser gefüllte Kessel über die bis an die Mauer vorgedrungenen Kreuzträger aus. Wo es ihnen gelungen war, einen der Christen zu töten, da ließen sie an langen Seilen befestigte, eiserne Haken hinunter und versuchten, den Leichnam zum Wehrgang hinaufzuziehen, um ihn auszuplündern. Danach warfen sie den entkleideten, leblosen Körper wieder herab.
Eine gute Stunde lang ließen die Heerführer der Kreuzfahrer ihre Krieger gewähren, dann brachen sie den ohnehin nicht mit besonderem Nachdruck betriebenen Angriff, mit dem sie vor allem die Stärke der sarazenischen Verteidigung hatten prüfen wollen, wieder ab. Sie hatten genug gesehen, um zu wissen, dass sie ohne die Verstärkung durch die Heere aus dem Süden und Norden Frankreichs, der Stadt Kilidsch Arslans nicht habhaft werden konnten.
***
Zuerst hatten reitende Boten die Herannahenden angekündigt, dann war im Norden eine große, gelblichgraue Staubwolke in den hellblauen Himmel gestiegen. Eine halbe Stunde später waren dann auch schon die langen, von den frohlockenden Rufen der Hörner und Posaunen und dem dröhnende Wummern der Trommeln und Pauken begleiteten Kolonnen der Armee des Grafen Raimund aus den Bergen Bithyniens in das Tal von Nikäa herabgestiegen.
Vereint mit vielen anderen lothringischen und normannischen Kreuzfahrern standen auch die Falkenburger am Rand der von Civetot kommenden Straße und begrüßten die Vorbeireitenden mit Jubel und lauten »Deus le volt«-Rufen.
An der Spitze des provencalischen Heeres ritten vier Herren, von denen sich der eine durch seinen Krummstab als Bischof Adhemar und ein zweiter durch seine goldene Rüstung als der romäische General Tatikios kenntlich gemacht hatten.
Dem stolz und gerade im Sattel sitzenden Grafen von Toulouse sah man nicht an, dass er bereits im fünfundsechzigsten Lebensjahr stand. Mit fester Hand hielt er die goldbeschlagenen Zügel seines Schimmelhengtes, und dass sich in das Blond seines langen, welligen Haares schon etwas Grau gemischt hatte, war selbst aus nächster Nähe kaum zu erkennen. Seine große Hakennase und sein scharf blickendes, linkes Auge - das Rechte hatte er im Kampf mit den Mauren in Spanien verloren - gaben seinem Aussehen die Majestät eines Adlers.
Auch der an der Seite des Grafen reitende Bohemund von Tarent war mit seinen vierzig Jahren kein Jüngling mehr. Ähnlich wie der Graf war auch er von einer beachtlichen Körpergröße, dabei schlank und muskulös. Er hatte eine sehr helle Gesichtsfarbe, glatt rasierte, rote Wangen und weißblondes, nach Normannenart kurz gehaltenes Haar. Seine Nase war gerade und sein Kinn kräftig, und seine grünlichgrauen Augen waren in Gemeinschaft mit den schmalen Lippen sowohl in der Lage ein freundliches, ja beinahe sanftmütiges, als auch ein hartes, finsteres Lächeln hervorzubringen, das dem, dem es galt, das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte.
Neben ihm und dem Herrn von St. Gilles wirkten der drahtige, aber bestenfalls mittelgroße Adhemar von Le Puy, und der beleibte Tatikios selbst im Schmuck ihrer Rüstungen und Waffen eher unscheinbar und unbedeutend.
Vor dem in der Mitte des lothringischen Lagers stehenden Zelt des Herrn von Bouillon wurden die Okzitanen von Gottfried und Balduin, dessen Eheweib Godehilde von Tosni, sowie von Tankred und Butumites empfangen und herzlich begrüßt.
Frau Godehilde, eine eher herbe Schönheit, kredenzte den Neuankömmlingen den Begrüßungstrunk mit kühler Würde, nur Bohemund von Tarent, der normannischen Blutes war wie sie selbst, wurde von ihr mit einem kleinen Lächeln bedacht.
Graf Raimund, dessen Gemahlin Elvira sich mit all ihren Frauen und Dienerinnen noch beim Tross befand, dankte mit ausgesuchter Höflichkeit für den ihm bereiteten Empfang und der Bischof von Le Puy segnete die Kreuzfahrer und rief den Beistand sämtlicher Heiligen auf ihre große Unternehmung herab.
Nachdem sich die Heerführer gegenseitig umarmt und den Bruderkuss gegeben hatten, wurden die Okzitanen von Tankred zu dem für sie vorgesehenen Lagerplatz geleitet. Als sie sich diesem aber näherten, sahen die an der Spitze reitenden Kreuzfahrer plötzlich eine gut tausend Mann zählende Abteilung der Seldschuken vor sich, die in die Stadt zu gelangen versuchte.
Die Seldschuken in Nikäa hatten schon vor einigen Tagen Boten zu ihrem Sultan gesandt, der sich zu dieser Zeit noch bei Melitene aufhielt.
Auch jetzt, nachdem er erfahren hatte, dass die Ungläubigen von Pelekanon nach Nikäa aufgebrochen waren, nahm Kilidsch Arslan die Bedrohung durch die Kreuzträger noch immer nicht sonderlich ernst, aber immerhin entsandte er einen größeren Teil seines Heeres nach Westen.
Die vom Statthalter Nikäas ausgeschickten Boten berichteten den Anführern der seldschukischen Krieger, dass sie durch das südliche Tor gefahrlos in die Stadt gelangen könnten, da dort niemand wäre, der ihnen im Weg stünde oder sie angreifen würde. Umso größer jedoch war ihre Überraschung, als sie sich plötzlich ohne Vorwarnung einer ganzen Armee von kampfbereiten Nazarenern gegenübersahen.
Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern schlug Raimund von Toulouse ein Kreuz, zog sein Schwert und stürzte sich an der Spitze seiner Männer ungestüm auf die Feinde.
Von dem Erscheinen der Giaurs völlig überrascht, konnten die meisten der seldschukischen Reiter gerade noch einen Pfeil abschießen, bevor sie von der Wucht der gepanzerten Reiter getroffen und niedergewalzt wurden. Von Lanzen durchbohrt, von Schwertern, Äxten und Keulen niedergeschlagen oder von den großen Ritterpferden der Abendländer zerstampft, blieben fast zweihundert ihrer Krieger auf dem Schlachtfeld, die übrigen wandten sich zu heilloser Flucht.
Dieser erste richtige Sieg über die Sarazenen löste bei den Kreuzfahrern große Begeisterung aus und ließ die Brust des Grafen Raimund vor Stolz schwellen. Er hatte es doch schon immer gewusst, und des Öfteren auch gesagt, dass nur er allein dazu bestimmt sei, die Führung dieses Feldzuges zu übernehmen!
Eine mindestens ebenso große Freude wie der Sieg der Okzitanen, löste bei den Kreuzfahrern jedoch auch die am darauffolgenden Tag vor Nikäa eintreffende, große Proviantkolonne aus, die Kaiser Alexios auf mehrmaliges Drängen Bohemunds von Pelekanon aus in Marsch gesetzt hatte. Wie seit ihrem Aufbruch von Konstantinopel nicht mehr, schwelgten die Wallfahrer Christi im gedankenlosen Wohlleben und schöpften nicht nur aus den bis an den Rand gefüllten Kochkesseln, sondern auch den Fässern und Eimern mit dem griechischen Rotwein kräftig aus dem Vollen.
Nun endlich glätteten sich auch die Sorgenfalten auf Agnes Stirn ein wenig, wenngleich es der Köchin nicht gelang, mit den von den Proviantverteilern ausgegebenen Lebensmitteln, die eigenen, schon tüchtig geschmälerten Vorräte wieder vollständig aufzufüllen. Doch dessen ungeachtet wurde der Abend dieses glücklichen Tages auch von den Falkenburgern zu einer ausgelassenen Siegesfeier genutzt.
Wie all die anderen seiner Gefährten trank auch Gerold nach dem von Agnes stark gewürzten Essen kräftig über den Durst und die Köchin sorgte dafür, dass sein Becher nicht leer wurde. Auch gab sie in den von ihr ausgeschenkten Wein mit zunehmender Tageszeit immer weniger Wasser, so dass die wackeren Mannen aus Sachsen und der Ostmark schon bald in einen tüchtigen Rausch verfielen.
Eine Stunde vor Mitternacht war auch Gerold schließlich so betrunken, dass er der neben ihm sitzenden Agnes zuerst den Arm um die Schultern legte, um ihr dann, kurze Zeit später, kichernd an den fülligen Busen zu grapschen.
Die Augen der Köchin leuchteten auf und als hätte sie nur darauf gewartet, flüsterte sie dem Ritter ins Ohr: »Kommt Herr, ich bringe Euch in Euer Zelt.«
Mit starkem Arm stützte sie den schwankenden Mann auf dem Weg in sein Quartier und setzte ihn dort auf die neben seinem Lager stehende Reisetruhe. Nachdem sie den Eingang des Zeltes sorgfältig geschlossen hatte, kehrte sie zum Feldbett des Falkenburgers zurück und begann, die unordentlich darauf liegenden Decken gerade zu streifen.
Mit halbgeschlossenen Augen betrachtete Gerold den in die Höhe gereckten Hintern der Magd und plötzlich schoss ihm die Begierde so heiß ins Gehirn, dass er sich erhob und von hinten an sie herantrat. Die Frau stöhnte vor Wollust, als er ihr die Cotta über die breiten Hüften streifte und ihr mit der rechten Hand zwischen den Beinen hindurch an ihre Scham und mit der Linken von der Seite her an ihre schwappenden Brüste griff.
Nachdem sie sich selbst ihre Kleider über den Kopf gezerrt hatte, stieß Gerold sie aufs Lager und knetete ihre gewaltigen Pobacken so lange, bis er sich ausreichend erregt hatte. Dann packte er die schwere Hüfte der Köchin und drehte sie auf den Rücken. Willig öffnete sie ihm ihre Schenkel und gleich darauf zeugten sanft schmatzenden Geräusche von den schnellen Bewegungen seines Gliedes in ihrer Scheide.
Tief sog der Ritter den salzigen Schweißgeruch des fleischigen weiblichen Körpers ein und ergötzte sich an dem Keuchen und Stöhnen, welches die Magd unter seinen kräftigen Stößen von sich gab.
Und dann wurden sie beide von einer Welle blutwarmer Wohligkeit überflutet und der heiße Samen des Mannes ergoss sich wie ein Springquell in Agnes Schoß.
***
»Alarm, Alarm«, brüllte Otto der Schieler, als er wie ein von der Tarantel Gestochener in Gerolds Zelt gestürmt kam. »Die Sarazenen greifen an!«
Der Falkenburger fuhr auf und warf die Decke beiseite, womit er auch Agnes nackten Körper entblößte. Seine geröteten Augen vertrugen die so plötzlich in das Zelt dringende Helligkeit nicht, und so tastete er wie ein Blinder nach seinen regellos um das Lager herum verstreuten Sachen.
Während er noch dabei war seine Hosen und sein Hemd überzustreifen, erschien die Hünengestalt Aribos im Zelteingang. Der Riese packte den unausgesetzt und mit offenem Maul auf die unverhüllten Fleischmassen der Köchin starrenden Knecht am Kragen und warf ihn umstandslos aus dem Zelt, dann half er dem allmählich wieder zu sich selbst findenden Ritter seinen Kettenpanzer anzulegen.
Als Gerold gewappnet ins Freie trat, warteten Tassilo, Vizelin und Dankward schon mit den Pferden auf ihn. Die Männer schwangen sich in die Sättel, ließen sich von den Knechten die Lanzen reichen und trabten zur Mitte des Lagers, wo das Zelt des Feldherrn stand. Dort hatte Balduin von Boulogne schon eine Schar von mehreren Dutzend Rittern um sich gesammelt.
»Ihr guten Krieger Christi«, rief der auf einem feurigen Rappen sitzende Graf und schwang sein funkelndes Schwert über dem von einem spitz zulaufenden Helm mit breiter Nasenschiene geschütztem Haupt, »die Sarazenen greifen in großer Zahl unsere okzitanischen Brüder an, wir können nicht warten bis all unsere Mannen kampfbereit sind, wir müssen den Bedrängten sogleich zu Hilfe kommen. Mein Bruder Gottfried folgt uns, so schnell es geht, mit einer weiteren Verstärkung. Und jetzt mir nach! Gott will es! Deus le volt!«
»Deus le volt!«, antworteten die Ritter und Knappen aus voller Kehle.
Der Boulogner setzte sich an die Spitze der kleinen Schar und gab seinem Streitross die Sporen. Die Kreuzritter reihten sich hinter ihm ein und trabten am Rand des normannischen Lagers entlang auf ein freies Feld im Südosten Nikäas zu, wo eine große, von tausenden Pferdehufen aufgewirbelte Staubwolke davon zeugte, dass hier die provencalischen Ritter bereits mit den Sarazenen handgemein geworden waren.
Die kleine Abteilung, die Raimund vor zwei Tagen noch ohne große Mühe in die Flucht geschlagen hatte, war nur die Vorhut der Seldschuken gewesen, der eine weitaus größere Heeresmacht folgte.
Einen Tag lang hatten sich die sarazenischen Heerführer über die erlittene Niederlage und die daraus entstandene Lage beraten, dann hatten sie sich schließlich entschlossen, die in ihren funkelnden Siegessäbel geschlagene Scharte wieder auszuwetzen.
Nachdem sie Allah um Beistand angefleht hatten, griffen sie im Morgengrauen mit all ihren Kriegern an, um die von den verfluchten Nazarenern versperrte Straße nach Nikäa freizukämpfen. Die südfranzösischen Ritter und Sergeanten aber waren auf der Hut gewesen und den Angreifern schnell und in großer Zahl entgegen gestürmt, sodass sich ein heftiges Gefecht entwickelt hatte.
Erfüllt von einem Gefühl, das sich aus Kampfesfreude und ein wenig diffuser Endlichkeitsangst mischte, legte Gerold die Lanze ein und hob den Schild bis zur Höhe der Augen. Seine Blicke suchten die hohe Gestalt Balduins, der sie, flankiert von den Tournay-Brüdern, geradewegs auf das dichteste Kampfgetümmel zuführte.
Der Bruder Herzog Gottfrieds hatte gehofft, die Sarazenen in der Flanke fassen zu können, doch die sarazenischen Befehlshaber bemerkten die von Norden kommenden Feinde noch rechtzeitig und warfen ihnen hastig eine neue, noch nicht im Kampf befindliche Schar ihrer Reiter entgegen.
Die Kreuzfahrer sahen eine dichte Reihe von bunt gekleideten, bärtigen Männern auf kleinen, flinken Pferden auf sich zu stürmen, die statt Lanzen und Schilden große Bögen und Pfeile in den Händen hielten.
In einem erstaunlichen Gleichmaß ihrer Bewegungen hoben die Sarazenen ihre Bögen, zogen die Sehnen mit dem aufgelegten Pfeil bis an die Ohren und ließen einen Hagel von gefiederten Geschossen in genau berechneter Bahn auf die Kreuzträger niedergehen.
Die Christen duckten sich hinter ihre Schilde und beteten darum, dass ihre ungepanzerten Pferde von den schräg von oben auf sie niederfallenden Pfeilen verschont bleiben mögen. Das war alles, was sie zu ihrem Schutz tun konnten.
Begleitet von einem dumpfen Knall wurde Gerolds Schild von einem harten Schlag getroffen, und der Ritter sah mit Erstaunen und Entsetzen zugleich, das die stählerne Pfeilspitze eine Spanne weit durch das Schildholz und das darüber gespannte Leder gedrungen war. Hätte das Geschoss den Schild etwas weiter innen getroffen, dann wäre sein Arm am Schildholz festgenagelt worden.
Doch zum Glück für die Krieger Christi kamen die Sarazenen nicht mehr dazu noch einen zweiten Pfeil abzuschießen, denn schon zwei, drei pochende Herzschläge später trafen die angreifenden Kreuzfahrer auf die seldschukischen Reiter.
Die in prächtige hellblaue, zitronengelbe oder zinnoberrote Gewänder gehüllten Orientalen hatten noch damit zu tun, ihre kostbaren Bögen in die verzierten Futterale zu schieben und hastig nach ihren am Sattel hängenden Rundschilden zu greifen, als sie von den leder – und eisengepanzerten Abendländern wie von einer Lawine überrollt wurden.
Gerold zielte mit der Lanze auf einen der vor ihm auftauchenden Sarazenen und durchbohrte dem einen grausigen, schrillen Schrei ausstoßenden Mann ohne größere Mühe den aus einer großen, runden Metallscheibe bestehenden Brustpanzer.
Von dem seitlich vom Pferd fallende Körper des Getöteten wurde dem Falkenburger der Speer aus der Hand gerissen - schnell griff er nach seinem Schwert, zog es aus der Scheide und wandte sich einem der zahlreich um ihn herum wimmelnden feindlichen Krieger zu.
Den ersten Schlag konnte der Seldschuke mit seinem leicht gekrümmten Schwert noch parieren, doch schon der zweite Hieb des Ritters verbeulte ihm die von einem weißen Turbantuch umwickelte, spitz zulaufende Eisenhaube und ließ ihn im Sattel schwanken. Der dritte Treffer machte ihm endgültig den Garaus.
»Zur Mitte, zur Mitte!« erhob sich die weit hallende Stimme Balduins von Boulogne über den Kampflärm, dessen langes Schwert eine blutige Bresche in die Reihen der Sarazenen schlug.
Nachdem Gerold zwei weitere Feinde niedergestreckt hatte, bekam er etwas Luft und fand die Zeit, sich nach seinen Gefährten umzuschauen. Links von ihm kämpften Dankward und Tassilo, mit wildem Gebrüll und weitausholenden Hieben der Mühlenberger, still und mit eleganten Bewegungen der Pernsteiner. Ein feines, beinahe friedfertiges Lächeln lag auf den Lippen des blonden Ritters, doch seine Schläge erfolgten mit tödlicher Sicherheit. Schon war sein rechter Arm dunkel vom Blut seiner erschlagenen Gegner.
Auf der rechten Seite Gerolds trugen die Seite an Seite kämpfenden Aribo und Vizelin Tod und Verwundung in reichlichem Maße in die Reihen des Feindes. Schon der Anblick des schwarzbärtigen Riesen mit seiner gewaltigen Keule und des Mönches mit seinem über dem Kopf kreisenden Kampfstock genügten, um Angst und Schrecken unter den Kriegern Kilidsch Arslans zu verbreiten.
Ein funkelndes Schwert fuhr auf Gerold nieder, gerade noch rechtzeitig hob er den Schild schützend über den Kopf und fing den harten Schlag ab. Mit einem schnellen, geraden Stoß traf er dem Angreifer in die Kehle und beendete dessen irdisches Dasein. Triumphierend riss der Ritter sein Schwert in die Höhe und sein Mund öffnete sich zu einem heiser krächzenden Schrei. Doch nur einen Augenblick später stellten sich ihm schon die nächsten Gegner in den Weg und er stürzte sich wieder in den Kampf.
»Deus le volt!«
»Christus, Christus …«
»Allah ... Allah ...«
Gerade und gekrümmte Schwerter schlugen klirrend gegeneinander, dumpf klangen die Schläge auf den runden oder blattförmigen Schilden, Pferde wieherten, Verwundete schrien gellend.
Immer tiefer drang der Stoßkeil der lothringischen Ritter in die Front der seldschukischen Krieger ein, teilte sie und warf sie zur Seite, so wie der schnittige Bug eines Schiffes die gegen ihn anbrandenden Wellen zerschneidet. Auch die mit grimmigem Kampfesmut angreifenden Okzitanen hieben mit unverminderten Kräften auf die Sarazenen ein und streckten viele von ihnen nieder.
Die zwischen zwei Feuer geratenen Krieger des Sultans wehrten sich tapfer und hartnäckig, doch als aus dem Lager der Normannen weitere Verstärkungen für die Kreuzträger heranrückten, gaben sie den Kampf endgültig für verloren und flohen auf ihren schnellen Pferden aus der Schlacht. Zurück blieben nur einige wenige, zwischen den Scharen der Lothringer und Okzitanen hoffnungslos eingeschlossene Sarazenen, die nun ihre Waffen wegwarfen und die Arme hoben, um sich den Siegern zu ergeben.
Gerold nahm den Helm ab und ließ seinen Blick über das blutgetränkte Schlachtfeld schweifen. Überall lagen Gefallene und Verwundete - Christen und Muslime - regellos und eng beieinander. Jetzt, da das Getöse des Kampfes verklungen war, drang das Stöhnen, Schreien und Klagen der Verletzten und Sterbenden umso lauter an seine Ohren.
Schon zeigten sich am hellblauen Himmel die ersten Aasvögel, die sich auf ein mehr als reichliches Mahl freuten.
Die normannischen Krieger, die sich mit ihren noch frischen Pferden an die Verfolgung der fliehenden Muslime gemacht hatten, kehrten bald zurück und brachten einige Karren mit, auf denen Hunderte von langen Stricken lagen.
»Damit wollten die ungläubigen Hunde uns fesseln und fortzerren wie unvernünftiges Schlachtvieh!«, lachten die Nachfahren der stolzen Wikinger und warfen rachsüchtige Blicke auf das kleine Häuflein der seldschukischen Gefangenen.
»Über das Schicksal der Sarazenen entscheidet der Rat der Fürsten«, rief Balduin den Normannen zu, die unweit der Stelle, an der man die trotzig dreinblickenden Sarazenen zusammengetrieben hatte, mit dem Grafen von Toulouse und dem Bischof von Le Puy zusammengetroffen waren. »Bis dahin gehören sie Herrn Raimund, dessen Männer die Hauptlast des Kampfes getragen haben!«
Inzwischen hatte Gerold am Rande der Walstatt seine Gefährten um sich versammelt, nur Tassilo fehlte noch. Schon begann der Falkenburger um das Leben seines Freundes zu fürchten, als dieser, unverletzt und mit einem flammendroten Stück Stoff über dem Arm, in aller Ruhe heran geritten kam.
»Was hast du da?«, erkundigte sich Gerold neugierig.
»Eine sarazenische Hose«, antwortete der Pernsteiner freudestrahlend.
»Ich habe sie einem der Gefangenen ausgezogen. Schau nur, wie schön sie im Sonnenlicht glänzt!«
»Eine Hose«, stöhnte Gerold in komischer Verzweiflung, »mein Gott, wir haben hier einen riesigen Sieg über die wilden Heiden errungen, und er hat nichts weiter im Sinn als eine Hose! Oh, Herr und Erlöser, steht uns bei!«
Am Abend saßen Gerold und Tassilo nebeneinander und mit den Rücken an eines der Räder ihres Reisewagens gelehnt und schauten in den sternklaren Himmel. Sie waren allein, die anderen hatten sich schon zur Ruhe begeben. Auch Agnes war im Zelt Dankwards verschwunden, allerdings erst, nachdem der Falkenburger ihre schmachtenden Blicke absichtlich übersehen hatte.
»Wo dort oben wohl die Halle Gottes mit seinem Thron und den Sitzen für die Christenmenschen ist?«, bemerkte Tassilo fast flüsternd, »und das Paradies … ob es sich gleich neben der Halle befindet?«
»Wahrscheinlich befindet sich beides irgendwo hinter den Sternen und dem Mantel der Dunkelheit«, erwiderte Gerold mit einiger Verzögerung.
»Das Paradies muss doch wenigstens so groß sein wie unsere Erde«, setzte der Pernsteiner fort, »denn wenn alle absolvierten Christen dorthin kommen ... und für immer dort bleiben, dann muss es doch riesige Ausmaße haben.«
Gerold schob die Unterlippe vor und hob die Schultern. »Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind es ja zunächst mal nur die Seelen der Rechtgläubigen, die in den Himmel kommen und die, hat mir mal jemand erzählt, sollen ja nur so groß wie eine Taube sein. Die Körper der Menschen werden ja erst am jüngsten Tag wieder auferstehen und dann doch wohl wieder auf der Erde leben.«
»Na das wird ein Gedränge werden«, versetzte Tassilo schmunzelnd. »Stell dir vor, wenn all die Christen aus über tausend Jahren plötzlich alle zugleich auf der Erde sind!«
»Vielleicht macht Gott die Welt dann größer, sodass alle genug Platz haben.«
Der Ritter von Pernstein griff nach seinem Schnurrbart und zwirbelte dessen rechtes Ende mit Daumen und Zeigefinger zu einer recht ansehnlichen Spitze. »Dann wird er das wohl alle paar Jahre wieder machen müssen, denn wenn niemand mehr stirbt und immer neue Kinder geboren werden ...«
»Vielleicht werden ja dann keine Kinder mehr geboren«, meinte Gerold und musste plötzlich an Mathilde denken.
»Meinst du?«, fragte Tassilo erstaunt. »Aber kannst du dir eine Welt, in der alle glücklich sein sollen, vorstellen, in der den Männern die Freude des Zeugens und den Weibern das Glück der Mutterschaft fehlt?«
»Ja, wer weiß«, brummte Gerold, der allmählich müde wurde.
»Wir«, gab der blonde Ritter entschieden zurück, »wir werden es wissen – eines Tages jedenfalls. Denn das ewige Seelenheil ist uns sicher, seitdem wir uns dieser großen christlichen Unternehmung angeschlossen haben.«
»Das ist es«, bestätigte Gerold und gähnte herzhaft, »und jetzt werde ich auch für das Heil meines Körpers sorgen und mich aufs Ohr legen. Nach der letzten Nacht habe ich es bitter nötig.«
***
Nach der Schlacht gegen die Seldschuken hatten sich viele der Kreuzfahrer daran ergötzt, den gefallenen Muslimen die Köpfe abzuschlagen, sie auf Spieße zu stecken und im Lager umher zu tragen. Eine große Zahl der abgehackten Schädel wurde auf Anraten Bohemunds von Tarent auch zu den Wurfmaschinen gebracht und von diesen in die Stadt geschleudert, um unter den Verteidigern Angst zu verbreiten und ihre Widerstandskraft zu schwächen.
Nun, da die Wallfahrer Christi von dem schwer geschlagenen Entsatzheer des Sultans Kilidsch Arslan bis auf weiteres nichts mehr zu befürchten hatten, machten sie sich mit ganzer Kraft daran, die Belagerung Nikäas voran zu treiben.
Seit am Tag der Heiligen Clothilde endlich auch die Heere aus Flandern, der Normandie und der Grafschaft Blois vor Nikäa erschienen waren, konnten auch die letzten Lücken in dem sich hufeisenförmig um die Stadt legenden Belagerungsring der Kreuzfahrer geschlossen werden, womit die Bewohner der Stadt endgültig von jeglicher Zufuhr über Land abgeschnitten waren.
In ihrem Lager im Süden Nikäas beratschlagten derweilen der ruhmsüchtige Graf Raimund und der Bischof Adhemar darüber, ob, und wie sie den geradewegs vor ihrer Nase aufragenden Gonates-Turm zum Einsturz bringen könnten.
Verborgen unter einem Schutzdach und gedeckt von ein paar Dutzend Bogenschützen und Schleuderern gruben sich eine Handvoll furchtloser Männer aus der Gascogne bis unter die Fundamente des Turmes. Die mit Keilhauen und Brecheisen in die Mauer geschlagene Bresche stützten sie sorgfältig mit Balken und Bohlen ab und füllten sie mit Holzscheiten, trockenem Reisig und ölgetränktem Werg vollständig aus. Sobald sie ihr Werk vollendet hatten, ließen sie sich eine Fackel reichen und setzten die von ihnen eingebrachte Mauerfüllung in Brand. Die Flammen loderten mächtig empor und wie ein dunkler Mantel umhüllte grauschwarzer Rauch den Turm bis hinauf zu den Zinnen.
Das Feuer, das allen Löschversuchen der Seldschuken zum Trotz, bis weit in den Abend hinein brannte, erhitzte und zermürbte das sich unmittelbar um den Durchbruch herum befindliche Mauerwerk so sehr, dass es dem Druck der über ihm lastenden Ziegelschichten nicht mehr standhalten konnte und zusammenbrach, wodurch eine Bresche entstand, die groß genug war, um durch sie in die Stadt einzudringen.
Unter den Okzitanen erhob sich lauter Jubel, doch da es bereits zu dunkel geworden war, um mit den Verteidigern zu kämpfen, hielten Raimund und Adhemar ihre Krieger von einem sofortigen Angriff zurück und verschoben die Erstürmung der Stadt auf den kommenden Morgen. Doch wie erstaunt und verärgert waren sie, als sie bei Sonnenaufgang erkennen mussten, dass die gottlosen und unritterlichen Sarazenen über Nacht die Bresche wieder vollständig ausgefüllt hatten!
»Dabei hat ihnen der Teufel geholfen«, rief Graf Raimund und machte sich bittere Vorwürfe, dass er den Befehl zum Sturmangriff nicht noch am vergangenen Abend gegeben hatte. Wider besseres Wissen hatte er diesen ungläubigen Geschöpfen des Teufels ein gewisses Maß an Ritterlichkeit zugestanden, hatte erwartet, dass die Heiden, so wie es die Regeln im Kriege geboten, bis zum Morgengrauen stillhalten und sich dann den tapferen Streitern Christi zum ehrlichem Kampf stellen würden. Nun war er von den elenden Sarazenen auf schnöde Weise eines Schlechteren belehrt und zum Narren gehalten worden.
Doch nicht nur bei den Okzitanen machte die Belagerung keine rechten Fortschritte. Der Beschuss der dicken Mauern mit den romäischen Kriegsmaschinen hatte bisher nur wenig Wirkung hinterlassen und für jeden von Pfeilen, Speeren oder Steinkugeln getroffenen Sarazenen stand schon wenige Augenblicke später ein neuer Verteidiger auf dem Wehrgang. Darüber hinaus mussten die Anführer der Krieger Christi feststellen, dass auch die Blockade Nikäas eine noch nicht bedachte Schwachstelle aufwies.
Schon mehrmals in mondhellen Nächten hatten die Wachen der Kreuzfahrer beobachtet, wie schwarz gestrichene und mit schwarzen Segeln versehene Boote über den Askanius-See bis an die Stadtmauer heranfuhren und den Belagerten Nahrung und Futter brachten, die diese durch kleine, versteckte Mauerpforten in die Stadt holten.
Da die Aushungerung Nikäas unter solchen Umständen ergebnislos bleiben musste, kamen die Heerführer zum Kriegsrat zusammen und beschlossen schweren Herzens, den von ihnen wenig geliebten Kaiser um die Lieferung von einigen Schiffen zu bitten. Der Autokrator Christi, der in Pelekanon den Fortgang der Ereignisse verfolgte, kam der Bitte der Franken unverzüglich nach und ließ gut ein Dutzend Boote, von denen ein jedes bis zu hundertfünfzig Männer aufnehmen konnte, mit Hilfe von Ochsen und Seilen von Civetot aus über die Berge nach Nikäa schaffen.
Nach einem sechstägigen Marsch erreichte der von einer starken Abteilung Turkopolen begleitete Wagenzug gegen Mittag den Askanischen See, doch die Kaiserlichen warteten mit dem zu Wasser lassen der Boote noch bis zum Einbruch der Nacht. Erst als sich eine alles verhüllende Dunkelheit über das Tal von Nikäa gelegt hatte, setzten sie ihre Wasserfahrzeuge in aller Stille auf dem See aus und bemannten sie mit den gut ausgerüsteten Turkopolen.
Bei Tagesanbruch segelten die Boote auf die Stadt zu und warfen außerhalb der Reichweite der sarazenischen Wurfmaschinen Anker. Als die Seldschuken die byzantinischen Wimpel an den Mastspitzen erkannten, begriffen sie, dass sie nun endgültig von jedweder Hilfe von außen abgeschnitten waren und einer lähmenden Krankheit gleich, begann sich eine große Hoffnungslosigkeit unter ihnen breitzumachen.
Am selben Tag wie die kleine Flotte waren im Lager der Kreuzfahrer auch zweitausend leichtbewaffnete Fußkrieger der byzantinischen Armee eingetroffen, die unter dem Befehl des Generals Tatikios standen.
Der General hatte in einem früheren Gefecht seine Nasenspitze verloren und diese durch eine goldene Nachbildung ersetzt, sodass man ihn allgemein General Goldnase nannte. Nach einem kurzen Kriegsrat mit den Anführern der Abendländer schloss sich das byzantinische Korps dem Heer des Grafen Raimund an und bezog vor dem Gonates-Turm Stellung, auf den viele der Pilger Christi ob seines schnellen nächtlichen Wiederaufbaus, welcher nur mit der Hilfe unholder Mächte hatte ausgeführt werden können, mit Argwohn sahen.
Nachdem die Stadt nun zu Land und zu Wasser vollständig umschlossen war, rieten die romäischen Generäle Butumites und Tatikios den Heerführern der Christen, für den nächsten Tag einen großen Sturmangriff zu befehlen, da den Verteidigern der Schreck über das Erscheinen der kaiserlichen Boote noch in den Gliedern und Köpfen stecken, und sie bei einem entschlossenen Vorgehen der Franken schon bald die Waffen strecken würden. Die Versammlung der christlichen Fürsten, denen ohnehin die vor Nikäa verbrachte Zeit allmählich lang geworden war, stimmte begeistert zu und gab noch zur selben Stunde den Angriffsbefehl an ihre Krieger weiter.
Am nächsten Morgen, am Tag der Sommersonnenwende, ist das ganze christliche Heer auf den Beinen. Fanfaren schmettern, Trompeten erschallen, Hörner rufen, Trommeln und Pauken werden geschlagen und aus tausenden rauen Männerkehlen erschallt ein wildes, bis hinauf zu den Wehrgängen Nikäas dringendes Kriegsgeschrei.
»Gott will es, Deus le volt, Christus vincit, Heiliges Grab, Jerusalem ...«
Glühend vor Kampfeseifer und von einem ungeheuren Siegeswillen beseelt, fiebern die in tiefgestaffelten Sturmkolonnen versammelten Krieger Christi dem unmittelbar bevorstehenden Angriff entgegen.
Dann endlich ist es soweit.
Sämtliche Wurfmaschinen der Kreuzfahrer und Byzantiner, alle Katapulte, Ballisten, Trebuchets und Skorpione werden zugleich abgeschossen, Steine groß wie Melonen schlagen gegen die Mauerkronen, Pfeilgeschosse zischen, Tontöpfe, gefüllt mit Kalk, der den Verteidigern die Augen verätzen soll, zerplatzen mit lautem Krachen.
Gegen jedes Tor Nikäas werden Rammböcke in Bewegung gesetzt. Von kräftigen Armen geschoben, nähern sich ein halbes Dutzend Belagerungstürme den Mauern, gefolgt von Hunderten zu Fuß gehender Ritter und Knappen. Ein Wald von Sturmleitern wogt auf die Stadtbefestigungen zu, und über sie hinweg steigen Wolken von Pfeilen zu den Wehrgängen hinauf.
Nur einige der Angreifer bemerken in ihrem Eifer, dass die Wehrgänge der Stadt heute seltsam dünn besetzt sind, dass ihnen keine Steine, Pfeile, Speere oder brennende Pechkränze entgegen geflogen kommen, und diese Wenigen schreiben das feige Verhalten der Sarazenen deren panischer Angst vor ihrem unaufhaltsamen Sturmlauf zu und ihre Siegeszuversicht sprengt alle Grenzen.
Doch dann geschieht etwas Unfassbares!
Gerade in dem Augenblick, in dem sich die ersten Leitern an die Mauern lehnen und die ersten Rammstöße gegen die eisenbeschlagenen Stadttore donnern, stehen plötzlich der General Butumites und andere romäische Offiziere auf den Mauern Nikäas und schwenken die roten Banner mit den goldenen Byzantinerkreuzen über ihren Köpfen, zum Zeichen, dass die Sarazenen die Stadt dem glorreichen Autokrator Christi Alexios Komnenos übergeben haben.
»Verrat!« brüllen Tausende lothringische, flämische, okzitanische, normannische und fränkische Kehlen in ihrer Sprache.
»Verrat!« brüllen auch Gerold, Tassilo, Dankward und ihre Knechte.
»Verrat!« brüllen nun auch die von den Byzantinern übertölpelten Fürsten.
»Diese elenden Romäer«, schreien Gottfried, Raimund und Tankred wie im Chor, »diese verräterischen Hunde, diese hinterhältigen Schweine!«
Nur die weitsichtigsten unter den Anführern, wie Bohemund und Balduin von Boulogne, begreifen sofort, was geschehen ist.