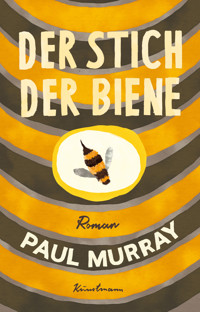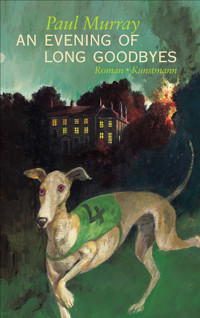19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hat Claude Martingale gehofft, er könne seinem Leben als Banker durch seinen Umzug von Paris nach Dublin die ersehnte Wende geben? Sein neuer Job in der aufstrebenden Bank von Torabundo raubt ihm jedenfalls schnell jegliche Illusion. Auch hier verbringt er, wie alle seine Kollegen, seine Tage und Nächte einzig im Dienste des Geldes. In diese lähmende Eintönigkeit platzt der Schriftsteller Paul, der, auf der Suche nach neuem Stoff, Claude zu seinem modernen Jedermann erkoren hat, zum Helden seines künftigen literarischen Meisterwerks. Unter Pauls höchst erfindungsreichem Einfluss wird Claudes Leben tatsächlich aufregender, besonders als die schöne griechische Kellnerin Ariadne ins Geschehen tritt. Doch Paul treibt ein doppeltes Spiel, und auch die Bank von Torabundo erweist sich als weniger ehrenwert als erhofft: zwielichtige Übernahmen, dubioser Derivatehandel und eine neue Unternehmensstrategie, die sich »kontraintuitives Handeln« nennt – kann das alles gut gehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Der gute Banker ist ein mitreißender Roman, eine hochkomische Betrachtung der Betrügereien, die im Namen der Kunst, der Liebe und des Kommerz geschehen – und wahrscheinlich der lustigste Roman, der über die andauernde Finanzkrise geschrieben wurde.
Hat Claude Martingale gehofft, er könne seinem Leben als Banker durch seinen Umzug von Paris nach Dublin die ersehnte Wende geben? Sein neuer Job in der aufstrebenden Bank von Torabundo raubt ihm jedenfalls schnell jegliche Illusion. Auch hier verbringt er, wie alle seine Kollegen, seine Tage und Nächte einzig im Dienste des Geldes. In diese lähmende Eintönigkeit platzt der Schriftsteller Paul, der, auf der Suche nach neuem Stoff, Claude zu seinem modernen Jedermann erkoren hat, zum Helden seines künftigen literarischen Meisterwerks. Unter Pauls höchst erfindungsreichem Einfluss wird Claudes Leben tatsächlich aufregender, besonders als die schöne griechische Kellnerin Ariadne ins Geschehen tritt.
Doch Paul treibt ein doppeltes Spiel, und auch die Bank von Torabundo erweist sich als weniger ehrenwert als erhofft: zwielichtige Übernahmen, dubioser Derivatehandel und eine neue Unternehmensstrategie, die sich »kontraintuitives Handeln« nennt – kann das alles gut gehen?
Über den Autor
Paul Murray, geboren 1975, studierte Englische Literatur und Creative Writing an der University of East Anglia. Danach arbeitete er als Buchhändler. Nach An Evening of Long Goodbyes (2005) und dem Bestseller Skippy stirbt (2011) ist dies sein dritter Roman. Er lebt in Dublin und gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der irischen Literatur.
Paul Murray
Der gute Banker
Roman
Aus dem Englischen vonWolfgang Müller
Verlag Antje Kunstmann
Für meine Mutter und meinen Vater
Inhalt
1 Eine Bootsfahrt
2 In den Abgrund
3 Persona ficta
4 Die Monsterwelle
Danksagungen
IDEE FÜR EINEN ROMAN: Ein Banker raubt seine eigene Bank aus. Er arbeitet allein. Erst deutet alles auf einen klassischen Insider-Job hin. Den Mann kann man allerdings kaum als Insider bezeichnen. Er ist Franzose, kein Ire. Am Anfang könnte man ihn noch für einen typischen Pariser halten – schwarzer Anzug, teure Schuhe, gepflegte, wenn auch etwas lange Haare. Aber im Lauf der Geschichte kommt seine Vergangenheit ans Licht, und wir stellen fest, dass er auch da drüben nie ganz ins Raster passte. Keine Jugend in einem grünen Vorort, keine noble grande école von der Sorte, die Banker normalerweise absolvieren. Stattdessen eine Kindheit in einem heruntergekommenen Viertel, das die Stadt lieber verleugnet. Sein Vater Arbeiter – Schweißer vielleicht, Alt-Achtundsechziger, harter Hund.
Die Familie hat nicht viel. Wegen der prekären Arbeit des Vaters muss die Familie ständig beim Geldverleiher vorstellig werden. Gerichtsvollzieher konfiszieren den Wagen, solche Sachen. Aber der Vater hat ehrgeizige Pläne mit dem Jungen. Er soll es mal besser haben. Also ackert sich der Sohn durch eine drittklassige Schule, schafft es auf eine zweitklassige Uni und bekommt nach seinem Abschluss als Jahrgangsbester ein Jobangebot von einer namhaften französischen Bank. Die Arbeit ist stumpfsinnig, hauptsächlich Ablage und Verwaltung, aber er ist fleißig und schnell und fällt nach ein paar Monaten seinem Abteilungsleiter auf, der ihn fürs Erste der Rechercheabteilung empfiehlt.
Offiziell treibt er als Junior Analyst für die Bank und ihre Kunden Informationen über Unternehmen auf. Tatsächlich verbringt er seine Zeit damit, Papierstaus zu beheben, Kaffee zu holen und sich artig die neuesten sexuellen Eskapaden seines Bosses anzuhören. Wenn er mal zum Arbeiten kommt, stellt er fest, dass ihm die Arbeit gefällt. Noch wichtiger, er macht sie gut. Er beobachtet die Geldströme, lernt, welche geheimen Mächte dabei am Werk sind, beginnt zu begreifen, wie die Rede eines obskuren Politikers in, sagen wir, Guangzhou die Aktienpreise in die Höhe treiben und das Gerücht über eine Änderung des Leitzinses eine weltweite Panik auslösen kann. Stunde um Stunde, von frühmorgens bis spätabends, sitzt er vor seinem kalt glänzenden Bildschirm und entwirft Modelle, überwacht Trades und tüftelt die beste Strategie aus, wie er einen Kunden davon überzeugen kann, dass er und alle seine Mitbewerber den Wert einer Aktie vollkommen falsch einschätzen. Eines Morgens wirft er einen Blick auf seinen Kontostand und stellt fest, dass ihm sein erster Bonus gutgeschrieben wurde: drei Mal so viel, wie sein Vater im ganzen Jahr verdient. Da wusste er, dass er es geschafft hatte.
Aber sein Vater ist nicht glücklich. Er sieht die Erfolgstrophäen seines Sohnes – das Auto, den Anzug, die makellosen Hände – und verachtet sie. Das ergibt keinen Sinn, genau das hatte er doch gewollt! Aber je höher der Junge aufsteigt, desto zorniger wird der alte Mann. Was der Banker auch versucht, um ihn zu beeindrucken, es bewirkt das Gegenteil. Er bringt kleine Geschenke mit nach Hause, der Vater nimmt sie nicht an. Er führt seine Eltern zum Essen aus, der alte Mann rührt nichts an. Sie streiten unablässig. Der Vater beschimpft seinen Sohn für Dinge, für die er nichts kann – die Veränderungen im Viertel, die steigenden Mieten, den gewählten Präsidenten. Er nennt ihn einen Deserteur, einen Verräter. Er schaut seinen Sohn an und sieht den Botschafter einer Welt, die ihn nicht mehr braucht.
Was kann der Banker tun? Will der alte Mann ernsthaft, dass er seinen Job aufgibt? Das wäre doch verrückt, oder? Außerdem mag er seinen Job. Er mag den Reichtum und das Ansehen. Er mag es, eine schöne Wohnung in Auteuil und einen schönen neuen Mercedes zu haben, mit dem er dort vorfahren kann. Er mag das feine Essen im Le Grand Véfour und die feinen Klamotten aus der Rue de Sèvres. Er mag die wunderschönen Mädchen, die ihn ganz plötzlich mögen, und die Mikro-Romanzen zwischen Börsenschluss am Freitagabend und Sieben-Uhr-Sitzung am Montagmorgen. Und wie der Vater, so der Sohn: Die Konfrontation putscht ihn auf. Es wird so schlimm, dass sie sich nicht mal mehr im selben Raum aufhalten können. Nach dem Tod seiner Mutter entscheidet er, dass es reicht. Ein Headhunter ruft ihn wegen einer Stelle bei der Bank von Torabundo an, eine aufstrebende Investmentbank mit Europa-Zentrale in Dublin. Sie wollen einen Analysten, der ihre Kunden im Umgang mit Finanzinstituten im Inland und in Europa berät. Seine Sprachkenntnisse prädestinieren ihn für die Aufgabe. Sie bieten deutlich mehr Gehalt als das, was er in Paris verdient.
Er betrachtet es nicht als Flucht und auch nicht direkt als Bestrafung. Aber es stimmt, der alte Mann muss sich jetzt um sich selbst kümmern. Aber sollen sie jemals eine funktionierende Beziehung haben, dann muss er etwas Kompromissbereitschaft zeigen. Also nimmt der Sohn den Job an und bricht bis auf die monatliche Überweisung für die im Haus wohnende Krankenschwester jeden Kontakt ab. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, will er an Weihnachten nach Paris fliegen, wird aber von der Weltwirtschaftskrise aufgehalten. Er ist zu beschäftigt, er kann nicht weg. Nächstes Weihnachten, denkt er sich, ganz bestimmt. Aber im April ruft ihn die Krankenschwester an und teilt ihm mit, dass der alte Mann im Schlaf gestorben ist.
So ist die Lage zu Beginn unserer Geschichte. Ein paar Monate später: Er ist zurück in Dublin und verbringt seine Tage im Dienst des Geldes. Auch die Nächte. Er hat keine Freunde, keine Hobbys, kein Leben außerhalb der Bank. Er arbeitet so hart, dass er keinen Augenblick für sich selbst hat, oder eher: Ihm fehlt ein Ich für so einen Augenblick. Ein Beobachter würde vielleicht sagen, dass er depressiv ist. Er würde sagen, dass er nur seine Ruhe haben will. Sicher hat er zu diesem Zeitpunkt nicht die Absicht, ein Verbrechen zu begehen.
Aber jetzt kommt’s: Er wird beobachtet. Schon seit ein paar Wochen wird er von jemandem beobachtet, einem Mann ganz in Schwarz. Er macht keine Anstalten, seine Anwesenheit zu verbergen, auch macht er keine Anstalten, mit ihm in Verbindung zu treten. Er ist einfach da. Ein überzähliges Etwas, das dem Bild hinzugefügt ist. Er kommt nie näher, beobachtet einfach, den Blick wie durch ein Zielfernrohr auf den Banker gerichtet. Aber der Banker weiß, dass er jetzt jeden Moment aus der Menge heraustreten und ihn mit seinem Namen ansprechen wird. Und in diesem Augenblick wird sich alles ändern.
Das ist die Konstellation. Was meinen Sie? Kauft mir das einer ab?
1
Eine Bootsfahrt
Als Heilmittel gegen das Leben in der Gesellschaft: die Großstadt. Sie ist für alle Zukunft die einzig begehbare Wüste.
Albert Camus
»CLAUDE?«
»Ja?«
»Was machst du unter deinem Schreibtisch?«
»Ich?«
»Versteckst du dich etwa?«
»Warum sollte ich mich verstecken?«, sage ich. Ich warte noch eine Sekunde und hoffe, dass sie sich damit zufriedengibt, aber ihre Füße rühren sich nicht vom Fleck. »Ich suche meinen Tacker.«
»Oh«, sagt Ish. An einem Knöchel, zwischen dem Lacklederpumps und dem Saum ihres Rocks, baumeln an einer feingliedrigen Kette mehrere kleine Tieranhänger. Auf den fusseligen blauen Teppichfliesen nähert sich ein Paar braune Budapester und bleibt neben Ishs Pumps stehen.
»Was ist los?«, höre ich Jürgen sagen.
»Claude sucht seinen Tacker«, sagt Ish.
»Oh«, sagt Jürgen. Und dann: »Da liegt er doch, mitten auf dem Schreibtisch.«
»Tatsächlich«, sagt Ish. »Claude, dein Tacker liegt auf dem Schreibtisch.«
Ich stehe auf und schaue auf den Punkt, auf den ihr Finger zeigt. »Ah!«, sage ich und versuche ein erfreutes und überraschtes Gesicht zu machen.
»Kommst du mit zum Essen?«, fragt Jürgen. »Wir gehen in den Hippieladen.«
»Ich habe ziemlich viel zu tun«, sage ich.
»Es ist Freitag, Claude, Casual Day«, drängelt Ish. »Du kannst doch am Casual Day nicht am Schreibtisch essen!«
»Ich habe heute Nachmittag noch einen Termin mit Walter.«
»Komm schon, Claude, du kannst doch nicht nur von Carambars leben.« Sie greift nach meinem Arm und zieht daran.
»Okay, okay«, sage ich, greife nach meiner Anzugjacke und tue so, als fiele mir der missbilligende Blick nicht auf, mit dem sie mich mustert.
Zu Hause in Australien hat Ish Anthropologie studiert. Den Casual Day, eins der wenigen Rituale, die wir bei der Bank of Torabundo haben, nimmt sie sehr ernst. Für die meisten Angestellten tun es gebügelte Chinos und vielleicht noch ein geöffneter Hemdkragen, aber Ish trägt ein tief ausgeschittenes, mit Quasten besetztes Top und einen langen, bunten Rock, ebenfalls mit Quasten. Sie hat für den Anlass sogar ihre gebräunte Haut noch etwas aufgepeppt. Das dunkle, speckige Braun sieht aus, als hätte sie sich den Körper mit Pastete eingerieben. Als mir dieses Bild in den Sinn kommt, wird mir sofort übel. Im Lift nach unten hebt und senkt sich mein Magen wie bei einer Achterbahnfahrt. Im günstigsten Fall macht mich der Casual Day übellaunig. Heute treibt er meine Paranoia zu neuen, unguten Höhen.
»Kommt Kevin auch?«, frage ich, um mich abzulenken.
»Er ist schon vorgegangen und versucht einen Tisch zu ergattern«, sagt Ish.
»Am Casual Day ist in dem Laden die Hölle los«, sagt Jürgen. Der Lift hält in jedem Stock und nimmt weitere Leute mit gebügelten Chinos und geöffneten Hemdkragen auf. Sie quetschen sich zu uns und saugen die Luft ab. Von dem Gedränge bekomme ich Herzrasen: Ich bin erleichtert, als ich durch die Doppeltüren des Transaction House hinaus in die frische Luft treten kann – aber nur für einen Augenblick.
Pastellfarbene Wellen identisch gekleideter Menschen ergießen sich von allen Seiten auf die Plaza. Ich scanne die herandrängenden Gesichter, schaue in die nichtssagenden Blicke, die meinem begegnen. Inmitten all der eleganten Lockerheit sollte eine Gestalt in Schwarz leicht auszumachen sein – was aber bedeutet, dass auch ich ein nicht zu übersehendes Ziel bin. Plötzlich steht mir das eingefrorene Bild vor Augen, auf dem er sich durch das Meer aus Leibern drängt wie eine in gesundem Blut schwimmende Krebszelle.
»Ich überlege gerade, ob ich mir ein Bidet anschaffen soll«, sagt Ish.
»Für die neue Wohnung?«, fragt Jürgen.
»Hatte ich am Anfang gar nicht dran gedacht. Aber dann hat der Kerl aus dem Ausstellungsraum angerufen und gemeint, weil ich die komplette Garnitur nehme, könnte er mir ein Bidet zum halben Preis lassen. Die Frage ist, will ich ein Bidet? Eigentlich bin ich ja schon einigermaßen stubenrein.«
»Außerdem will man sich im eigenen Bad nicht wie im Ausland fühlen, oder?«, sagt Jürgen. »Schätze, Claude ist da der Fachmann. Also, Claude, was hat so ein Bidet für Vorteile?«
»Glaubst du, Franzosen mampfen den ganzen Tag nur Baguettes und sitzen auf ihren Bidets rum«, blaffe ich ihn an. Im Freien fällt es mir schwer, meine Nervosität zu verbergen.
Jürgen erzählt Ish von einer speziellen Kloschüssel, die er aus Deutschland hat importieren lassen. Ich schalte seine Stimme stumm und nehme die Suche wieder auf. Über mir kreisen und wirbeln einfarbige Vögel, die aussehen wie Fetzen, die man aus dem wolkenverhangenen Himmel gerissen hat. Wie lange geht das schon so? Eine Woche? Zwei? Also, seit er mir zum ersten Mal aufgefallen ist – obwohl, wenn ich an die Zeit davor denke, scheint er auch schon da gewesen zu sein, ganz unauffällig, am Rand meiner Erinnerungen.
Es gibt kein erkennbares Muster für seine Auftritte. An einem Tag taucht er hier auf, am nächsten woanders. Möglich, dass ich ihn in der Morgendämmerung neben den Trambahngleisen sehe, auf meinem kurzen, synaptischen Gang von der Wohnung zur Bank. Später sitze ich mit Jürgen über einem Verkaufsprospekt, schaue aus dem Fenster und sehe ihn Sonnenblumenkerne kauend auf einer Bank sitzen. Im Feinkostladen, in der Bar, sogar nachts, wenn ich auf meinem Balkon stehe und über den entvölkerten Platz schaue, scheint er immer wieder kurz aufzutauchen, sein leerer Blick das Spiegelbild meines eigenen Blicks.
Die Arche ist jetzt in Sichtweite. Ich kann die hin und her wuselnden Kellnerinnen sehen, Gäste, die essen, sich unterhalten, mit ihren Handys spielen. Von meinem Verfolger keine Spur, doch mit jedem Schritt wächst in mir die grauenhafte Gewissheit, dass er da drin ist. Ich bleibe stehen, meine schweißnassen Lippen beginnen Ausreden zu nuscheln, aber es ist zu spät, die Tür öffnet sich, und eine Gestalt geht schnurstracks auf uns zu …
»Alles voll«, sagt Kevin.
»Mist«, sagt Ish.
»Viertelstunde, dann wird was frei«, sagt Kevin.
Jürgen schaut auf seine Uhr. »Dann hätten wir noch zwölfeinhalb Minuten zum Essen.«
»Tja«, sage ich und stoße einen verlogenen Seufzer aus. »Schätze, dann müssen wir zurück ins …«
»Was ist mit diesem neuen Laden?«, sagt Ish und schnippt mit den Fingern. »Drüben, auf der anderen Seite des Platzes? Wird dir gefallen, Claude, ist französisch.«
Ich zucke mit den Achseln. Solange wir uns von der Arche wegbewegen, bin ich glücklich.
Der »französische Laden« heißt Chomps Elysées. Ein Bild vom Eiffelturm ziert das laminierte Schild, und an den Wänden im Innern hängen Fotografien von Sacré-Cœur und dem Moulin Rouge. Nichts auf der Speisekarte scheint typisch französisch. Ich bestelle einen Moccachino und etwas, das sich »Panini Fromage« nennt. Ich lehne mich zurück und versuche zu entspannen, während unser Trainee Kevin seine Meinung zu Ishs sanitären Optionen zum Besten gibt. Sei vernünftig, sage ich mir: Wer sollte ein Interesse daran haben, dich zu verfolgen? Keiner, lautet die Antwort. Außerhalb meiner Abteilung weiß kein Mensch, dass es mich überhaupt gibt.
Dieser Gedanke muntert mich nicht so auf wie beabsichtigt. Zu allem Übel kommt dann auch noch das Panini Fromage. Es ist nicht so, dass der Käse wirklich schlecht schmeckt, vielmehr schmeckt er nach nichts. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor so intensiv nichts geschmeckt habe. Es ist, als äße ich ein winziges schwarzes Loch, das in einem italienischen Sandwich steckt. Ausgeschlossen, dass man in Paris jemals so schlechtes Essen serviert bekäme, denke ich und verspüre plötzlich einen Stich Heimweh. Wie weit ist es mit mir gekommen! Was habe ich alles zurückgelassen! Und wofür? Mit jedem Bissen spüre ich die Leere in mir aufsteigen, als löschte das Panini wie eine Art Anti-Madeleine direkt vor meinen Augen meine Vergangenheit aus – als würde jede Verbindung gekappt und mir nur dieser graue, nach nichts schmeckende Augenblick bleiben.
Ich gehe zur Theke. Das missmutige Gesicht der Kellnerin erscheint mir authentisch pariserisch, aber als sie den Mund aufmacht, verrät ihr Akzent die proaktivere Feindseligkeit des Slawischen.
»Ja?«, sagt sie und tut erst gar nicht so, als würde sie sich durch mein Auftauchen auch nur um einen Deut weniger langweilen.
»Ich glaube, da ist ein Fehler passiert«, sage ich.
»Panini Fromage«, sagt sie. »Das ist französischer Käse.«
»Das ist kein Käse«, sage ich. »Das ist synthetisch.«
»Synthetisch?«
»Nicht echt.« Ich klappe das Brot auseinander und zeige auf die dicke, grauweiße Scheibe auf dem trübseligen Salatblatt. Sie ähnelt sehr einem nichtssagenden Stück Materie, strukturlos und bleich, der erst Gottes Pinsel eine spezifische Farbe und Form verliehen hat. »Ich komme aus Frankreich«, sage ich, als ob das irgendetwas klärte. »Und das ist kein französischer Käse.
Das Mädchen schaut mich mit unverhohlener Verachtung an. In Restaurants wie diesem sollte man sich nicht beschweren. In Restaurants wie diesem sollte man dem Essen nicht mehr Beachtung schenken als den Straßen, durch die man mit einem Latte macchiato in der Hand zurück zu seinem Computer eilt. Der Bildschirm, das Telefon, das ist die körperlose Welt, die wir in Wahrheit bewohnen. Das International Financial Services Centre ist bloß ein Rahmen dafür, eine Skizze, das Äquivalent zu den Kreidelinien eines Kinderhüpfspiels auf dem Pflaster.
»Sie was andres wollen?« Sie verspottet mich. Ich werde rot, hebe kapitulierend die Hände und drehe mich um.
Erst da bemerke ich den Mann in Schwarz direkt hinter mir.
Das Café kehrt zum Normalbetrieb zurück. Das übellaunige Mädchen boniert das nächste Panini, die Büroangestellten trinken ihre maßgeschneiderten Kaffees. Ich starre zu Ish am Tisch nebenan, aber sie scheint mich nicht zu bemerken – und auch sonst niemand, als hätte der Fremde eine Art Tarnumhang über uns ausgeworfen. Blendend weißes Licht fällt durch die offene Tür herein. Er schaut mich mit furchterregend eisblauen Augen an.
»Claude«, sagt er. Er kennt meinen Namen, natürlich.
»Was wollen Sie von mir?« Ich versuche einen kämpferischen Ton anzuschlagen, aber ich bringe nur ein Flüstern zustande.
»Nur reden«, sagt er.
»Sie haben den Falschen erwischt«, sage ich. »Ich habe nichts getan.«
»Dann sind Sie der Richtige«, sagt er. »Langsam dehnen sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln. »Dann sind Sie genau der Richtige.«
ER HEISST PAUL UND IST SCHRIFTSTELLER. »Ich beschatte Sie für ein Projekt, an dem ich arbeite. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Ihnen aufgefallen war. Hoffentlich habe ich Ihnen keine Angst eingejagt.«
»Ich hatte keine Angst«, lüge ich. »Obwohl man heutzutage schon aufpassen muss. Sind ja jede Menge Leute unterwegs, die auf Banker ziemlich sauer sind.«
»Ich kann mich nur noch mal entschuldigen. Und Ihr Lunch geht natürlich auf mich. Ah, da ist sie ja.« Die Kellnerin taucht auf. Sie ist so dunkelhaarig und freundlich, wie ihr Widerpart in dem falschen französischen Café blond und kühl gewesen ist, und stellt zwei Teller frisch zubereitete Sauerampfersuppe auf den Tisch. Wir sind wieder zurück über die Plaza in die Arche gegangen und haben diesmal einen Tisch gefunden.
»Ich verstehe, warum Sie das Lokal mögen«, sagt er und tunkt ein Stück Brot in die Suppe. »Das Essen ist fantastisch. Und dieser ganze Seemannskram, ich liebe das.« Er nickt zu den Bullaugen und dem großen Anker neben der Tür. »Wie auf einer Bootsfahrt.« Er spitzt die Lippen und bläst auf das Brot. Anscheinend hat er es nicht eilig, mir den Grund unseres Rendezvous mitzuteilen.
»Sie sind also Schriftsteller«, sage ich. »Was schreiben Sie?«
»Vor ein paar Jahren habe ich einen Roman geschrieben«, sagt er. »Der hieß For Love of a Clown.«
Irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt es ganz leise. Irgendein Preis?
»Sie denken an The Clowns of Sorrow von Bimal Banerjee, der den Raytheon gewonnen hat. Mein Roman ist ungefähr zur gleichen Zeit erschienen, Thema ist so ziemlich das Gleiche. Hat sich ganz gut verkauft, aber als ich dann den nächsten anfangen wollte, habe ich festgestellt, dass mir irgendwie die Luft ausgegangen war. Da habe ich mir dann ein paar wirklich harte Fragen gestellt. Was will ich mit dem Roman, welchen Platz in der modernen Welt soll er einnehmen, so was. Lange ging gar nichts, ich steckte fest, es ging keinen Millimeter vorwärts. Und dann, aus heiterem Himmel, war sie da. Die Idee für ein neues Buch, alles, als hätte mir einer ein Baby vor die Tür gelegt.«
»Und worum geht es?«, frage ich höflich.
»Worum es geht?« Paul lächelt. »Tja, es geht um Sie, Claude. Es geht um Sie.«
Ich kann meine Überraschung nicht verbergen. »Um mich?«
»Ich studiere Sie und Ihren Tagesablauf jetzt schon seit einigen Wochen. Mit scheint, als habe Ihr Leben gewisse Werte, als trage es gewisse fundamentale Züge unserer modernen Welt. Wir leben in Zeiten großen Wandels, und ein Mann wie Sie befindet sich genau im Zentrum dieses Wandels.«
»Ich glaube nicht, dass mein Leben ein sehr interessantes Buch abgeben würde«, sage ich. »Ich denke, das kann ich mit einiger Expertise behaupten.«
Er lacht. »In gewisser Weise ist genau das der Punkt. Die Geschichten, die wir in Büchern lesen, was uns als interessant vorgeführt wird … das hat nur sehr wenig mit dem wirklichen Leben von heute zu tun. Ich rede nicht von purem Eskapismus, Vampiren, Serienkillern, versteckten Codes in Gemälden und so weiter. Ich meine die sogenannte ernste Literatur. Ein Junge geht mit seinem emotional volatilen Vater auf die Jagd, eine Frau in Trauer freundet sich mit einem Asylsuchenden an, ein Komponist mit einer seltenen neurologischen Krankheit spaziert in New York herum und denkt über das Wesen von Kunst nach. Menschen schauen auf ihr Leben zurück, Menschen erleben Offenbarungen, Menschen erforschen Sinn. Sinn, das ist die große Sache. In diesen Büchern stolpert wer über einen Felsbrocken und findet darunter den verborgenen Sinn. Jeder steht andauernd an der Schwelle zu einer herzerschütternden Transformation. Und das ist, verzeihen Sie den Ausdruck, Affenscheiße. Der moderne Mensch lebt im Zustand der Zerstreuung. Er hüpft von einer Zerstreuung zur nächsten, und genauso mag er das auch. Er transformiert sich nicht, er hält nicht inne und riecht an der Rose, er sitzt nicht da und erinnert sich langer Abschnitte seiner Kindheit. Herrgott, ich kann mich kaum daran erinnern, was ich vorgestern gemacht habe. Was ich sagen will: die Menschen warten nicht darauf, in irgendeinen unsäglichen Augenblick zurückversetzt zu werden. Sie suchen nicht nach Sinn. Dieses ganze Konzept des Romans, das ist erledigt.«
»Sie wollen also ein sinnfreies Buch schreiben«, sage ich.
»Ich will ein Buch schreiben, das nicht voller Dinge ist, die nur in Büchern vorkommen«, sagt er. »Ich will etwas schreiben, das aufrichtig widerspiegelt, wie wir heute leben. Echtes, tatsächliches Leben, kein Elfenbeinturmgeschwätz, keine Literatur. Wie lebt es sich im einundzwanzigsten Jahrhundert? Diese Stadt, zum Beispiel.« Er macht eine ausladende Geste in Richtung Fenster, zu der anonymen Glasfront des International Financial Services Centre. »Wir sind inmitten Dublins, wo Joyce Ulysses spielen lässt. Aber es sieht nicht aus wie Dublin. Wir könnten in London sein, in Frankfurt oder in Kuala Lumpur. Schauen Sie sich die Menschen an, keiner spricht mit dem anderen, jeder schaut nur auf sein Handy. Und dafür existiert dieser Ort. Es ist ein Ort, um woanders zu sein. Hier zu sein bedeutet, nicht hier zu sein. Das ist das moderne Leben.«
»Verstehe«, sage ich. Was nicht stimmt, zumindest nicht ganz.
»Die Frage lautet also, wie beschreibt man das? Wenn Joyce heute Ulysses schreiben würde, dann würde er nicht über irgendein Kaff im neunzehnten Jahrhundert schreiben, sondern über die Hauptstadt des globalisiertesten Landes der Erde. Wo würde er anfangen? Wer würde sein Bloom sein? Sein Jedermann?«
Er schaut mich unverblümt an, aber ich benötige einen Augenblick, bis ich die Tragweite seiner Worte begreife.
»Sie glauben, ich bin der Jedermann?«
Er macht mit den Händen eine Simsalabim!-Geste.
»Aber ich bin nicht mal Ire«, wende ich ein. »Wie kann ich da Ihr typischer Dubliner sein?«
Er schüttelt heftig den Kopf. »Das ist der Schlüssel. Wie ich gesagt habe, woanders zu sein, darum geht’s hier. Denken Sie nach! Bei Ihrer Arbeit, da haben Sie es doch mit Kollegen von überall zu tun, oder?«
»Das stimmt.«
»Und die Putzkolonnen kommen von überall, und die Kellnerinnen in diesem Restaurant kommen von überall. Das moderne Leben ist eine Zentrifuge. Es schleudert die Menschen in alle Richtungen. Deshalb sind Sie perfekt für das Buch. Der entwurzelte Jedermann, allein, getrennt von Freunden und Familie. Und dann die Arbeit selbst … Sie sind Banker, richtig?«
»Ja, Analyst bei der Bank of Torabundo«, sage ich, bevor mir die Merkwürdigkeit auffällt, dass er das weiß.
»Na also.« Er breitet die Arme aus, um das Selbstverständliche zu unterstreichen. »Ich muss ja wohl kaum sagen, wie repräsentativ das ist. Bis jetzt ist die Geschichte des einundzwanzigsten Jahrhunderts die Geschichte der Banken. Schauen Sie sich das Chaos an, in das sie unser Land gestürzt haben.«
Ich beginne zu verstehen. »Ihr Buch soll also eine Art Enthüllungsstory werden.«
»Nein, nein«, sagt er und fuchtelt mit den Händen herum, als wolle er eine übel riechende Rauchschwade verscheuchen. »Das soll keine Bloßstellung werden. Wegen der Taten einer Minderheit einen ganzen Berufsstand zu verteufeln, das interessiert mich nicht. Ich will die Stereotypen überwinden, die menschliche Seite im Innern der Konzernmaschine entdecken. Ich will zeigen, wie es ist, ein moderner Mensch zu sein. Der hier lebt und nicht auf einem Fischtrawler, in einem Kohlebergwerk oder auf einer Ranch in Wyoming.« Er deutet wieder zum Fenster, und wir drehen uns beide auf unseren Stühlen um und betrachten die netzartige Fensterfront des Finanzzentrums, die nichtssagenden Fassaden der multinationalen Unternehmen. »Dort entsteht das moderne Leben. Wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Alles. Was innerhalb dieses Gebäudes geschieht, definiert unser Leben. Auch wenn uns das nur auffällt, wenn etwas schiefläuft. Die Banken sind wie das Herz, der Maschinenraum, die Welt in der Welt.« Er zeigt wieder auf das Centre. »Was da rauskommt, die Kredite, die Deals, daraus setzt sich unsere Realität zusammen. In Anbetracht dessen, können Sie sich ein besseres Thema für ein Buch vorstellen … als Sie?«
Im Wesentlichen, erklärt er mir, wäre der Ablauf eine intensivere Variante dessen, was er ohnehin schon tut: mir zu folgen, mich aus der Nähe zu beobachten, so konzentriert wie möglich meine Arbeit für die Bank unter die Lupe zu nehmen.
»Und was muss ich tun?«
»Nichts, absolut nichts«, sagt Paul. »Seien Sie einfach Sie selbst. Seien Sie Sie.« Er schaut auf die Rechnung, nimmt einen Schein aus seiner Brieftasche und legt ihn in das Schälchen. »Ich erwarte nicht, dass Sie sich sofort entscheiden. Sich vor jemand vollkommen Fremdem zu entblößen, das ist schon ziemlich viel verlangt. Ich wünschte, ich könnte Ihnen eine stattliche Entlohnung versprechen, aber im Moment kann ich nur mit der zweifelhaften Ehre dienen, Material für ein Buch zu liefern, das vielleicht nie erscheinen wird.« Er grinst mich an. »Aber die Mädchen in Ihrem Büro interessiert es sicher brennend, dass Sie in einem Roman mitspielen, jede Wette.«
»Wie meinen Sie das?«
»Denken Sie nach … Heathcliff, Mr Darcy, sogar Captain Ahab. Die Frauen fahren total auf die ab.«
»Die sind ja auch erfunden«, sage ich langsam.
»Genau. Aber Sie werden echt sein. Verstehen Sie? Sie kriegen das Beste aus beiden Welten.«
Wie um seine Worte zu bekräftigen, schwebt die wunderschöne dunkelhaarige Kellnerin an uns vorbei und lächelt mich an.
Mich schwindelt, es wird wirklich Zeit, dass ich wieder an meinen Schreibtisch komme. Aber da ist immer noch eine Frage, die er nicht beantwortet hat. »Warum ich? Im IFSC arbeiten dreißigtausend Menschen. Warum haben Sie mich ausgesucht?«
»Um ehrlich zu sein, das da hat als Erstes meine Aufmerksamkeit erregt«, sagt er.
»Das? Oh.« Ich begreife, dass er auf meine Jacke zeigt, die ich mir gerade anziehe.
»Das Schwarz fällt wirklich auf, besonders mit der Krawatte. Die meisten hier stehen auf Grau. Ist das was typisch Französisches?«
Ja, sage ich, das ist was typisch Französisches.
»Gibt Ihnen einen literarischen Anstrich«, sagt er. »Und als ich Sie dann aus der Nähe sah, habe ich festgestellt, dass Sie über eine gewisse … tja, ich weiß nicht, eine gewisse Sensibilität verfügen. Ich hatte einfach den Eindruck, dass Sie sich von den anderen unterscheiden. Dass sie nicht nur mechanisch ihr Pensum abspulen. Dass Sie vielleicht auf der Suche nach etwas sind. Schwer zu erklären.« Er reißt ein Stück Papier aus einem kleinen roten Notizbuch und schreibt seine Nummer auf. »Also«, sagt er. »Möglich, dass ich völlig falschliege, aber ich glaube, über den Laden da drüben sollte man ein wirklich bedeutendes Buch schreiben. Und ich glaube, dass Sie der perfekte Mann dafür sind. Wenn Sie warum auch immer ein schlechtes Gefühl dabei haben, dann verspreche ich Ihnen, sofort aus Ihrem Leben zu verschwinden. Aber dürfte ich Sie bitten, wenigstens darüber nachzudenken?«
»Da ist er ja!«, sagt Jürgen, als ich die Rechercheabteilung betrete. »Wir haben schon gedacht, wir müssen ein Suchkommando losschicken.«
»Wohin bist du auf einmal verschwunden«, fragt Ish mit einem Mund voller Büroklammern.
»Nirgendwohin«, sage ich achselzuckend. »Ich hab jemanden getroffen, und wir sind kurz auf einen Kaffee gegangen.«
»Casual Day.« Jürgen schüttelt den Kopf. »Da ist alles möglich.«
Kimberlee vom Empfang kommt herein. »Claude, Ryan Colchis hat angerufen wegen ein paar Zahlen über eine ukrainische Firma, die du für ihn ausgegraben hast.«
»Okay«, sage ich.
»Und Walters Assistentin hat angerufen, dass er später noch vorbeischaut.«
»Wochenende ade«, sagt Ish.
Ich setze mich vor meinen Terminal und starre die Wand aus neuen E-Mails an. Der Schriftsteller und sein seltsamer Vorschlag beginnen schon zu verschwimmen, wie eine jener entfernten und unwirklichen Episoden, die man vielleicht doch nur geträumt hat. Dennoch liegt über den vertrauten Dingen des Büros ein seltsamer Schimmer, sie scheinen irgendwie zu strahlen, wie verwunschene Möbel in einem Märchen, die durch den Raum tänzeln, sobald man ihnen den Rücken zukehrt.
»Habt ihr Claude die Neuigkeit schon erzählt?«, ruft Kevin von seinem Schreibtisch.
»Welche Neuigkeit?«, frage ich mit einem seltsamen Gefühl von … wovon, Gleichzeitigkeit? Als ob mir jemand über die Schulter schaut?
»Blankly ist der neue Boss«, sagt Ish. »Rachaels Büro hat die Nachricht gerade rausgeschickt.«
»Also Blankly«, sage ich. »Sieh mal einer an!«
»Da wird sich einiges ändern, Claude«, sagt Jürgen. »Die Geschichte der Bank of Torabundo fängt wieder ganz von vorn an.«
»Ja«, sage ich. Und dann: »Schätze, ich rufe mal Colchis an.«
»Fühlst du dich besser jetzt?« Ish berührt meinen Arm. »Du hast vorhin ein bisschen unwohl ausgesehen.«
»Ja, geht schon, musste bloß ein bisschen frische Luft schnappen.« Aber sie lässt sich nicht abwimmeln, sie schaut mich weiter durchdringend an.
»Bist du sicher?«, sagt sie. »Du kommst mir irgendwie, ich weiß nicht, verändert vor.«
»Claude verändert sich nie«, sagt Jürgen und klopft mir auf die Schulter. »Claude ist immer der Gleiche.«
»Ja.« Ish rümpft nachdenklich die Nase, und ich wende meine Augen dem Bildschirm zu, als hätte ich ein Geheimnis zu hüten.
WAS ZU DEN ERSTEN DINGEN GEHÖRT, die man im Bankgeschäft lernt, ist das Pareto-Prinzip, auch bekannt als Achtzig-zu-zwanzig-Regel: In allen Lebenbereichen ergeben sich achtzig Prozent der Ergebnisse aus zwanzig Prozent des Aufwandes. So machst du achtzig Prozent deines Profits mit zwanzig Prozent deiner Kunden, achtzig Prozent deines gesellschaftlichen Lebens verbringst du mit zwanzig Prozent deiner Freunde, achtzig Prozent der Musik, die du hörst, stammen von zwanzig Prozent deiner Sammlung, usw. Das Konzept ist die Minimierung der »Grauzone«, die deinen Tag verschlingt, zum Beispiel, die achtzig Prozent deines Lesestoffs, die dir nur zwanzig Prozent deiner Informationen liefern.
Walter Corless ist sich sehr bewusst, auf welcher Seite dieses Prinzips er steht. Er weiß, dass er der reichste und mächtigste Mensch ist, mit dem du je zu tun hattest, und als solcher fordert er 100 Prozent deiner Zeit und Aufmerksamkeit. Ein Treffen mit und sogar ein Anruf von Walter ist wie ein supermassiver Planet, der sich in deinem kleinen Winkel des Universums materialisiert. Er verdunkelt die Sonne und überwindet dein Gravitationsfeld, sodass du nur noch zuschauen kannst, wie die gesamte Struktur deiner Welt auseinanderfliegt und sich um seine Welt herum neu zusammensetzt. Angefangen hat er mit Torf, den er von der Ladefläche eines Pritschenwagens verkauft hat. Dreißig Jahre später ist er Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer eines der größten Bauunternehmen auf den Britischen Inseln. Sogar die weltweite Krise hat ihm nichts anhaben können. Während alle seine Mitkonkurrenten auf Wohnungsbau setzten, investierte Dublex auch in Transport, Logistik, und, am profitabelsten, in Hochsicherheitsprojekte – Militäreinrichtungen, Befestigungsanlagen, Gefängnisse: in Zeiten von Unruhen in Europa und Asien eines der wenigen Wachstumsfelder. Ein nach seiner Tochter benanntes Unternehmen, das Anlagen für erweiterte Verhörtechniken in Weißrussland baut, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Einstellung des Mannes zu seinen Geschäften und zum Leben im Allgemeinen. (Diese Tochter, Lexi, betreibt heute eine Kette von Pflegeheimen, die unter der Hand als Die Abdeckerei bekannt ist.)
Sein Fahrer ruft mich kurz nach sechs an. Ich gehe nach draußen und finde Walters Limousine unter Verletzung aller Vorschriften des Centres auf der Plaza vor dem Transaction House geparkt. Walter sitzt mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücksitz. Ich quetsche mich ihm gegenüber auf den Klappsitz. Schwer durch die Nase atmend starrt er mich an. Er ist ein mürrischer, graugesichtiger Mann, der aussieht, als hätte man ihn aus dem gleichen Sumpfloch gebuddelt wie seine ersten Säcke Torf. Die Zeitungen schreiben von seinem »Tatendrang« und seiner »Fokussierung«, aber das sind Euphemismen. Walter verfügt ganz simpel über die Unbarmherzigkeit des Killers mit den toten Augen, der dir in einem Horrorfilm unerbittlich hinterherstapft und sich weder von Messern, Kugeln oder Flammenwerfern aufhalten lässt. Obwohl sein Vermögen in die Milliarden geht und er Steuerberater in Steueroasen überall auf der Welt beschäftigt, hat er noch immer Spaß daran, seine Schuldner persönlich aufzusuchen, und stecken in seinen Taschen immer noch jede Menge Schecks, Wechsel und mit Gummibändern umwickelte Geldbündel. Manchmal streckt er mir eine Handvoll Bares entgegen und gibt mir Anweisungen, wo ich es investieren soll. Das ist zwar eigentlich nicht meine Aufgabe, aber Walter kümmert es nicht, was meine Aufgabe ist, oder genauer, als unser größter Kunde weiß er, dass meine Aufgabe das ist, was immer er mir aufträgt.
Heute Abend will er meine Meinung über ein Angebot hören. Das Innenministerium des autokratisch regierten Staates Oran im Nahen Osten hat bei Dublex angefragt, ob es das Privatanwesen des Kalifen befestigen könne.
»Rechnen die mit Ärger?«, frage ich.
Walter brummt nur. Er weiß natürlich Bescheid. Spezialisten auf jedem nur denkbaren Gebiet arbeiten für ihn, aber bevor er eine Entscheidung trifft, holt er gern Meinungen von so vielen Seiten wie möglich ein, um, so sagt Ish, die Anzahl der Leute zu erhöhen, die er zusammenscheißen kann, wenn etwas schiefläuft. »Hat der Arsch genug Kohle, das will ich von Ihnen wissen«, sagt er.
»Das Land ist einer der größten Ölproduzenten der Region«, sage ich. »Ich nehme an, er ist kreditwürdig.«
Walter schaut finster. Ich sage, dass ich das überprüfen werde, und er bekundet seine Zustimmung, indem er das Thema wechselt und zur gewohnten Tirade über »Regulierungen« anhebt.
Als wir fertig sind, gehe ich nach Hause, wo ich den geheimnisvollen Schriftsteller endlich genauer unter die Lupe nehmen kann. Im Netz finde ich heraus, dass es den Roman, den er erwähnt hat, For Love of a Clown, tatsächlich gibt. Eine Bildersuche bestätigt mit einem Foto, das ihn zeigt, wie er bei einem gewissen Donard Exotic Fruits and Book Festival einer riesigen Papaya die Hand schüttelt, dass der Autor und der Mann, der mich angesprochen hat, ein und derselbe ist. Seine Apeiron-Seite weist zwei Kundenrezensionen auf, beide negativ: Die erste vergleicht seinen Clown-Roman zu seinen Ungunsten mit Bimal Banerjees The Clowns of Sorrow und bewertet ihn mit zwei Schlangen und einem Kaktus, die zweite gibt gar keine Bewertung ab und besteht einzig aus dem Satz: »Unter keinen Umständen sollten Sie diesem Mann Geld leihen.« Sonst finde ich nichts. Was die übrige Welt in den letzten sieben Jahren angeht, so könnte er genauso gut nicht gelebt haben – was sich mit seiner Aussage deckt, dass ihm irgendwie die Luft ausgegangen sei.
Ich gehe auf den Balkon und versuche den Blick mit den Augen eines Romanschriftstellers schweifen zu lassen. Meine Wohnung liegt im International Financial Services Centre, nur einen Steinwurf von der Bank entfernt. Das Stadtzentrum befindet sich flussaufwärts. Wenn ich mich über das Geländer beuge, dann kann ich den Spire sehen, der wie ein Funkmast aus dem Herz der Dinge in die Dunkelheit ragt. Allerdings kann ich nur an den seltenen Abenden, wenn der Wind in eine ganz bestimmte Richtung weht, die Geräuschkulisse von dort hören, das Kreischen und den Jubel, das Gelächter und die Prügeleien, und auch dann nur ganz schwach wie eine Orgie von Geistern. Wenn nach Einbruch der Dunkelheit nur noch wenige Lichter die dunklen Steinquader der Gebäude besprenkeln, kann man sich bei einem Blick über den verlassenen Platz leicht einbilden, die Welt habe die Einsätze erhöht und sich verdrückt, sei dem Taktstock des Handels gefolgt und habe mich hier allein zurückgelassen.
Vor meiner Ankunft in Dublin wusste ich wenig über die Stadt. Ich hatte eine Ahnung, dass sie für ihre toten Schriftsteller berühmt war. Ich erinnerte mich an den Namen des Flusses, weil wir in der Schule darüber gestritten hatten, ob der Sänger in »How To Disappear Completely« auf der Liffey oder der Lethe dahingetrieben war. Ich hatte vage Vorstellungen von Guinness und Originalität.
Es stellte sich heraus, dass die Stadt ganz anders war, als ich erwartet hatte. An der Uni hatte ich über die virtuelle, die simulierte Welt gelesen, die an unsere Welt grenzt und sie durchdringt – »wirklich, ohne echt zu sein, gegenwärtig, ohne da zu sein«, wie der Philosoph François Texier schreibt. Ich glaubte nicht, dass ich dieses Konzept nach der Uni noch einmal benötigen würde, und nicht im Traum hätte ich gedacht, einmal mittendrin zu leben.
Abgesehen davon herrscht einiger Streit darüber, ob das International Financial Services Centre wirklich ein Teil Dublins ist. Obwohl es nur fünf Gehminuten von der O’Connell Street entfernt liegt, kommen Einheimischen nie hierher. Trotz der Kapitalströme, die jedes Jahr ins Centre fließen, scheinen viele nicht einmal von seiner Existenz zu wissen. Es wurde vor zwanzig Jahren als eine Art Schrittmacher gebaut, ein geniales Stück Finanz- und Rechtstechnologie, eingepflanzt in Dublins tausend Jahre alten Körper. Ein Mischmasch aus plumpen Glasgebäuden, der sich wie ein pygmäenhaftes Manhattan am Fluss entlangzieht, wo sich früher das Hafenviertel befunden hatte. Seine Hauptfunktion ist die eines juristischen Niemandslands: Zur Steuervermeidung transferieren multinationale Konzerne ihr Geld hierher, Banken tätigen hier ihre heikleren Geschäfte mit der Garantie, dass die Behörden ein Auge zudrücken. Viele der Unternehmen verfügen über milliardenschwere Vermögenswerte, aber keinen einzigen Angestellten. Die Lobby des Transaction House ist vollgepflastert mit Namensschildern aus Messing, die alle zu einem einzigen, dauerhaft leeren Büro gehören. Sie nennen das Schattenbankensystem, und das IFSC ist ein Schattenort – ein Alibi, das deine Anwesenheit bescheinigt, wenn du abwesend bist, und deine Anwesenheit leugnet, wenn du unsichtbar bleiben willst.
Konnte man an so einem Ort einen Roman ansiedeln? In einer Stadt, die keine ist? Bevölkert mit Menschen, die dafür bezahlt werden, nicht sie selbst zu sein? Er sagt, er wolle das Menschliche im Innern der Maschine finden, wolle inmitten der goldenen Abstraktionen das Konkrete aufspüren. Er glaubt zu erkennen, dass ich irgendwie anders bin, und ich stehe hier auf dem Balkon und spüre ein Prickeln bei dem Gedanken, dass auch ich das erkennen könnte. Aber was, wenn er falschliegt? Wenn er den Spiegel hochhält und da ist nichts?
Jürgen teilt keine meiner Bedenken. »Ein Schriftsteller?«, sagt er laut, als ich nach der Montagssitzung beiläufig darauf zu sprechen komme. »Ein richtiger Schriftsteller? Und der will über dich ein Buch schreiben?«
»Ja«, sage ich.
»Über dich?«, sagt der Trainee Kevin.
Ich zucke mit den Achseln. »Scheint so, als wäre ich genau sein Mann. So sagt man doch, oder?« (Tatsächlich weiß ich ganz genau, dass man das so sagt.)
»Glaubst du, dass wir da auch vorkommen?«
»Keine Ahnung«, sage ich. »Ich werde ihn fragen.«
»Hört sich ein bisschen schräg an, findest du nicht?« Ish ist zurückhaltender. »Irgendein Kerl folgt dir überallhin und schreibt alles auf, was du tust?«
»Schräg ist, dass das nicht schon früher jemandem eingefallen ist«, sagt Kevin. »Genau genommen sollten eigentlich viel mehr Schriftsteller über Banken schreiben.«
»Aber er will uns nicht fertigmachen, oder?«, sagt Ish. »Dass wir alle nur Wichser und Geldsäcke sind, so was?«
»Er hat gesagt, dass er einen ausgewogenen Bericht über das Leben in einer modernen Investmentbank schreiben will. Er sagt, er will unsere verborgene Menschlichkeit aufspüren.«
»Wird auch Zeit, dass die Kunstwelt die Banker zur Kenntnis nimmt«, sagt Jürgen. »Angesichts der Tatsache, dass wir derzeit die meiste Kunst kaufen, ist es schon frustrierend, von ihr dauernd falsch dargestellt zu werden.«
»Dann machst du also mit?«, fragt Ish.
»Ich weiß noch nicht.«
»Du musst!«, protestiert Kevin. »Wenn du es nicht machst, mache ich es. Das kannst du ihm sagen.«
»Als dein Vorgesetzter, Claude, rate ich dir zu«, sagt Jürgen. »Aber die endgültige Entscheidung liegt natürlich bei dir.«
Während ich noch überlege, fügt er hinzu, dass er »den Stein schon mal ins Rollen bringen« und die Sache kurz bei Rachael, dem Chief Operating Officer, ansprechen will. Bevor ich protestieren kann, hat er sich schon getrollt. Vielleicht sagt sie ja Nein. Ich beschließe, nicht mehr darüber nachzudenken und ihre Rückmeldung abzuwarten.
Ich gehe zu meinem Schreibtisch und spüre das vertraute Kribbeln in den Eingeweiden, als ich mich vor meinen Terminal setze. Das ist der Markt: Ziffern, die die ganze Welt abbilden, ein Tesserakt aus purer Information. Die Medien stellen die Banker als ausschließlich von Gier getrieben dar, aber das ist nicht ganz korrekt. Es gibt die, die es nur wegen des Geldes machen, das ist wahr – die wie Bergarbeiter oder Tiefseetaucher kilometerweit unter die Oberfläche der Dinge vordringen, weit jenseits des Lichts und von allem, was sie lieben, um mit Reichtümern beladen wieder aufzutauchen. Aber es gibt auch andere, die es wegen des archimedischen Punkts machen, denen die Welt zum Hoheitsgebiet geworden ist, denen die Bewegungen des Marktes, wie sie sich auf dem Bildschirm darstellen, komplexer erscheinen als das Leben selbst, tiefgründiger und komplizierter. Menschen, die mit ihrer schwindelerregenden Intelligenz die rohen Fakten der Welt so transzendieren, wie ein Landschaftsgemälde die Schönheit der Natur erhöht, indem es ihre gedankenlosen Handlungen in einen Rahmen des Bewussten spannt. Für diese Menschen verblassen die Highs der besten Drogen neben dem Rausch, den die schwankenden Zahlenfelder bei ihnen hervorrufen: Reisbauern in Henan, Autobauer in Stuttgart, pharmazeutische Forschungsunternehmen in Cork und Montevideo, kondensiert, komprimiert, miteinander interagierend auf eine Weise, von der sie selbst keine Vorstellung haben, rasend, tanzend, kollidierend wie Moleküle unter einem Mikroskop.
Ish ist eine Ausnahme. Sie gehört nicht zu der Archimedischer-Punkt-Fraktion, ist aber auch nicht besonders an Geld interessiert – wenn es nicht um die Abzahlung ihrer Wohnung geht, die sie schon vom Reißbrett zu einem Preis gekauft hat, der sogar für einen Investmentbanker, wie sie selbst zugibt, etwas extravagant gewesen sein mag.
»Irgendwas Neues aus dem Uncanny Valley?«, fragt sie mich jetzt.
»Du sitzt neben mir, du weißt genau, dass ich noch nichts gehört habe.«
»Ja, stimmt.« Einen Augenblick später fängt sie wieder an. »Du, Claude?«
»Wenn das wieder eine Frage zum Buch ist, lautet die Antwort: ›Ich weiß es nicht.‹«
»Es geht nicht um das Buch, es geht um den Film zum Buch.«
»…«
»Also, wenn die einen Film daraus machen, habe ich dann eine Mitsprache, wer meine Rolle spielt? Ich meine, nicht dass die irgendeine Schabracke dafür nehmen?«
Der Morgen schleppt sich dahin, ohne dass Rachael von sich hören lässt. Kurz vor Mittag jedoch ragt hinter mir plötzlich ein Schatten auf.
»Was zum Henker, Crazy Frog, erzählst du unseren Kunden über Tarmalat?«
»Ich erzähle ihnen bloß, dass Tarmalat wegen der griechischen Staatsschuldenkrise mächtig unter Druck steht«, sage ich. »Unmöglich, dass die ihre Zielvorgaben erreichen.«
»Ich versuche, denen Tarmalat zu verkaufen, du Schwachkopf!« Seine ohnehin voluminösen Nackenmuskeln spannen sich wie die Mastleinen eines Schiffs unter vollen Segeln. »Ich habe zweihundert von den Scheißteilen zu zwölf ein Viertel.«
»Meine Quelle sagt, dass die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dreißig Prozent weniger Ertrag machen. Eine Abschreibung der griechischen Schulden kann die hundert Millionen kosten. Deine Kunden werden dir dankbar sein, dass du sie verschont hast.«
»Dafür gibt’s aber keine Provision, oder?« Er macht ein mürrisches Gesicht. »Gottverdammte Griechenärsche«, nuschelt er. »Warum konnten die nicht einfach bei ihren … worin sind die noch mal gut, die Griechen?«
»Demokratie, haben sie erfunden«, sagt Ish.
»Darauf reiten die aber jetzt schon ziemlich lange rum«, sagt Howie.
Howie Hogan sieht nicht aus wie ein Genie. Fünfundzwanzig, jeden Tag bis an die Schmerzgrenze im Fitnessraum und trotzdem noch kindlich speckige Gesichtszüge, die ihm das Aussehen eines dieser überfütterten und fantasielosen reichen Jungs verleihen, die die Welt für einen drittklassigen Bordfilm halten, dem sie nur so lange Beachtung schenken, bis sie ihren wirklichen Zielort erreichen. Das ist Howie. Außerdem ist er der Starhändler der BOT. Neben mathematischem Scharfsinn, schnellen Reflexen und der Fähigkeit, Menschen Dinge verkaufen zu können, die sie nicht wollen, ist Howie mit dem Geschenk fast völliger emotionaler Dissoziation gesegnet. Andere Händler rasten aus, schnappen über oder brechen spektakulär zusammen. Gewinn oder Verlust, Howies einzige Reaktion ist Feixen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch im Schlaf feixt. Was macht er hier? Er müsste eigentlich in London sein, in der Champions League der Investmentbanken, und zehn Mal so viel verdienen wie hier bei der BOT. Aber irgendeine Unbesonnenheit in seiner Vergangenheit – worüber aber keiner von uns Näheres in Erfahrung bringen konnte – zwingt ihn auf den steinigen Weg zur Spitze.
Nachdem er die Schelte über die Sabotage seiner Verkaufsbemühungen losgeworden ist, rechne ich eigentlich damit, dass er sich wieder verdrückt, aber er steht immer noch hinter mir. »Was ist das eigentlich für eine Scheiße, die ich da höre?«, sagt er schließlich.
»Die Kartellbehörde hat die Fusion von Close & Coulthard gestoppt«, sage ich. »Hab ich dir geschickt, schau in deinen Instant Messenger.«
»Ich meine die Geschichte, dass jemand deine Biografie schreiben will.«
»Ach, das.«
Flimmerndes Feixen. »Was ist das für ein Penner, der ein Buch über dich schreiben will?«, sagt Howie.
»Ein Schriftsteller«, sage ich ausdruckslos.
»Zu deiner Information. Er meint, Claude sei der perfekte Jedermann«, wirft Ish ein.
Howie lacht. »Jedermann!«, wiederholt er. »Wer ist das denn, der langweiligste Superheld der Welt?«
»Musst du nicht zu einem Verhör wegen Belästigung am Arbeitsplatz?«, sagt Ish.
»Aufgepasst, Superschurken! Der Super-Rechenschieber Jedermann hat die Macht, euch zu Tode zu langweilen!« Howie stolziert kichernd davon. »Claude in einem Buch. Da sag noch einer, die Franzosen hätten keinen Humor.«
»Hör einfach nicht hin, Claude, er ist nur neidisch«, sagt Ish.
»Meinen die Leute, Franzosen hätten keinen Sinn für Humor?«, frage ich sie.
»Natürlich nicht«, sagt sie und tätschelt mir die Hand.
Ich mache mich wieder an die Arbeit, aber die kurze Unterhaltung hat ausgereicht, meine Ängste wieder anzufachen. Howie hat recht. Ich habe keine Geschichte. Ich habe keine Zeit für eine Geschichte. Ich habe mein Leben hier exakt so organisiert, damit ich keine Geschichte habe. Warum soll ich wollen, dass mir jemand folgt, mich begutachtet und dann feststellt, das ich keine Geschichte habe? Ich hole meine Brieftasche heraus und falte den Zettel mit Pauls Telefonnummer auseinander, aber bevor ich ihn anrufen und absagen kann, sehe ich von den Konferenzräumen Jürgen auf mich zukommen.
»Claude! Gute Nachrichten!« Er grinst mich aufgeregt an. »Rachael hat grünes Licht für dein Buchprojekt gegeben.«
»Oh«, sage ich überrascht.
»Los, ruf sofort deinen Schriftsteller an«, drängt er.
»Ja, gleich«, sage ich.
»Sofort«, wiederholt er.
»Ja«, sage ich.
Er steht da und wartet. Ungewollt schaue ich ihn an, wie es vielleicht ein Außenstehender tun würde: die Kugelschreiberschutzhülle in der Brusttasche, die abscheuliche Krawatte, die seltsam plastifizierten, anscheinend immer gleich langen Haare. Ist er glücklich? Einsam? Gelangweilt? Passt eins dieser Worte überhaupt?
»Aber erst muss ich noch was erledigen.« Ich gehe zum Lift und drücke auf den Knopf fürs Erdgeschoss. Während ich nach unten gleite, überlege ich hin und her. Er schreibt kein Buch über mich, rufe ich mir in Erinnerung. Er beschattet mich aus Recherchegründen. Ich bin ein höchst erfolgreicher Angestellter einer höchst erfolgreichen Bank. Es gibt keinen Grund zu der Befürchtung, er könne mein Leben als langweilig oder hohl empfinden.
Die Lifttüren öffnen sich. Die Sicherheitsleute schauen in meine Richtung und fast sofort wieder weg. Draußen ist es vollkommen windstill. In den Fenstern der Gebäude ringsum wuselt die Belegschaft hin und her, ein stummes Bild der Produktivität. Die graue Hülle der Royal Irish Bank am Ufer gegenüber ist allerdings nur von Möwen bevölkert. Erst letzte Woche ist zwei Stockwerke unter uns eine deutsche Bank implodiert. Wir schauten von oben zu, wie die ehemaligen Angestellten durch die Doppeltüren ins Freie traten – ins Licht blinzelnd, Pappkartons voller Mauspads und Birkenfeigen unterm Arm, die Blicke nach oben zu den dunkel glänzenden Scheiben gerichtet wie zu einem Land, das nun für sie verloren war.
Beim zweiten Klingeln hebt Paul ab.
»Ich bin’s«, sage ich. »Claude.«
In der Leitung hallt es eigenartig, als ob jemand mithört. Ich habe das höchst merkwürdige Gefühl, dass er schon weiß, was ich sagen werde. Aber seine Stimme klingt warm und menschlich, nicht wie die Stimme eines Gottes oder allwissenden Aufsehers. »Wie geht’s, Kumpel?«
»Gut, danke. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mein Boss grünes Licht für Ihr Projekt gegeben hat.«
»Fantastisch!« Seine Freude klingt aufrichtig, was bei mir die gegenteilige Wirkung hervorruft, da ich schon seinen drohenden Absturz vor mir sehe.
»Also, was genau soll ich jetzt tun?«, sage ich.
»Wie gesagt, Claude, Sie sollen überhaupt nichts tun. Seien Sie einfach Sie selbst.«
»Okay.«
»Ich werde mich nicht aufdrängen, versprochen. Sie werden kaum merken, dass ich da bin.«
»Sehr gut.«
»Hört sich nicht gerade begeistert an.«
»Doch, doch«, sage ich, doch dann füge ich unüberlegt hinzu: »Ist nur so, dass da nichts Dramatisches passiert.«
»Was meinen Sie?«
»Was wir in der Bank machen, das ist ziemlich komplex und technisch. Wenn Sie schillernde Figuren erwarten, aufregende Sachen, dann könnten Sie ziemlich … Na ja, ich weiß eben nicht, ob Sie was damit anfangen können.«
Gelächter hallt durch die Leitung. »Zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf. Ich bin der Künstler, okay? Es ist meine Aufgabe, das Gold in Ihrem Laden zu finden, egal, wo es versteckt ist.«
»Sie glauben, da ist irgendwo Gold?«, sage ich.
»Sicher, Claude, ganz sicher.«
FÜR MICH IST ES NATÜRLICH OHNE FRAGE dramatisch. Für mich wie für jeden anderen im Bankgeschäft waren die beiden letzten Jahre wie der Untergang Roms, die Französische Revolution, die Südseeblase und die Mondlandung zusammengenommen.
Ein halbes Jahrzehnt – eigentlich seit der vorherigen Finanzkrise, die damals die größte Vernichtung von Kapital in der Geschichte darstellte – hatte die Welt von geliehenem Geld gelebt. Die Löhne sanken, aber Kredite waren billig. Man bekam zwar weniger bezahlt, aber ein Darlehen für eine Ferienreise oder ein neues Auto oder Haus war leicht zu bekommen. Die Banken selbst liehen sich von Megabanken in Europa gewaltige Mengen Geld und reichten es mit hübschen Margen weiter an den Autokäufer, den Start-up-Unternehmer, den Immobilienentwickler. Die Regierungen schauten zufrieden zu, weil ja alle so glücklich waren mit ihren Autos, Ferienreisen und Häusern. Und natürlich nahmen auch die Regierungen in großem Stil Schulden auf, um die staatlichen Leistungen zu finanzieren, für die die Steuern der Arbeitnehmer nicht mehr ausreichten.
Kurz, die ganze Welt war massiv verschuldet, was aber scheinbar keine Rolle spielte. Dann, plötzlich, fast über Nacht, spielte es doch eine Rolle. Irgendwo erkannte irgendwer, dass der globale Boom in Wahrheit ein Pyramidensystem war, eine gewaltige entflammbare Pyramide, die nur darauf wartete, Feuer zu fangen. Die Investoren gerieten in Panik und begannen ihr Geld aus den Megabanken abzuziehen, die Megabanken begannen verzweifelt ihre Darlehen bei den Regionalbanken zurückzufordern, die Regionalbanken forderten ihre Darlehen von ihren Kunden zurück, die Kunden forderten ihre Darlehen von ihren Geschäftspartnern zurück – oder versuchten es zumindest, denn urplötzlich ging dort niemand mehr ans Telefon.
Die Folgen dieses verheerenden Kreditstillstands wirken bis heute nach. Überall auf der Welt sind Banken gefallen wie Kegel, illustre Finanzdynastien wurden weggeblasen wie Rauch. In den Vereinigten Staaten zählen Bear Stearns, Merrill Lynch und Lehman Brothers zu den größten Opfern, während die großen Privatkundenbanken in Irland nur noch im Geschäft sind, weil die Regierung sie gerettet hat. Diese Rettungsaktion wiederum hat eine Serie verhängnisvoller Ereignisse ausgelöst: Firmenschließungen, Eigenheimverluste, Massenauswanderung – fast vierhunderttausend Menschen aus einem Land, dessen Bevölkerung nicht mal halb so groß ist wie die des Ballungsraums Paris. Jeden Tag bringen die Nachrichten eine neue Horrorgeschichte: der Rentner, der sich von Tauben ernährt; die durch Seitenstraßen streifenden, langsam verhungernden Pferde, die ihre Besitzer freigelassen haben, weil sie sich den Stall nicht mehr leisten können. Nichts, was die Politiker tun, scheint zu helfen. In Griechenland, Spanien, Portugal und Italien wächst der öffentliche Zorn, Revolution liegt in der Luft.
Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Trompeten schmettern, lautet das Sprichwort. Wenn man richtig aufgestellt ist, kann man jetzt jede Menge Geld machen.
Um vier Uhr morgens breche ich meine Einschlafversuche ab, trinke eine Tasse Kaffee und gehe über die Straße in den Fitnessraum im Keller des Transaction House. Zwei Händler an den Multipressen versuchen vorauszusagen, wie sich die BOT-Strategie unter dem neuen Chef verändern wird, und spucken große Töne, wie viel Geld sie machen und wie gnadenlos sie ihre Konkurrenten von den anderen Banken »ficken« würden, wenn man sie erst mal »von der Leine« ließe.
Oben sitzen Thomas »Yuan« McGregor und sein Team für die asiatischen Märkte schon an ihren Schreibtischen. Ich nutze die frühe Stunde und überfliege die Schlagzeilen mit den neuesten unheilvollen Prognosen für Europa. Sonnenstrahlen kriechen durchs Fenster, die ersten noch vom Schlaf verquollenen Gesichter tauchen in der Lobby auf. Zunächst langsam, dann immer hektischer setzen die kleinen Rituale des Tages ein: der regenbesprenkelte Praktikant mit dem Tablett voller Kaffeebecher; die rätselhaften Witze inmitten des endlosen mit DRINGEND, HOHE PRIORITÄT, SOFORT LESEN markierten E-Mail-Stroms in der Inbox; das kollektive Aufstöhnen beim Anblick des Kuriers mit seinem Paket voller Korrekturen, Überarbeitungen und Rückziehern über Nacht. Wenn es auf 8:00 Uhr zugeht, steigt die Spannung. In Vorbereitung auf die Marktöffnung telefonieren die Händler ununterbrochen, halten Ausschau nach Aktualisierungen, nach preissensitiven Entwickungen, nach allem, was ihnen einen Vorteil gegenüber den unsichtbaren Horden beschert, die hier und auf der anderen Seite des Teichs genau das Gleiche tun. Schon bald hängt die gesamte Rechercheabteilung am Telefon, niemand nimmt den anderen mehr wahr, alle Augen sind auf Bildschirme fixiert oder auf den leeren Punkt in der Luft, wo sich das Leben jetzt abspielt. Man wittert den Markt wie ein an seiner Leine zerrender Hund und wartet auf den Augenblick, wenn der Handel startet.
Die ersten Stunden vergehen wie im Rausch, danach entspannt sich die Lage ein wenig. Ich habe mich für zehn Uhr mit Paul verabredet. Ish und Jürgen wollen mich begleiten, aber ich kann sie überreden, im Büro zu bleiben. »Er will mein Leben beobachten, so wie es jeden Tag abläuft«, sage ich. »Alles muss ganz natürlich sein.«
»Na gut«, sagen sie und gehen widerwillig zurück zu ihren Schreibtischen.
Im Lift nach unten stelle ich überrascht fest, wie nervös ich bin. Ich spüre die gleiche Beklommenheit wie vor Jahren, als ich auf dem Weg zum Rendezvous mit einem Mädchen war, in das ich verliebt war. Ich wusste, dass ich ihr an diesem Tag meine Gefühle offenbaren musste, und wusste gleichzeitig, dass ich genau das nicht tun würde. Als sich die Lifttüren öffnen und ich hinaus in die leere Lobby trete, kommt mir auch der Anflug von Verzweiflung bekannt vor.
Ich schaue auf das Display meines Handys, aber keine Nachricht von ihm. Hat er seine Meinung geändert? Hat er sich auf meine Kosten bloß einen Spaß gemacht? Ich drücke mich an der Tür herum und tue so, als bemerkte ich nicht, dass die Sicherheitsleute von ihrem Schalter zu mir herüberschauen. Und dann sehe ich ihn. Er läuft über die Plaza, und genau wie beim Auftauchen von Sylvie, Valou, Aimée oder den anderen spüre ich, dass mein Herz einen Satz macht.
Er lächelt mich spröde an und entschuldigt sich für die Verspätung. Er sieht fast genauso nervös aus wie ich. Kein Problem, sage ich und gehe mit ihm zu den Sicherheitsleuten. Er muss verschiedene Formulare ausfüllen, man nimmt seine Fingerabdrücke. Dann muss er sich ruhig hinstellen, damit der Wachmann ihn fotografieren und seine Iris scannen kann. Schweigend warten wir, während der Wachmann auf einen Bildschirm starrt, den wir nicht einsehen können. Dann seufzt er, wir hören ein klackendes Geräusch, er greift nach unten und holt Pauls Ausweis hervor.
»Hab schon gedacht, dass er jetzt auch noch eine Blutprobe will«, sagt Paul, als wir uns umdrehen und zum Lift gehen.
»Ha, ha«, sage ich.
Es dauert lange, bis der Lift kommt. Als die Türen sich schließlich öffnen, drücke ich auf den Knopf zum sechsten Stock. »Wir sind im Sechsten«, sage ich überflüssigerweise.
»Genau«, sagt Paul.
Wir fahren nach oben. Ich suche nach einem Fakt oder technischen Detail, das ihm nützlich sein könnte oder zumindest das Schweigen brechen könnte.
»Otis«, sage ich.
»Bitte?«
»Der Lift. Der Hersteller heißt Otis. Ist einer der berühmtesten Liftproduzenten.«
»Ja.«
»Das bedeutet natürlich nicht zwingend, dass er auch der beste ist. Allerdings hat sich dieser spezielle Lift nach meiner Erfahrung immer als sehr zuverlässig erwiesen.«
»Schön zu wissen.«
»Ich nehme an, Otis ist der Name des Erfinders. Könnte aber natürlich auch einfach erfunden sein … Wissen Sie das vielleicht?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Man kann natürlich auch die Treppe nehmen«, füge ich hinzu. »Aber gewöhnlich nehme ich den Lift.«
»Alles klar«, sagt er.
Ah, quel con! Als wir den sechsten Stock erreichen, rechne ich fast damit, dass er sich für die Zeit bedankt, die ich mir für ihn genommen habe, und gleich wieder nach unten fährt. Erleichtert sehe ich Ish und Jürgen in der Lobby stehen. Sie tun so, als führten sie eine angeregte Unterhaltung über die Topfpflanze neben der Rezeption.
»Das ist der feine Unterschied zwischen zu viel Wasser und zu wenig«, sagt Ish gerade und verfällt in Schweigen, als wir aus dem Lift treten. Erwartungsvoll schauen uns die beiden an, und meine Nervosität verflüchtigt sich zugunsten von aufwallendem Stolz.
»Ish, Jürgen, das ist Paul«, sage ich leichthin. »Er wird die nächsten paar Wochen hier im Büro mein Schatten sein. Paul, darf ich vorstellen, meine Kollegin Ish und Jürgen, Teamleiter Financial Institutions.«
»Hallo«, sagt Paul.
Verlegen lächeln wir uns alle eine Zeit lang an – dann, gerade als ich mich umdrehen und mit Paul weggehen will, sagt Ish schnell, so als könne sie sich nicht mehr länger zusammenreißen: »Sind Sie wirklich Schriftsteller?«
»Zu meiner Schande«, sagt Paul.
»Wow«, murmelt Ish.
Ich schaue zu Jürgen und verdrehe die Augen. Aber auch ihm steht eine schulmädchenhafte Ehrerbietung ins Gesicht geschrieben. »Ein Schriftsteller!«, sagt er. »Das muss ja so aufregend sein!«
»Besser als Arbeit, nehme ich an«, sagt Paul.
»Ha, ha, das sicher!«, sagt Jürgen. Er schaut auf seine Schuhe und fügt beiläufig hinzu: »Nun ja, eigentlich bin ich nicht ganz aufrichtig, denn ich weiß selbst ein bisschen was über die Schriftstellerei, von meiner Arbeit für Florin Affairs. Das ist ein Magazin für mittelalterliche Ökonomie, vielleicht haben Sie davon gehört?«
Paul tut so, als zermartere er sich das Gehirn.
»Nicht zu verwechseln mit Forint Affairs. Das ist das Magazin über die ungarische Währung.«
»Genau«, sagt Paul.
»Sie haben sich ein exzellentes Thema ausgesucht, wenn ich das sagen darf«, fährt Jürgen fort. »Die Bank of Torabundo ist eins der faszinierendsten Institute im Bereich der Kapitalallokation. Und Claude ist einer unser geschätztesten Mitarbeiter.« Er hält inne, wendet sich an Ish. »Obwohl wir natürlich alle unsere Mitarbeiter schätzen«, sagt er.
»Ich bin Claudes beste Freundin in dem Saftladen hier«, springt Ish ihm zur Seite. »Komisch, oder? Heißt doch immer, Frogs und Aussies kommen nicht klar miteinander? Weil die Frogs, die sind alle schmuh-schmuh-schmuh und die Aussies heymannhey. Aber wir passen zusammen wie die Faust aufs Auge, stimmt’s nicht, Claude?«
Ich stelle mir die blauen Flecken und die Schreie vor. »Ja«, sage ich.«
»Also, wenn Sie was über seine Geheimnisse wissen wollen, wissen Sie, an wen Sie sich wenden müssen.«
»Claude hat Geheimnisse?« Paul beäugt mich mit einem angedeuteten Lächeln.
»Zum Beispiel seine Schublade voller Carambars«, sagt Ish. »Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.«
»Wir sollten auf jeden Fall mal reden«, sagt Paul.
»Ich zeige Paul jetzt den Rest des Büros«, sage ich bedeutungsvoll.
»Wenn Sie ein Buch über ihn schreiben, dann muss ich da auch rein, ha, ha!«, ruft Ish uns hinterher. »Und für den Fall, dass … ich habe Größe acht, ha, ha!«
Ich ziehe ihn weg. Kalkuliert gleichgültige Blicke schauen uns an, während wir den Raum durchqueren. Anscheinend hat jeder von dem Besucher gehört. »Das ist also die Rechercheabteilung«, sage ich und deute mit ausladender Geste auf die Uhren an der Wand, die stumm geschalteten Fernseher, die Arbeitsnischen voller Monitore, Telefone, Papierkram.
»Wo sind die Burschen, die sich die ganze Zeit anbrüllen?«