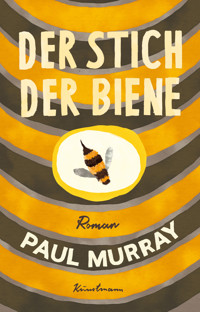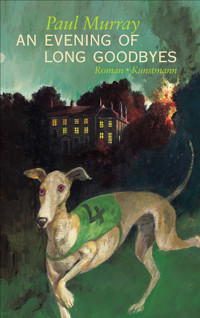Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ruprecht Van Doren ist ein übergewichtiges Genie, seine Hobbies sind komplexe Mathematik und die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Mit Daniel ›Skippy‹ Juster teilt er sich ein Zimmer im Turm des Seabrook College, einer altehrwürdigen Dubliner Institution, in der sich keiner so richtig für die beiden interessiert. Aber als Skippy sich in Lori verliebt, eine Frisbee spielende Schönheit aus der Mädchenschule gegenüber, haben auf einmal alle möglichen Leute Interesse – auch Carl, Teilzeit-Drogendealer und offizieller Schulpsychopath. Während seine Lehrer mit der Modernisierung kämpfen und Ruprecht versucht, ein Portal in ein paralleles Universum zu öffnen, steuert Skippy, im Namen der Liebe, auf einen Showdown zu – in Form eines fatalen Doughnut-Wettessens, das nur eine Person überleben wird...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Murray
SKIPPY STIRBT
Roman
Aus dem Englischenvon Rudolf Hermsteinund Martina Tichy
Verlag Antje Kunstmann
Für Seán
INHALT
Skippy und Ruprecht …
I Hopeland
II Heartland
III Ghostland
IV Afterland
Danksagung
Skippy und Ruprecht sitzen eines Abends im Ed’s und tragen ein Doughnut-Wettessen aus, als Skippy auf einmal blauviolett anläuft und vom Stuhl fällt. Es ist ein Freitag im November, und das Ed’s ist nur halb voll; falls Skippy ein Geräusch macht, während er auf den Boden kippt, achtet niemand darauf. Und Ruprecht ist zunächst auch nicht sonderlich besorgt; er freut sich sogar, denn das bedeutet, dass er, Ruprecht, das Wettessen gewonnen hat, das sechzehnte in Folge, wodurch er wieder ein Stück an den Allzeitrekord heranrückt, den Guido »Die Drüse« LaManche hält, vom Absolventenjahrgang 1993 des Seabrook College.
Abgesehen von seiner Genialität – er ist wirklich ein Genie –, hat Ruprecht nicht allzu viel vorzuweisen. Als chronisch übergewichtiger Junge mit Hamsterbacken ist er schlecht im Sport und auch auf den meisten anderen Gebieten, auf denen komplizierte mathematische Gleichungen keine Rolle spielen. Deshalb sind ihm seine Siege im Doughnut-Wettessen so wichtig, und das ist auch der Grund, warum er, obwohl Skippy jetzt schon fast eine Minute am Boden liegt, immer noch auf seinem Stuhl sitzt und leise »Ja, ja« vor sich hin jubelt – bis der Tisch sich ruckartig bewegt, seine Cola umkippt und er merkt, dass etwas nicht stimmt.
Auf den Schachbrettfliesen unter dem Tisch windet sich Skippy lautlos in Krämpfen. »Was ist los?«, fragt Ruprecht, bekommt aber keine Antwort. Skippys Augen quellen hervor, und aus seinem Mund kommt ein seltsam grabesdumpfes Keuchen. Ruprecht lockert ihm die Krawatte und knöpft ihm den Kragen auf, aber das nützt offenbar nichts, denn das schwere Atmen, die Zuckungen und der glupschäugige Blick werden noch schlimmer, und Ruprecht spürt, wie ein Kribbeln seinen Nacken hochsteigt. »Was ist los?«, fragt er noch mal, mit so lauter Stimme, als befände sich Skippy auf der anderen Seite einer viel befahrenen Straße. Alle schauen jetzt her: Der lange Tisch mit Seabrook-Zehntklässlern und ihren Freundinnen, die beiden St.-Brigid’s-Mädchen, die eine dick, die andere dünn, beide noch in ihrer Schuluniform, und die drei Auffüllkräfte aus dem Einkaufszentrum um die Ecke – sie alle drehen sich um und sehen zu, wie Skippy keucht und würgt, ganz so, als wäre er am Ertrinken. Aber wie könnte er hier ertrinken, denkt Ruprecht, hier drinnen, wo doch das Meer drüben auf der anderen Seite vom Park ist? Das ist völlig verrückt, und es passiert alles so schnell, dass ihm keine Zeit bleibt, sich zu überlegen, was zu tun ist –
In dem Moment geht eine Tür auf, und ein junger Asiate, in einem Ed’s-Shirt mit einem Anstecker, auf dem in nachgemachter Schreibschrift Hi, ich bin steht und dann, in einem fast unleserlichen Gekritzel, Zhang Xíelín, taucht mit einem Tablett voller Kleingeld hinter dem Tresen auf. Er stutzt angesichts der vielen Leute, die aufgestanden sind, um besser zu sehen; dann erblickt er die Gestalt auf dem Boden, lässt das Tablett fallen, springt über den Tresen, stößt Ruprecht beiseite und zieht Skippys Kiefer auseinander. Er schaut ihm in den Mund, aber es ist zu dunkel, also hievt er Skippy hoch, fasst ihn mit beiden Armen um die Körpermitte und fängt an, ruckartig seinen Magen zu pressen.
Inzwischen ist Ruprechts Gehirn aus der Betäubung erwacht: Er schaut nach den auf dem Boden liegenden Doughnuts, weil er meint, wenn er feststellen kann, an welchem Doughnut Skippy sich verschluckt hat, kriegt er vielleicht raus, was eigentlich los ist. Doch zu seiner Verblüffung sind die sechs Doughnuts, die zu Beginn des Wettessens in Skippys Schachtel waren, alle noch vorhanden und es fehlt nicht der kleinste Bissen. Er überlegt krampfhaft. Er hat Skippy nicht im Auge behalten – bei einem Wettessen tritt Ruprecht in eine Sphäre ein, in der sich die übrige Welt in nichts auflöst, das ist auch das Geheimnis seiner rekordverdächtigen sechzehn Siege –, hat aber angenommen, dass auch er aß; warum sollte man zu einem Doughnut-Wettessen antreten und dann keine Doughnuts essen? Vor allem aber: Wenn er nichts gegessen hat, wie kann er dann –
»Halt!«, ruft er, springt auf und macht Zhang Xielin ein Zeichen. »Halt!« Zhang schaut keuchend auf; Skippy hängt wie ein Mehlsack über seinen Armen. »Er hat überhaupt nichts gegessen«, sagt Ruprecht. »Er ist nicht am Ersticken.« Ungläubiges Gemurmel erhebt sich unter den Zuschauern. Zhang Xielin schaut misstrauisch drein, lässt es aber zu, dass Ruprecht ihm Skippy, der überraschend schwer ist, aus den Armen nimmt und ihn wieder auf den Boden legt.
Seit Skippys Sturz vom Stuhl sind vielleicht drei Minuten vergangen, in dieser Zeitspanne ist seine blauviolette Farbe zu einem gespenstisch zarten Eierschalenblau verblasst, und sein Keuchen hat sich in ein Wispern verwandelt; auch seine Zuckungen sind fast vollständig verebbt, und seine Augen sind zwar offen, blicken aber seltsam leer, sodass sich Ruprecht, obwohl er ihn direkt anschaut, nicht ganz sicher ist, ob Skippy überhaupt noch bei Bewusstsein ist. Plötzlich hat er das Gefühl, als schlössen sich zwei kalte Hände um seine Lungenflügel, als ihm klar wird, was jetzt gleich geschehen wird, obwohl er es andererseits auch wieder nicht ganz glauben kann – könnte so etwas denn wirklich passieren? Könnte es wirklich hier passieren, hier in Ed’s Doughnut House? Ed’s mit seiner Original-Jukebox, dem Kunstleder und den Schwarz-Weiß-Fotos von Amerika; Ed’s mit seinen Neonröhren, den Plastikgäbelchen und der seltsam sterilen Luft, die nach Doughnuts riechen müsste, es aber nicht tut; Ed’s, wo sie jeden Tag hingehen, wo nie irgendwas passiert, wo nichts passieren darf, denn deswegen gehen sie ja hin –
Eines der Mädchen in knittrigen Hosen lässt einen Schrei los. »Schaut mal!« Sie wippt auf den Zehenspitzen auf und ab und sticht mit dem Finger Löcher in die Luft, und Ruprecht reißt sich aus seiner blöden Erstarrung, schaut nach unten und sieht, dass Skippy die linke Hand gehoben hat. Erleichterung durchströmt ihn.
»Na also!«, schreit er.
Die Hand rührt sich, als sei sie gerade aus tiefem Schlaf erwacht, und gleichzeitig stößt Skippy einen langen, heiseren Seufzer aus.
»Na also!«, wiederholt Ruprecht, ohne recht zu wissen, was er damit meint. »Du schaffst es!«
Skippy macht ein gurgelndes Geräusch und blinzelt zu Ruprecht hinauf.
»Der Krankenwagen muss jeden Moment hier sein«, sagt Ruprecht zu ihm. »Alles wird gut.«
Gurgel-gurgel, macht Skippy.
»Ganz ruhig«, sagt Ruprecht.
Aber Skippy ist nicht ruhig, er gurgelt weiter, als wollte er Ruprecht etwas sagen. Er verdreht hektisch die Augen, starrt zur Decke empor, dann schnellt wie auf einen plötzlichen Einfall hin seine Hand vor und sucht den gefliesten Boden ab. Blind tastet sie in der verschütteten Cola und den schmelzenden Eiswürfeln herum, bis sie auf einen der herabgefallenen Doughnuts stößt; sie packt ihn, wie eine Spinne, die ungeschickt mit ihrer Beute ringt, und zerdrückt ihn zwischen den Fingern, immer fester und fester.
»Ganz ruhig«, wiederholt Ruprecht und schaut über seine Schulter zum Fenster, ob der Krankenwagen nicht endlich kommt.
Aber Skippy zerdrückt weiter den Doughnut, bis seine Hand ganz mit Himbeersirup verschmiert ist; dann senkt er eine rot glänzende Fingerspitze und malt eine geschwungene Linie auf den Boden.
S
»Er schreibt«, flüstert jemand.
Er schreibt. Quälend langsam – Schweiß tropft von seiner Stirn, der Atem rasselt wie eine eingeschlossene Murmel in seiner Brust – zeichnet Skippy himbeerrote Linien auf den Schachbrettboden, eine nach der anderen. A, G – die Lippen der Zuschauer bewegen sich lautlos, immer wenn ein Buchstabe vollendet ist. Und während draußen weiter der Verkehr vorbeirauscht, breitet sich im Doughnut House eine merkwürdige Stille aus, fast so etwas wie heitere Gelassenheit, als hielte hier drinnen die Zeit den Atem an. Statt dem nächsten zu weichen, wird der Moment elastisch und dehnt sich aus, um alle Anwesenden zu umfassen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf das vorzubereiten, was nun kommt.
SAG LORI
Das übergewichtige St.-Brigid’s-Mädchen in der Nische erbleicht und flüstert ihrer Begleiterin etwas ins Ohr. Skippy schaut flehentlich zu Ruprecht auf. Ruprecht räuspert sich, rückt seine Brille zurecht und liest die auf den Fliesen kristallisierende Botschaft.
»Sag Lori?«, sagt er.
Skippy verdreht die Augen und krächzt.
»Was soll ich ihr sagen?«
Skippy keucht.
»Ich weiß es nicht!«, brabbelt Ruprecht. »Tut mir leid, ich weiß es nicht!« Er bückt sich und besieht sich erneut mit zusammengekniffenen Augen die rosa Buchstaben.
»Sag ihr, dass er sie liebt!«, ruft das übergewichtige oder womöglich sogar schwangere Mädchen in der St.-Brigid’s-Uniform. »Du sollst Lori sagen, dass er sie liebt! Mannomann!«
»Ich soll Lori sagen, dass du sie liebst?«, fragt Ruprecht zweifelnd. »Meinst du das?«
Skippy atmet aus – er lächelt. Dann streckt er sich auf den Fliesen aus, und Ruprecht sieht ganz deutlich, wie das Auf und Ab von Skippys Brust sanft zum Stillstand kommt.
»He!« Ruprecht packt ihn an den Schultern und schüttelt ihn. »Hey!, was soll denn das?«
Skippy antwortet nicht.
Einen Moment lang herrscht kalte, karge Stille, dann bricht, fast wie auf den allgemeinen Wunsch, sie auszufüllen, ein ohrenbetäubender Tumult in dem Lokal los. Luft!, ist die einhellige Meinung. Er braucht frische Luft! Die Tür wird aufgerissen, und die kalte Novemberluft strömt gierig herein. Ruprecht merkt, dass er reglos dasteht und auf seinen Freund hinabschaut. »Atme!«, schreit er ihn an und gestikuliert sinnlos wie ein wütender Lehrer. »Warum atmest du nicht?« Aber Skippy liegt einfach nur mit einem friedlichen Gesichtsausdruck da, so still, wie es stiller nicht mehr geht.
Ringsum gellt die Luft von Schreien und Vorschlägen, Dingen, an die sich die Leute aus Krankenhausserien im Fernsehen erinnern. Ruprecht hält das nicht aus. Er drängt sich zwischen den Umstehenden durch zur Tür hinaus. Draußen beißt er sich auf den Daumen und sieht zu, wie der Verkehr vorbeiströmt, dunkle, anonyme Fahrzeuge, von denen keines nach einem Krankenwagen aussieht.
Als er wieder hineingeht, kniet Zhang Xielin neben Skippy und hält seinen Kopf auf dem Schoß. Doughnuts liegen über den Boden verstreut wie kleine kandierte Kränze. In der Stille sehen die Leute Ruprecht mit feuchten, mitfühlenden Augen scheu an. Ruprecht starrt feindselig zurück. Er schäumt innerlich, er glüht, er bebt vor Wut. Am liebsten würde er hinausstürmen, auf sein Zimmer gehen und Skippy liegen lassen. Am liebsten würde er »Warum? Warum? Warum? Warum?« schreien. Er geht wieder hinaus, um in den Verkehr zu starren, er weint, und in diesem Moment spürt er, wie die Hunderttausende von Fakten in seinem Kopf zu Matsch werden.
Durch die Lorbeerbäume kann man oben in einer Ecke des Seabrook Tower gerade noch das Fenster ihres gemeinsamen Zimmers ausmachen, wo Skippy vor kaum einer halben Stunde Ruprecht zu dem Wettessen herausgefordert hat. Der große rosa Ring auf dem Dach von Ed’s Doughnut House sendet sein kaltes synthetisches Licht aus, eine Neonnull, die den Mond und alle Sternbilder des unendlichen Raums dahinter überstrahlt. Ruprecht schaut nicht in diese Richtung. Das Universum erscheint ihm in diesem Augenblick als etwas Furchtbares – dünn und fadenscheinig und leer. Anscheinend weiß es das selbst und wendet sich beschämt ab.
IHOPELAND
Diese Tagträume hielten sich wie ein alternatives Leben …
Robert Graves
Früher hat Howard in den Wintermonaten von seinem Platz am mittleren Pult der mittleren Reihe aus immer aus dem Fenster des Geschichtsraums geschaut und beobachtet, wie die ganze Schule in Flammen aufging. Die Rugbyfelder, der Basketballplatz, der Parkplatz und die Bäume dahinter – für einen wunderschönen Moment wurde das alles verschlungen. Und obwohl der Bann gleich wieder gebrochen war – das Licht wurde schwächer und röter, verglomm schließlich und ließ die Schule und ihre Umgebung unversehrt –, wusste man wenigstens, dass der Tag fast vorüber war.
Heute steht er vor der Klasse – die falsche Perspektive und die falsche Jahreszeit, um den Sonnenuntergang zu sehen. Er weiß jedoch, dass es erst in einer Viertelstunde klingelt, deshalb fasst er sich an die Nase, seufzt unhörbar und versucht es noch einmal. »Na los. Die wichtigsten Länder. Nur die wichtigsten. Na, wer traut sich?«
Die schläfrige Stille bleibt ungestört. Die Heizkörper glühen, obwohl es draußen nicht besonders kalt ist: Die Heizung ist überaltert und launisch, wie die meisten Sachen in diesem Trakt der Schule, und im Lauf des Tages baut sich die Wärme zu einem schwülen Malariamief auf. Howard beschwert sich natürlich, genau wie die anderen Lehrer, ist aber insgeheim nicht undankbar; zusammen mit der einschläfernden Wirkung des Geschichtsunterrichts sorgt die Hitze dafür, dass der Unruhepegel in den letzten Stunden nur selten über leise summendes Geschwätz und einen gelegentlichen Papierflieger hinausgeht.
»Na, wer?«, wiederholt er und schaut suchend in die Klasse, wobei er geflissentlich Ruprecht Van Dorens hochgestreckten Arm übersieht, unter dem sich Ruprecht atemlos abmüht. Die anderen Jungen blinzeln Howard an, als wollten sie ihn dafür tadeln, dass er ihre Ruhe stört. Auf Howards altem Platz stiert Daniel »Skippy« Juster katatonisch ins Leere, als wäre er mit Drogen vollgepumpt; in dem sonnigen Eckchen in der hinteren Reihe hat sich Henry Lafayette ein Nest aus seinen Armen gebaut und seinen Kopf hineingebettet. Sogar die Uhr klingt so, als sei sie schon fast eingenickt.
»Das haben wir jetzt doch zwei Tage lang durchgenommen. Wollt ihr behaupten, dass keiner von euch auch nur eins der beteiligten Länder nennen kann? Kommt schon, ihr geht hier nicht raus, ehe ihr mir nicht beweist, dass ihr’s wisst.«
»Uruguay?«, murmelt Bob Shambles zögernd, als müsste er die Antwort aus wallenden Zaubernebeln heraufbeschwören.
»Nein«, sagt Howard und schaut sicherheitshalber in das Buch, das aufgeschlagen auf seinem Pult liegt. »Damals bekannt als ›der Krieg, der alle Kriege beendet‹« lautet die Unterschrift unter dem Foto einer riesigen, von Wasserflächen durchzogenen Mondlandschaft, aus der alle natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Lebenszeichen verschwunden sind.
»Die Juden?«, fragt Ultan O’Dowd.
»Die Juden sind kein Land. Mario?«
»Ja?« Mario Bianchi schaut ruckartig von dem Gegenstand auf, mit dem er gerade unter dem Pult hantiert hat, wahrscheinlich seinem Handy. »Äh, das war … es war – Mann, hör auf –, Sir, Dennis begrapscht mein Bein! Mann, lass das, du Grapscher!«
»Hör auf, sein Bein zu begrapschen, Dennis.«
»Tu ich ja gar nicht, Sir!« Dennis Hoey gibt die gekränkte Unschuld.
An der Tafel lässt die sinkende Sonne den aus dem Lehrbuch abgeschriebenen Text – »MAIN«: Militarismus, Allianzen, Industrialisierung, Nationalismus – allmählich verblassen. »Ja, Mario?«
»Äh …« Mario versucht Zeit zu gewinnen. »Na ja, Italien …«
»Italien war für das Catering zuständig«, meint Niall Henaghan.
»Hey!«, warnt ihn Mario.
»Sir, Mario nennt seinen Pimmel Il Duce«, sagt Dennis.
»Sir!«
»Dennis.«
»Doch, im Ernst – ich hab’s doch gehört, Mario. ›Zeit, dich zu erheben, Duce‹, sagst du. ›Dein Volk erwartet dich, Duce.‹«
»Wenigstens hab ich einen Pimmel und nicht bloß ein …«
»Mir scheint, wir kommen vom Thema ab«, schaltet sich Howard ein. »Kommt schon, Jungs. Die wichtigsten Teilnehmer des Ersten Weltkriegs. Ich gebe euch einen Tipp. Deutschland. Deutschland war beteiligt. Und welche Länder waren mit Deutschland verbündet – ja, Henry?« Wovon immer Henry träumt, er gibt einen lauten Schnarcher von sich. Als er seinen Namen hört, hebt er den Kopf und schaut Howard aus trüben, erschrockenen Augen an.
»Elfen?«, sagt er.
Hysterisches Gelächter bricht los.
»Äh, wie war noch mal die Frage?«, fragt Henry leicht gekränkt.
Howard ist drauf und dran, sich seine Niederlage einzugestehen und noch einmal ganz von vorn anzufangen. Ein Blick auf die Uhr entbindet ihn jedoch für heute jeder weiteren Anstrengung. Er lässt die Jungen wieder ihr Lehrbuch aufschlagen und Geoff Sproke das dort abgedruckte Gedicht vorlesen.
»›Auf Flanderns Feldern‹«, beginnt Geoff. »Von Lieutenant John McCrae.«
»Von Lieutenant John McGay«, witzelt John Reidy.
»Also bitte!«
»›Auf Flanderns Feldern‹«, liest Geoff, »›blüht der Mohn‹«:
»Zwischen den Kreuzen, Reihe um Reihe,
Die unseren Platz markieren; und am Himmel
Fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend
Kaum gehört inmitten der Kanonen unten.
Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch
Am Leben – «
An dieser Stelle klingelt es. Schlagartig sind die tagträumenden, schläfrigen Jungen hellwach, schnappen sich ihre Taschen, verstauen ihre Bücher und rücken als geschlossener Trupp zur Tür vor. »Bis morgen lest ihr das Kapitel zu Ende«, ruft Howard ins Getümmel. »Und wenn ihr schon dabei seid, dann lest auch gleich, was ihr für heute aufhattet.« Aber die Klasse hat sich bereits verflüchtigt, und Howard bleibt zurück und fragt sich wie immer, ob wohl irgendwas von dem, was er gesagt hat, hängen geblieben ist; er sieht förmlich seine Worte zerknüllt auf dem Boden liegen. Er packt seine Bücher weg, wischt die Tafel ab und beginnt sich im Schulschlussgewühl zum Lehrerzimmer durchzuschlagen.
In Our Ladys Hall tummeln sich, je nach hormoneller Lage, Zwerge und Riesen. Das Aroma der Halbwüchsigkeit, gegen das weder Deodorants noch geöffnete Fenster ankommen, hängt schwer in der Luft, und die Wände hallen wider von den mannigfachen Pieps- und Klingeltönen, den schrillen Musikfetzen aus zweihundert Handys, die während des Unterrichts verboten sind und jetzt mit solcher Dringlichkeit wieder eingeschaltet werden, als hinge das Überleben ihrer Besitzer davon ab. Von ihrer Nische in sicherer Höhe blickt die Gipsmadonna mit dem besternten Heiligenschein und dem pfirsichgelben Teint kokett schmollend auf die außer Rand und Band geratene Männlichkeit hinab.
»Hey!, Flubber!« Dennis Hoey hampelt dicht vor Howard vorbei, um William »Flubber« Cooke abzufangen. »Hey!, ich wollte dich nur mal was fragen.«
Flubber ist sofort misstrauisch: »Was denn?«
»Ach, ich wollte bloß wissen, ob du ein kleiner Schwachkopf bist.«
Mit gerunzelter Stirn denkt Flubber – achtzig Kilo schwer und auf seiner zweiten Ehrenrunde in der achten Klasse – darüber nach.
»Da ist kein Trick dabei oder so«, verspricht Dennis. »Ich will bloß wissen, ob du ein kleiner Schwachkopf bist.«
»Nein«, erwidert Flubber, woraufhin Dennis abschwirrt und dabei »Er ist ein großer Schwachkopf. Er ist ein großer Schwachkopf!« ruft. Flubber lässt einen Brüller los und will ihm nachlaufen, bleibt aber abrupt stehen und taucht in der entgegengesetzten Richtung ab, als die Menge sich teilt und eine hohe, ausgemergelte Gestalt sich mit ausgreifenden Schritten nähert.
Pater Jerome Green: Französischlehrer, Koordinator der karitativen Aktivitäten von Seabrook und die mit Abstand furchteinflößendste Persönlichkeit der Schule. Wo er geht und steht, beansprucht er so viel Raum wie zwei oder drei Männer, als hätte er stets ein unsichtbares Gefolge von mistgabelschwingenden Kobolden, die jeden aufspießen, der gerade unreine Gedanken hegt. Im Vorbeigehen ringt sich Howard ein schwaches Lächeln ab; der Pater mustert ihn dafür mit demselben finsteren Blick wie jeden anderen auch, mit einem Ausdruck allzeit bereiter, unpersönlicher Missbilligung, so geübt darin, den Menschen in die Seele zu schauen und darin Sünde, Begierde und Unmoral wahrzunehmen, dass er es längst so selbstverständlich tut, wie man ein Kästchen ankreuzt.
Manchmal hat Howard das deprimierende Gefühl, dass sich hier in den zehn Jahren seit seinem Abschluss rein gar nichts verändert hat, und daran sind vor allem die Patres schuld. Die Rüstigen sind rüstig, die Tatterigen tatterig wie eh und je; Pater Green sammelt immer noch Lebensmittelkonserven für Afrika und terrorisiert die Schüler, Pater Laughton hat immer noch Tränen in den Augen, wenn er seinen desinteressierten Klassen die Werke Bachs vorstellt, Pater Foley hat für verstörte Jugendliche nach wie vor nur den einen »väterlichen« Rat: mehr Rugby zu spielen. An schlechten Tagen sieht Howard ihr Durchhaltevermögen als eine Art persönlichen Vorwurf – als sei der fast zehn Jahre umfassende Lebensabschnitt zwischen seiner Immatrikulation an der Universität und seiner unrühmlichen Rückkehr an die Schule wegen seiner eigenen Unfähigkeit rückgängig gemacht, aus den Akten gestrichen, als kompletter Blödsinn abgetan worden.
Das ist natürlich pure Paranoia. Die Patres sind nicht unsterblich. Die Holy Paraclete Fathers haben dasselbe Problem wie jeder andere katholische Orden: Sie sterben aus. Nur wenige der Patres in Seabrook sind unter sechzig, und der neueste Rekrut im Pastoralprogramm – einer aus einer stetig schwindenden Zahl – ist ein junger Seminarist aus dem Umland von Kinshasa. Als der Schuldirektor, Pater Desmond Furlong, Anfang September erkrankte, nahm zum ersten Mal in der Geschichte Seabrooks ein Laie – der Wirtschaftslehrer Gregory L. Costigan – die Zügel in die Hand.
Howard verlässt die holzgetäfelten Hallen des Altbaus, geht zum Neubau hinüber, steigt die Treppe hinauf und öffnet wie immer mit einem leichten Schaudern die Tür mit der Aufschrift »Lehrerzimmer«. Ein halbes Dutzend seiner Kollegen klagen sich gegenseitig ihr Leid, korrigieren Hausarbeiten oder wechseln ihre Nikotinpflaster. Ohne zu grüßen oder seine Anwesenheit anderweitig zu bekunden, geht Howard an sein Fach und wirft ein paar Bücher und einen Stapel Kopien in seine Aktentasche; um jeden Blickkontakt zu vermeiden, stiehlt er sich dann seitwärts wieder aus dem Raum. Er poltert die Treppe wieder hinunter und geht durch den jetzt leeren Korridor, den Blick fest auf den Ausgang geheftet – da lässt eine junge weibliche Stimme ihn innehalten.
Obwohl die Glocke zum Ende der letzten Schulstunde schon vor gut fünf Minuten geklingelt hat, ist im Geografiezimmer der Unterricht offenbar noch in vollem Gang. Howard bückt sich leicht und späht durch das schmale Türfenster. Die Jungen drinnen lassen keine Ungeduld erkennen; sie scheinen gar nicht zu merken, wie die Zeit vergeht.
Der Grund dafür steht vor der Klasse. Sie heißt Miss McIntyre und ist eine Vertretung. Howard hat sie ein paar Mal kurz im Lehrerzimmer und auf dem Gang gesehen, aber noch keine Gelegenheit gehabt, mit ihr zu sprechen. In den dämmrigen Tiefen des Geografieraums zieht sie die Blicke auf sich wie eine Flamme. Sie hat eine füllige blonde Haarmähne, wie man sie sonst nur in Shampoowerbespots sieht, und trägt ein todschickes magnolienfarbenes Kostüm, das besser in einen Sitzungssaal passen würde als in ein Schulzimmer der Orientierungsstufe; ihre Stimme ist weich und melodisch, hat aber auch etwas Autoritäres, einen befehlsgewohnten Unterton. In der Armbeuge hält sie einen Globus, den sie beim Sprechen geistesabwesend streichelt wie einen dicken, verwöhnten Kater; fast meint man ihn schnurren zu hören, während er sich träge unter ihren Fingerspitzen dreht.
»… dicht unter der Erdoberfläche«, sagt sie gerade, »so hohe Temperaturen, dass sogar das Gestein geschmolzen ist – kann mir jemand sagen, wie man das nennt, dieses geschmolzene Gestein?«
»Magma«, krächzen mehrere Jungen gleichzeitig.
»Und wie nennt man es, wenn es aus einem Vulkan an die Oberfläche geschleudert wird?«
»Lava«, antworten sie mit bebender Stimme.
»Sehr gut! Und vor Jahrmillionen gab es eine ungeheuer rege vulkanische Aktivität: Magma quoll ununterbrochen zur gesamten Erdoberfläche auf. Die Landschaft, die wir heute kennen« – sie fährt mit einem lackierten Fingernagel einen Bergrücken hinab – »ist zum größten Teil in dieser Epoche entstanden, als der ganze Planet dramatischen physikalischen Veränderungen unterworfen war. Man könnte das vielleicht die Teenagerzeit der Erde nennen!«
Die Schüler erröten allesamt bis an die Haarwurzeln und schauen in ihre Lehrbücher. Sie lacht erneut und lässt den Globus rotieren, zupft mit den Fingerspitzen an ihm wie ein Bassist an den Saiten seines Instruments und schaut dann auf ihre Uhr. »Ach, du meine Güte! Ach, ihr Ärmsten, ich hätte euch ja schon vor zehn Minuten entlassen müssen! Warum hat denn keiner was gesagt?«
Die Jungen murmeln Unverständliches, ohne von ihren Büchern aufzuschauen.
»Na gut, also …« Sie dreht sich um und schreibt die Hausaufgabe an die Tafel, so weit oben, dass ihr der Rock bis über die Kniekehlen hochrutscht; wenige Augenblicke danach öffnet sich die Tür, und die Jungen trotten widerstrebend hinaus. Howard tut so, als betrachte er am Schwarzen Brett interessiert die Fotos vom letzten Ausflug des Bergwanderclubs auf den Djouce Mountain, und späht aus dem Augenwinkel, bis der Strom der grauen Pullover versiegt ist. Als sie dann immer noch nicht auftaucht, geht er zurück, um nachzu…
»Ups!«
»O Gott, Entschuldigung!« Er geht neben ihr in die Hocke und hilft ihr, die vielen Blätter einzusammeln, die auf den schmutzigen Boden gefallen sind. »Tut mir schrecklich leid, ich hab Sie gar nicht gesehen. Ich wollte gerade zu … einer Besprechung, und in der Eile …«
»Schon gut«, sagt sie, »danke«, während er noch ein paar Landkarten auf den Stapel legt, den sie wieder auf den Armen hält. »Danke«, wiederholt sie und schaut ihm direkt in die Augen, und das tut sie auch weiter, während sich beide synchron aufrichten, sodass Howard, unfähig, den Blick abzuwenden, einen Moment lang in Panik gerät, als wären sie irgendwie aneinandergekettet, wie die Kids in den apokryphen Geschichten, die sich beim Küssen mit ihren Zahnspangen ineinander verhaken und von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden müssen.
»Tut mir leid«, sagt er noch einmal mechanisch.
»Hören Sie auf, sich zu entschuldigen«, sagt sie lachend.
Er stellt sich vor. »Ich bin Howard Fallon. Ich gebe Geschichte. Und Sie sind die Vertretung für Finian Ó Dálaigh?«
»Stimmt«, sagt sie. »Er ist anscheinend bis Weihnachten krankgeschrieben; ich weiß nicht, was er hat.«
»Gallensteine«, sagt Howard.
»Oh«, sagt sie.
Howard wünschte, er könnte die Gallensteine ungesagt machen. »Tja«, setzt er mühsam neu an, »eigentlich bin ich auf dem Heimweg. Kann ich Sie mitnehmen?«
Sie legt den Kopf schräg. »Wollten Sie nicht in eine Besprechung?«
»Doch. Aber so wichtig ist die auch wieder nicht.«
»Ich bin auch mit dem Auto hier, trotzdem danke«, sagt sie. »Aber wenn Sie möchten, könnten Sie mir die Bücher abnehmen.«
»Okay«, sagt Howard. Wahrscheinlich hat sie es ironisch gemeint, doch bevor sie ihr Angebot zurückziehen kann, nimmt er ihr den Stapel Ordner und Bücher aus den Händen, ignoriert die mörderischen Blicke von einem Grüppchen ihrer Schüler, die noch auf dem Flur herumlungern, und geht neben ihr her zum Ausgang.
»Und, wie finden Sie’s?«, fragt er, um das Gespräch wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu bringen. »Haben Sie schon viel unterrichtet, oder ist es das erste Mal für Sie?«
»Ach« – sie pustet sich eine goldene Haarsträhne aus der Stirn –, »ich bin gar nicht Lehrerin von Beruf. Eigentlich tue ich nur Greg einen Gefallen. Mr. Costigan, meine ich. Mein Gott, ich hatte diesen Miss- und Mister-Quatsch schon fast vergessen. Klingt richtig komisch: Miss McIntyre.«
»Die Lehrkräfte dürfen sich mit Vornamen anreden.«
»Mhm … Aber, ehrlich gesagt macht’s mir richtig Spaß, Miss McIntyre zu sein. Wie auch immer, Greg und ich haben uns irgendwann mal unterhalten, und er hat gesagt, dass sie Probleme hätten, eine gute Vertretung zu finden, und da ich vor langer Zeit mal Lehrerin werden wollte und gerade etwas Zeit hatte bis zu meiner nächsten Anstellung, hab ich mir gedacht, warum nicht?«
»Und was machen Sie normalerweise?« Er hält ihr die Tür auf, und sie treten in die jetzt kalte und trockene Herbstluft hinaus.
»Investmentbanking.«
Howard nimmt diese Auskunft bewusst neutral entgegen, dann sagt er beiläufig: »Auf dem Gebiet war ich früher auch tätig. Zwei Jahre in der City. Futures hauptsächlich.«
»Und warum jetzt nicht mehr?«
Er grinst. »Lesen Sie keine Zeitungen? No Future in Futures.«
Sie reagiert nicht, wartet auf eine ernsthafte Antwort.
»Na ja, wahrscheinlich werde ich irgendwann doch wieder da landen«, platzt er heraus. »Das hier mache ich eigentlich nur vorübergehend. Irgendwie bin ich da reingerutscht. Andererseits ist es auch ganz nett, finde ich – mal was zurückgeben zu können. Das Gefühl zu haben, dass man was Sinnvolles tut.« Sie gehen um den Parkplatz der Abschlussklasse herum, auf dem viele Lexus und Audi TT stehen – Howard wird mulmig, als sein eigenes Auto in Sicht kommt.
»Wo kommen denn die vielen Federn da her?«
»Ach, das ist nichts.« Er fährt mit der Hand über das Autodach und schaufelt einen ganzen Berg weißer Federn hinunter. Sie wirbeln zu Boden, doch ein paar schweben wieder nach oben und heften sich an seine Hosenbeine. Miss McIntyre tritt einen Schritt zurück. »Das ist bloß … äh, eine Art Streich, den mir die Jungen spielen.«
»Die nennen Sie Howard Hasenherz«, bemerkt sie im Tonfall einer Touristin, die sich nach der Bedeutung eines rätselhaften lokalen Ausdrucks erkundigt.
»Ja.« Howard lacht freudlos und streift noch mehr Federn von Windschutzscheibe und Kühlerhaube, ohne eine Erklärung abzugeben. »Wissen Sie, eigentlich sind das nette Jungs, hier an der Schule, aber ein paar von ihnen, na ja, die schlagen schon mal gern über die Stränge.«
»Da muss ich ja aufpassen«, sagt sie.
»Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Prozentsatz. Die meisten … Ich meine, alles in allem ist es sehr schön, hier arbeiten zu können.«
»Sie sind voller Federn«, bemerkt sie umsichtig.
»Ja«, knurrt er, wischt sich oberflächlich die Hosenbeine ab und rückt seine Krawatte zurecht. Ihre Augen, die von einem leuchtenden, blendenden Blau sind, wie dafür gemacht, spöttisch zu funkeln, funkeln ihn spöttisch an. Howard hat für heute genug Demütigungen erlebt; er will sich gerade mit den schäbigen Resten seiner Würde empfehlen, als sie ihn fragt: »Und, wie ist es so, Geschichte zu unterrichten?«
»Wie es ist?«
»Ich genieße es richtig, mich wieder mit Geografie zu beschäftigen.« Sie schaut verträumt in den eisblauen Himmel, nach den sich gelb färbenden Bäumen. »Wissen Sie, diese titanischen Kämpfe zwischen verschiedenen Kräften, die tatsächlich die Erde geformt haben, auf der wir heute herumlaufen … das ist so dramatisch …« Sie drückt sinnlich die Hände aneinander, eine Göttin, die aus roher Materie Welten formt, dann richtet sie ihre Augen wieder auf Howard. »Und Geschichte – das muss doch riesigen Spaß machen!«
Das ist zwar nicht das erste Wort, das Howard in diesem Zusammenhang einfallen würde, aber er belässt es bei einem verbindlichen Lächeln.
»Was nehmen Sie denn gerade durch?«
»Tja, wir sind jetzt beim Ersten Weltkrieg.«
»Oh!« Sie klatscht in die Hände. »Ich liebe den Ersten Weltkrieg. Da sind die Jungs sicher mit Feuereifer dabei.«
»Sie würden sich wundern«, sagt er.
»Sie sollten ihnen Robert Graves vorlesen«, sagt sie.
»Wen?«
»Der war in den Schützengräben«, erwidert sie. Nach einer Pause fügt sie hinzu: »Außerdem war er einer der ganz großen Liebesdichter.«
»Ich seh ihn mir mal an«, sagt er stirnrunzelnd. »Sonst noch irgendwelche Tipps für mich? Irgendwelche Lehren, die Sie aus Ihren ersten fünf Tagen als Lehrkraft gezogen haben?«
Sie lacht. »Wenn ich noch auf etwas stoße, sag ich’s Ihnen, versprochen. Anscheinend können Sie ja einen Rat gut gebrauchen.« Sie nimmt Howard die Bücher ab und zielt mit ihrem Autoschlüssel auf einen riesigen weißgoldenen SUV, der neben Howards ramponiertem Bluebird steht. »Bis morgen«, sagt sie.
»Genau«, sagt Howard.
Aber sie rührt sich nicht, und er auch nicht: Einen Moment lang hält sie ihn einzig mit dem Licht ihrer spektakulären Augen fest. Sie mustert ihn, die Zungenspitze im Mundwinkel, als überlegte sie, was es zum Abendessen geben soll. Dann entblößt sie kokett lächelnd eine Reihe weiß blinkender Zähne und sagt: »Damit Sie’s wissen: Ich werde nicht mit Ihnen schlafen.«
Erst denkt Howard, er habe sich verhört, und als ihm klar wird, dass sie es doch gesagt hat, ist er immer noch zu baff, um zu antworten. Er steht einfach nur da oder schwankt vielleicht ein bisschen. Sie steigt in ihren Jeep, und als sie losfährt, wirbeln weiße Federn um seine Beine.
Die Tür geht quietschend auf, und du gehst hinein in den Großen Saal. Spinnweben überall, sie schweben vom Fußboden zur Decke wie die Schleier von tausend verlassenen Bräuten. Du schaust auf die Karte und gehst durch eine Tür am anderen Ende des Saals. Dieser Raum war früher die Bibliothek; der Boden ist mit verstaubten Bücherstapeln bedeckt. Auf dem Tisch liegt eine Schriftrolle, doch bevor du sie lesen kannst, springt die alte Standuhr auf, und ein, zwei, drei Zombies stürzen sich auf dich! Du wehrst sie fackelschwingend ab und läufst geduckt auf die andere Seite des Tisches, aber dann tauchen noch mehr in der Tür auf, angelockt durch den Geruch von lebendigem Fleisch –
»Skippy, das ist stinklangweilig.«
»Ja, Skip, meinst du, du könntest mal wen anders ranlassen?«
»Ich bin gleich so weit«, murmelt Skippy, während ihn die Zombies die gebrechliche Treppe hinauf verfolgen.
»Was meint ihr, was diese Zombies den ganzen Tag machen?«, fragt sich Geoff. »Wenn keiner da ist, den sie fressen können?«
»Sie bestellen sich eine Pizza«, sagt Dennis. »Die Marios Dad liefert.«
»Ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass mein Vater kein Pizzabote ist, er ist ein wichtiger Diplomat an der italienischen Botschaft«, blafft Mario.
»Nein, im Ernst, wann geht da schon jemand rein, in denen ihr Spukhaus? Und was machen die, laufen sie den ganzen Tag rum und jammern sich gegenseitig was vor?«
»Die hören sich an wie meine Eltern«, findet Geoff. Er steht auf, streckt die Arme aus, tapert im Zimmer herum und sagt mit zombiehafter Grabesstimme: »Geoff … bring den Abfall raus … Geoff … ich finde meine Brille nicht … Wir müssen große Opfer bringen, um dich auf diese Schule zu schicken, Geoff …«
Skippy wollte, sie würden aufhören zu reden. Etwas Heißes windet sich um sein Gehirn wie eine fette Schlange, eng und immer enger, sodass seine Augenlider schwer werden … Und jetzt verdunkelt sich für eine Sekunde der Bildschirm, gerade so lange, dass sich ein zerlumpter Arm um seinen Hals schlingen kann. Er schreckt aus dem Schlaf hoch, versucht sich zu befreien, aber es ist zu spät, sie stürzen sich auf ihn, zerren ihn zu Boden, bedrängen ihn so, dass er sich selbst nicht mehr sehen kann; ihre langen Nägel sausen durch die Luft, ihre verfaulten Zähne knirschen, und das kleine rotierende Licht, das seine Seele ist, wirbelt zur Decke hinauf …
»Game over, Skippy«, sagt Geoff mit Zombiestimme und legt ihm schwer die Hand auf die Schulter.
»Na endlich«, sagt Mario. »Können wir jetzt was anderes spielen?«
Skippys Zimmer liegt wie alle Schülerzimmer im Turm, der sich am Ende von Our Lady’s Hall befindet und der allerälteste Teil von Seabrook ist. In grauer Vorzeit, als die Schule gebaut wurde, aß und schlief die gesamte Schülerschaft hier und wurde auch hier unterrichtet; heutzutage sind die meisten Schüler Externe: Unter den zweihundert jedes Jahrgangs sind nur zwanzig oder dreißig arme Seelen, die nach dem Klingeln hierher müssen. Irgendwelche Harry-Potter-Fantasien werden schnell erstickt: Das Leben in dem Turm, einem uralten Gemäuer, das hauptsächlich aus Zugluft besteht, hat überhaupt nichts Magisches an sich, ist man doch auf Gedeih und Verderb verrückten Lehrern, Schikanen von älteren Mitschülern, Fußpilzepidemien usw. ausgeliefert. Es gibt aber auch Tröstliches. An einem Punkt in ihrem Leben, an dem ihre wundervollen, fürsorglichen Elternhäuser zu unerträglichen Guantánamos geworden sind und jeder Tag, den sie von ihren Gleichaltrigen getrennt verbringen müssen, im besten Fall als eine geisttötende Werbesendung für Dinge wahrgenommen wird, die keiner haben will, und im schlimmsten als eine Folter, nicht unähnlich einer veritablen Kreuzigung, genießen die Internatsschüler ein gewisses Ansehen bei ihren Kameraden. Sie strahlen eine Art Freiheitsglanz aus; sie können sich eine Aura des Geheimnisvollen zulegen, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Mums oder Dads auftauchen und die Show platzen lassen, indem sie lustige Geschichten von »Missgeschicken« erzählen, die ihre Kinder hatten, als sie noch klein waren, oder sie coram publico ermahnen, doch bitte nicht wie ein Perverser mit den Händen in den Hosentaschen herumzulaufen.
Aber das Beste am Internatsleben ist unbestritten, dass man, trotz des fieberhaften Bäumepflanzens der Patres, vom Turm aus in den Hof von St. Brigid’s schauen kann, der Mädchenschule nebenan. Jeden Morgen, Mittag und Abend hallt die Luft wider von glockenhellen Mädchenstimmen, und abends, bevor sie die Vorhänge zuziehen, kann man, ohne auch nur durchs Fernrohr schauen zu müssen – und das ist gut, denn Ruprecht ist sehr eigen darin, wofür sein Fernrohr benutzt wird, und hält es stets auf die mädchenfreien Bereiche des Firmaments gerichtet –, seine weiblichen Pendants in den oberen Fenstern herumgehen, reden, sich das Haar bürsten oder, will man Mario glauben, sogar nackt Aerobics machen sehen. Näher kommt man allerdings nie an sie heran, denn obwohl es ständiger Gegenstand von Plänen und aufschneiderischen Berichten ist, hat es noch keiner erwiesenermaßen geschafft, die Mauer zwischen den beiden Schulen zu überwinden. Und es ist auch noch nie einer am Hausmeister von St. Brigid’s und seinem berüchtigten Hund Nipper vorbeigekommen, ganz zu schweigen von der furchterregenden Geisternonne, die angeblich nächtens über das Schulgelände wandelt und, je nachdem, mit wem man redet, entweder ein Kruzifix oder eine Zickzackschere schwingt.
Ruprecht Van Doren, der Besitzer des Fernrohrs und Skippys Zimmergenosse, ist nicht wie die anderen Jungen. Er ist im Januar nach Seabrook gekommen, wie ein verspätetes und nicht mehr umtauschbares Weihnachtsgeschenk, nachdem seine Eltern bei einer Kajakexpedition den Amazonas hinauf ums Leben gekommen waren. Vor ihrem Tod war er zu Hause von Privatlehrern unterrichtet worden, die auf Geheiß seines Vaters, Baron Maximilian Van Doren, aus Oxford eingeflogen wurden, und daher hat er eine ganz andere Einstellung zu Bildung und Ausbildung als seine Kameraden. Für Ruprecht ist die Welt ein Kompendium faszinierender Fakten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, und jedes knifflige mathematische Problem wie das Eintauchen in ein schönes warmes Wannenbad. Wer sich auch nur flüchtig im Zimmer umschaut, bekommt eine Vorstellung von seinen derzeitigen Projekten und Interessen. An den Wänden hängen Karten jeder Art – Karten vom Mond, vom nahen und fernen Sternhimmel, eine Weltkarte, auf der kleine Stecknadeln die Schauplätze jüngerer Ufo-Sichtungen markieren –, aber auch ein Bild von Einstein und Ergebniszettel von herausragenden Siegen im Kniffeln. Das Fernrohr, mit einem Schild, auf dem in schwarzen Buchstaben NICHT BERÜHREN steht, zeigt aus dem Fenster. Am Fußende des Bettes glänzt wichtigtuerisch ein Waldhorn. Auf dem Schreibtisch, hinter einem Stapel unverständlicher Ausdrucke, ist sein Computer mit geheimnisvollen Operationen beschäftigt, deren Sinn und Zweck nur seinem Besitzer bekannt sind. So eindrucksvoll das alles bereits ist, verkörpert es doch nur einen Bruchteil von Ruprechts Aktivitäten, die sich zum größten Teil in seinem »Labor« abspielen, einer der muffigen Kammern im Kellergeschoss. Hier unten, umgeben von weiteren Computern und Computerteilen, Stapeln unergründlicher Papiere und elektronischer Geräte, konstruiert Ruprecht Gleichungen, führt Experimente durch und widmet sich dem, was er für den Heiligen Gral der Naturwissenschaft hält: dem Ursprung des Universums.
»Letzte Meldung, Ruprecht: Der Ursprung des Universums ist bekannt. Man nennt ihn Urknall.«
»Aha. Und was war vor dem Knall? Was war währenddessen? Und was hat da geknallt?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Siehst du, genau das ist der Punkt. Von Sekunden nach dem Urknall bis heute ist das Universum erklärbar, will sagen, es gehorcht erkennbaren Gesetzen, Gesetzen, die man in der Sprache der Mathematik ausdrücken kann. Geht man aber weiter zurück, bis zum allerersten Anfang, dann gelten diese Gesetze nicht mehr. Die Gleichungen gehen nicht auf. Wenn wir sie aber lösen könnten, wenn wir wüssten, was in diesen ersten Millisekunden abgelaufen ist – dann wäre das wie ein Generalschlüssel, der alle möglichen anderen Türen öffnen würde. Professor Hideo Tamashi glaubt, die Zukunft der Menschheit könnte davon abhängen, dass es uns gelingt, diese Türen zu öffnen.«
Wenn man vierundzwanzig Stunden pro Tag mit Ruprecht eingesperrt ist, hört man viel über diesen Professor Hideo Tamashi und seine bahnbrechenden Versuche, das Rätsel des Urknalls mit Hilfe der zehndimensionalen Stringtheorie zu lösen. Außerdem hört man eine Menge über Stanford, die Universität, an der Professor Tamashi lehrt und die nach Ruprechts Schilderungen eine Art Kreuzung aus einer Spielhalle und der Wolkenstadt in Star Wars sein muss, ein Ort, wo alle Overalls tragen und nie etwas Schlimmes passiert. Praktisch seit er laufen gelernt hat, ist es Ruprechts Herzenswunsch, einmal bei Professor Tamashi zu studieren, und immer, wenn er den Prof. oder Stanford und dessen wirklich erstklassige Laboreinrichtungen erwähnt, tut er das mit einem sehnsüchtigen Unterton, wie jemand, der ein wunderschönes Land beschreibt, das er einmal im Traum gesehen hat.
»Warum gehst du dann nicht einfach hin«, fragt ihn Dennis, »wenn da alles so hammermäßig cool ist?«
»Mein lieber Dennis«, gluckst Ruprecht, »man ›geht‹ nicht einfach an eine Universität wie Stanford.«
Man braucht vielmehr, so scheint es, einen sogenannten Akademischen Lebenslauf, dem der Leiter der Zulassungsstelle entnimmt, dass man noch einen Tick smarter ist als all die anderen smarten Leute, die sich ebenfalls dort bewerben. Daher Ruprechts diverse Forschungsvorhaben, Versuche und Erfindungen, sogar diejenigen – lästern seine Gegner, vor allem Dennis –, die angeblich der Zukunft der Menschheit dienen.
»Dem Schleimscheißer geht die Menschheit doch komplett am Arsch vorbei«, sagt Dennis. »Der will bloß nach Amerika abhauen und andere Streber kennenlernen, die mit ihm kniffeln und sich nicht über sein Übergewicht lustig machen.«
»Ich glaub, das ist ganz schön hart für ihn«, sagt Skippy. »Ihr wisst schon, ein Genie sein und so und dann hier bei uns rumgammeln müssen.«
»Der ist doch kein Genie!«, tobt Dennis los. »Der ist ein falscher Fuffziger!«
»Und seine Gleichungen, Dennis, was ist mit denen?«, fragt Skippy.
»Genau. Und mit seinen Erfindungen?«, fällt Geoff ein.
»Seine Erfindungen? Diese Zeitmaschine, ein mit Alufolie ausgeschlagener, mit einem Wecker verbundener Kleiderschrank? Die Röntgenbrille, die nichts weiter ist als eine stinknormale Brille, die er an die Innenseite eines Toasters geklebt hat? Wer kann denn so was für Arbeiten eines ernsthaften Wissenschaftlers halten?«
Dennis und Ruprecht vertragen sich nicht. Der Grund ist kaum zu übersehen: Zwei unterschiedlichere Jungen kann man sich schwerlich vorstellen. Ruprecht ist immer wieder von der Welt um ihn herum fasziniert, er beteiligt sich eifrig am Unterricht und stürzt sich auf alle möglichen außerschulischen Aktivitäten. Dennis hingegen, ein eingefleischter Zyniker, der sogar sarkastische Träume hat, hasst die Welt und alles, was in ihr ist, vor allem Ruprecht, und hat sich noch nie auf etwas gestürzt, mit Ausnahme einer weitgehend erfolgreichen Kampagne letzten Sommer, mit dem Ziel, das Wort »Kanal« überall dort, wo es im Großraum Dublin in Erscheinung trat, seines Anfangsbuchstabens zu berauben, sodass nun auf zahllosen Schildern KÖNIGLICHER ANAL, ACHTUNG! ANAL und GRAND ANAL HOTEL ZU lesen stand. In Dennis’ Augen ist die ganze Person Ruprecht Van Doren nichts weiter als ein großmäuliger Mischmasch aus schwachsinnigen Internettheorien und hochgestochenen Redensarten, die er aus dem Discovery Channel hat.
»Aber Dennis, warum sollte er sich so was denn aus den Fingern saugen?«
»Warum tut irgendjemand irgendwas in diesem Kackloch? Weil er was Besseres sein will als wir. Glaub mir, der ist genauso wenig ein Genie wie ich. Und wenn du mich fragst: Dass er Waise ist, das hat er sich auch bloß ausgedacht.«
An diesem Punkt wird es Dennis’ Zuhörern endgültig zu bunt. Sicher, es stimmt, dass Ruprecht seine Exeltern weitgehend im Ungefähren lässt, abgesehen von einer gelegentlichen Bemerkung über die Reiterkünste seines Vaters, für die er »rheinauf, rheinab berühmt« gewesen sei, oder einer flüchtigen Erwähnung seiner Mutter, »einer zarten Frau mit ästhetischen Händen«. Und es stimmt auch, dass einerseits Ruprecht jetzt behauptet, sie seien Botaniker gewesen und bei einer Kajakfahrt den Amazonas hinauf auf der Suche nach einer seltenen Heilpflanze ums Leben gekommen, andererseits aber Martin Fennessy berichtet, Ruprecht habe ihm kurz nach seiner Ankunft erzählt, sie seien Profikajakfahrer gewesen und bei der Teilnahme an einem Kajakrennen rund um die Welt ertrunken. Aber niemand glaubt, dass er oder sonst irgendjemand, vielleicht mit Ausnahme von Dennis selbst, das schlechte Karma mit etwas derart Gefährlichem herausfordern würde wie Lügen über den Tod der eigenen Eltern zu verbreiten.
Das soll nicht heißen, dass Ruprecht einem nicht auf den Geist geht oder nicht Gift für den eigenen Coolnessfaktor ist. Es hat eindeutig seine Nachteile, sich mit Ruprecht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber Fazit ist und bleibt, dass Skippy ihn aus unerfindlichen Gründen tatsächlich mag; und nun liegen die Dinge so, dass man, wenn man mit Skippy befreundet ist, Ruprecht in Kauf nehmen muss wie einen zweihundert Pfund schweren Trostpreis.
Und inzwischen haben ihn auch einige andere ins Herz geschlossen. Vielleicht hat Dennis recht und er redet nonstop Blödsinn – trotzdem ist es eine Abwechslung nach allem anderen, was sie dieser Tage zu hören bekommen. Man verbringt ja einen großen Teil seiner Kindheit vor dem Fernseher und denkt, dass man alles, was man da sieht, eines Tages selbst erleben wird: ein Formel-1-Rennen gewinnen, Trainhopping machen, einer Terroristengruppe das Handwerk legen, zu jemandem »Geben Sie mir die Waffe« sagen usw. Dann kommt man in die höhere Schule, und plötzlich fragen einen alle nach beruflichen Plänen und langfristigen Zielen, und mit Zielen meinen sie nicht die, die man dereinst im FA-Cup zu erreichen hofft. Nach und nach dämmert einem die schreckliche Wahrheit – dass die Zukunft nicht die Achterbahnfahrt sein wird, die man sich vorgestellt hat, dass die Welt der Eltern, die Welt, in der man abwaschen, zum Zahnarzt gehen und am Wochenende im Baumarkt Bodenfliesen kaufen muss, weitgehend das ist, was die Leute meinen, wenn sie »Leben« sagen. Jeden Tag scheint sich jetzt eine weitere Tür zu schließen, die etwa, auf der PROFISTUNTMAN oder KAMPF GEGEN BÖSEN ROBOTER steht, bis dann im Lauf der Wochen auch die Türen mit Aufschriften wie VON EINER SCHLANGE GEBISSEN WERDEN, DIE WELT VOR EINEM ASTEROIDEN RETTEN oder IN LETZTER SEKUNDE EINE BOMBE ENTSCHÄRFEN eine nach der anderen zufallen und man das Geräusch allmählich sogar mag und anfängt, einige Türen selbst zu schließen, auch solche, die ruhig offen bleiben könnten …
Am Beginn dieses Prozesses – wenn man mit dieser brutalen Ernüchterung konfrontiert wird, die zum Erwachsenwerden dazuzugehören scheint, mehr noch als verrücktspielende Drüsen und die Entdeckung der Mädchen – ist es seltsam tröstlich, sich Ruprechts durchgeknallte Theorien anzuhören.
»Stellt euch das mal vor«, sagt er und schaut aus dem Fenster, während ihr anderen euch um den Nintendo drängt, »dass alles, was ist, alles, was je gewesen ist – jedes Sandkorn, jeder Wassertropfen, jeder Stern, jeder Planet, ja sogar Raum und Zeit selbst –, in einen einzigen dimensionslosen Punkt gestopft ist, für den keine Regeln oder Gesetze gelten und der nur darauf wartet, hinauszufliegen und sich in die Zukunft zu verwandeln. So gesehen ist der Urknall ein bisschen wie die Schule, oder?«
»Was?«
»Ruprecht, was faselst du denn da?«
»Na ja, ich will damit sagen, eines Tages gehen wir alle hier weg und werden Wissenschaftler und Bankangestellte und Tauchlehrer und Hotelchefs – die Substanz der Gesellschaft, sozusagen. Aber bis dahin wird diese Substanz, will sagen, wir, die Zukunft, in diesen winzigkleinen Punkt gestopft, wo keins der Gesetze der Gesellschaft Gültigkeit hat. Also in die Schule.«
Verständnisloses Schweigen und dann: »Ich sag dir den Unterschied zwischen der Schule hier und dem Urknall: Der besteht darin, dass es im Urknall kein Partikel gibt, das wie Mario ist. Aber verlass dich drauf, wenn es eins gibt, dann ist es das große Hengstpartikel, und es bumst die glücklichen Damenpartikel die ganze Nacht.«
»Ja«, erwidert Ruprecht ein bisschen traurig; und dann wird er still dort an seinem Fenster, isst einen Doughnut und betrachtet die Sterne.
Howard the Coward – Howard Hasenherz: Ja, so nennen sie ihn. Howard Hasenherz. Federn, Eier auf seinem Stuhl, einmal sogar ein ganzes Tiefkühlhuhn da auf dem Pult, verschnürt, picklig, gedemütigt.
»Das liegt nur daran, dass Coward sich auf Howard reimt«, meint Halley. »Wenn du Ray heißen würdest, würden sie Gay Ray zu dir sagen. Oder aus Mary würden sie Scary Mary machen. Die ticken einfach so. Das hat nichts zu bedeuten.«
»Es bedeutet, dass sie’s wissen.«
»Du meine Güte, Howard, ein winziger Aussetzer, und das vor so vielen Jahren. Woher sollten die das wissen?«
»Sie wissen es aber.«
»Und wenn schon. Ich weiß, dass du kein Feigling bist. Das sind doch noch Kinder, die können dir nicht in die Seele schauen.«
Aber sie irrt sich. Genau das können sie eben doch. Die Jungen – seine Schüler – sind alt genug, um im Prinzip schon ziemlich gut zu verstehen, wie die Welt funktioniert, aber auch jung genug, um sich ihre Urteilsfähigkeit nicht durch so etwas wie Nachsicht oder Mitleid trüben zu lassen oder durch die Einsicht, dass dies alles eines Tages auch ihnen passieren wird. Damit sind sie bestens dafür gerüstet, den Apparat der Weltlichkeit, mit dem sich die Erwachsenenwelt, verkörpert durch ihre Lehrer, umgibt, bis auf den knirschenden Grund seines leeren Herzens zu durchschauen. Sie finden ihn erheiternd. Und die Namen, die sie den anderen Lehrern geben, treffen mit schlafwandlerischer Sicherheit ins Schwarze: Malco-Alko. Fettsack Johnson. Lurch.
Howard Hasenherz. Scheiße! Von wem weiß sie das?
Der Wagen springt beim dritten Versuch an und zuckelt an schwatzenden, sich mit Kastanien bewerfenden Grüppchen von Jungen entlang zum Tor, wo sich ein Rückstau von Autos gebildet hat, die auf eine Lücke im fließenden Verkehr warten. Vor Jahren, an ihrem allerletzten Schultag, sind Howard und seine Freunde noch einmal unter eben diesem Tor – über das sich im Bogen der goldene Schriftzug SEABROOK COLLEGE spannt – stehen geblieben und haben der Einrichtung, die sie jetzt ernährt, den Stinkefinger gezeigt, bevor sie hindurchgegangen sind, hinaus in das aufregende Panorama von Leidenschaft und Abenteuer, das den Schauplatz für ihr Erwachsenenleben abgeben würde. Manchmal – oft sogar – fragt er sich, ob er sich durch diese kleine Geste, in einem ansonsten gesten- und widerspruchsfreien Leben, selbst dazu verurteilt hat, hierher zurückzukehren und den Rest seiner Tage damit zuzubringen, dieses einzige Zeichen der Auflehnung auszulöschen. Gott hat etwas übrig für solch plumpe Ironie.
Er ist jetzt an der Spitze der Schlange und setzt den rechten Blinker. Über der Stadt sind die zerfaserten Anfänge eines Abendrots zu sehen, eine verschwenderische Mischung aus Magenta- und Karmintönen; er sitzt da, und verspätet fallen ihm witzige Entgegnungen ein, eine nach der anderen.
Sag niemals nie.
Das glaubst du.
Besser, man heult mit den Wölfen.
Das Auto hinter ihm hupt, als sich eine Lücke auftut. In letzter Sekunde wechselt Howard den Blinker und biegt nach links ab.
Halley telefoniert, als er heimkommt; sie schwenkt mit ihrem Stuhl herum, verdreht die Augen und macht mit der Hand ein Blablazeichen. Die Luft ist geschwängert vom Zigarettenrauch eines ganzen Tages, und der Aschenbecher quillt über von zerdrückten Kippen und abgebrannten Streichhölzern. Er formt mit den Lippen ein lautloses Hi und geht ins Bad. Sein Handy klingelt, während er sich die Hände wäscht. »Farley«, sagt er leise.
»Howard?«
»Ich hab dich dreimal angerufen, wo warst du denn?«
»Ich musste mit meinen Neuntklässlern was für die Projektausstellung erledigen. Was ist denn? Alles in Ordnung. Ich versteh dich kaum.«
»Moment« – Howard streckt den Arm aus und dreht die Dusche auf. Mit seiner normalen Stimme sagt er: »Hör zu, es ist was sehr –«
»Bist du unter der Dusche?«
»Nein, ich steh davor.«
»Soll ich dich später noch mal anrufen?«
»Nein – hör zu, ich wollte –, mir ist vorhin was ganz Komisches passiert. Ich hab mich mit dieser Neuen unterhalten, der Vertretung, du weißt schon, sie gibt Geografie –«
»Aurelie?«
»Was?«
»Aurelie. So heißt sie.«
»Woher weißt du das?«
»Wie, woher ich das weiß?«
»Ich wollte sagen«, – er spürt, wie sich seine Wangen röten, »– ich wollte sagen, was ist denn das für ein Name, Aurelie?«
»Das ist französisch. Sie ist Halbfranzösin.« Farley kichert anzüglich. »Welche Hälfte da wohl die französische ist? Geht’s dir gut, Howard? Du klingst ein bisschen daneben.«
»Pass auf, Folgendes: Ich hab gerade vorhin auf dem Parkplatz mit ihr geredet, eine ganz normale Unterhaltung über die Arbeit und wie sie vorankommt, da sagt sie plötzlich zu mir«, – er öffnet die Tür einen Spalt. Halley, das Telefon zwischen Schulter und Wange geklemmt, nickt immer noch und macht Mhmgeräusche, »– sie sagt, sie wird nicht mit mir schlafen!« Er wartet, und als keine Reaktion kommt, fügt er hinzu: »Wie findest du das?«
»Seltsam«, gibt Farley zu.
»Höchst seltsam«, bestätigt Howard.
»Und was hast du geantwortet?«
»Gar nichts. Ich war zu perplex.«
»Du hast dich nicht vorher an ihrem Schenkel gerieben oder so was?«
»Das ist es ja, ich hab das durch nichts provoziert. Wir haben da gestanden und über die Arbeit geredet, und auf einmal sagt sie: ›Damit Sie’s wissen, ich werde nicht mit Ihnen schlafen.‹ Was meinst du, was kann das bedeuten?«
»Na ja, so aus dem Stand würde ich sagen, es bedeutet, dass sie nicht mit dir schlafen wird.«
»Aber wenn man nicht mit jemandem schlafen will, sagt man’s ihm doch nicht, Farley. Man bringt nicht aus heiterem Himmel das Thema Sex aufs Tapet, nur um es dann auszuschließen. Es sei denn, man will eigentlich über Sex reden.«
»Moment – willst du damit sagen, sie hat, als sie dir gesagt hat, sie wird nicht mit dir schlafen, eigentlich gemeint: ›Ich werde mit Ihnen schlafen‹?«
»Klingt das nicht wie eine Herausforderung? Als ob sie sagen will: ›Ich werde jetzt nicht mit Ihnen schlafen, aber wenn sich bestimmte Umstände ändern, könnte ich mit Ihnen schlafen‹?«
»Hmm«, macht Farley, dann sagt er zögernd: »Ich weiß nicht, Howard.«
»Okay, verstehe, sie will mir nur ein bisschen Zeit und Peinlichkeit ersparen, meinst du das? Sie will mir nur helfen? Etwas Sexuelles kann beim besten Willen nicht dahinterstecken?«
»Ich weiß nicht, was sie gemeint hat. Aber ist das nicht sowieso graue Theorie? Du hast doch schon eine Freundin. Und eine Hypothek. Howard?«
»Ja, klar«, sagt Howard ungeduldig. »Ich hab ja nur gemeint, dass es komisch ist, so was zu sagen, das ist alles.«
»Wenn ich du wäre, würde ich mir deswegen keine schlaflosen Nächte machen. Hört sich an, als wär sie der kokette Typ. Wahrscheinlich macht sie das mit jedem so.«
»Ja«, stimmt Howard kurz angebunden zu. »Du, ich muss Schluss machen. Bis morgen.« Er legt auf.
»Hast du da drin mit jemandem geredet?«, fragt ihn Halley, als er herauskommt.
»Ich hab gesungen«, murmelt Howard.
»Gesungen?« Ihre Augen verengen sich. »Hast du überhaupt geduscht?«
»Hm?« Howard geht auf, dass seine Ausrede einen erheblichen Schönheitsfehler hat. »Ja, sicher, ich hab mir nur nicht die Haare gewaschen. Das Wasser ist kalt.«
»Kalt? Wieso denn das? Das kann doch nicht sein.«
»Ich meine, mir war kalt. Unter der Dusche. Deshalb bin ich wieder raus. Ist doch egal.«
»Brütest du was aus?«
»Mir fehlt nichts.« Er setzt sich an die Frühstücksbar. Halley stellt sich neben ihn und mustert ihn aufmerksam. »Ein bisschen fiebrig wirkst du schon.«
»Mir fehlt nichts«, wiederholt er mit mehr Nachdruck.
»Schon gut, schon gut …« Sie geht weg und setzt Wasser auf. Er dreht sich zum Fenster und sagt lautlos den Namen Aurelie vor sich hin.
Sie wohnen einige vierspurige Kilometer von Seabrook entfernt, an der vordersten Front des schleichenden Angriffs der Vororte auf die Dubliner Berge. Als Heranwachsende sind Howard und Farley hier zusammen mit dem Fahrrad herumgefahren, durch von Sonnenglut und Grashüpfern knisternde Märchenwälder. Jetzt sieht es hier aus wie auf einem Schlachtfeld – mit Regenwasser gefüllte Gräben, umgeben von nassen Erdhügeln. Auf der anderen Talseite wird ein Technologiepark gebaut: Jede Woche hat sich die Landschaft wieder etwas mehr verändert, ist eine Erhebung planiert, eine Fläche aufgerissen worden.
Das sagen sie alle.
»Was hast du denn da?« Halley kommt mit zwei Tassen zurück.
»Ein Buch.«
»Was du nicht sagst.« Sie nimmt es ihm aus der Hand. »Robert Graves, Strich drunter!«
»Das hab ich auf dem Heimweg mitgenommen. Erster Weltkrieg. Ich dachte, das gefällt den Jungs vielleicht.«
»Robert Graves, hat der nicht Ich, Claudius geschrieben? Wo sie eine Fernsehserie draus gemacht haben?«
»Weiß ich nicht.«
»Doch.« Sie überfliegt die Rückseite des Buches. »Sieht interessant aus.«
Howard zuckt unverbindlich mit den Schultern. Halley lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück und schaut zu, wie seine Blicke rastlos über den Tresen tanzen. »Wieso bist du denn so komisch?«
Er erstarrt. »Ich? Ich bin doch nicht komisch.«
»Doch.«
Er versucht verzweifelt, sich zu erinnern, wie er sich ihr gegenüber normalerweise verhält. »Es war nur ein langer Tag – o Gott –« Er stöhnt unwillkürlich, als sie eine Zigarette aus ihrer Hemdtasche zieht. »Rauchst du jetzt noch eins von den Dingern?«
»Jetzt fang bloß …«
»Das ist ungesund! Du wolltest doch aufhören.«
»Was soll ich sagen, Howard? Ich bin süchtig. Hoffnungslos und krankhaft süchtig, ein willenloses Opfer der Tabakindustrie.« Sie lässt die Schultern hängen, während die Zigarette aufglüht. »Und schließlich bin ich ja nicht schwanger oder so.«
Ach ja, genau – so geht er normalerweise mit ihr um. Jetzt erinnert er sich wieder. Anscheinend durchlaufen sie gerade eine längere Phase, in der sie nur noch miteinander reden können, wenn sie sich gegenseitig kritisieren und einander unnötige Vorwürfe machen. Wichtiges, Unwichtiges, alles kann einen Streit auslösen, selbst wenn eigentlich keiner von beiden streiten will, selbst wenn er oder sie versucht, etwas Nettes zu sagen oder eine schlichte Tatsache feststellt. Ihre Beziehung ist wie ein defektes Gerät, das nach dem Einschalten nur noch sporadisch läuft und einem einen elektrischen Schlag versetzt, wenn man nach dem Fehler sucht. Die einfachste Lösung wäre natürlich, es gar nicht mehr einzuschalten, sondern sich nach einem neuen umzusehen; über diese Möglichkeit mag er aber noch nicht ernsthaft nachdenken.
»Wie geht’s mit der Arbeit?«, fragt er in versöhnlichem Ton.
»Ach …« Sie macht eine wegwerfende Geste, als müsste sie den Staub des Tages von den Händen schütteln. »Heute Vormittag hab ich einen Testbericht über einen neuen Laserdrucker geschrieben. Dann hab ich fast den ganzen Nachmittag damit zugebracht, jemanden bei Epson an die Strippe zu kriegen, der mir die technischen Daten bestätigt. Die übliche Nervtour.«
»Irgendwelche neuen technischen Wunderwerke?«
»Ja, allerdings …« Sie nimmt ein kleines rechteckiges Silberding von ihrem Schreibtisch und hält es ihm hin. Howard runzelt die Stirn und fingert daran herum – es ist flach wie eine Kreditkarte und kleiner als seine Handfläche.
»Was ist das?«
»Eine Videokamera.«
»Das ist eine Kamera?«
Sie nimmt ihm das Ding aus der Hand, schiebt einen Deckel zurück und gibt es ihm zurück. Die Kamera gibt ein fast unhörbares Surren von sich. Er hält sie in die Höhe und richtet sie auf Halley; ein klares Bild von ihr erscheint auf dem winzigen Display, und in einer Ecke blinkt ein rotes Licht. »Ist ja unfassbar«, sagt er lachend. »Was kann die denn sonst noch?«
»Machen sie jeden Tag zu einem Sommertag!«, liest sie aus der Pressemitteilung vor. »Die Sony JLS9xr weist erhebliche Verbesserungen gegenüber dem Modell JLS700 auf und besitzt darüber hinaus völlig neue Features, vor allem das neue Intelligent Eye System von Sony, das nicht nur eine unerreicht hohe Auflösung liefert, sondern auch über Bildverfeinerung in Echtzeit verfügt; damit werden Ihre Videos lebendiger als das Leben selbst.«
»Lebendiger als das Leben selbst?«
»Die Kamera korrigiert das Bild während der Aufnahme. Sie gleicht schwache Beleuchtung aus, erhöht die Farbsättigung und verleiht den Objekten Glanz.«
»Wow.« Sie senkt leicht den Kopf, während sie ihre Zigarette ausdrückt, und hebt ihn dann wieder. Ihr winziges Abbild auf dem Display wirkt tatsächlich brillanter, kompakter, schärfer – ein rosiger Schimmer auf ihren Wangen, ein Glitzern in ihrem Haar. Als er versuchsweise von dem Bild wegschaut, kommen ihm die echte Halley und die ganze Wohnung plötzlich flau und verwaschen vor. Er schaut wieder auf das Display und zoomt auf ihre Augen, die tiefblau sind und feine weiße Streifen haben; wie Eis, denkt er immer. Sie wirken traurig.
»Und du?«
»Ich?«
»Du wirkst ein bisschen geknickt.« Irgendwie fällt es ihm so leichter, mit ihr zu reden, mit der Kamera als Puffer zwischen ihnen; er wird mutiger dadurch, obwohl sie so nahe bei ihm sitzt, dass er sie berühren könnte.
Sie zuckt resigniert mit den Schultern. »Ich weiß nicht … es ist nur, diese PR-Leute, ach Gott, die klingen schon so, als würden sie sich selbst in Maschinen verwandeln: Stell ihnen irgendeine Frage, und sie liefern dir immer dieselbe stereotype Antwort …« Sie verstummt. Ihre Finger wandern mit der Rückseite über ihre Stirn, fast ohne sie zu berühren; die Kamera registriert dort feine Fältchen, die ihm noch nie aufgefallen sind. Er stellt sie sich vor, wie sie allein hier sitzt und stirnrunzelnd auf den Bildschirm schaut in der Nische im Wohnzimmer, die sie zu ihrem Büro gemacht hat, wo sie von Zeitschriften und Prototypen umgeben ist und nur der Rauch ihrer Zigaretten ihr Gesellschaft leistet. »Ich hab versucht, etwas zu schreiben«, sagt sie nachdenklich.
»Etwas?«
»Eine Geschichte. Ich weiß nicht. Irgendwas.« Auch sie wirkt zufriedener mit diesem Arrangement, davon befreit, ihm in die Augen sehen zu müssen; sie schaut aus dem Fenster, auf den Aschenbecher hinab, drückt ihr Armband gegen die Knochen ihres Handgelenks, knetet es. Howard begehrt sie plötzlich. Vielleicht ist das die Lösung all ihrer Probleme! Er könnte die Kamera ständig tragen, sie irgendwie an seinen Kopf montieren. »Ich hab mich hingesetzt und mir gesagt, dass ich erst wieder aufstehe, wenn ich etwas geschrieben habe. Eine volle Stunde hab ich da gesessen, aber was soll ich dir sagen, ich konnte an nichts anderes denken als an Drucker. Ich bin schon so lange mit dem Zeug hier eingesperrt, dass ich vergessen habe, wie richtige Menschen denken und sich verhalten.« Unglücklich schlürft sie ihren Tee. »Meinst du, es gibt einen Markt für so was, Howard? Romane mit Bürogeräten als Hauptfiguren? Modem Bovary. Der Scanner von Notre-Dame?«