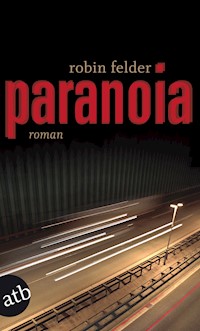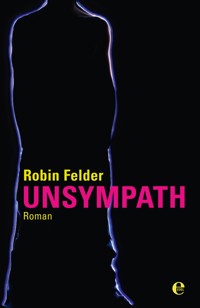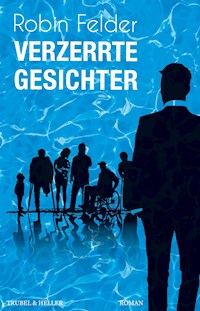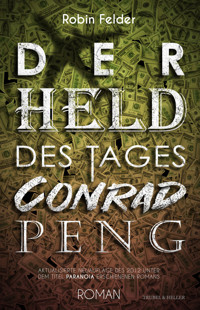
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trubel & Heller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Neuauflage des Romans »Paranoia« von Robin Felder, nun aktualisiert und versehen mit seinem ursprünglichen Titel »Der Held des Tages Conrad Peng«. Es sind phasenweise Aussetzer, die dem einunddreißigjährigen Conrad Peng zunehmend zu schaffen machen. So wenig er sich anschließend an das Geringste erinnern kann, so unmöglich lässt sich sein überhitztes Verhalten erklären. Inzwischen in vollem Bewusstsein, die Kontrolle zu verlieren, schlittert der karrieresüchtige Ressortleiter eines großen Consultingunternehmens von einem selbstzerstörerischen Ereignis zum nächsten, und verursacht dabei nicht zuletzt auch drastische berufliche Schäden. Bis er, durch eine Verkettung surrealer Unwahrscheinlichkeiten, eine Frau vor dem sicheren Tod bewahrt und daraufhin medial zum großen Retter avanciert – während zeitgleich sein Patenschaftskind und einziger emotionaler Anker, der achtjährige Vollwaise Fynn, immer tiefer in einen Gewaltstrudel innerhalb seines Umfelds gesogen wird. Weshalb Conrad Peng die folgenschwere Entscheidung trifft, einzugreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER HELD DES TAGES CONRAD PENG
ROMAN
ROBIN FELDER
INHALT
Über den Autor
Hinweis
I. Der Held des Tages Conrad Peng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
IMPRESSUM
© 2024 Trubel & Heller, München
Erhältlich als Taschenbuch und E-Book.
www.trubelheller.de
Redaktion: Stefan Brill
Umschlagkonzept: Robin Felder
Umschlaggestaltung: Michael Dorschner | kimi kido
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
E-Book-ISBN: 9783989951761
Erstellt mit Vellum
ÜBER DEN AUTOR
Robin Felder lebt und arbeitet in München. Bislang sind von ihm erschienen: Unsympath (2010, edel), Paranoia (2012, atb), The Godjob (2014, T&H) und Verzerrte Gesichter (2020, T&H).
Als Taschenbuch bei Trubel & Heller erhältlich:
Unsympath
Der Held des Tages Conrad Peng
The Godjob
Verzerrte Gesichter
HINWEIS
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Paranoia
bei Aufbau Taschenbuch, Berlin.
Sämtliche handelnden Personen und Begebenheiten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, existierenden Unternehmen sowie Ereignissen oder Schauplätzen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.
„Wer spricht von Siegen?
Übersteh‘n ist alles.“
Rainer Maria Rilke
„Halte grundsätzlich jeden für ein Arschloch,
bis er das Gegenteil bewiesen hat.“
Frank Zappa
01
Wo bin ich? Meine Augen halb geöffnet, wandert mein Blick ziellos suchend umher. Wo bin ich? Wenn ich erst mal weiß, wo ich mich befinde, werde ich bestimmt auch erfahren, wie ich hierhergekommen bin.
In dem grauen Satinkissen hinterlasse ich eine Mulde, als ich meinen Kopf leicht anhebe und auf das Nachtkästchen schiele. Neben zwei flachen Tablettenpackungen und einem Restaurantführer entdecke ich mein Handy und greife nach ihm. Ich richte meinen Oberkörper auf, klappe das Display hoch und prüfe die Uhr. Die Welt bekommt einen zeitlichen Rahmen. 10 Uhr 36.
Geweckt wurde ich eben von einem Traum. Meinem altbekannten Falltraum. Ich stürze kopfüber von der Bahnsteigkante eines S-Bahnhofs, nächtliche ländliche Gegend. Und bevor ich in dem Schotter der Gleise lande – zack –, kurz vor dem Aufprall, wache ich auf. Habe ich jede Nacht mindestens einmal. Richtig ruhig kann ich nur tagsüber schlafen.
Ich reibe mir die Augen, das hilft aber auch nichts. Ich würde sagen, ich bin in einem desolaten Zustand. Mit einem Ruck bringe mich auf der Bettkante in Sitzposition, meine nackten Zehen berühren den kalten Estrich-Fußboden. Erst der linke Fuß, dann der rechte. Abergläubisch bin ich nicht. Das Zimmer ist hell. Was heißt Zimmer? Ein riesiger Raum, grau in grau, hellgraue Betonwände, steingraue Decke. Eher ein Loft. Eine grauweiße Kochnische weit entfernt am anderen Ende der Wand, an der auch eine schmale Couch steht. Grau. Ein wandfüllendes Ölgemälde ohne Rahmen. Modern, abstrakt, die Grundfarbe ist gleichzeitig das Motiv. Der Titel: Asche im Nebel. Ist geraten.
Stilbruch lässt sich dem Innenarchitekten nicht vorwerfen. Die Kundenvorgabe könnte gelautet haben: bewusstes Understatement, inszenierte Lässigkeit, heruntergekommene Atmosphäre. So jedenfalls ist es gedacht gewesen. Siehe auch: Es war sicher teuer, es so billig aussehen zu lassen.
Weiter drüben steht eine fahrbare Kleiderstange mit wenigen farblosen Fetzen, die wie schlaffe Liliputaner an dünnen Drahtbügeln hängen. Daneben ein Standspiegel, zu dessen Rollenfüßen zwei tischtennisballgroße Hausstaubknäuel liegen. In der Mitte des Raums, auf einem weiß getünchten Sockel, der Blickfang: Die lebensgroße Skulptur eines halbnackten Römers im Lendenschurz, der zum Diskuswurf ansetzt.
Durch die eins, zwei, drei, vier Fenster kann ich erkennen, dass Vormittag ist. Das stimmt mit der Uhrzeit schon mal überein. Die knapp unter der Decke endenden Scheiben geben den lautlosen Blick frei auf vorbeieilende Sneakers, Stiefel, Lederslipper, Knöchel, Socken und Hosenbeine ansonsten körperloser Passanten. Menschen vom Schuh bis zum Knie. Ich befinde mich also in einem Souterrain-Loft.
Warm ist es. Und etwas feucht.
Langsam drehe ich meinen Kopf um neunzig Grad, dabei kratze ich mich am Nacken. Nicht, dass es gejuckt hätte.
Wen haben wir denn da? Auf der anderen Seite der französischen Kingsize-Matratze liegt eine brünette Gazelle, so dürr, dass es sich bei ihr entweder um eine dem Tod Geweihte oder ein Model handelt. Hohe Wangenknochen, fein gemeißelte Züge, fast wie retuschiert. Einen Meter zweiundachtzig groß. Mindestens. Kategorie A-Mensch. Grundsätzlich finde ich ja, dass dünne Frauen angezogen und fülligere Frauen ausgezogen am besten aussehen. Ich werde ein wenig wacher.
Sie tut so, als würde sie schlafen. Macht sie gut. Würde sich ihr Brustkorb nicht minimal heben und senken, könnte man auch annehmen, sie sei kürzlich verstorben. Auf die Weltbevölkerung umgesetzt, begehen statistisch gesehen, von einhunderttausend Menschen fünf Frauen Selbstmord – dem stehen neunzehn Männer gegenüber. Dabei wählen Männer konsequentere Methoden, wie Erschießen und Erhängen, wohingegen Damen lieber eine Überdosis Schlafmittel einwerfen. So viel dazu.
Ich stiere die Bohnenstange vorsichtig an, um sie mit meinem Blick nur ja nicht aufzuscheuchen. Ihre Körperhaltung vermittelt einen bewusst zur Schau gestellten Eindruck, wie jemand, der ziemlich stolz auf seine äußere Erscheinung ist.
Phänomen der Jetztzeit: Stolz auf Dinge sein, für die man nichts kann.
Und strenggenommen kann man für nichts was.
Innerhalb des Spielraums, den ein hübsches Gesicht hat, erkenne ich eine Neigung zu Kombilippen: volle Unterlippe, aber dünne Oberlippe. Eben in dem Rahmen, der die Attraktivität nicht beeinträchtigt.
Jetzt stellen sich mir also drei Fragen. Erstens, wo bin ich? Zweitens, wer ist die da? Drittens, was ist geschehen? Na ja, und viertens, seit wann? Das stumm geschaltete Handy zeigt neunundzwanzig entgangene Anrufe und achtzehn Nachrichten an. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt keinen genauen zeitlichen Rückschluss zu. Könnte sich innerhalb eines halben Tages oder dreier Tage angesammelt haben.
Wie bin ich nur in diesen Schlamassel geraten? Vertagung der Frage. Aufstehen? Nach sehr kurzer Überlegung tue ich genau das.
Mein erster nüchterner Gedanke kommt angeflogen, während ich mich im Stehen mit hochgereckten Armen ausgiebig strecke und mir nicht die Mühe mache, meine raushängenden Eier wieder in die Unterhose zu stecken: Ja, richtig, ich bin frischgebackener Partner bei Lutz & Wendelen Consulting, weltweit drittgrößte Unternehmensberatung, Nummer eins in Deutschland. Endlich. Die Visitenkarten sind bereits gedruckt, meine neue Bezeichnung lautet Vice President. Daran werde ich mich nicht lange gewöhnen müssen. Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jemals anders gewesen ist. Entsprechend folgt mein zweiter nüchterner Gedanke auf dem Fuße: Ich finde an meiner Beförderung weniger Gefallen, als ich müsste. Denn bedauerlicherweise bin ich unersättlich. Sobald ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, erhöhe ich sofort meine Erwartungen und finde keine Ruhe, bis auch diese erfüllt sind. Was sich dann natürlich als herb enttäuschend herausstellt und nach einer weiteren, noch höheren Wunschsetzung verlangt. Und so fort.
Die Bettwäsche raschelt. Das Mädchen bewegt sich, rückt einen Arm zurecht. Immer noch wie für ein Foto posierend, das niemand macht. Meine Augenbrauen ziehen sich automatisch nach oben. Sacht bewege ich mich auf meine verkrumpelt in einer Ecke liegende Anzughose zu. Ich greife danach. Ein Bein angewinkelt in die Höhe haltend, ringe ich mit dem Hosenbein, stoße schließlich zur Hälfte mit dem Fuß durch. Plötzliche beträchtliche Gleichgewichtsschwankungen zwingen mich, in dieser grotesken Stellung zu verharren, auf einem Bein zu hüpfen und einen Zappeltanz zu veranstalten, der mich aussehen lassen dürfte wie einen Einbeinigen, dem man die Krücken versteckt hat. Mit jedem Sprung senkt sich die hochgereckte Sohle, und ich erwarte, augenblicklich festen Boden unter ihr zu spüren und meine Statik wiederherzustellen. Wie sich jedoch herausstellt, hat die glatte Estrichfläche andere Pläne. Eben noch springe ich umher. Und einen Moment später befinde ich mich auf meinem Hintern und spüre den harten Beton unter den Pobacken. Peinlich berührt und schmerzverzerrt vergewissere ich mich, ob die anorexische Gastgeberin durch meinen Crash aufgescheucht wurde. Immer noch nicht. Obwohl ich nicht sehr laut war, hätte der Krawall ausreichen dürfen, sie zu wecken. Da ist was oberfaul. Ihre künstliche Leichenstarre könnte also sehr wahrscheinlich heißen: Der Besucher soll bitte keine Spuren hinterlassen und möglichst bald verschwinden. Einverstanden.
Ich hieve mich wieder auf die Füße. Die Welt taumelt ein bisschen, während ich meinen Bauch einziehe, um den obersten Knopf der Hose zuzumachen. Ich ziehe die Socken über und stopfe meine Fersen in die dunkelbraunen Schuhe. Beim Bücken komme ich beinahe wieder ins Straucheln. Als ich das schwere Parfum der Gazelle einatme, fühle mich auf einmal entsetzlich einsam. In meiner Brust gefriert etwas zu Eis. Ich erinnere mich an nichts, aber es sieht ganz danach aus, als ob mit der da was lief. Aber was? Nicht besonders viel, vemute ich. Die Antwort spielt im Grunde auch keine Rolle. Ich hab’s einfach nicht so mit jungen Mädchen.
Ich sehe sie an, als erwarte ich einen Einwand. Und verabscheue mich ein bisschen mehr als üblich.
Mit den Fingern kämme ich mir die Haare, und während ich wie auf Stelzen zur Tür schleiche, stülpe ich mir unordentlich mein weißes Hemd über und stecke meinen rechten Arm in mein anthrazitfarbenes Sakko. Ich drehe die rechte Manschette um ein paar Grad. Dann die linke. Meine Krawatte lege ich mir wie ein Handtuch um den Hals. Auf das Binden des zweifachen Windsorknotens, den ich zu dunklen Anzügen und einfarbiger Krawatte bevorzuge, verzichte ich. Zugunsten raschen Verschwindens. Verabschiedend schaue ich Barbarella noch mal aufmerksam an, um sie für immer zu vergessen. Ihren Namen werde ich wohl nie erfahren.
Die Klinke ist traumhaft leise. Ich ziehe die Tür auf. Die beiden Staubballen unter dem Standspiegel zucken und kriechen in den Luftwirbel. Ich wende mich ab, Blick in Fluchtrichtung.
Der Bordstein liegt genau auf Höhe meiner Augen. Noch mehr Schien- und Wadenbeine laufen im herbstlichen Nebel an mir vorbei. Diesmal mit Klanguntermalung. Die Schrittgeräusche, das Klackern der Absätze, alles klingt seltsam differenziert. Als könnte ich jeden auftretenden Schuh einzeln zuordnen. Ich bin draußen. Nichts wie weg. Langsam schließe ich die Tür, die in entgegenkommend geräuschlosen Angeln hängt. Kurz bevor das Schloss einschnappt, ballen sich meine Kiefermuskeln. Durch den Spalt höre ich eine weibliche Stimme aus der Wohnung dringen.
Ein argwöhnisches, hochgezogenes „Tschüss“.
02
Nur häppchenweise lässt sich die Oktoberluft atmen, so kalt ist es. Ich nehme die eins, drei, fünf Stufen nach oben, gelange auf Bodenniveau und stehe auf dem Gehsteig einer befahrenen Straße. Ein fehlzündendes Moped rauscht vorbei. Der befreiende Moment des Entkommens gewährt mir eine nur allzu kurze Erleichterung, denn schon setzt eine verstärkte Gedankentätigkeit ein, und ich beginne nach Anhaltspunkten zu suchen, anhand derer ich das schwarze Loch meines Erinnerungsausfalls rekonstruieren könnte. Doch ich habe keine Zeit, unsicher zu werden. Ich muss weiter.
Ich drehe mich noch mal um, sehe hinunter auf die Souterraintür, kneife die Augen zusammen und strecke dabei mein Kinn vor. CL steht auf dem Klingelschild aus goldfarbenem Messing. Nichts sonst. CL kann eine Menge heißen. Initialen an der Tür suggerieren definitiv Bedeutsamkeit.
In dem Moment, in dem ich mich wieder abwende, knattert ein Sattelschlepper vorbei, sein schmutziger Wind stinkt unmittelbar nach Diesel. Ich schüttle mein Jackett zurecht, schlage den Kragen hoch, scheine mich dahinter zu verstecken und bewege mich Schritt für Schritt weg von meiner Nachtunterkunft. Meine Gedanken entfernen sich noch viel schneller von ihr.
Die Atmosphäre wiegt schwer wie Blei. Alles wirkt wie von einem Dunstschleier überzogen. Fahler Grünstich, wie nachkoloriert und künstlich vernebelt. Es ergeben sich tausend Schattierungen von entsättigtem Grün. Und letztlich doch so grau wie die Wohnung, aus der ich komme.
Zum Glück muss ich erst jetzt niesen. Und noch mal. Und noch mal. Bei mir bleibt’s nie bei einem Mal.
Die nächsten Minuten gehe ich ziellos geradeaus und malträtiere meinen Verstand regelrecht, wo ich mich aufgehalten haben könnte. Doch meine Hirnregionen geben nichts frei. Was für ein Systemabsturz! Kein lichter Moment. Nicht mal eine schemenhafte, ungenaue Ahnung.
Montagabend, das ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Die Feier zu meiner Beförderung. Im Restaurant des Charles Hotel. Das Essen, Acht-Gänge-Menü, neunzehn Personen, danach in die Bar. Aus. Das ist der Schlusspunkt. Mehr ist da nicht. Ich kann mich einfach an nichts erinnern. Mir wird mehrfach angst und bange, und ich ertappe mich dabei, wie ich einer Erkenntnis den Zugang verweigere. Eine Erkenntnis, die mich neuerdings immer öfter zu erreichen versucht.
Ich setze an, die Straße zu überqueren, werde vom wilden Gehupe eines Linienbusses zurückgescheucht, hebe entschuldigend meinen Arm zum Busfahrer und laufe neben dem wieder beschleunigenden Riesenkasten hastig weiter, bis er mich überholt hat und ich, diesmal aufmerksamer, über die Straße gehe. Ich sollte mich fassen.
Priorität Nummer eins, mich orientieren und aus dieser hilflosen Situation befreien. Wegweiser finden. So was wie eine Stadtplantafel mit einem roten „Sie sind hier“-Klebepunkt.
Die Straße ist eher eine Allee und wird gesäumt von mehrstöckigen Altbauten im Kolonialstil. Monolithisch dastehende Senioren der Architektur. Alle in tadellosem Zustand, keines fällt besonders ins Auge. Hier und da alter Baumbestand. Kopfsteinpflaster auf der Fahrbahn. Eine Brise treibt ein Bonbonpapier darüber. Der Bordstein bedarf neuer Bodenplatten, durch den Großteil der Gehsteigritzen drängt sich moosiges Gras. Die bienenkorbähnlichen Laternen bestehen aus gelbem Glas, aufgespießt von schwarzen Masten. Alles in allem, eine vornehme Gegend.
Derartige Betrachtungen geben mir allerdings noch immer keine genügende Antwort auf meine Frage, wo ich bin. Ich bin wie gelähmt. Bei der schätzungsweise dreißigjährigen Frau mit rosenwangigem Kindergesicht und Pagenschnitt, die mit Einkaufstüten an mir vorbeigeht, C-Mensch, werde ich mich schon mal nicht erkundigen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich bin? Wie hört sich so was denn an? Ich möchte kein Aufhebens um mich machen. Bevor ich jemanden nach etwas frage, brauche ich immer erst eine gewisse Aufwärmphase, während der ich inständig hoffe, dass sich das Problem in der Zwischenzeit von selbst löst.
Ich erreiche eine Kreuzung, an der mir blaue Schilder mitteilen, dass ich mich an der Ecke Seydlitz-/Mauerstraße befinde. Hurra! Das sagt mir gar nichts. Ich schaue umher, enttäuscht von der Nutzlosigkeit dieser Information, und fühle mich ziemlich verloren. Ozeane und Landmassen von daheim entfernt. Ich irre nicht gern ohne Orientierung durch die Fremde. Ich liebe es, mich auszukennen.
Zu allem Überfluss bleibt mein Blick unwillkürlich an einer Doppel-Reklametafel hängen. Links, die Werbung für Feinwaschmittel, ignoriere ich. Nur das rechte Plakat, das von einem bahnbrechenden Haarwuchsmittel kündet, erregt kurz meine Aufmerksamkeit. Natürlich wird die Wundertinktur nicht funktionieren, aber eine höher werdende Stirn raubt einem nun mal den letzten Nerv.
Ich schweife ab. Passiert mir immer öfter.
Gebieterisch und flehend drehe mich zweimal um die eigene Achse, auf der Suche nach einem Anhaltspunkt. Auf den meisten Autokennzeichen steht ein D. Na also. Das ist doch schon mal was. Düsseldorf. Auch auf dem Taxi, das sich mir nähert. D. Gut! Aber ich sehe, es ist ein Großraumtaxi. Daher lasse ich es vorüberfahren. In so was steige ich nicht ein. Nicht allzu lang darauf kommt ein normales. Ich mache einen Schritt nach vorne, näher zur Fahrbahn und hebe meinen Arm. Dabei recke ich zusätzlich drei Finger in die Luft. Sie sind steif vor Kälte. Ich winke, ein reiner Routinevorgang. Der Mercedes fährt ran. Lässig öffne ich die hintere Tür des elfenbeinfarben beschichteten Wagens mit Dreckspritzern an den Seiten. Die Angeln machen ein Geräusch, als würde jemand mit seinen Fingernägeln über eine Tafel kratzen, ein kurzer Schauer fährt über meinen Rücken. Ich steige ein, mit präsidialer Würde, wie ein Mann von Welt. Dem ein wenig die Beine zittern.
„Guten Tag“, sage ich schonungsvoll und lasse mich auf den Sitz plumpsen. Und schon bin ich in einer anderen Sphäre.
Verdutzt beantwortet der Fahrer mit serbokroatisch flachem Hinterkopf, aber perfektem Ausländerdeutsch (F-Mensch), meine anschließende, hilflose Frage mit „Na, Mittwoch natürlich. Heute ist Mittwoch.“
Ich sage ah, danke, denke mir ah, zwei Tage, und lehne mich zurück. Fast zwei Tage fehlen mir in meinem Gedächtnis. Mein Gott, zwei Tage.
Das Taxameter wird angeschaltet. Im leise gedrehten Radio verkündet jemand hochmotiviert und einfühlsam die meteorologischen Prognosen, als wäre schlechtes Wetter was Neues. Der ehemalige Freiheitskämpfer aus dem erschreckend nahen Osten sitzt halb zu mir gedreht da und wirft mir einen erwartungsvollen Blick zu, aus dem ich nicht ganz schlau werde. Er sieht aus wie eine Suppendose. Ich spreize die Hände. Sammle mich. Zwei Tage! Weg. Futsch. Ausgelöscht. Stumm stiere ich den Fahrer an, meine Miene spricht Bände. Was – ist – denn?
„Wohin soll’s gehn?“, erkundigt er sich trocken.
Ach so, ja.
Will heim.
Ich sage harmlos genug: „Zum Flughafen bitte.“
Ich bin in der falschen Stadt.
03
Sechs Stunden werde ich wohl hier auf der Bank vor dem Panoramafenster mit Aussicht auf die Start- und Landebahnen sitzen und auf meine Maschine warten. Allein der Gedanke schlaucht. Warten. Ein Zustand, dessen Tristesse ja allgemein anerkannt ist. Meine Flugangst potenziert sich dadurch auch noch überproportional. Was für ein Akt es eben war, überhaupt noch ein Flugticket nach Hause zu bekommen. Möchte man nicht glauben, dass die Strecke so begehrt ist. Ich fläze mich missmutig in meinen Sitz in der Abflughalle, Gate wasweißich, zücke mein Telefon und tippe einmal auf die Kurzwahltaste. Mit einigem Druck presse ich das beständig fettige Rechteck an mein Ohr.
„Fynn, ich bin’s. – Ja, alles okay. Bei dir auch? – Nein, nein, ich bin nur gerade aufm Flughafen. – Ja, geschäftlich. Klar. – Bei uns bleibt’s bei kommendem Dienstag, oder? - Wenn du möchtest, können wir ins Kino gehen. Und dann auf ein Eis oder Sushi oder beides oder was du ... – Gut! – Gut, ja. – Ist ja schon in ... sechs Tagen. - Dann hole ich dich von der Schule ab. Wann hast du aus? Um Viertel nach zwölf? – Ah, früher, ja schön, dann ... - Genau, dann um halb zwölf. Hast du der Frau Richling das mit der Hausaufgabe erklärt? – Das ist ... ja, das klingt doch gut. – Aber wenn du dort bist, dann hol ich dich besser an der Pforte vom Heim ab, oder? - Kinoprogramm bring ich mit, oder hast du schon einen konkreten Wunsch? – Wie: keine Ahnung? ... da finden wir schon was. Sonst gehen wir in den Zoo, haha. – Ich weiß doch, dass du das nicht ma... - Arme Löwen, ja ich weiß. - Ja, und arme Tiger. Und ... genau, die auch, ja. Tiergefängnis. – Ja, klar. Geht’s dir sonst gut? - Nö, das ist schon vorbei. – Bin gerade in Düsseldorf. – Ähm, wir haben hier, ähm, wir hatten ein Meeting wegen einer, ähm, nicht so wichtig, uninteressant für dich. So ein Großhandelskonzern. Funktioniert die Xbox jetzt? – Prima. – Ah gut. Okay, dann bis Dienstag, ja? – Egal, wir telefonieren davor doch sowieso noch mal. – In Ordnung, bis dann, Tschü-üss.“
Ich lege auf. Mit unscharfem Blick schaue ich durch die Scheibe auf die kaum zu erahnende Sonne am Himmel. Die kenn ich, ist immer dieselbe. Sie entfaltet keine wärmespendende Wirkung und ist so schwach, dass man ihr ins trübe Auge schauen kann. Ihre matte Erscheinung kündigt den nahenden Winter an. Ich mag den Winter lieber als den Sommer.
Mein verschwommenes Starren bleibt noch etwas haften. Der Zustand jenseits von Glück und Unglück. Von nichts aufgeschreckt, außer der Frist, die man sich selbst für solche gedankenverlorenen Momente setzt, sauge ich die Luft ein und fasse mich wieder. Wie wenn man sich sagte: Schluss, mehr gibt’s nicht. Mehr gibt’s auch nicht, weil der Herr neben mir den Umstand, dass wir beide ziemlich teure Anzüge tragen, für eine Gemeinsamkeit hält, die ihn glauben macht, sich gestatten zu können, mit mir Verbindung aufzunehmen. Er hält sich und mich für unsereins! Von wegen. Ich ahne, wir haben nicht die geringste Schnittmenge. Noch ehe ich mich innerlich sortieren kann, fragt er mich aber hochinteressiert: „Ihr Sohn?“
„Wie bitte?“ Ich sehe ihn von der Seite an.
„Entschuldigung, ich habe ihr Telefongespräch mitbekommen. Ich meinte nur ...“
Ich will nicht zu tief einsteigen, also antworte ich: „Ah. Ja, ja genau, mein Sohn“, obwohl Fynn nicht mein Sohn ist. Fynn hat keine Eltern. Sie konnten nie ermittelt werden. Das verbindet uns. Das ist einer der Gründe, warum ich Fynns Patenschaft übernommen habe. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass erwachsene Vollwaisen sich um den Nachwuchs kümmern.
„Schön!“, sagt der graugesichtige Unbekannte, „Ihr einziger?“
Ich nicke. Wahrheit, Unwahrheit, ist doch egal.
„Wie alt ist er denn?“, erkundigt er sich weiter und behält mich eisern im Blick. Man darf solche Fragen niemals als Interesse an einem selbst missverstehen. Sie sind lediglich Vorwand für den Mitteilungsdrang des Fragestellers.
„Er ist acht“, gebe ich konziliant Auskunft. Ich muss mitspielen, wenn ich nicht will, dass Herr Neugierig sein Gesicht verliert. Lieber würde ich noch ein paar Telefonate machen oder die zerfledderte Financial Times lesen, die jemand auf einem der schräg gegenüberstehenden Stühle hat liegen lassen, als mich mit diesem hinterkopfglatzigen Arschloch und seinem kurzgetrimmten Bart zu unterhalten.
„Ich selbst habe drei Söhne. Fünf, neun und vierzehn“, fährt der aufdringliche C-Mensch fort, der sich zwei Minuten später als Zahnarzt aus Grünwald vorstellt. Es gibt mir seit jeher Rätsel auf, dass es ein derart hohes soziales Ansehen genießt, anderen ganztätig im Mund rumzustochern.
Dr. dent. schildert mir deplatziert selbstbewusst seine familiären Verhältnisse, obwohl ich kein sonderliches Interesse zeige. Er schnallt es nicht. Anscheinend nimmt er unseren ähnlichen Dresscode tatsächlich zum Anlass, uns beide irgendwie auf derselben Ebene zu verorten. Aber es ist so gut wie sicher, dass er sein Studium nicht mit Summa cum laude abgeschlossen hat. So wie ich. Es ist so gut wie sicher, dass er nicht erst mal zusehen musste, ein Stipendium zu bekommen, um sich eine akademische Laufbahn überhaupt leisten zu können. So wie ich. Denn gemäß den Verhältnissen, aus denen ich stamme, hätte ich mir eine solche Ausbildung ganz einfach nicht leisten können. Ich wette, der Zahnklempner war nicht deutschlandweit jahrgangsbester Uniabgänger. So wie ich. Vermutlich habe ich mehr vergessen, als er je lernen wird.
Wie es ihm auch scheinen mag, wir haben nichts gemeinsam. Aber das glaubt er. Ich komme mir vor wie sein netter Zeitvertreib. Sein After-Shave-Geruch ist unerträglich.
Auf der Piste hebt ein weiterer Flieger ab und durchschneidet die Luft, und ich spähe verstohlen abwechselnd zu der einsamen Zeitung auf dem Stuhl und dem Nachrichtenbildschirm, über den die immer selben Weltnews in Endlosschleife flimmern, während mein Zahnbohrer vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Ihm steht der Sinn nach ratschen und er hat mich als Zielobjekt auserkoren. Worauf ich mir nichts einbilden sollte. Er ist einer jener Menschen, die die Gabe besitzen, sich mit jedem beliebigen Fremden unterhalten zu können und dieses Gefühl von Affinität und Beziehung herzustellen, obwohl sie wissen, dass man sich nach diesem Gespräch nie wieder sehen wird.
Seinen Ausführungen entnehme ich, dass die Zahnbranche blüht. Und als er mich nach meinem Job fragt, bringe ich das Thema mit meiner eigenen Masche schnell wieder auf ihn zurück, weil es im Allgemeinen so ist, dass ich von einer Sache umso weniger spreche, je mehr sie mir bedeutet. Ich neige dazu, meine berufliche Tätigkeit als etwas anzusehen, das in meinem Leben einen gesonderten Platz einnimmt und auf keinen anderen Bereich übergreifen soll.
Er schwafelt dankbar weiter und sagt so was wie, er wolle „künftig vermehrt die Welt bereisen ... Fremde Kulturen kennenlernen ... Vor allem Asien, Japan, Korea, China ... So spannend alles“. Etwas in der Art. Wenig Inspirierendes. In professioneller Nullkonversation geübt, erzähle ich ihm, einfach, damit ich was erzähle, wie sagenhaft toll Hongkong ist. Ich war nie dort. Empfehle ihm, es unbedingt mal zu bereisen. Wunderschön, ehrlich. Muss man gesehen haben. Ich überlege mir, Fakten dürften einen wie ihn sowieso nicht interessieren. Ihm geht’s um die Idee von Asien, das Ideal der Ferne. Nicht um hundefressende Schlitzaugen, rassistische Kleinwüchsige, frauenunterdrückende gelbhäutige Prolls. Die mir schwer begreifliche Romantisierung von Reisezielen und fremden Kulturen. Dabei stört die rationale Auseinandersetzung doch erheblich. Mir kommt in den Sinn, dass ich immer denselben Kopf aufhabe, egal, wohin ich reise.
Mein ungebetener Gesprächspartner berichtet weiter, sich gegenwärtig auf Immobiliensuche zu befinden. Er träumt von einem eigenen Ferienhäuschen im Süden, irgendwo in Italien, wo's schön und warm ist, schwärmt er und krault seinen Bart. Donnerwetter. Das ist in meinen Augen die beste Unterhaltung aller Zeiten.
Ich signalisiere ihm vollste Nachvollziehbarkeit seines Plans und kann mir nichts Idiotischeres vorstellen. Ich sage ihm nicht, dass er für die Kohle, die so ein Haus im Ausland in Anschaffung und Unterhalt kostet, ewig in einem Fünf-Sterne-Hotel wohnen könnte und dann auch nicht lebenslänglich auf einen Urlaubsort festgelegt wäre. Ärger, Sorgen und Verantwortung mal ganz außen vor gelassen. Auch hier geht es wieder mal um die Idee, nicht um Tatsachen. Aber wie soll jemand so etwas verstehen, der gleich darauf diesen Klischeekrampf aller Klischeekrämpfe absondert: „Es ist auch, weil ... ich meine, finden Sie nicht auch, wir Deutschen sind so steif und spießig. Im Süden sind die Menschen viel netter und lockerer.“ Man kann es nicht mit anhören, und ich denke mir, ausgerechnet du musst so was sagen! Dann hau doch ab, ich fahr dich gern persönlich zum Bahnhof! Mal sehen, wie du reagierst, wenn dich die ganzen öligen, korrupten und unzuverlässigen italienischen Chaoten auflaufen lassen und du nach einem Jahr immer noch keine Antwort vom römischen Einwohnermeldeamt oder vom Heizungsinstallateur bekommen hast, und an diverse Spaghettifresser gehörig Schmiergeld abdrücken durftest. Dann definieren wir noch mal den Begriff spießig, du Spießer. Die Weichbirnen in diesem Land schreiben offenbar alle voneinander ab. Wie oft habe ich das schon gehört, diesen hanebüchenen Woanders-ist-alles-besser-Müll. Immer nur von ultra angepassten Schwachmaten, denen es an jeglicher Originalität fehlt, die eigentlich scheiß Nazis sind, mit Ausländern in Infinitiven sprechen und die nach spätestens vier Wochen Landflucht heulend nach Hause zurückgerannt kämen. Was für Träume hinter den Nichtdenkerstirnen dieser Leute schlummern! Ich verstehe das nicht.
Ich beschränke mich darauf, nur noch Geräusche als Antworten von mir zu geben. In meinem Kopf arbeitet es parallel die ganze Zeit: Was ist mit mir die letzten beiden Tage passiert? Meine Beunruhigung umgibt mich wie ein Dauerrauschen.
Die Maschine für dieses Gate ist laut Durchsage bereit zum Einsteigen. Aber mein Oralmediziner ist in redseliger Laune, bleibt noch sitzen, bis zuletzt. Durch ein Klingeln in meinen Ohren höre ich ihn fragen: „Aber wissen Sie, was ich wirklich gerne hätte?“
Ein Hirn? „Nein. Was denn?“
„Zeit!“
Ich bin überwältigt von seinem philosophischen Turn. Ich lache. Eigentlich ihn aus, aber ich kriege die Kurve und lasse es wie eine sentimentale Beipflichtung durch meine Lippen strömen.
„Zeit! Das ist doch das Wertvollste überhaupt, finden Sie nicht?“ Das sind seine Worte. Das Wertvollste überhaupt, was immer das heißen mag. Ich denke mir: Wirf dein Leben weg, und du hast nichts verloren. Doch ich begreife schnell, dass er seinen Käse als gewichtiges Schlusswort betrachtet und aufsteht. Er reicht mir die Hand, und als ob das noch nicht genug wäre, salbadert er, mit bohrenden Augen: „Grüßen Sie Ihren Sohn unbekannterweise recht herzlich von mir. Fynn heißt er, richtig?“
Und mit der Erwähnung von Fynns Namen ist bei mir Schluss mit lustig. Ihn zu nennen, steht diesem Typen nicht zu. Dazu hat er kein Recht. Auch ohne böse Absicht. Ein Sakrileg. Ganz im Ernst. Fynn ist tabu, für diesen Zipfel aus dem Tal der Ahnungslosen. Ich fühle mich plötzlich von jeder Rücksichtnahme befreit - unterdrücke das Gefühl sich anbahnenden, besinnungslosen Hasses jedoch sofort und glaube mit einem Mal, den wahren Sinn von Manieren, Anstand und Heuchelei zu begreifen. Tugenden, die mir schon ziemlich früh eingebläut wurden. Einzig der Mäßigung darf man uneingeschränkt frönen, hat Pater Cornelius immer gesagt. Ich stehe zum Händeschütteln sogar auf, lasse einen kräftigen Händedruck einwirken und sage ernst, aber ruhig: „Hat mich gefreut. - Ja, ich muss noch eine weitere Maschine abwarten, nicht schlimm. - Auf Wiedersehen. Und guten Flug.“ Dr. Karies nickt und macht sich forsch auf den Weg zum Boardingschalter. Irgendwann kommt für alles der letzte Augenblick.
Die Financial Times hat sich inzwischen jemand anderes unbemerkt gekrallt. Ich setze mich wieder. Das Gespräch hat mir überhaupt nicht gutgetan. Und, ich muss noch zwei weitere Maschinen abwarten. Schrecklich.
04
X Stunden später, zu viele um sie aufzuzählen, lande ich in der richtigen Stadt. Mit wetterbedingter Verspätung von drei Stunden. Das hat mir gerade noch gefehlt. Als Flug LH852 aus Düsseldorf in München aufsetzt, fällt feiner Schnee. Wir haben kurz nach 22 Uhr, stockdunkel draußen. Ich möchte noch ins Büro, also noch mal Taxi. Pro Jahr produziere ich über dreihundert Taxiquittungen, die ich auf meiner Spesenliste abrechne.
Ich weise den Fahrer (E-Mensch) an, zuerst noch eine Privatadresse in Schwabing anzufahren. Die Wohnung eines befreundeten Chefarztes (B-Mensch), mit dem ich mich vorhin telefonisch verabredet habe. Ich brauche Tablettennachschub. Mein Insidon-Vorrat neigt sich dem Ende zu. Meine ganzen Psychopharmaka beziehe ich über ihn und zahle immer aus eigener Kasse. So stelle ich sicher, dass mein Konsum nicht bei meiner Krankenversicherung aktenkundig wird. Man weiß nie. Eine Enthüllung meiner Gepflogenheiten könnte ich nicht brauchen. Nicht nur, was meine Medikation betrifft.
Die Übergabe klappt wie stets reibungslos und wird im Flur abgewickelt, die Kinder schlafen schon, und seine Frau (B bis C-Mensch) mag meine konspirativen Besuche nicht. Dabei kauft sie sich vom Gewinn sicher schönes unnützes Zeug. Ich verabschiede mich. Noch auf dem Weg von der Wohnung zurück zum wartenden, warnblinkenden Taxi ziehe ich einen flachen Streifen aus der Packung, drücke mir zwei kleine Tabletten in die Handfläche und schlucke die runden Dinger, die meine Depressionsschübe, meine Stimmungsschwankungen und die Stimmen, die ich höre, seit zwölf Jahren in Schach halten, mit gesammelter Spucke runter.
Der Langzeitverträglichkeit wegen wechsle ich meine Präparate alle sechs Monate durch. Es besteht für mich kein Zweifel daran, dass ich ein ernsthaftes Narkotikaproblem habe.
Mit knarziger Stimme weise ich den Fahrer an, mich ins Büro zu bringen. Er ist ein älterer junger Mann, ewige Mitte Zwanzig, also Anfang Dreißig, der die für sein Alter erwarteten beruflichen Fortschritte nicht vorweisen kann und noch in zehn Jahren fest glauben wird, nur übergangsweise Kunden durch die Nacht zu kutschieren. Tagsüber versucht er sich schätzungsweise als Videogame-Entwickler, in Webdesign oder als Redakteur für Gratis-Onlineportale. Vorerst noch für lau, Vorleistung, alles braucht seine Zeit, der große Durchbruch kommt schon noch. Und sobald sich da was tut, kann er auch für die unehelichen Kinder zahlen, die zu bekommen er sich natürlich entschieden hat, da er es für wichtig hält, „dazu zu stehen“, so wie er ja auch „bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, weißt, wie ich mein?“ Die trostlose Version des ewig aktuellen Mannes eben. Die Deppen, die ihren Schwanz nicht rauszuziehen imstande sind, bevor sie kommen.
Der Schnee fällt in pappigen Schlieren gegen die Wagenfenster. Entgegen weitverbreiteten Mythen bringen sich in kalten Monaten weit weniger Leute um als in warmen. Laut Statistik.
Die Tabletten setzen ein und entschärfen mein paranoides Delirium, meinen Taumel rund um die Frage, was in den fehlenden Stunden bloß mit mir geschehen sein mag.
Der ewige Verlierer am Steuer lenkt den Wagen auf nassen Straßen durch die City, vorbei an der Universität, die am symbolträchtigen Geschwister-Scholl-Platz liegt. Die Adresse, bei der ich immer, wenn ich hier entlangkomme, genau an diese Geschwister Scholl und ihre legendäre Weiße Rose denken muss. Die verehrte Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Sehr löblich. Sie genießen weltweiten Heldenstatus, was man mir jedoch mal genauer erläutern sollte. Denn nicht nur haben diese Aktionisten nichts erreicht, mehr noch ließen sie sich bei einer ihrer stümperhaften Flugblattverteilungsaktionen zugedröhnt erwischen, um letztlich dem Dritten Reich nicht den geringsten Schaden zuzufügen. Wenn folglich also lediglich die gute Absicht Voraussetzung ist, um verehrt zu werden, dann besteht für mich dringender Erklärungsbedarf. Allein der hehre Vorsatz zählt? Des Ergebnisses ungeachtet? Echt? Echt, ich verstehe das nicht.
Ich spiele mit der Tablettenschachtel in meinen Händen, drehe sie um ihre Achse, stecke sie ein. Der Geschwister-Scholl-Platz zieht an uns vorbei, und noch etliche andere Gebäude. Ein paar Minuten lang. Dann hält das Fahrzeug. Da wären wir. Noch eine Quittung mehr.
05
Es ist Mitternacht, und ich sitze in meinem Büro im einundzwanzigsten Stockwerk des VelCo Office Towers. Das ganze Gebäude wird von Lutz & Wendelen gemietet. Es ist das Hauptquartier, die Schaltzentrale sämtlicher weltweiten Niederlassungen. Über zweitausendvierhundert Mitarbeiter zählt das Unternehmen. Trotz später Stunde möchte ich wenigstens die Post und meine Mails, die sich seit Montag angehäuft haben, bearbeiten. Nicht umsonst bin ich, wo ich bin. Aber ich bin nicht der Einzige, der noch hier ist. Beim Hereinkommen habe ich gesehen, dass bei zahlreichen Kollegen Licht brennt. Überstunden sind hier an der Tagesordnung. Hier kommt nur durch, wer bereit ist, sich zum Wohl der Firma alles abzuverlangen. Grundvoraussetzung Nummer eins. Auch nach vierzehn Stunden einen hohen Energielevel beizubehalten ist hier jedem in Fleisch und Blut übergegangen. Schlafentzug wird zum Kick, Erschöpfung zum kräfteverleihenden High. Die Sogwirkung kollektiver Erfolgsgier.
Ich bräuchte eine Dusche, mich juckt es überall. Während ich auf meinem Apple eine Datensicherungskopie anfertige, die einige Sekunden in Anspruch nehmen wird, dribble ich mit den Beinen, drehe damit meinen Stuhl in die entgegengesetzte Richtung und starre durch die komplett spiegelverglaste Wand nach draußen. Von hier aus habe ich einen Blick auf die nächtliche Stadt, der mich manchmal beflügelt und manchmal schwermütig macht. Einen Kilometer Luftlinie entfernt pulsen zwei Signallampen auf der Spitze des Olympiaturms stoßweise ihr rotes Licht in die Dunkelheit, in einem Rhythmus, der sicherlich irgendeinen Sinn ergibt. Wenn ich meinen Blick steil senke, blicke ich auf eine sechsspurige Schnellstraße, die sich durch eine lange Häuserschlucht zieht. Wie auf diesen lang belichteten Fotos, ziehen die Rückleuchten der Autos verschwommene Lichtschlieren nach sich.
Ich linse über die Schulter auf den Bildschirm, um den Status des Back-up-Vorgangs zu ersehen. Zur Hälfte fertig. Meine Augen bleiben auf dem in meine Kalbslederschreibunterlage eingestanzten L & W-Logo hängen.
Noch während meines Studiums entschied ich mich, zu Lutz & Wendelen zu gehen. Bereits ein Jahr vor Abschluss wurde ich von vielen Managementberaterfirmen umworben, gelockt mit Zusicherungen wie imposantem Einstiegsgehalt, attraktiven Kundenportfolios und rasanten Aufstiegschancen. Aber das Angebot von L & W war konkurrenzlos, unablehnbar. Sofort nach meinem Examen fing ich hier an. Meine anschließende zweijährige Promotion absolvierte ich dann nebenher, als ich bereits voll im Einsatz für die Firma war. Einige Jahre ist das inzwischen her. Und nichts hat sich geändert. Nach wie vor will ich nach ganz oben. Koste es, was es wolle. Nein, rein gar nichts, nichts hat sich geändert. Mehr noch, ich habe festgestellt, das Ganze spitzt sich zu, je höher ich komme. Ich glaube, Menschen ohne diesen inneren Antrieb führen ein besseres Leben.
Eine puertoricanische Putzfrau (G-Mensch) kommt unvermittelt zur Tür herein. Ich erschrecke nicht wenig. So spät? Klar, wann sonst. Ihre langen schwarzen Haare glänzen wie gelackt. Ich gebe ihr „Jetzt bitte nicht“ zu verstehen. Sie antwortet etwas scheinbar Humorvolles, das ich nicht kapiere. Nach nur zwanzig Jahren Deutschland wäre es vielleicht tatsächlich etwas zu viel von ihr verlangt, der Landessprache rudimentär mächtig zu sein. Sie brüllt beinah vor Amüsement über ihre kryptische Bemerkung und leert trotzdem meinen leeren Mülleimer aus. Ihr Geruch ist auch nicht besonders. Gacker, gacker. Sie steht so rangniedrig, dass sie sich ein vollkommen freies Lachen leisten kann. Wakwakwak. Es ist kein schönes Lachen, aber dafür waren Naturvölker ja auch nie bekannt. Ich schaue die ganze Zeit wohlwollend drein, mit verhaltenem Gesicht. Eine Rolle, die mir nicht besonders gut steht. Sie geht. Immer noch unbedarft blöckend.
Back-up-Balken bei Dreiviertel, ich sehe wieder raus. Zahlreiche Bürotürme ragen in direkter Verlängerung meiner Blickrichtung majestätisch und verschwörerisch zugleich empor. Nach und nach wächst die Stadt mit Hochhäusern zu. Jedes für sich, ein zwielichtiges Versprechen.
Ein Pling kündet vom Abschluss der Datensicherung. Ich wende mich von der Aussicht auf die Gebäudesilhouette ab und lasse meine Finger wieder über die Computertastatur fliegen. In den Jahren, die ich hier bin, habe ich es in meiner Karriere ziemlich weit gebracht. Aber mein Drang nach Größerem konkurriert andauernd mit der tief in mir verwurzelten Furcht, die erworbenen Privilegien könnten jeden Moment wieder aufgekündigt werden und ich müsse wieder zurück in die Welt, in die ich eigentlich gehöre. Hinter die Mauern, hinter denen ich großgezogen wurde. Zurück zu hochglanzgescheuerten Linoleumböden, Abendandachten und Morgenandachten, Tischgebeten und Nachtgebeten, regelmäßiger Beichte, Züchtigung und Erniedrigung, dem Brüllen der Erzieher und Kinder und dem erdrückenden Gefühl des Eingesperrtseins.
Natürlich weiß ich, dass diese Zeit ein für allemal vorbei ist, aber ich kann nichts dagegen tun, ich komme immer wieder nur auf dieses eine Thema zurück. Meine Arbeit hilft mir nicht so sehr dieses Problem zu überwinden, sondern es vielmehr, zumindest zeitweise, auszublenden. Ich glaube, meine Karriere ist alles, was mich am Leben hält. Nachdenklich reibe ich mir über mein Kinn und merke, wie läppisch es klänge, würde ich versuchen, das jemandem zu erklären.
Eine Stimme, die immer auftaucht, sobald ich beginne, über meine Vergangenheit zu grübeln, sagt:
Komm doch mit. Das wird bestimmt lustig.
Ich bin allein im Zimmer. Und ich kenne die Stimme. Ich höre sie oft. Diese eine Szene spult sich immer wieder in meinem Kopf ab.
Ich stoppe mein Tippen und starre tatenlos auf den Bildschirm. Konzentriere mich. Denn: ich muss schlucken. Ich muss dringend schlucken. Wie man eben einfach schlucken muss. Speichel entsorgen. Aber ich schlucke nicht. Ich werde es nicht tun. Minuten vergehen. Das macht dich wahnsinnig. Diesem Bedürfnis gebe ich nicht nach. Dafür verschwindet die Stimme in meinem Kopf langsam, wird leiser, leiser. Nicht schlucken. Ich werde nicht schlucken. Grundbedürfnisse beschneiden. Irrsinn. Den sich sammelnden Speichel in die Mundwinkel pressen, nicht nachgeben. Nicht den Hals anspannen. Nicht ... schlucken. Ich erhebe mich und führe mit vollem Schwung eine Art Karatehieb auf eine senkrechte Stahlstrebe der Fensterfront aus. Zur Verlagerung meiner Aufmerksamkeit. Es tut höllisch weh. Erfüllt somit seinen Zweck. Ich massiere meine linke Handkante. Ich glaube, sie ist nicht gebrochen. Die Stimme in meinem Schädel verstummt gänzlich. Mein Mund ist voller Flüssigkeit. Ein angedeutetes Klopfen ertönt. Ich entgegne einfach nichts. Salzsäule. Die Tür öffnet sich vorsichtig, und eine weibliche Stimme fragt sanft: „Du bist ja noch da? Ich wollte dir nur noch mal persönlich gratulieren, weil ich vorgestern doch unterwegs war und wir uns nicht mehr gesehen haben. Ich will gar nicht lang stören.“ Ein Versprechen?
Zaghaft hebe ich meinen Kopf, sehe Esther an. Ihre mittelbraunen, mittellangen Harre über einem genauen Gesicht, das dazu da zu sein scheint, viel zu sehen und wenig auszudrücken. Esther: Controllerin, Bestjahresabsolventin, Auslandsstudium, unter anderem Harvard und ENA Paris, Doktortitel, erste Fachbuchveröffentlichung nächstes Jahr, Prada-Import-Kostüme, Golf-Ressort-Urlaube, Porsche Cayenne – und doch nur ein Trostpreis. Intellektuell und menschlich ein A-plus-Mensch. Optisch, na ja. Ich kann’s nicht ändern. Niemandes Typ. Aber ich schätze Esther sehr. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, habe ich das seltsame Gefühl, mit einem einzigen Blick die zentralen Elemente ihres Charakters zu erfassen. Sie hat ein gutes Herz. Wie vielen Menschen begegnet man schon im Leben, von denen man das sagen kann. Womöglich erkenne ich das nur, weil ich nicht mit ihr schlafen will.
„Komm doch rein, hi“, sage ich. Meine Stimme ist belegt, ich blubbere fast. Aber ich schlucke nicht.
„Also ...“ Esther macht einen Knicks und neigt ihren Kopf zur Seite, versteht diese Übertreibung wohl als Parodie auf die höfische Etikette der Renaissancezeit, sieht dabei aber ungewollt grazil aus. In Familien, aus denen Frauen wie Esther stammen, gehört Ballettunterricht für Mädchen ab vier zur Grundausbildung (ist nur so dahingesagt). „Glückwunsch, Conrad.“
„Danke, Esther, danke“, sage ich und bewege meine linke Hand an der Innenseite meines rechten Unterarms auf und nieder. Unentwegt pulsiert eine Prellung dritten Grades an meiner Handkante im Rhythmus meines Herzschlags. „Wirklich schade, dass du zu meiner kleinen Feier nicht kommen konntest. Und du? So spät noch hier? Hast du viel zu tun?“
Sie tritt näher. Der leere Raum zwischen uns wird weniger. An meinem Eindruck, wie durch einen unsichtbaren Panzer von ihr und der übrigen Welt getrennt zu sein, ändert das nicht das Geringste. Sie wirkt müde, und vermutlich trifft das auch auf mich zu. Der nicht allzu breite Lichtkegel meiner Schreibtischlampe überzieht das aus Chrom und Edelhölzern bestehende Mobiliar mit einem vornehmen, schummrigen Gelb.
Esther antwortet: „Ich fliege morgen nach London, mit Markus und Marc. Wir haben dort die Abschlusskonferenz mit Watanabe anberaumt. Ich musste noch was vorbereiten, aber jetzt bin ich fertig. Wie steht’s mit dir? Nett, dein neues Büro.“
„Nett, nicht wahr? Ein bisschen dunkel vielleicht.“ Ich schaue mit einer Grimasse umher. Wir lachen beide vernehmlich, vor allem, weil meine Bemerkung weder witzig noch sonst was war. Ihre kleine Zahnlücke wird sichtbar. Ich schalte das Deckenlicht nicht ein. Mein neues Luxusbüro, völlig unerheblich, nicht der Rede wert. Mit wachsendem Erfolg scheint meine Chance auf irgendeine erlangbare Form der Zufriedenheit nur um so mehr nachzulassen.
Esther lächelt noch immer über meinen faden Witzversuch, um ein sich anbahnendes Schweigen zu verdrängen. Sie kann das. Im Gegenzug frische ich mein schelmisches Schmunzeln, von dem ich annehme, dass es so gar nicht nach einunddreißig aussieht, noch mal auf und bessere es nach. Weil nichts schlimmer wäre, als ihr Entgegenkommen nicht zu goutieren. Aus Gründen des Gesprächsübergangs sauge ich mir etwas Firmenbezogenes aus den Fingern und rede belangloses Zeug, wobei sie mir gerade intensiv genug direkt in die Augen schaut, um klarzumachen, dass ich mich für diese heiße Luft nicht zu schämen brauche. Meine Stimme muss unangenehm klingen, total verschleimt. Nein, ich schlucke einfach nicht. Wenn es Esther auffällt, dann lässt sie es sich nicht anmerken. Sie fährt sich durchs Haar. Am Ringfinger trägt sie so wenig wie ich. Könnte gut sein, dass sie auf mich steht. Sicher bin ich nicht, sicher bin ich nie. Aber die Blicke, ihre Bewegungen, der Tonfall, die paar dürftigen Parameter, die ich für mich auswerte - gut möglich, sehr wahrscheinlich sogar.
„Ich habe hier auch noch ein bisschen was zu tun, ich muss morgen nach Wien, Air Linus, Akquise!“, sage ich und zeige auf die in Teakholz gefasste Marmorplatte, auf der nur mein Laptop mit seinem aufgerissenen Maul thront. Und ein Kuli mit Echtgoldaufsatz. Sowie ein halbleeres Glas Red Bull, das sehr nah an der Kante steht. Keinen Schimmer, weshalb ich Gläser immer zu nah am Rand abstelle.
Ich füge an: „Noch ein Stündchen, dann mache ich auch Schluss“, um sicherzustellen, dass Esther abzieht und nicht auf die Idee kommt, wir könnten gemeinsam noch wohin gehen.
„Ich verstehe.“ Ein winziges Stirnrunzeln zieht ihre Brauen zusammen, dann sieht sie ziemlich ostentativ auf ihre kleine Armbanduhr. Ja, da bin ich mir ganz sicher, so ein intelligentes Mädchen wie sie versteht ganz gewiss.
„Na, dann will ich dich nicht länger stören“, wiederholt sie ihre gleich zu Beginn geäußerte Beteuerung. Hält also Wort.
„Guten Flug und viel Glück morgen, Esther“, malme ich feucht die Silben heraus und reibe die Hände gegeneinander, als erwarte ich dadurch deren Erwärmung.
„Ja, gute Nacht, Conrad, schlaf gut. Und mach nicht zu lange.“
Ich nicke willfährig. Solche Bemerkungen sind mir immer ein wenig zu viel. Weibliche Wärme und Fürsorge haben stets etwas Besitzergreifendes, kein Zweifel. Als sie sich umdreht, durchs Zimmer geht und hinaus, klaube ich den Kuli vom Tisch und wiege ihn zwischen zwei Fingern. Eine nichtssagende Geste, die mir erspart, ihr nachzusehen. Ganz klar, irgendeine Form von Befangenheit verbindet uns, das fällt mir schon seit längerem auf. Deshalb habe ich immer das Gefühl, dass wir beide nach jedem Aufeinandertreffen erleichtert sind, es gut überstanden zu haben.
Ich höre, wie die Tür sich schließt, und schlucke nicht. Blick auf die Armbanduhr. Das Gefühl, Zeit vertrödelt zu haben, treibt mich an. Ich setze mich und mache mit der Arbeit weiter.
Wenige Minuten später klopft es, zeitgleich geht die Tür auf, und ich höre „Woa woa woa, da ist ja mein Lieblingsconrad! Ja, wo war er denn, unser verschollener Pisser?“ Ben steckt seine Visage zur Tür herein und spricht zu mir, mit dieser künstlichen Kinderüberdrehtheit, die wir untereinander fast nur noch in Anwesenheit anderer abstellen können.
„Bist du versumpft oder was? Hab dich heute auf Handy nicht rangekriegt. Das ist unprofessionell, mein Vollpfosten.“ Ben und unsere gemeinsame Angewohnheit, nur noch drüber zu sein. Mitunter nervt‘s, ist man nicht immer zu aufgelegt. Vor allem wenn ich schon etwas müde bin, ist mir Ben mit seiner unerschütterlichen Energie oft ein bisschen zu viel. Mit zwei großen Schritten steht er (A-Mensch, triple A) vor mir und lacht mich an, mit ultraweißen Zähnen, die man nur hat, wenn man eine solariumbraune Haut vorweisen kann. Seine Haare sind etwas durcheinander, auf diese gewollte Art. Und der Anzug, Hut ab, feinster Zwirn.
Ich beiße mir auf die Lippen – nicht schlucken, ein Königreich für einmal schlucken -, beuge mich vor und lächle wölfisch: „Gerade dich hat es schon mal am allerwenigsten zu interessieren, wo dein Vorgesetzter war, du Loser.“ Daraufhin sehe ich ihn an, als müsste er damit rausrücken, wo ich denn tatsächlich zum Teufel noch mal gewesen sein könnte, und fahre einen Gang zurückgeschaltet fort: „Ich hab heute ewig lang auf dem Düsseldorfer Flughafen festgesessen und konnte dabei nicht mal rumtelefonieren, weil mein scheiß Akku leer war. Wobei ich dabei eine Eingebung hatte. Achtung! Ein Service mit allen verfügbaren Akkumodellen! Ein Stand mit sämtlichen weltweiten Ladekabelformaten. Das wär’s! Wahnsinn, oder? Genial. Es gibt noch so vieles, das es nicht gibt. Die besten Erfindungen harren nach wie vor ihrer Erfindung. Eigenzitatende. Hast du das? Notier mal bitte! Die besten Erfindungen harren noch ihrer Erfindung! Schreib das auf, für die Nachwelt. Esther war übrigens gerade hier und ...“
„Ich weiß, ich habe sie noch auf dem Gang getroffen, aber Moment mal, was hast du denn in Düsseldorf ge...“
„Ah, verstehe. Bist du bereit für Wien morgen?“, würge ich ihn ab. Ein düsteres Geheimnis mehr.
„Yes, Sir! Für den A.L.I.-Auftrag gehöre ich ganz dir. Übrigens, Grande Monsignore Lutz wollte dich sprechen. Hat dich heute ebenfalls nicht erreicht. Hat‘s dann bei mir versucht. Er wollte nur noch mal auf die Bedeutung des morgigen Meetings hinweisen, irgend so was in der Art. Ist das so schwer, sein Handy an zu haben, du Trottel?“
„Sag mal, hast du mir gerade zugehört? Akku? Leer? Leer? Akku? Akku leer?“
Ben bewegt sich rückwärts wieder auf die Tür zu, ein kurzes Gastspiel ankündigend, und sagt nekisch: „Ja, ja, hab ich vernommen, kein Problem. Der Alte erwartet uns erst Montag zum Appell. Bis dahin ist er in, äh Singapur, glaube ich. Nicht erreichbar, hat er gemeint. Na egal. Wollt ich dir nur ausrichten. Bin aufm Sprung, bin schon weg. Hab ein Date mit Annabelle!“ Er furcht die Stirn. „Annabelle, mein Aufriss der Woche, von der Kasse beim Rossmann, unten neben der Bäckerei. Hast du bestimmt schon gesehen. Sagt, sie steht auf Schlipstypen.“ Seine Stimme wird zu einem verschwörerischen Bariton. „Kann sie haben.“ Er greift an seinen Prince-Albert-Krawattenknoten, rutscht daran herum und hinterlässt ihn weniger mittig. „Das könnte scharf werden. Sieht aus wie ne Pornodarstellerin.“
„Wäre dieses Jahr schon deine Pornodarstellerin Nummer siebenundzwanzig, kann das sein?“, sage ich beifällig. Aus dem Hut gezauberte Fantasiezahlen sind immer ungerade.
Es ist Ben, der spricht: „Mindestens, mein Bester!“
„Ich bete, sie ist volljährig!“
„Locker. Seit September ... Ich mach die Prollmaus jetzt noch klar. Hat solche ...“, er jongliert zwei imaginäre Melonen vor seiner Brust, meine Güte. „Prall und straff. Oh sweet sixt..., äh, eighteen“, singt er an und verzieht sein Gesicht.
„Offensichtlich bedarf es für diese Aufgabe keiner geringeren Persönlichkeit, als einer, die über jene Subtilität verfügt, die so untrennbar mit deinem Namen verbunden ist“, quatsche ich dahin. Ben knirscht leise „Fürwahr, führwahr“ durch die Zähne und macht noch mal die Melonennummer, den Griff seiner Aktentasche aus handtamponiertem Leder dabei noch fester unter den Arm geklemmt. Gott, ist der heute drauf.
„Wir gehen jetzt erst was trinken. Komm doch mit! Vielleicht hat sie eine Freundin!“
„Und die ist Regalauffüllerin bei Lidl? Nein, wirklich: toller Vorschlag, sonst gern, aber ich hab leider, leider keine Zeit“, sage ich mit treuherziger Stimme und schüttele den Kopf. Ich begeistere mich nicht für junges Gemüse.
„Unsinn, komm jetzt, lass uns gehen, das ist doch gar keine schlechte Idee.“
„Bitte lass mich diese Bemerkung nicht ignorieren müssen.“
„Schon gut, schon gut. Mein Fehler.“
„Na also.“
„Ach, halt die Klappe.“
„Dir ist schon klar, dass unser Flieger in weniger als sieben Stunden geht, oder?“ Ich führe eine Hand zur Stirn.
“Klar, schaff ich locker. Wer braucht Schlaf? Wird viel zu hoch gehandelt. Lass uns morgen quatschen. 7 Uhr 30, Terminal 2, see you!“, pseudoflüstert er und macht eine Drehung auf den polierten Bodenfliesen. Er knallt die Tür zu. Ich lächle zaghaft, obwohl schon für niemanden mehr. Ben ist mein natürliches Gegenteil. Und ich bewundere ihn dafür.
Ohne mich zu rühren, starre ich ins Leere. Schläfenpochen rechts. Ich sitze da. Fünf Minuten. Zehn. Fünfzehn. Alles ist in Ordnung. Mein Gesicht ist schweißbedeckt.
Ich schlucke erst morgen wieder.
06
Der Tag darauf. Donnerstag. Wien, etwas außerhalb. Ein postmoderner, monumentaler Glaskasten. Firmenzentrale Air Linus International, eine weltweit operierende Fluglinie, deren Bilanzen und Kalkulationen die letzten drei Jahre gehörig ins Straucheln geraten sind. Auftragsvolumen: ein paar Millionen Euro. Wie viel genau, hängt davon ab, wie viel man ihnen aus dem Kreuz zu leiern fertigbringt.
Um einen solchen Job an Land zu ziehen, ist ein bestimmter Persönlichkeitstypus erforderlich. So einer wie ich.
Schlag 11 Uhr. Ein Sitzungssaal mit hellgrau gerahmten Glaswänden und einer stark hallenden Akustik, die jedes Wort in Rufen verwandelt und jedes Murmeln in Dröhnen. Ich mache eine überflüssige Geste zu einem Stuhl, ob ich mich setzen darf. Nehme Platz. Beginn des Meetings.