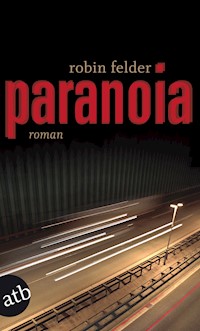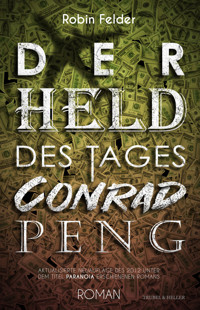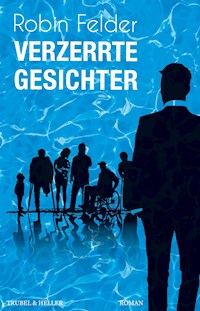9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trubel & Heller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er wirkt wie ein Mann Anfang vierzig, lebt jedoch seit nahezu 300 Jahren unter aufeinanderfolgenden Identitäten in ständiger Angst vor Aufdeckung seiner Andersartigkeit. Als er im Netz auf eine Person stößt, die vorgeblich – wie er selbst – um ein Siebenfaches langsamer altert als gewöhnlich, zeigt er sich unentschlossen, ob einem Treffen zuzustimmen klug oder fahrlässig wäre. Die einzige Eingeweihte, seine 92-jährige bettlägrige Tochter, deren Alterungsprozess regulär verläuft, rät ihrem jugendlichen Vater, diese lang ersehnte Gelegenheit der Begegnung mit einem Gleichbeschaffenen unter allen Umständen zu ergreifen. Woraufhin sämtliche Vorbereitungen in die Wege geleitet werden. Doch dann geht alles, aber auch wirklich alles schief, wie man es sich lieber nicht ausgemalt hätte. »Müsste ich die früheren Zeiten in drei Worten zusammenfassen, wären das: Gewalt, Trunksucht und Konformität. Aber vielleicht verrät diese Beschreibung auch mehr über mich als über die früheren Zeiten.« Ein Roman wie eine Autobiografie in Echtzeit. Packend und provokativ, gnadenlos und mit nichts vergleichbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DIE ERSTEN 300 JAHRE MEINES LEBENS
ROMAN
ROBIN FELDER
INHALT
Über den Autor
Über das Buch
I. Die ersten 300 Jahre meines Lebens
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
I. Anno Domini 1641
Olivia Sheffield
Einleitung
Hinweis
Vorwort der Autorin
Kapitel 1
IMPRESSUM
© 2025 Trubel & Heller, München
www.trubelheller.de
Keinerlei KI involviert
Umschlaggestaltung: Michael Dorschner
Satz: Timo Leibig
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
ISBN 9783689958794
Erstellt mit Vellum
ÜBER DEN AUTOR
Robin Felder lebt und arbeitet in München. Bislang sind von ihm erschienen: Unsympath, Paranoia, The Godjob, Verzerrte Gesichter.
ÜBER DAS BUCH
Er wirkt wie ein Mann Anfang vierzig, lebt jedoch seit nahezu 300 Jahren unter aufeinanderfolgenden Identitäten in ständiger Angst vor Aufdeckung seiner Andersartigkeit. Als er im Netz auf eine Person stößt, die vorgeblich – wie er selbst – um ein Siebenfaches langsamer altert als gewöhnlich, zeigt er sich unentschlossen, ob einem Treffen zuzustimmen klug oder fahrlässig wäre. Die einzige Eingeweihte, seine 92-jährige bettlägrige Tochter, deren Alterungsprozess regulär verläuft, rät ihrem jugendlichen Vater, diese lang ersehnte Gelegenheit der Begegnung mit einem Gleichbeschaffenen unter allen Umständen zu ergreifen. Woraufhin sämtliche Vorbereitungen in die Wege geleitet werden.
Doch dann geht alles, aber auch wirklich alles schief, wie man es sich lieber nicht ausgemalt hätte.
Müsste ich die früheren Zeiten in drei Worten zusammenfassen, wären das: Gewalt, Trunksucht und Konformität. Aber vielleicht verrät diese Beschreibung auch mehr über mich als über die früheren Zeiten.
Ein Roman wie eine Autobiografie in Echtzeit.
Packend und provokativ, gnadenlos und mit nichts vergleichbar.
»Ein fantastisches Buch ... auch wenn wir dessen Veröffentlichung gern verhindert hätten.«
Goldsmith & Spencer
Was zählt, ist nicht, was uns passiert,
sondern wie wir darauf reagieren.
Epiktet
Ich möchte keinem Klub angehören,
der mich als Mitglied akzeptiert.
Groucho Marx
1
Wie ein Gestrandeter auf einer einsamen Insel, der das Meer ständig nach einem sich nähernden Menschen absucht, durchstreife ich das Internet, seit es das Internet gibt, auf der Suche nach jemandem, der so ist wie ich. Jahrzehnte vergeblicher Recherche und Fährtenlegerei liegen hinter mir. Eine Dauerschleife zermürbender Ergebnislosigkeit.
Und nun?
Das.
Ich klappe meinen Laptop zu. Ist es wirklich möglich, dass ich soeben fündig geworden bin? Nach all der Zeit?
Überfordert und lächerlich weihevoll lehne ich mich im Sessel zurück, mein Blick rast ziellos durch unser Mansardenzimmer mit den weißen Dachschrägen und den weißen Möbeln. Nichts davon nehme ich wahr, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Einen Augenblick lang frage ich mich sogar, ob ich mir die Nachricht bloß eingebildet habe. Aber – nein.
Jemand hat auf die codierten Begriffe reagiert, die ich in verschiedenen Foren hinterlegt habe. Ich kann mich nicht entscheiden, ob es nach einer Ewigkeit des Dranbleibens eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ist, eine herbeigesehnte Entdeckung dieser Größenordnung zu machen. Mir erscheint beides verdächtig.
Die grelle Herbstsonne knallt mir durch das Giebelfenster ins Gesicht, weil ich versäumt habe, die Jalousien zuzudrehen, bevor ich mich ins Darknet eingeloggt habe. Und jetzt bring ich’s einfach nicht mehr fertig, zum Fenster zu gehen.
Erst hielt ich die Meldung für einen Fehlalarm, da es schon ein paarmal vorgekommen ist, dass mir jemand durch mein digitales Labyrinth entgegengekrochen kam und irgendeinen Bullshit von sich gab. Die üblichen Schwachköpfe, die man auf solchen Portalen auch anzufinden erwartet. Und wenn man ehrlich ist, sind ja längst alle da draußen wahnsinnig geworden. Wir bewegen uns in einer Welt, in der kaum einer mehr die Frage „Wie viele Geschlechter gibt es?“, ohne rumzustottern, beantworten kann. Es ist wirklich nicht leicht, mit dem Kollaps der Gesellschaft Schritt zu halten.
Doch diesmal ist es anders, diesmal ist die Message, die in meinem Postfach liegt, kein eindeutiger Unfug.
Filius_Contemplata nennt sich die Person, die geantwortet hat. So geht’s schon mal los, Latein, ach Gott. Mit Unterstrich auch noch. Niedlich. Aber dann: Who you? Patience as well. Centuries. Cells about seven. How long earth?, lautet die Formulierung der Mitteilung. Und die hat’s in sich.
Klingt meine sinngemäße Übersetzung treffend, oder übersehe ich gerade was? Wer bist du? Ebenfalls Geduld. Jahrhunderte. Zellen um die sieben. Wie lange Erde?
Wirklich clever komprimiert, sofern man weiß, was gemeint sein könnte. Trotz kryptischer Anmutung durchdacht und vielseitig deutbar, für den Fall, dass man in einen Hinterhalt gerät. Eine ganze mutmaßliche Lebensgeschichte, die sich in ein paar sorgfältig hingetupften Sätzen entfaltet. Fast ein bisschen lyrisch.
Oder es ist das Gebrabbel eines Schimpansen mit automatischer Spracherkennung. Kann natürlich auch sein.
Das alles und mehr tuschele ich mit geübter Ungezwungenheit vor mich hin. Ich bin aus dem Alter raus, in dem man glaubt, Selbstgespräche seien verrückt.
Jetzt bloß nicht überhitzen. Komm mal wieder runter. Erst mal Abstand gewinnen, drüber schlafen. Ich bin vollkommen überrumpelt. Was absurd ist, wenn man bedenkt, dass ich exakt dieses Szenario – nämlich irgendwann endlich auf einen Schicksalsgefährten zu treffen – in unzähligen Nächten bis zum Gehtnichtmehr gedanklich durchgespielt habe, nun aber ratlos bin, wie ich mich verhalten soll. Auch wenn sich’s blöd anhört, wünsche ich mir beinah, dass niemand auf meinen Köder angesprungen wäre.
Genug! Ich raffe mich auf, ich kriege es hin und verlasse mein Arbeitszimmer, das den kompletten Dachboden einnimmt.
„Brauchst du noch was?“, frage ich Augusta leise, als ich ihr Zimmer betrete, das einen Stock tiefer liegt. Wir wohnen auf zwei Etagen, der vierten und fünften eines Altbaus. Ich hasse Altbauten. Alt ist immer scheiße, egal in welchem Bezug.
Augusta liegt kurzatmig in ihrem Bett, regungslos, wie für sich selbst unzugänglich, und starrt auf die Decke, aber ich weiß, dass sie mich wahrnimmt. Lediglich das neue Morphinpräparat schränkt ihre Reaktionsfähigkeit ein, vor allem direkt nach Einnahme, das ist alles. Die unerlässliche Umstellerei ihrer Medikation alle paar Wochen haben wir ziemlich dick, da jedes Mal dermaßen viele Nebenwirkungen auftreten, bis sich alles wieder einigermaßen einpendelt, dass man es am liebsten gleich sein lassen würde.
Meine Augusta ist zweiundneunzig, inzwischen erschütternd verhutzelt und verbogen, und hochgradig pflegebedürftig. Ihre Leiden sind so vielgestaltig, dass sich bisweilen nicht mehr entschlüsseln lässt, an welchem Krankheitsbild sie am heftigsten zu knapsen hat. Schwere Osteoporose (früher hätten wir es Knochenfraß genannt), diverse chronisch entzündete Organe, dazu zügig voranschreitende Demenz (Ehrensache), Verdacht auf Parkinson, zwei Krebsherde, ein paar Wucherungen hier und da und obendrein noch ein gutartiger Tumor unter der Schulter, den wir Goodie nennen, na ja. In ihrem Körper ist ganz fürchterlich der Wurm drin.
Vielleicht sind meine Gene an diesem übermäßigen Wirrwarr schuld, wer weiß.
Andererseits: Zwoundneunzig! Da kann man ihre Hebamme auch nicht mehr verantwortlich machen.
Seit etwa vier Jahren ist Augusta bettlägrig, was eine ganz schön harte Nummer für uns beide ist.
Gestaltet sich der Kontrollverlust für sie wie ein nie enden werdender Horrortrip – und jedes weitere Wort dazu wäre überflüssig –, so ist mein Part, sie zu versorgen, für mich ohne jegliche Ambivalenz erfüllbar – weil ich ihr Vater bin.
Ich habe das alles bereits vor rund neunzig Jahren für sie getan. In Teilen. Das Windelnwechseln, das Anziehen, Umziehen, Füttern, den ganzen Betreuungskram. Nachdem Augustas Mutter früh verstarb, war ich alleinerziehender Vater in den 1930ern. Etwas, das mit heute nicht vergleichbar ist. Und damit meine ich nicht, dass man die Windeln seinerzeit noch selbst auswaschen musste. Oder dass man sich einer nicht zu unterschätzenden Aburteilung ausgesetzt sah (in meinem Fall aus den verschiedensten Gründen). Aber das stellte, im Rückblick betrachtet, das geringste Problem dar. Vielmehr war die Welt damals einfach ... anders. Im Gesamten anders. Schwergängiger auf allen Ebenen.
Ist das richtig gesagt?
Müsste ich die früheren Zeiten in drei Worten zusammenfassen, wären das: Gewalt, Trunksucht und Konformität. Aber vielleicht verrät diese Beschreibung auch mehr über mich als über die früheren Zeiten.
Spielt eh keine Rolle. Ich kann mir das Gestern selbst kaum mehr vorstellen. Die Vergangenheit kommt mir vor wie eine weit entfernte, einbalsamierte Idee.
Schwarz-weiß jedoch, wie auf den Fotos und in den Filmen, war sie nicht.
Jedenfalls lässt mich Augustas und meine Tochter-Vater-Beziehung ihren jetzigen Pflegebedarf leichter verkraften, als wenn ich, zum Beispiel, ihr Sohn wäre. Was ich offiziell allerdings seit mehr als zwanzig Jahren bin.
Zuvor gaben wir mich als ihren Bruder aus. Erst als ihren älteren, dann als ihren jüngeren; meine äußere Erscheinung musste stets zu Augustas jeweiligem Alter passen und unser Verwandtschaftsverhältnis entsprechend sukzessive angeglichen werden. Von ihrer Geburt an. Folglich wurde ich – über Augustas bisherige Lebensspanne hinweg – formell von ihrem echten Vater zu ihrem angeblichen Bruder, dann zu einem noch jüngeren Bruder und aktuell eben zu ihrem vorgeblichen Sohn.
Solchen chronologischen Abstufungen nachzukommen, ist nichts Neues für mich.
1934 wurden meine Frau und ich Eltern von Augusta. Sie ist unser beider und auch mein einziges Kind. Genauer gesagt kam Augusta als properes, kerngesundes Mädchen am 2. Januar 1934 zur Welt. Sie war ein putziges Baby, normal eben, und ich sah damals ungefähr wie ein Mann Ende zwanzig aus. Auch ganz normal.
Heute, zweiundneunzig Jahre später, wirke ich wie ein Mann Anfang vierzig, einundvierzig, zweiundvierzig, Pi mal Daumen. Was bedeutet, dass ich mittlerweile sogar als zu jung erscheine, um Augustas Sohn zu sein!
Ich sehe zu jung aus, um für den Sohn meiner eigenen Tochter durchzugehen. Hat man so was schon mal gehört? Längst rutsche ich optisch in die Enkelrolle, bloß möchte ich nicht schon wieder meine Identität wechseln. Gleichzeitig will ich auch nicht, dass Augusta stirbt (auch wenn es ihr zu wünschen wäre und sich die Sache mit meinem Identitätswechsel dadurch etwas entzerren würde). Genauso wenig ist mir danach, aufzufliegen.
Worauf soll ich also hoffen?
Ziemlich vertrackt. Aber das ist meine ganze Biografie. So vertrackt wie widersinnig. Es schlaucht.
„Mein Flug geht in zwei Stunden, ich muss los. Melanie kommt gleich, die macht dir dann Abendessen. Ist eh wieder bald“, sage ich, als ginge es im Leben nur darum, die Zeit rumzubringen, was wohl auch mehr stimmt als alles andere.
Ich drücke das gekippte Fenster zu, der Himmel draußen ist inzwischen gefärbt mit dem Violett eines sich bald entladenden Gewitters, anschließend stelle ich den Fernseher an und regle ihn auf mittellaut, bevor ich Augusta mit meinem Zeigefinger über die Wange streiche und ihr „Tschau, bis morgen Abend“ zuflüstere, ohne eine Antwort zu erwarten. Im Moment hat sie nicht einmal mehr ausreichend Ahnung, wer sie selbst ist.
Von der sensationellen Kontaktaufnahme eines gewissen Filius_Contemplata, die mir unausgesetzt durch den Kopf geistert, habe ich entschieden ihr vorläufig nicht zu berichten. Ich klopfe das erst gründlich ab, bevor ich sie damit aufrühre.
Ein erstes Indiz dafür, dass der Verfasser der Nachricht wirklich über hundert Jahre alt sein könnte, ist schon mal: Er hat nicht ein einziges Emoji in seinem Text verwendet. Und so ausgefuchst wäre kein jüngerer Zeitgenosse, um irgendeinen Anschein zu erwecken. Selbst jede aktuelle Oma haut doch bei erstbester Gelegenheit automatisch ein Tränen lachendes Smiley nach dem anderen raus. Plus Rakete. Und ich mach nicht mal Witze.
Ich versende ebenfalls keine Emojis. Never ever.
Eigentlich ein Fehler, oder?
Filius also. Ob Rohrkrepierer, Serienmörder oder Schuss ins Schwarze, schön langsam macht sich doch so etwas wie Euphorie in mir breit. Sollten wir einen Treffer gelandet haben, wäre das unfassbar. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus.
Aber ich weiß zugleich, egal wie stark dir jemandes Wirkung auch entgegenstrahlt: Am Ende fällt die Illusion immer in sich zusammen. Allzu große Begeisterung hat noch nie zu etwas Begeisterndem geführt.
2
Geschlafen habe ich kaum, trotzdem sind meine Sinne geschärft, als hätte ich ein Adrenalinbad genommen. Irritierend, wie drüber ich bin. Halb neun! Dann wollen wir mal. Ich muss die Sitzung hinter mich bringen.
Mit meiner Schuhspitze drücke ich die Eingangstür des Chateau Kellermann auf. Nichts weiter als eine zweistöckige Villa aus der Gründerzeit, von wegen Chateau.
„Ja, hallöchen, Herr Felder. Einen wunderschönen Tag wünsche ich“, röhrt Herr Arbiter, der Pförtner, im Singsangton durch die Scheibe seines Kabuffs. Er gibt verlässlich den Gutelauneclown, doch an der Färbung seiner Stimme kann ich erkennen, dass er zu vier Vierteln aus purem Hass besteht. Der Rest ist Verbitterung.
„Geht’s gut?“, zirpe ich, Nerven aus Stahl, Herz aus Gold.
Ich lächle, er lächelt, Nettigkeiten sind einfach mühsam.
Drei Schritte weiter komme ich im Rund der Lobby an. Heller Marmorboden, hohe Decken, Stuck an den Wänden – sowie bombastische Heizkosten, unlösbares Legionellenproblem und ständig ist irgendwas renovierungsbedürftig. Aber: gute Lage.
Das Anwesen habe ich gekauft, kurz überlegen, knapp vor dem Ersten Weltkrieg. Meine Firma befand sich noch in der Anfangsphase, aber während der Weimarer Republik standen Immobilienpreise in einem ganz anderen Verhältnis zum Nettoeinkommen. Weitere Faktoren spielten auch mit rein, klar, aber ich will nichts verkomplizieren, auch wenn ich für nichts mehr belangt werden kann. Sagen wir, ich hatte einen Lauf. Mittlerweile könnte ein Start-up-Unternehmen eine solche Investition unmöglich stemmen. Die Zukunft birgt gegenwärtig kein Potenzial.
Aber so was ändert sich auch wieder wie nichts.
Eine schlanke Frau mit Aufsteckfrisur und Konfliktgesicht kommt mir durch die Halle entgegengetrippelt, als hätte sie mich abgepasst. Meine Büroleiterin Sina Mechlitz.
Unsere Gutenmorgens überschneiden sich nahezu.
„Sie sehen hervorragend aus, Herr Felder“, sprudelt es aus ihr heraus, wobei sie nicht darauf anspielt, wie unfassbar attraktiv ich bin – natürlich nicht –, sondern schlicht und ergreifend ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck verleiht, dass ein angeblich weit über Fünfzigjähriger um mehr als ein Dutzend Jahre jünger anmuten kann.
Es soll ja Menschen geben, für die so was das Höchste wäre.
Und dann gibt es da noch Menschen wie mich.
Wenn ich einmal monatlich unseren Firmensitz besuche, bleibt Frau Mechlitz stets aufs Neue die Spucke weg.
„Immer nur halb so hervorragend wie Sie, Frau Mechlitz“, erwidere ich ihrer als Kompliment verkleideten Verblüffung und schaue verzagt. Ich bin derartig überfällig ... ich muss sehr bald wieder formal sterben, und mir ein neues Geburtsdatum und einen neuen Namen zulegen, sonst wird’s verdächtig.
Zum Kotzen. Diese ewige Unruhe. Man gewöhnt sich nicht daran.
„Von meiner Seite aus könnten wir gleich loslegen, sofern alles vorbereitet ist“, flöte ich hauchig, weil es zum Freundlichsein heutzutage praktisch keine Alternative mehr gibt.
„Selbstverständlich, wir wären so weit“, schallt es von Frau Mechlitz auf dieselbe Weise zurück, wie ich in den Wald hineingerufen habe, was mich aber nicht weniger auf der Hut sein lässt, und mein Blick sagt „Sie zuerst, bitte“, und schon stöckelt sie vor mir her, die Treppen hinauf in den ersten Stock, seitlich gedreht smalltalkend, doch ich höre kaum zu, nicht mal, wenn ich selbst etwas sage.
Unwillkürlich registriere ich Frau Mechlitz’ schon wieder dünner gewordene Arme und Beine. Respekt. Magersucht ist fast noch wohlstandsverwahrloster als Fettsucht.
Sie öffnet die linke Hälfte des schweren Türflügels unseres Konferenzraums und ich schwebe förmlich an ihr vorbei und hindurch. Ich tue, was ich kann.
„Hallo zusammen, schön, Sie zu sehen“, drehe ich auf, als ich das mit dem Besprechungstisch raumfüllend bestückte Zimmer betrete und meiner Belegschaft ansichtig werde. Sieben der sechzehn Sessel werden belegt sein, wenn Frau Mechlitz und ich uns gleich ebenfalls gesetzt haben. Wir sind vollzählig.
Augenblicklich ist Ruhe im Raum, ich wappne mich innerlich. Das wäre sie, die Führungsriege der Rollos & Jalousien Felder GmbH und Co. KG. Einmal betont gelassen rundherumgeschaut, Augenkontakt mit jedem Einzelnen der Anwesenden, grüßendes Nicken, bitte recht freundlich, ich schnaufe unmerklich, und voilà. Dezent lasse ich meine Laptoptasche auf die Tischplatte gleiten und nehme Platz. Wohlgemerkt setze ich mich nicht an die Stirnseite des Konferenztisches, wie man es von einem Firmeninhaber vermuten könnte, sondern zu den anderen, an eine der beiden Längsseiten, mitten rein. Das ist Teil meiner allumfassenden Ich-bin-einer-von-euch-Simulation.
Vor hundert Jahren, auch noch vor dreißig, hätten mir meine Angestellten mein Bemühen um Augenhöhe als Schwäche ausgelegt, da musste man Ansagen machen und Autorität vorspiegeln, statt Ebenbürtigkeit zu heucheln. Heute erschiene mir jedwedes Chefgehabe als kontraproduktiv und feudalistisch. Immer schön auf Kumpel und Wirgefühl machen, lautet die Devise. Flache Hierarchien. Mir bleibt nichts anderes übrig. Entschiedenheit, die keinen Widerspruch duldet, oder mal jemandem einen Einlauf verpassen, das war einmal.
Bei den Unikaten um mich herum, wie auch bei meinen ganzen anderen circa dreihundert Beschäftigten in Fertigung, Montage und Vertrieb, handelt es sich inzwischen größtenteils um handysüchtige, kaum belastbare, mit Fantasymotiven durchtätowierte, ewige Kinder, geprägt von Selbstgefälligkeit und Unsicherheit. Das darf man nie vergessen. Das ist die aktuelle Erwachsenengeneration. Nach Vernunftsmaßstäben letztlich unbrauchbar. Aber von Vernunft kann ich mir auch nichts kaufen.
Ich bin ja schon froh, wenn sich einer nicht die komplette Fresse mit Tattootinte verziert hat und nur höchstens die Hälfte seiner Arbeitszeit privat im Netz verbringt. Überdies muss ich mich immer wieder ermahnen, daran zu denken: Bald werden die Millennials und ich gleich alt aussehen! Und dann muss ich mein Verhalten, mein Outfit und alles andere vollends dem ihren anpassen.
Na prost Mahlzeit.
Meinen Sack rasier ich mir immerhin schon seit schätzungsweise zwanzig Jahren. Aber das allein reicht ja nicht.
Im Verlauf meines Lebens habe ich mich bereits in eine Menge Generationen eingefügt, vielen Altersklassen entsprochen und mich assimiliert, das kenne ich zur Genüge, ernsthaft, aber diese Nasenbohrer! Das wird eine echte Herausforderung.
Und wer sich nun beschwert, dass ich hier den Untergang des Abendlandes beweine, der redet sich leicht. Der möge sich bitte ins Gedächtnis rufen, dass ich das künftige Elend ja hautnah miterleben muss. Ich muss mir die Sprüche und Ansichten draufschaffen, sonst wirke ich am Ende noch wie ein Anachronismus aus Großväterchen und Mann-Mitte-vierzig. Das ist mein Los.
Damit begreift man schon eine ganze Menge.
„Wie war Ihr Monat, lief alles glatt?“, werfe ich in die Runde und lächle halbseitig, etwas misslungen. Die Antworten sind noch weniger erwähnenswert als meine plumpe Frage, aber es menschelt, das ist die Hauptsache.
Die Luft hier drinnen ist leicht stickig. Macht nichts. Ich kichere über eine Bemerkung, die jemand fallen ließ und die ich gar nicht richtig verstanden habe, und klappe mein MacBook auf. Rechts neben mir sitzt Sven Kellinghusen, achtunddreißig, untersetzt, Hauttyp schneeweiß, neurotischer Vertriebsleiter mit abgebissenen Fingernägeln und spitz zischenden s-Lauten beim Sprechen, dererwegen ich, statt ihm zuzuhören, immer nur die Sekunden zähle, bis er endlich wieder seinen Mund hält. Er ist ein Mann mit Ecken und Kanten, gibt immer seine vollen sechzig Prozent, besitzt zahllose Motivkrawatten, eine schrecklicher als die andere, und hat beim Gehen leichte Koordinationsdefizite, was zunächst gewöhnungsbedürftig ist, dann aber ganz lustig aussieht.
Links neben mir die, ich glaube, zweiunddreißigjährige Karin Mustubat. Zu gleichen Teilen zuständig für Produktentwicklung und Marketing, was eine ineffektive, aber notwendige Kombination ist, da sie – wie sag ich das am nettesten – in gleichem Maße geistig schlicht wie total unfähig ist, aber auf diese Weise in jedem der beiden Ressorts nur halben Schaden anrichten kann. Ich schleife sie mit, weil die Einhaltung der Frauenquote im Betrieb politisch wichtiger ist als das Erzielen einer Kompetenzquote. (Ein einziger Krampf.) Doch auch dieser Trend wird vorübergehen. Spätestens dann, wenn sogar dem letzten Trottel aufgeht, dass Frauen zwar bei Toppositionen auf absolute Gleichstellung pochen können, Jobs bei Kanalreinigung und Stahlbau hingegen elegant für sich ausschließen. Das nennt man Rosinenpickerei.
Für vier ausgeschriebene Stellen habe ich dreißig Männer zur Auswahl und neun Frauen. Das ist die Realität. Trotzdem muss ich am Ende auf zwei Männer und zwei Frauen kommen.
Benennen Sie den Fehler!
Diese Steigbügelhalterei degradiert die Frau zum unmündigen Kind. Schutzbedürftig und von jeder Verantwortung und Eigeninitiative befreit. Mir etwas zu gut gemeint. Ich selbst würde mir eine solche Inobhutnahme als betreuungswürdiges Sonderwesen verbitten.
Apropos, mein Favorit unter den Stellenausschreibungen der letzten Jahre: Menschen mit Behinderung und Frauen bevorzugt. Think about that.
Es müssen schleunigst wieder die Geeignetsten gewinnen dürfen, nicht die Kategorisierten. Sonst führen Quoten zu Privilegien und somit auch wieder zu Diskriminierung. Sowie zu einer Kettenreaktion aus kompletter Inkompetenz.
Erfahre ich am eigenen Leib. Wenn Sie bitte mal schauen wollen, in die werte Runde um uns herum.
Und man muss nicht glauben, dass eine inkompetente Mitarbeiterin nicht selbst merkt, dass sie ihre Stelle nur aus statistischen, nicht aus den erstrebten Gründen bekommen hat. Das macht auf Dauer auch nicht glücklich.
Nun denn. Keine große Affäre. Der Mensch braucht eben immer seine Zeit, bis er sich auf die Schliche kommt.
Da müssen wir jetzt durch.
Die Mustubat also, Vollkatastrophe.
Das wenige Private, was ich über sie weiß: Sie hat Lebensmittelallergien gegen so gut wie alles, schon aus Prinzip, sie geht einmal die Woche zur Therapiesitzung, in der sie mit ihrer Psychologin bespricht, wie sie mit ihrer glücklichen Kindheit klarkommen soll, und irgendwann möchte sie aus wahrer Liebe heiraten. Ich vermute, aus wahrer Liebe zu teuren Handtaschen, Schmuck und Luxusurlauben.
Daumen drücken.
Und dann haben wir da noch, mir gegenüber, im Gegenlicht dieses trüben Septembertages, Pit Reiber von der Buchhaltung, langer Lulatsch, einundfünfzig, fähiger Mann, auf Zack, schnell im Kopf, viermal geschieden, wirklich beeindruckend, gelbliche Zähne, seit Ewigkeiten in der Firma, will mehr sein, als er jemals sein wird, und macht auch gern mal krank. Ich mag ihn. Seine Naivität schließt das nicht aus.
Er ist so was von schwul, glaubt aber, dass es keiner merkt. Inklusive seiner vier durchalimentierten Ex-Frauen. Er hinkt da mit seiner Verschleierei etwas hinterher, könnte man meinen. Schwulsein ist in. Aber verkorkst ist verkorkst.
Des Weiteren, links von Pit, in tadelloser Garderobe, Harald Höfflinger vom Onlineteam, gerade vierzig geworden und aufgedunsen wie ein Heißluftballon mit aufgemaltem Filzstiftgesicht, halb Mensch, halb Knödel, was seiner Exzentrik jedoch keinen Abbruch tut und ihn schon gar nicht am Abliefern meist solider Arbeit hindert. Er duzt alles nieder, zwinkert immer so komplizenhaft und ist auch sonst ein wenig eigen. Ich bewundere Menschen, die abartig aussehen, sich aber nicht drum scheren. Das ist Selbstbewusstsein. Inbegriffen einer gehörigen Portion Verdrängung und Kompensation natürlich, aber man darf doch bei keinem zu tief bohren.
Und zu guter Vorletzt die bereits in Erscheinung getretene Sina Mechlitz, eine überpflegte Opportunistin Mitte dreißig, die meine rechte Hand hier in unserem Hamburger Haupthaus darstellt. Optisch ziemlich uncharismatisch, aber wenn sie die Augen etwas zusammenkneift, geht’s.
Sie ist von einer Verschlagenheit, die sie zweifellos auszeichnet, die mir jedoch vor allem dann auf den Geist geht, wenn ich so tun muss, als bemerkte ich ihre hintertriebene Ader nicht, damit zwischen uns bloß keine Schräglage entsteht.
Als mittelständischer Unternehmer wird man ständig torpediert, auch aus den eigenen Reihen heraus. Aber kein Problem. Wir sind doch alle Arschlöcher. Wie stark ausgeprägt, kommt nur auf die Konstellation an. Weshalb ich, was immer Sina im Schilde führt, vollstes Verständnis habe. Unabhängig davon, ob sie auf Datenklau aus ist, auf Kundenabwerbung für eine eventuell geplante Selbstständigkeit oder ob sie einfach nur von blankem Zerstörungsbedürfnis gelenkt wird: Die Folgen werden mich sowieso nicht mehr betreffen.
Gell, Rainhard?
Rainhard, der Siebte im Bunde, der ganz außen sitzt, mit einem leeren Stuhl Abstand zu Sina, fixiert mich unablässig, auch als Pit Reiber längst begonnen hat, uns das Resümee der Umsatzzahlen des vergangenen Monats vorzutragen.
Ich stehe unter Rainhards argwöhnischer Beobachtung, seit dem Tag, an dem ich vor zweiundzwanzig Jahren die Firma übernommen habe, als meine Tochter Augusta sich pünktlich zu ihrem Siebzigsten in Rente begab.
Bis zu jenem Zeitpunkt war Rainhard Eiben der engste Mitarbeiter Augustas, die die Firma über dreißig Jahre lang geleitet hatte. In dem Moment, in dem ich Augustas Nachfolge antrat, und zwar in meiner Rolle als ihr Sohn, keimte zwischen Rainhard und mir jene groteske Dynamik auf, die entsteht, wenn ein Vertrauter (er) der ehemaligen Chefin (Augusta) sich mit einem Mal ihrem vermeintlich verhätschelten und unerfahrenen Spross (mir) unterzuordnen genötigt sieht. Dass dieser Günstling (also ich) in Wirklichkeit die Firma vor über hundert Jahren gegründet hat, weiß Rainhard freilich bis heute nicht.
Doch trotz unseres kniffligen Verhältnisses und obwohl er jetzt auch schon auf die siebzig zugeht, und auch ungeachtet seiner ekelerregend buschigen Augenbrauen, muss ich wirklich einräumen – und ich rede nicht gern gut über Menschen –, dass er letztlich in Ordnung ist. Ein korrekter Typ.
Allein schon seine Vorbehalte mir gegenüber sprechen ja für ihn.
Deshalb lasse ich Rainhard in der Firma tun und lassen, was er will, solange er will. Er genießt Welpenschutz.
Und das zu sagen, ist kein Versehen.
Ich könnte sein Urururopa sein, so abgefahren das klingt.
Wie überhaupt meine persönliche Historie, wie auch die des Unternehmens, eine lange und ungewöhnliche Entwicklung durchlaufen musste.
Während der Jahrzehnte, in denen Augusta unseren Betrieb nach außen hin allein leitete, dirigierte ich die Geschicke der Firma aus dem Hintergrund und war daher voll im Thema, als ich 2004 aus der Versenkung auftauchte und seitdem der Rollos & Jalousien Felder GmbH und Co. KG wieder offiziell vorstehe – wie bereits von den Jahren 1910 bis zu meinem vorläufigen Abschiedsjahr 1971, als meine optische Erscheinung auch beim besten Willen nicht mehr zum angegebenen Alter meiner dritten Inkarnation als Firmenbesitzer passte und ich auf den wirklich allerletzten Drücker verstarb. Mit der Elastizität eines Mannes Mitte dreißig.
Ein einziges Theater. Willkommen in meinem Leben.
„Lassen Sie uns doch jetzt bitte die neue Produktlinie besprechen, und da vor allem den EF250“, mahne ich an, nachdem wir mit dem regulären Tagesordnungszeugs endlich durch sind und alle ihren Beitrag leisten durften. Pit, Sven, Karin, Sina, Harald, sogar Rainhard. Es muss halt jeder mal was sagen. Wenn ich nicht Teil des Ganzen wäre, müsste ich mich übergeben. Meetings sind völlige Zeitverschwendung, gestohlene Stunden. Ließe sich alles in vier Sätzen zusammenfassen, der Rest ist Geschwätz. Weiß der Teufel, warum es sich in Betrieben so eingeschlichen hat.
„Ich weiß, ich bin lästig ...“, leite ich also das Thema EF250 mit drolliger Selbstironie ein und will gerade weiterprasseln, da knattert mir ein „Entschuldigung!“ mitten in den Satz rein und ich schaue volksnah von meinen Unterlagen auf. Sieh an, die Karin Mustubat, unser Totalausfall, möchte gerne etwas einflechten, aber wenn ich daran denke, was ich alles so möchte, dann könnten wir es auch sofort sein lassen.
Ich überwinde mich, obwohl ich ahne, was für ein vogelwilder Quatsch uns droht, gebe Karin ein Zeichen, zu äußern, was sie äußern möchte, nur zu, und werde Zeuge einer von anschaulichen Gesten begleiteten Anmerkung, die so gespenstisch insignifikant ist, ein solches Meisterwerk des Versagens, echt schwach, dass ich mir Mühe gebe, nicht die Augen zu verdrehen, sondern stattdessen „Sehr schön, das behalten wir im Hinterkopf“ verlautbare und tue, als wäre ich restlos begeistert.
Ich weiß wirklich nicht, wozu sie gut ist.
Aus unersichtlichen Gründen bittet jetzt auch noch Pit Reiber ums Wort und verwickelt Karin in einen saftigen Schlagabtausch aus gegenseitigen Schuldzuweisungen, die nicht erst seit gestern zwischen den beiden zu schwelen scheinen, bis Pit mit einem abschätzigen „Wie auch immer“ samt passendem Wink das Elend beendet, was zu beobachten mehr Spaß macht, als man vermuten möchte. Karin schäumt ein kantiges „Echt jetzt?“ hervor, brennt mit ihren Augen Löcher in Pit und da haben wir den Salat. Zwei beleidigte Leberwürste, die sich ein weiteres Mal in ihren Vorannahmen bestätigt sehen: Die Mustubat hält Pit Reiber für rüde und Pit Reiber hält die Mustubat für eine hohle Nuss. Womit beide letztlich recht haben.
Ich nicke angemessen beeindruckt, übernehme wieder die Gesprächsführung und beziehe die ganze Gruppe mit ein. Auf meinem Gesicht: die Parodie eines Lächelns.
Der Chef ist immer der Sklave.
Um mich herum sind alle dermaßen sensibel, wirklich wahr, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als sie beständig in Watte zu packen. Ihre Naivität beschämt mich geradezu. Und kurioserweise merken sie ja alle selbst, dass was mit ihnen nicht stimmt.
Ich schwöre: In jeder vorangegangenen Epoche wäre der aktuelle Typus Mensch durch die Bank elendig krepiert. Wegen jedem Dreck beleidigt, erfüllt von überzogenem Anspruchsdenken, permanent emotional angeschlagen und dabei, und das ist das Wichtigste: immer auch ein bisschen depressiv! Und zwar aus den falschen Gründen. Weil depressiv reihum mit schlecht drauf verwechselt wird, aber so viel tiefschürfender klingt als unglücklich verwöhnt.
Die Zeiten werden härter, die Menschen weicher.
Diese Generation wird sich selbst um die Ohren fliegen.
Der Countdown läuft.
Andererseits dachte ich mir das auch schon bei so manch anderer nachwachsenden Generation zuvor.
Wenn es da jemandem anders geht: Es würde mich wundern.
„Die Ergebnisse des Praxistests waren ja ziemlich erfreulich, aber bevor wir die Probephase finishen, sollten wir ...“, spiralisiere ich mich wieder ins Ausgangsthema, Geduldsfaden längst gerissen, ziehe simultan zum Sprechen mein Slim-Fit-Jackett aus und werfe es über die Rückenlehne. Modisch bin ich durchgehend auf dem aktuellen Stand, da ich unter der Angst leide, ansonsten altzöpfig rüberzukommen. Denn ich bin altzöpfig. Plus starrsinnig, plus saturiert. Weiß ich selbst. Geht doch gar nicht anders. Man entkommt sich nicht.
Natürlich kleide ich mich auch nicht übermäßig modebewusst, da man besonders modisch gekleidete Menschen nicht ernst nehmen kann.
Wenn es nach mir ginge, trüge ich immer noch den Stil der späten 1850er Jahre, meiner Lieblingsära. Damals, nicht halb so alt wie heute, war ich Teenager, und kein Abschnitt prägt stärker. Das lässt sich nie mehr auslöschen. So gesehen hinke ich dem Zeitgeist innerlich seit mindestens hundertfünfzig Jahren kontinuierlich hinterher.
Früher waren Kinder wie kleine Erwachsene gekleidet, das hat man fast vergessen. Es gab noch keinen spezifischen Style für Jugendliche. Ich mochte das. Ich mochte das sehr. Seitdem hat sich wahrlich einiges geändert. Heute kommen Erwachsene wie Kinder daher.
Nicht nur in Sachen Kleidung, auch sprachlich befinde ich mich dauernd auf Zehenspitzen. Mega, geil, cool, alles nicht mehr ganz neue Wörter, das ist mir bewusst, aber es passt zu meinem aktuellen Spielalter, Anfang vierzig. Also verwende ich diese Wörter regelmäßig und forme meine Sätze entsprechend. Eine verbale Maskerade sozusagen.
Auf der Vokabelliste für meine nächste Aneignung stehen bereits true, fresh, Dude, flexen, sliden, korben, instant, Shout-outs gehen raus an wenauchimmer – wobei mir dieses neue Zeug ebenfalls schon wieder gestrig vorkommt –, gönn dir, nice, abstürzen und safe statt ja sowie: Jeden zweiten Satz mit Digga oder Alter abschließen, auch Frauen gegenüber (kein Digge oder Alte).
Klar ist das lächerlich. Das fand ich aber bei dufte, superduper, tollmolle, flotte Biene, Manometer, pfiffig und das fetzt auch schon.
Ganz zu schweigen von Nakedei, Leibesertüchtigung oder Still gestanden!
Ich muss Sprache immer wieder neu lernen, mich ständig aktualisieren, das Neue wird so schnell alt. Allein, was man derzeit nicht mehr sagen sollte, ist enorm. Da ist Vorsicht geboten. Bloß nicht anecken oder, schlimmer noch, wie aus der Zeit gefallen wirken.
Diese sprachhygienischen Umstellungen kommen in Wellen, und bis ich sie jedes Mal verinnerlicht habe, nach einem langen Leben wie dem meinen, dauert es ein bisschen.
Krücken heißen jetzt Gehhilfen, sonst verletzt man Gefühle!
Du liebe Güte.
Wirkt leicht übergeschnappt.
Gut möglich, dass ich das in hundert Jahren rückblickend anders sehe.
Meine Mannschaft brainstormt noch wegen eines Problemchens mit dieser neuen Gardinenklammer – toll, was man alles bewirken kann, wenn man das Niveau niedrig hält – und wir beraten munter hin und her, wobei ich ihnen in allem recht gebe, aber meistens vollkommen anderer Meinung bin, bis ich schließlich durchatme und zu Sina sage: „Wenn wir diese eine Macke in der Qualitätsprüfung nächstens noch eingegroovt kriegen, ist alles easy.“ Sprachlich arg um Hipness bemüht, mag sein, aber besser wird’s nicht. Heutige Vierzigjährige wie ich (haha) haben ihren Jugendslang eben nie abgelegt. Bitte schön.
„Top, dann hätten wir’s mal wieder“, füge ich an und stehe ein wenig zu abrupt auf. Womöglich, weil ich weiß, dass dies meine Abschiedsvorstellung war. Ich werde noch ein paar Angelegenheiten regeln, dann heimfliegen – und nie mehr zurückkehren.
„Lüften wir doch mal ein bisschen durch“, sind allen Ernstes meine letzten Worte an die Truppe. Und zwar für immer. Das war’s. Nett, euch kennengelernt zu haben. Etwas schäbig. Was mich aber nicht so sehr stört, wie es eigentlich sollte.
Als ich rüber in mein Büro gehe, spüre ich einen Anflug von Wehmut, oder so etwas Ähnliches, aber nicht schlimm. Alle Strippen hinter mir abzuschneiden, ist eine meiner leichtesten Übungen.
Ich habe mein Interesse an der Firma komplett verloren. Vielleicht sind hundertsechzehn Jahre Selbstständigkeit auch einfach genug, und Überdruss ist die logische Konsequenz, wenn es der Vergangenheit zu viel gibt. Ich bin nicht mehr hungrig. Und das Gegenteil von hungrig ist nicht durstig, sondern satt.
Kommende Woche ist erster Notartermin von zweien. Ein französisches Konsortium wird Rollos & Jalousien Felder erwerben. Den Laden, den ich 1910 als Stadtteilgeschäft in München-Giesing eröffnet habe und der damals zunächst nur Rollladen Robert Felder hieß, bis eines meiner Vorhangschienendesigns auf dem Markt von einem Tag auf den anderen regelrecht wie eine Bombe einschlug und ich zur Expansion gezwungen war. Der Krieg konnte mir geschäftlich erstaunlich wenig anhaben, wie überhaupt die Kriegsphase gar nicht so einschneidend war, wie es der Begriff Krieg einen glauben lassen würde. Es handelte sich eher um punktuelle Ereignisse.
Franz Kafka schrieb am 1. August 1914, zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in sein Tagebuch: Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags Schwimmschule.
So war das. Krieg! Das kann schon mal vorkommen.
(Es war beileibe nicht mein erster. Auch wenn seit 1871 über vierzig Jahre Frieden geherrscht hatte.)
Bald nach Ende des Ersten Weltkriegs zog ich aus mehreren Gründen nach Hamburg, kaufte die Villa, in der ich mich gerade befinde, und verfolgte meine Geschäfte mit einigem Ehrgeiz, da es zur Selbstständigkeit für mich nie eine Alternative gab. Fremdbestimmtheit war mir nach Jahren unentrinnbarer Abhängigkeit ein Gräuel; und auch heute noch wäre ich lieber ein mäßig erfolgreicher Unternehmer als ein höchst erfolgreicher Angestellter.
Der Laden lief von Anfang an solide und ich gründete schnell Niederlassungen in vielen größeren deutschen Städten, optimierte und maximierte stetig Produktpalette wie Umsatz, spezialisierte mich irgendwann aufs Luxussegment, weil das auch in Krisenzeiten geht, kriegte nach der Jahrtausendwende wie durch ein Wunder die Kurve zum Digitalhandel, wodurch sich unser Gewinn obszönerweise fast verdreifachte, änderte meine Vornamen im Laufe des Weges von Robert zu Richard zu Raphael zu Robin (Augusta stand früh bereit, meine personalen Lücken zwischen den einzelnen Inkarnationen zu füllen) und, und, und, und im Grunde ist mir die ganze Firmenhistorie gleichgültig. Es ist gelaufen.
Das Ende, das gehört dazu.
Wie immer nach unseren Monatsmeetings ist mir Sina Mechlitz in mein Büro gefolgt, sitzt nun vor meinem Schreibtisch und quittiert eine meiner Anweisungen mit einem hochgezogenen „Okay“, tippt dabei etwas in ihr iPhone und okayt sich Punkt für Punkt auch durch meine restlichen Instruktionen, während sie sich pausenlos durchs Haar fährt. Alle Hände voll zu tun.
Sina kann zwei Masterabschlüsse vorweisen, hat zwei elitäre Auslandsuniversitäten besucht, in USA und UK, und verfügt über zahllose Zusatzqualifikationen sowie Schulungen durch Onlineseminare, auf denen sie gelernt hat zu lügen, ohne rot zu werden. Rundum eine Frau von Welt.
Wann die Französische Revolution ungefähr stattgefunden hat, ist ihr dagegen schleierhaft, wer Schopenhauer sein soll, sie hat keinen Schimmer, Josephine Baker, nie gehört, zu Dingen, die ihr gefallen, sagt sie „Voll schön!“, Madame Tussauds nannte sie mal „Madame Touché“, und ihre i schreibt sie mit kleinen Kreisen statt als Punkte.
Stirbt auch keiner dran.
Auf ihrem Instagram-Profil finden sich mehr als eine Handvoll Partyfotos, auf denen sie Arm in Arm mit ihren zugekoksten Girlfriends im Orgienmodus in irgendeinem Klub eskaliert. Aufgerissene Augen und Münder, direkt in die Kameralinse brüllend, Cocktailgläser in der Hand und alles. So, wie man’s kennt. Eine Bildunterschrift lautet Heute Abend saufen wir uns behindert, Bitches. Gleich daneben findet sich ein Foto von ihr im hautengen T-Shirt mit hochgepressten Brüsten und geschürzten Lippen zum Hashtag Pray for Afghanistan.
Alles kein Widerspruch für eine seriöse Businesswoman wie sie. Eben extrem vielschichtig, die Sina.
Aber sie hat sehr gute Zähne.
Es fällt schwer, sachlich zu bleiben.
Ich bin kein Hellseher und ich lege für nichts die Hand ins Feuer, aber eines weiß ich: Die verblassende Regentschaft der alten weißen Männer wird im Rückblick wie ein sanfter Windhauch anmuten gegen die sich anbahnende Regentschaft der gar nicht mehr so jungen weißen Frauen.
Wir werden sehen.
Sina, genau wie die gesamte Belegschaft, hat keine Ahnung von meinem Verkauf des Unternehmens. Eine Bedingung der Käufer. Von mir aus.
Dieses Konsortium wird mir eine ziemlich substanzielle Summe zahlen, da man vor allem scharf auf meine aktuellen Patente ist. Und die sind zum Schreien. Ich halte sogenannte Fertigungscopyrights an ressourcenschonenden Klickgleitern für Vorhangschienen ebenso wie an ökozertifizierten Leisten für Fensterblenden, die unter anderem in Flugzeugen verbaut werden. Diese Fairtrade-Handelsketten-Umweltschutz-Augenwischerei funktioniert besser als jedes bisherige Geschäftsmodell meiner Laufbahn. Ähnlich wie bei E-Autos oder Bioverpackungen ist die Ökobilanz dieser Produkte um ein Vielfaches katastrophaler als bei den herkömmlichen Vorgängermodellen. Interessiert aber keine Sau. Noch dazu fällt das bigotte Klump nach kürzester Zeit auseinander, aber die Leute schlucken’s, weil es maßgeblich öko ist und sie das Richtige tun. Früher nannten wir die Verarsche geplanter Verschleiß, heute Nachhaltigkeit. Umweltbewusstsein als Marktsegment, um neue Umsatznischen zu erschließen. CO2 als Billionengeschäft. Global und zukunftsorientiert. Herrlich.
Der Großteil der Menschen verfügt nicht über die psychologischen Kapazitäten, den Nepp zu durchblicken oder sich über widersinnige Erlasse hinwegzusetzen. Er ist nicht mal skeptisch, sondern lässt sich von Schuldkult und Konfessionszwang absorbieren und vom Zeitgeistinfekt befallen, stets edelmütige Ziele vor sich hertragen zu müssen. Doch anstatt auf, zum Beispiel, völlig unnötigen Schnickschnack wie Coffee-to-go-Becher zu verzichten, findet er es naheliegender, die Becher zu ökologisieren. Das sagt alles. Denn Verzicht klingt wie Völkermord. Absolutes Tabu.
Entsprechend gestaltet sich der Markt. Daher handle ich nach dem Motto: Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an.
Aber das hält man auch nicht ewig durch. Mangelnde Folgerichtigkeit nimmt einem über kurz oder lang den Wind aus den Segeln. Und so stoße ich meinen Laden jetzt eben ab, wenn mir so ein windiger Investor schon ein Angebot unterbreitet.
Macht ihr mal. Lange kann das alles wirtschaftlich ohnehin nicht mehr gut gehen. Noch rechtzeitig verkaufen und sich aus dem Staub machen, bevor das Land international nach hinten durchgereicht wird. Das Ausland hasst und belächelt uns. Merke ich an meinen auswärtigen Handelspartnern. Mittlerweile muss man sowieso die Auslandspresse lesen, um über die Vorgänge im eigenen Land korrekt informiert zu werden.
Die Party ist vorbei.
Schön war’s.
Sina liest mir noch mal alles eben Besprochene zum Abschluss vor. (Die auszufertigende Korrespondenz, die ich ihr auftrage, lässt sie sich sowieso von irgendeiner künstlichen Intelligenz vorformulieren.) Indessen feile ich in Gedanken an meiner Antwort an Filius_Contemplata, ich kann an nichts anderes mehr denken. Meine Unruhe umgibt mich wie ein Dauerrauschen.
Als ich das Chateau gegen fünf verlasse, schreit mir unser Pförtner Herr Arbiter in nahezu echter Fröhlichkeit „Tschüssikowski, schönen Abend“ hinterher, wie es nur verkappte Massenmörder können, und ich Spaßvogel antworte mit einem zackigen „Tschüssinger“. Eins besser als das andere. Aber er zieht’s durch, das muss man ihm lassen.
Von einem Taxi werde ich in mein Fitnesscenter in der Nähe des Flughafens kutschiert, für das ich Idiot einen Mitgliedsbeitrag berappe, der es in sich hat, obwohl ich doch nur einmal im Monat in town bin. Ich muss täglich trainieren, jede Körperregion, jede größere Muskelpartie gezielt bewegen, da an mir alles verschlissen ist. Meine Knie, meine Schultern, unterer Rücken, Nacken, alles. Trotz gedrosselter Alterung unterliegt meine Querkalkulation in puncto Knorpelverschleiß einem ganz eigenen Rhythmus. Und gegen Gelenkabnutzung hilft nichts außer Muskeln. Jede andere Meinung ist Märchentrallala, um vollmundige Ratgeberbücher und Coachings zu verkaufen.
Ohne Training würde ich schreien vor Schmerzen und humpeln wie ein Greis. Aber mit Training geht’s.
Es ist halb zehn abends, als ich die Lufthansamaschine nach München besteige. Draußen hat längst die Dunkelheit das Licht verdrängt. Ich lasse mich in meinen Sitz am Gang sinken und gebe mir die Kante. Mit Mineralwasser. Nicht kalt. Ich habe heute vergessen zu trinken. Ich muss auf mich achten.
Die Maschine ruckelt auffallend, aber das konstant. Mir egal. Ich denke an Augusta, an den zurückliegenden Tag, an den vor mir liegenden Notartermin, die Firma, das Geld, an Filius Unterstrich Contemplata, wer auch immer das sein mag, ich denke an die Zukunft, aber eigentlich an die Vergangenheit, an die Verstorbenen aus meinem Leben, die Weggefährten, die ich gerade so zusammenkriege, wenn ich mich über die Maßen anstrenge (ich habe zu viele Menschen kennengelernt), ich denke nicht nur an die Freunde von damals, sondern auch an ihre Beerdigungen, ich denke an die sonstigen Toten, an die, die ich schon so lange nicht vermisst habe, auch an meine zahllosen Identitäten, wer ich schon war, gerade bin und noch sein werde, mein ewiger Schwebezustand zwischen noch und noch nicht ... vor, zurück ... ich denke ... irgendwie an alles. Eben wenn man feststellt, dass eine ganze Menge geschehen ist und dann doch wieder nichts.
Und als das Zeichen ertönt, das den Landeanflug einläutet, anschnallen und so, fühle ich mich schlagartig, wie soll ich sagen, dünnhäutig, und mich überkommt eine Anwandlung pathetischer Orientierungslosigkeit.
Ich kann mir nichts vormachen, ich kann mir selbst gegenüber noch so abgebrüht tun, als wenn nichts wäre, aber wir haben den 22. September. Wieder einmal. Einmal mehr.
Diesmal im Jahr 2026.
Letztlich Wahnsinn.
Wie oft schon schlitterte dieser Kalendermoment ungebremst an mir vorbei!
Der Mann auf dem Platz neben mir, 7E, hustet zum Erbarmen. Seine Stirnglatze steht ihm. Das gibt’s auch.
Der Flieger setzt solide auf dem Rollfeld auf, das Ruckeln endet dennoch nicht. Die Beinfreiheit ist absolut okay, ich weiß nicht, was alle immer haben.
Überhaupt: Flugzeuge, Internet, Smartphones. Keiner staunt.
Die Außentemperatur beträgt angeblich siebzehn Grad.
Ich bin die Unruhe in Person. Der Inbegriff von Unausgeglichenheit. Heute ist mein dreihundertster Geburtstag.
Dass ich das noch erleben darf.
3
Es war das Jahr 1889, als ich zum ersten Mal von Progerie las, einer rätselhaften Erbkrankheit, die Kinder vorzeitig vergreisen lässt. Bereits wenige Monate nach ihrer Geburt beginnen betroffene Neugeborene, um ein Zehnfaches schneller zu altern und das Erscheinungsbild eines schrumpeligen Marsmännchens anzunehmen, bis sie, nach einem krankheitsanfälligen Leben, mit durchschnittlich vierzehn Jahren versterben. Zumeist an Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Laut Wikipedia geht man davon aus, dass es weltweit etwas über zweihundert an Progerie erkrankte Kinder gibt.
Wikipedia war natürlich noch ein Ding absoluter Undenkbarkeit, als ich im Juli 1889 in der Stuttgarter Ausgabe der Allgemeinen Zeitung auf diese frühe Beschreibung des Krankheitsbildes stieß.
Ob eine Zeichnung eines jener kleinwüchsigen Kinder neben dem Artikel abgedruckt war, weiß ich nicht mehr. Ein Foto war es aber wohl eher nicht, das war noch unüblich.
Die Wohnung hingegen, in der ich zu jener Zeit hauste, als ich den Beitrag entdeckte, sehe ich noch genau vor mir. Eine marode Bude mit rußigem Wandputz, gelegen im zweiten Stock eines städtischen Mietblocks, dessen einziges Plumpsklo sich auf dem Hinterhof befand und für sämtliche Bewohner des Gebäudes herhalten musste. Es dürfte wie nichts Gutes gestunken haben und auch sonst eine entsetzliche Sauerei gewesen sein, aber wenn ich so darüber nachdenke, ist mir das nicht über Gebühr negativ in Erinnerung geblieben. Man war da eben nicht so.
Die feuchte Zwei-Zimmer-Einheit im Haupthaus teilte ich mit drei jungen Männern, die wir alle das Kunststück fertigzubringen versuchten, neben unseren Ausbildungen (ich arbeitete als Schreinergeselle) noch ein Studium an der technischen Hochschule auf die Reihe zu bekommen. Was sich in meinem Fall bald als aussichtsloses Unterfangen herausstellen sollte, nachdem ich zum einen schlichtweg zu mittellos war, um eine zweigleisige Ausbildung über Jahre hinweg zu bewerkstelligen, und zum anderen, weil ich keine höhere Schulbildung durchlaufen, sondern mir lediglich gefälschte Zeugnisse besorgt hatte, weswegen mein Wissensstand kaum ausreichte, um den universitären Anforderungen zu entsprechen.
Und, zu guter Letzt, weil ich, aus den längst zur Gewohnheit gewordenen Gründen, schön langsam wieder von der Bildfläche verschwinden und abermals Stadt und Personalien wechseln musste. Ich war kurz davor, aufzufliegen.
Was würde mir außerdem ein abgeschlossenes Studium nützen, wenn ich gleich anschließend in eine neue Rolle schlüpfe und mich gänzlich anderen biografischen Gegebenheiten ausgesetzt sehe?
Wo fängt man an, wo hört man auf?
Meine Zerrissenheit bedarf keiner Erwähnung.
1889 war ich fast hundertdreiundsechzig Jahre alt, sah aus wie Anfang zwanzig und befand mich bereits in meiner vierten Inkarnation. Diesmal unter dem Namen Ignaz Gattner. Ignaz. Das fand ich schon damals furchtbar. (Oder täusche ich mich?) Aber ich konnte es mir nicht aussuchen. Das nicht, und sonst auch nichts.
Mein beständiger Bäumchen-wechsel-dich-Turnus, meine prekäre wirtschaftliche Situation, zusammen mit der ewigen Frage, was mit mir nicht stimmte, all diese Aspekte hatten mich ausgehöhlt. Kein Wunder also, dass mir die Nachricht von einem Syndrom, das Menschen schneller altern lässt, den Atem verschlug.
War es folglich nicht denkbar, dass gleicherweise ein Phänomen existierte, demnach Zellen bestimmter Körper langsamer alterten? So wie meine? War nicht ausgerechnet ich der lebende Beweis für diese These?
Es liegt im Bereich des Möglichen, dass mir meine Theorie einer Art Antiprogerie damals wie eine Chance erschien, mein Dasein als Sonderling endlich rechtfertigen und somit mein Versteckspiel beenden zu können. Hoffnung auf Erlösung. Seht her, es ist was Medizinisches. Doch mir muss relativ schnell klar geworden sein, dass, sogar wenn ein solches Syndrom existierte, mir damit keine Spur weitergeholfen wäre.
Mal angenommen, ich hätte mich hinreißen lassen, mich aus der Deckung zu wagen, dann, machen wir uns nichts vor, hätte ich mich auch gleich selbst in Brand stecken können.
Abweichungen von der Norm, ob erklärlich oder unerklärlich, führten Ende des 19. Jahrhunderts zu gesellschaftlicher Ächtung, zu Aussatz und Vergeltung, so sicher wie das Amen in der Kirche.
Um Anfeindungen fürchten zu müssen, reichte es bereits aus, unverheiratet zu sein oder kinderlos, Kirchgänge auszulassen, Hasenscharte, Kleinwuchs, Rothaarigkeit ... Es war nicht weit her mit der Toleranz gegenüber Minderheiten oder Personen mit besonderen Ausprägungen. Kaum auszumalen, wie radikal man erst auf eine Erscheinungsform wie die meine reagiert hätte, deren Beugung der Vergänglichkeit sofort mit nichts weniger als dunklen Mächten in Verbindung gebracht worden wäre, mit dem Teufel oder sonstigem Hokuspokus.
Mit Subversion und Unterwanderung der Menschheit.
Ich, die Heimsuchung.
Wäre man mir hinter meine verlangsamte Alterung gekommen, wäre ich fällig gewesen.
Auch wenn Pferdekutschen das Straßenbild prägten und Männer alle Arten von Hüten und Bärten trugen und das auf vergilbten Fotos ganz lauschig daherkommen mag, darf man nicht vergessen, dass wir damals in einer rauen Dreiklassengesellschaft lebten, in der der Reichskanzler Bismarck hieß, Arbeitnehmer wie Leibeigene behandelt wurden und die soziale Rangordnung das Ein und Alles war. Eine Zeit, in der Kinder ihre Eltern siezten und ganz selbstverständlich körperlich gemaßregelt wurden, Frauen auch, Tiere sowieso, und eine ordentliche Tracht Prügel niemanden anmahnend hinterm Ofen hervorlockte.
Nur um mal auf die Schnelle ein Bild damaliger Geisteshaltung zu zeichnen.
Es herrschte ständig irgendwo Krieg, mal kurz, mal länger, man sah jede Menge Versehrte, Einarmige, Einbeinige, alle Variationen von Krüppeln prägten das Straßenbild (Krüppel, so nannte man das früher, und dieser Begriff verletzte ganz sicher jede Menge Gefühle, aber das war das geringste Problem eines Krüppels), Europa war im Grunde genommen bettelarm, und dann hatten wir noch Tuberkulose, Typhus, Tetanus, den Pockentod ... die Liste längst vergangener Vorkommnisse ist endlos und ein Abbilden der kompletten Verhältnisse schier unmöglich.
Wir sprechen von einer Epoche, in der man sich den Hintern mit Zeitungspapier auswischte (im Idealfall), Operationen mit ungewaschenen Händen durchführte und höchstens einmal die Woche badete, aber alle Leute – arm wie reich – stets ordentlich gekleidet aus dem Haus gingen und noch nicht aussahen, als rängen sie um den ersten Platz im Schlabberlookcontest in irgendeinem sozialen Brennpunkt. Dafür konnte aber auch jeder was erleben, der sich nicht daran hielt.
Und was mir nicht noch alles einfiele.
Doch summa summarum war es im Hauptsächlichen eine Zeit, in der die Angst vorm Bi-Ba-Butzemann dem eisigen Standesdünkel in nichts nachstand. Esoterik, Zauberei, Astrologie, übersteigerte Religiosität, Magie und Schicksalsglaube, sogar linkshändig schreiben war bereits Frevel, kurzum: der ganze komplette altertümliche Schwachsinn war in den Köpfen der breiten Mehrheit noch lange nicht von Wissenschaft und Forschung abgelöst worden.
Auch nicht in meinem Kopf, wohlgemerkt, so ist es nicht.
Sogar Spitzenpolitiker ließen sich von Wahrsagern beraten, Intellektuelle hatten ihre persönlichen Schamanen, und das gemeine Volk, das war sowieso noch mal eine ganz andere Schublade.
Wenn ich daran denke, woran ich selbst damals alles geglaubt und wie ich gedacht habe und was ich alles noch nicht wusste – man könnte daran verrückt werden. (Auch, weil es einem bewusst macht, was man jetzt gerade noch alles nicht weiß.)
In unendlich vielem bin ich längst nicht mehr meiner Meinung.
Genau wie sich meine heutige Meinung in ein paar Jahren in Staub aufgelöst haben wird.
Es hätte seinerzeit durchaus passieren können, dass auch ich einen Menschen, der unter einer Abart, vergleichbar der meinigen, leidet, gering geachtet hätte.
Ich kann für nichts garantieren.
Wir waren andere Wesen in jener Ära. In jeder Ära.
Wenn ich mir so zuhöre, erscheine ich steinalt, dabei ist 1889 gar nicht so lange her. Keine hundertvierzig Jahre.
Es ist überhaupt verwunderlich: Je älter ich werde, desto greifbarer fühlen sich zurückliegende Perioden an. Sie kommen näher, umso mehr ich mich von ihnen entferne.
Die Textur der Zeit ist ein Mysterium.
Genau wie ich es mir bin.
Sieben Komma zwei hatte ich bereits damals ausgerechnet.
7,2-mal langsamer alterte ich, im Vergleich zu den Menschen um mich herum. Dieser Wert ließ sich aus dem Verhältnis zwischen meinen Lebensjahren und meiner äußeren Erscheinung ableiten und hat sich bis heute nicht verändert.
Innerhalb von sieben Jahren altere ich körperlich lediglich um ein Jahr.
Oder anders gesagt: Ich werde optisch um ein Jahr älter, während alle um mich herum sieben kalendarische Jahre zurücklegen.
Das galt es erst mal rauszukriegen.
Ich würde es am liebsten auch nicht glauben.
Demnach dürfte ich um die sechshundert Jahre alt werden und befinde mich somit gegenwärtig in der Lebensmitte.
Komm damit mal zurecht.
X aufeinanderfolgende Mütter muss ich in meinen ersten neunzig Lebensjahren benötigt (verschlissen) haben, um überhaupt mal aus dem Gröbsten rauszukommen und in die Pubertät zu gelangen.
Geboren vermutlich im September 1726, dürfte ich nicht vor 1815 in der Lage gewesen sein, einigermaßen auf eigenen Füßen zu stehen. Ich sah da wohl wie ein ungefähr Dreizehnjähriger aus.
Das Glück musst du erst mal haben, die hilflosen Jahrzehnte als Kleinkind und junges Kind ausreichend beschützt zu werden, um schier am Leben zu bleiben.
Meine echte Mutter konnte nichts mit mir anfangen, als sie merkte, dass ich eine stark verzögerte Entwicklung an den Tag legte und nach drei, vier Jahren immer noch aussah wie ein taufrisches Baby, wenn auch kerngesund. Meine älteste Schwester hatte meine Fürsorge dann übernommen, was ich freilich nur aus nebelhaften Erzählungen weiß. Und ab meiner zweiten Pflegemutter wurde es mit meinem Werdegang auch nicht weniger kompliziert.
Klingt an sich schlüssig. So fangen große Geschichten an.
Wäre aber alles Unsinn.
Die Wahrheit ist: Ich habe keine Ahnung, was die rund ersten hundert Jahre meines Lebens mit mir passierte. Dennoch bilde ich mir ein, aus meinen lebenslangen Ängsten, Psychosen und Traumata rückschließen zu können, dass ich während dieser verschollenen Jahrzehnte über längere Zeiträume in Dunkelheit weggeschlossen worden sein könnte. Sowie einiges Ekliges mehr. Vermutlich handelte es sich bei meiner Frühphase um eine holprige Angelegenheit.
Aber das sind Spekulationen.
Erinnerungslücken geben einfach nichts her.
Und von meinen Narben, chronischen Entzündungen, Allergien und Geschlechtskrankheiten (mit denen ich bereits als Kind infiziert war) fange ich gar nicht erst an. Das will keiner hören. Am allerwenigsten ich. Rührt nur auf, führt zu nichts.
Man muss lernen, mit Vergangenem abzuschließen. Und darin habe ich es zu einiger Meisterschaft gebracht.
Systematisches Verdrängen ist an sich nichts Falsches. Auch wenn man nie weiß, wie lange es gut geht.
Das dazu.
Zurück zur großen Heimlichtuerei.
Symptome verzögerter Alterung aufzuweisen, ist also das eine. Zu überleben, ist noch mal etwas ganz anderes. Auch heute.
Sogar wenn es da draußen nun eine weitere Gestalt wie mich geben sollte, nennen wir sie Filius_Contemplata, muss die auch zunächst mal den Riesendusel gehabt haben, genügend passenden Umständen ausgesetzt gewesen zu sein, um halbwegs heil und unentdeckt durch die Gezeiten zu segeln.
Leicht wird es nicht gewesen sein.
Genau wie bei mir wird sich ihr Bedürfnis nach Verborgenheit tief in die Seele eingegraben haben.
Noch heute, 2026, mit dreihundert Jahren auf dem Buckel und nach ebenso vielen Jahren gesellschaftlicher Entwicklung, macht die Welt auf mich nicht den Eindruck, ein sicherer Ort für Singularitäten und Außergewöhnlichkeit zu sein. Alles bleibt am Ende normativ. Sogar die gegenwärtige Zwangsumarmung von Randgruppen (ob die wollen oder nicht), die Heiligsprechung aller Minoritäten (ohne Bezug auf individuelle Eigenschaften), das missionarische Propagieren unbedingter Handlungspflicht gegenüber sämtlichen Ungerechtigkeiten weltweit sowie das Zelebrieren von Opfermentalität und das Unterminieren abweichender Standpunkte, Gefühle vor Rationalität, die frömmlerische Wokenesswelle eben, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem militanten Kult mit totalitären Zügen und wurde übergriffig.
Und ist mittlerweile brandgefährlich.
Rudelmentalität, Ausschluss Andersgetakteter, moralisierende Hetze. Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders. Die allgemeine Unterwürfigkeit ist, dank beständiger Vervollkommnung der Indoktrinationsmechanismen, neuerdings wieder im Wachsen begriffen.
Ich misstraue jeder Bewegung, jedem System. Jede Revolution wechselt nur die Menschen an den Schaltstellen der Macht aus, mehr nicht. Das inhärente Übel bleibt bestehen, welch hehre Absichten ursprünglich vielleicht auch verfolgt worden sein mögen. Wenn du dachtest, das Problem sei schlimm, dann warte, was erst los ist, wenn sie mit der Lösung kommen. Der Mensch kann nicht einfach nur reagieren, er muss immer überreagieren.
Das ist nichts für mich.
Das macht mir eher Angst.
Jeder Wind kann – und wird – sich ganz schnell drehen.
Wie liberal, vielfältig und offen manchem die Welt heute auch vorkommen mag: Der Mensch wird seiner Freiheit schnell überdrüssig, sein Bedürfnis nach Autorität ist nicht zu unterschätzen. Mal ist es irgendein übergeordneter Gott, dann eine Leitfigur aus Fleisch und Blut, dann eine gesichtslose Ideologie. Egal. Der Mensch braucht eine Ansage. Er braucht eine Richtungsvorgabe für seine Meinungen. Er wünscht es. Immer. Und immer aufs Neue.
Er verehrt Macht und Führung.
Er braucht Eindeutigkeit.
Er benötigt Gut-schlecht-Koordinaten zur bequemen Handhabung.
Er liest die Zeitung, um zu erfahren, welcher Meinung er sein soll.
Wird ihm gesagt, er solle dieses oder jenes tun, diesen oder jenen für das Böse halten: Er wird es befolgen.
Wenn nicht heute, dann morgen.
Wer zu buckeln weiß, weiß auch zu peinigen.
Der Mensch will dazugehören. Nicht pragmatisch sein. Das ist zu anstrengend. Er mag die Gedanken am liebsten, die ihn nicht zum Nachdenken zwingen.
Er will sich über andere erheben.
Und es ist kein Pessimismus zu behaupten, dass sich die menschliche Natur durch nichts verändern lässt.
Das Dilemma ist, dass jede neue Generation ihre relevanten Erfahrungen selbst machen muss. Jeder startet bei null. Es geht immer wieder von vorne los, und doch gleicht nichts dem, wie man es früher gekannt hat.
Unerfahrenheit vergeht nicht.
Schade.
Den Menschen kannst du alles in allem vergessen.
Nein, nein, ich bleibe vorsichtig.
Pharmaindustrie, Medien, der Mob. Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn jemand von denen mich in die Fänge bekäme.
4
„Willst du jetzt den toten Mann markieren oder was?“, stichelt Augusta, bewegungslos im Bett liegend, die grauen Haare zerzaust, nur 37,9 Grad Fieber. Sie hat heute einen für ihre Verhältnisse kraftvollen Tag. Ich weniger. Ich bin in fürchterlicher Verfassung.
„Du kannst auch einfach weitersuchen und weitersuchen, bis nur noch das Suchen übrig ist. Wäre dir das lieber?“, erteilt sie mir gleich noch eine bissige Ansage.
Mit dem Hintern an die Fensterbank gelehnt, stehe ich in ihrem Schlafzimmer, sehe in ihr zweiundneunzigjähriges Gesicht, das aus der Kopfkissenmulde ragt, und weiche mit einem „Jetzt komm! Ich bin mir einfach immer unsicherer, ob ich überhaupt reagieren soll“ aus, dem ich ein „Ich muss nachdenken, es sacken lassen“ hinzufüge, ohne mir klar zu sein, was ich damit meine. Auf gewisse Weise bin ich altersgemäß in einem Stadium angekommen, in dem ich selbst kein Wort mehr von dem glaube, was ich von mir gebe.
„Ja, ja, es gibt immer ein Davor und ein Danach, ich weiß“, imitiert Augusta mich stimmlich total beschissen, wie es typisch ist, wenn ihre Geduld zur Neige geht. Von mir hat sie das nicht. „Deine Zögerei ist ja nicht auszuhalten! Was wirst du also antworten, in drei Teufels Namen?“
„Du hast recht: Warum nicht mal was riskieren!“ Jetzt bin ich der Komiker hier im Raum, druckse dann aber gleich wieder rum: „Filius Contemplata könnte eine Menge Schaden in unserem Leben anricht...“
„Na und?“, fährt Augusta mir über den Mund, geistig auf der Höhe, als wäre alles wie früher.
„Na und – was!“, sage ich gestelzt. Natürlich weiß ich, was sie meint. Augusta weiß das auch. Ich bin nicht auszuhalten.
„Das Ganze wird dich so oder so aus der Bahn werfen. Tut es doch jetzt schon“, doziert sie, und das ist wahr. „Hör auf, Papa, dermaßen zaghaft zu sein. Du kannst nicht dein Leben lang Ausschau halten und dann einen Rückzieher machen, sobald du fündig geworden bist. Kommt hinzu, dass wir nicht mal einschätzen können, ob unser Filius womöglich bloß irgendein Wichtigtuer ist, der versehentlich eine halbwegs passend klingende Anwort an dich verfasst hat. Nun schau doch erst mal. Einen Schritt nach dem anderen.“ Augusta redet immer ein bisschen pastoral mit mir. Und ich lasse es über mich ergehen. Hier hat alles seine Ordnung.
Von klein auf war Augusta ein resolutes Persönchen, doch nachdem ich sie irgendwann in ihren Zwanzigern über mein wahres Alter und was das für uns bedeutet, in Kenntnis gesetzt hatte, gewöhnte sie sich mir gegenüber auch noch jenen belehrenden Tonfall an, mit dem sie mich, ihren vorsintflutlichen Vater, seither ratgeberisch durch die Untiefen des Hier und Heute zu navigieren glaubt. Damit ich nicht vollends desorientiert im Wurmloch meines eigenen Raum-Zeit-Gefüges umherirre.
Diese Form der Inschutznahme mag von Augustas Warte aus durchaus nachvollziehbar sein, ist aber natürlich eine Fehldeutung. Zumal ich, zellbiologisch wie auch äußerlich, seit bereits fünfzig Jahren der eindeutig Jüngere von uns beiden bin. Tendenz steigend. Weswegen unser Vater-Kind-Umgangsstil mitunter nicht einer gewissen Komik entbehrt. In noch stärkerem Maße, wenn Augusta, so wie jetzt, zerbrochen vor mir liegt, in ihrem edwardianisch verzierten Metallbett, aschfahl, mit tiefen Augenhöhlen und verkrümmtem Rückgrat einer zerrupften Primel gleich. Ein Bild der Trostlosigkeit, das mich unendlich niederschmettert.
Doch nicht mal ihre rapide nachlassende Gesundheit lässt sie unser Kräftegleichgewicht überdenken. Nach wie vor hält sie sich für den gegenwartsnäheren und richtungsweisenden Teil unseres Zweierteams. Eine Haltung, die unser Miteinander nicht immer einfach gemacht hat.
Vor allem während Augusta die Firmenleitung innehatte, bekamen wir uns mehrmals gehörig in die Haare. Da wir jedoch glücklicherweise beide von ähnlich fragwürdigem Charakter sind – groß im Austeilen, mies im Einstecken, besserwisserisch und absolut unfehlbar –, erkannten wir früh, dass wir einander intuitiv begreifen und deshalb auch die Denkart des anderen zu ertragen imstande sind – und uns aus eben diesen Gründen nie beim anderen entschuldigen müssen.
Was einiges vereinfacht.
Wir machen nach Auseinandersetzungen kurzerhand weiter, ohne eingeschnapptes Getue oder nicht zu kittende Zerwürfnisse. So schafften wir es, einander nie abhandenzukommen. Die ganzen neun Jahrzehnte.
Natürlich hätte ich ihr früher manchmal eine schmieren können, dass alles zu spät war. Und sie mir ebenfalls. Und das sagten wir uns auch. Geschmiert wurde allerdings nie (allein schon, weil ich selbst als Kind zu oft verdroschen worden bin). Wir sind alles, was wir haben.
Und das ist keine Gefühlsduselei, sondern schrecklich.
Ohne ihr Zutun wurde Augusta unweigerlich in den Strudel meiner alles vereinnahmenden Andersartigkeit gesogen. In ihre Rolle als einzige feste Konstante in meinem Leben.
Was wir schon gemeinsam durchgemacht haben!
Womit sie schon konfrontiert wurde, wegen mir!
Was wir beide füreinander sein müssen! Irrsinn.
Ich habe mich ihr gegenüber schuldig gemacht. Ich hätte sie nie zeugen dürfen.
Aber ich brauchte die Ehe mit Augustas Mutter als Deckung. Und ein Kind zu haben (mindestens eines, besser zehn!), war damals gesellschaftlich erforderlich, um nicht aufzufallen. Womit Augusta auch Teil meiner Tarnung war.
Weshalb ich mich zeit meines Lebens in doppelter Verantwortung ihr gegenüber sah.
Am liebsten wäre ich allein geblieben. Ich bin am liebsten allein. Ich habe ein starkes Innenleben, da ist immer was los. Nur wenn ich alleine bin, habe ich das Gefühl, in echt zu existieren.
Aber damit wäre ich nicht durchgekommen.
„Also! Was. Wirst. Du. Filius Contemplata. Schreiben?“, zischt meine Tochter – die im Übrigen vollkommen regulär altert – und zieht die Augenbrauen hoch, woraufhin der Beatmungsschlauch um ihre Nase und Ohren kein Stück verrutscht. Sitzt er zu fest?
„Hm“, tue ich, als müsste ich mich sammeln, nachdem ich mich seit Tagen selbst umtanze und mir vormache, der Schattengestalt aus dem Darknet eventuell wirklich nicht zu antworten. Armselig? Vernünftig? Was weiß ich.
„Ich werde einfach konkret werden“, sage ich, als wollte ich mir selbst widersprechen, und drehe mich dem großen Fenster zu, von dem aus man auf die Gebäudefassaden blickt, die ringsherum ein geschlossenes Oval bilden, saniertes Altbauviertel, an sich ruhige Lage. Starke Windböen blasen durch die paar verstreuten Hinterhofbäume, was ich lediglich an den wogenden Ästen erkennen kann, da kein Laut von außen hereindringt.