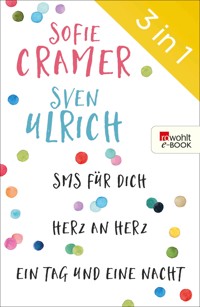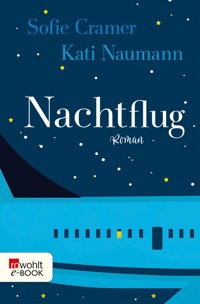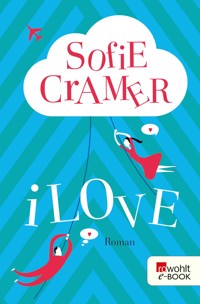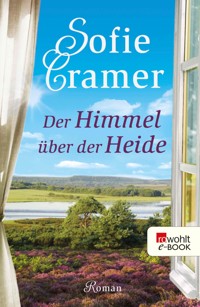9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Geschichte über die Kraft der Liebe und das Wagnis, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Lilly sehnt sich danach, noch einmal das Meer zu sehen, beim Cellospielen eine Gänsehaut zu bekommen und beim Küssen Schmetterlinge im Bauch zu spüren. Sie möchte jeden kostbaren Moment auskosten, denn sie weiß, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Len hingegen hat seit jenem schicksalhaften Tag vor zwei Jahren alles aufgegeben - seine Musik, seine Freunde und vor allem sich selbst. Jeder Atemzug ist für ihn eine Qual, denn er weiß, wie grausam das Schicksal zuschlagen kann. Zwei Seelen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch als sich ihre Wege kreuzen, wagen Lilly und Len das Abenteuer ihres Lebens. Eine Reise voller Höhen und Tiefen, die sie von Wien aus quer durch Europa führt und bei der sie nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst neu entdecken. Denn manchmal muss man die Vergangenheit loslassen, um die Schönheit des Moments zu erkennen - auch wenn der Himmel noch ein wenig warten muss. Der Himmel kann warten von Sofie Cramer ist ein zutiefst bewegender Roman über die Liebe, das Leben und den Mut, sich von Herzen fallen zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sofie Cramer
Der Himmel kann warten
Roman
Über dieses Buch
Ein Sommer für immer
Lilly würde alles geben, um noch einmal das Meer zu sehen. Beim Cellospielen eine Gänsehaut zu bekommen, beim Küssen Schmetterlinge im Bauch zu spüren: Sie will jeden Moment genießen. Denn sie weiß, wie kurz das Leben sein kann.
Len hat alles aufgegeben: seine Musik, seine Freunde und vor allem sich selbst. Seit jenem tragischen Tag vor zwei Jahren ist jeder Moment eine Qual. Denn er weiß, wie grausam das Schicksal sein kann.
Lilly und Len. Beinahe wären sich nie begegnet. Beinahe hätten sie es nicht gewagt – das Abenteuer ihres Lebens. Aber manchmal muss der Himmel einfach warten …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Cathrin Günther
Umschlagillustration Jutta Bücker
ISBN 978-3-644-55661-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Lilly
Len
Einen Winter später
Danke
Für meinen
Lieblingsonkel
Prolog
magic moments
mit dem leben in der hand
wollt ich schreiend um mich schmeißen,
du warst mir noch unbekannt,
in mir schien ich zu zerreißen.
spürte wut und hass und leere,
wusste nicht, wohin, wozu,
doch plötzlich wich die lebensschwere,
denn, lovely lilly, dann kamst du.
und spieltest mir auf deinen saiten
das lied vom leben, voll magie,
drum nimm mich, lass mich dich begleiten
in unsere welt der phantasie.
lass uns die sterne einzeln küssen
und sonnenstrahlen glücklich trinken,
lass uns nie wieder etwas müssen,
im ineinander sanft entsinken.
und zeig mir weiter deine saiten,
dein lied vom leben, voll magie,
damit sie unsere seelen weiten
in unserer welt der phantasie.
so leg ich mich in deine träume,
mein herz, das leg ich mit dazu,
geleite dich hin zu den bäumen,
beschütz dich bis zur letzten ruh
und zeig dir ewig meine saiten,
mein lied voll sehnsucht und magie,
das soll dich sternennah begleiten
in unsere welt der phantasie.*
Lilly
Ich liebe den Regen, dachte Lilly, als sie aus dem Fenster in den weitläufigen Garten blickte. Bei Regenwetter fühlte sie sich so schön normal. Denn was taten normale Menschen in ihrem Alter sonst, als bei Regen drinnen zu hocken und ihre kostbare Zeit vor irgendeinem Display totzuschlagen?
Lilly hatte sich wie so häufig in ihrem Zimmer in den übergroßen Sitzsack aus lila Samt gelümmelt und stöberte im Internet nach neuen Büchern. Gute Lektüre würde ihr vielleicht den Einstieg in die öden Sommerferien erleichtern. Denn Pläne hatte sie keine.
Während ihre Freunde drauf und dran waren, nach zwölf Jahren Schule endlich die Welt zu erobern, wurde Lillys Welt immer kleiner. Zwar hatte auch sie das Abitur frisch in der Tasche, dazu als Jahrgangsbeste. Doch was sollte sie schon damit anfangen? Sie würde nicht wirklich etwas davon haben.
«Haste schon gesehen?»
Lilly erschrak fürchterlich und starrte ihre Schwester entgeistert an, die, ohne anzuklopfen, in ihr Zimmer gepoltert war.
«Die Bilder sind online!»
Lilly stöhnte. «Welche Bilder?»
Es interessierte sie nicht. Überhaupt fand sie ihre drei Jahre jüngere Schwester einfach nur nervig. In ihrem Grufti-Outfit, mit dem dicken, schwarzen Lidstrich hinter der dunkel geränderten Brille und dem strengen Zopf sah Laura aus wie der Tod persönlich. Sehr zum Leidwesen ihrer Eltern trug die jüngere der beiden Heinemann-Töchter grundsätzlich nur Schwarz. Selbst ihre naturblonden Haare färbte sie schwarz, was die Mutter beim ersten Mal an den Rande des Wahnsinns getrieben hatte.
Lilly dagegen war schon immer angepasster gewesen. Sie lernte fleißig für die Schule, griff freiwillig zum Cello und ließ sich nicht auf Drogen, Computerspiele oder Männer ein. Auch bestand nie Gefahr, wie Laura in eine schwarze Phase abzudriften.
Trotzdem war Lilly das eigentliche Sorgenkind in der Familie.
«Na, vom Abiball», entgegnete Laura verständnislos. Sie trat zu Lilly, riss ihr den Laptop aus der Hand und ließ sich damit auf der Bettkante nieder.
«Guck mal hier!», befahl sie, sodass Lilly gezwungen war, sich aus dem Sitzsack zu hieven und neben die Schwester zu setzen.
Das Foto, das Laura zur Vergrößerung angeklickt hatte, zeigte Lillys beste Freundin Natascha zusammen mit einem Typen.
«Das ist doch Basti», sagte Laura.
Lilly wunderte sich, dass ihre Schwester den Kerl kannte. Basti war ein ehemaliger Schüler ihrer Schule, dem größten Gymnasium Lüneburgs. Es war nicht weiter verwunderlich, dass auch Absolventen der Vorjahre zum Abiball kamen. Ungewöhnlich war nur, dass Basti seinen Arm um Natascha gelegt hatte und sie durch ein glückliches Grinsen verriet, wie gut ihr dies gefiel. Bislang war er nur der Kumpel von Nataschas älterem Bruder gewesen. Aber das auf dem Bild sah eindeutig anders aus.
«Was haben die bitte am Laufen?», fragte Laura neugierig und wollte sich schon weiter durch die Galerie der bunten Partyfotos auf der Seite klicken. Aber Lilly nahm ihr den Laptop wieder ab.
«Das geht dich gar nichts an!»
Am liebsten hätte sie ihre Schwester einfach zurück auf den Flur geschoben. Auf keinen Fall wollte sie sich anmerken lassen, wie enttäuscht sie war. Lilly hatte den Abiball frühzeitig verlassen müssen und nicht mehr mitbekommen, wie ausgiebig offensichtlich noch gefeiert worden war. Aber Natascha hatte in den Tagen danach auch nichts Besonderes mehr erwähnt und Lilly nur mit den Worten getröstet: «Du hast echt nichts verpasst.»
«Also doch», stichelte Laura. «Die haben was miteinander!»
Lilly zuckte nur mit den Schultern.
«Na ja, das hält eh nicht lange», prophezeite Laura und schlug hinter sich die Tür zu.
Typisch Laura! Dabei war es noch gar nicht so lange her, dass die beiden Schwestern viel Zeit zusammen verbracht hatten. Wie oft hatten sie gemeinsam Musik gemacht: Lilly auf dem Cello und Laura am Klavier.
Lilly zog sich wieder in ihre Leseecke zurück. Das Knirschen des Sitzsacks erinnerte sie an das Innenleben von Kuscheltieren. Es klang nach unbeschwerter Kindheit, nach einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war.
Nicht ein einziges, dachte Lilly traurig, als sie sich tapfer bis zum letzten Foto des Abiballs durchgeklickt hatte. Und mit einem Mal fühlte sie sich seltsam verloren. Noch einmal rief sie die Startseite der Schule auf, um sicherzugehen, nicht doch ein Album ihres Abijahrgangs übersehen zu haben. Doch sie hatte alle rund 200 Bilder des wichtigsten Ereignisses des Jahres betrachtet – und keines zeigte sie.
Zum Glück hatte ihre Mutter ein paar Aufnahmen gemacht, bevor sie zusammen zum Fest aufgebrochen waren. Es gab auch ein paar Gruppen-Selfies auf ihrem eigenen Handy. Und doch löste es in Lilly eine starke Beklemmung aus, dass der eigens angeheuerte Fotograf sie als Einzige nicht für die Ewigkeit festgehalten hatte. War das ein Omen? Womöglich hatte er sie bloß für eine Verwandte gehalten und nicht für eine der achtzig Hauptpersonen. Schließlich hatte sie nicht getanzt und auch nichts auf der Bühne aufgeführt. Außerdem war sie als Erste wieder heimgefahren, weil die Anstrengungen der vergangenen Wochen deutliche Spuren hinterlassen hatten. Auch bei ihren Eltern. Und Lilly wusste nur zu gut, dass die beiden nicht ohne sie gefahren wären. Kein Auge würden sie zumachen, ehe die älteste Tochter nicht sicher in ihrem Bett lag. Also hatte sich Lilly gegen Mitternacht kurzerhand entschlossen, der unausgesprochenen, aber in den Augen ihrer Mutter deutlich ablesbaren Bitte nachzukommen und sich ihren Eltern und Laura beim Aufbruch anzuschließen. Unter anderen Umständen wäre sie vielleicht noch länger geblieben, aber sie war eben schon ziemlich kaputt.
Und so gab es eigentlich auch keinen Grund, sich zu wundern, dass es für die Nachwelt so aussehen musste, als hätte es sie nie auf diesem Abiball gegeben. Dabei hätte sich Lilly ausnahmsweise sicher gut gefallen auf einem Foto. Sie trug eine aufwendige Hochsteckfrisur und das hellblaue Chiffonkleid, das ihre Eltern eigens für den großen Tag spendiert hatten. Es war weit genug, um ihre spitzen Knochen in weibliche Rundungen zu verwandeln, und so geschickt ausgeschnitten, dass Lillys Narbe nicht zu sehen war. Dank eines Push-up-BHs hatte sie sogar ein annehmbares Dekolleté vorzuweisen.
Lilly klappte den Laptop zu und betrachtete das Kleid, das auch ein paar Wochen später noch immer an der Außenseite ihres Schranks hing. So konnte sie es jeden Tag bewundern. Ob sie jemals wieder eine Gelegenheit haben würde, es anzuziehen?
Sie stand auf und nahm das knielange Kleid, das auf einem vornehmen, mit Samt bezogenen Bügel hing, in die Hand. Dann hielt sie es an ihren zarten Körper und sah in den Spiegel. Aber es war nicht das gleiche Strahlen, welches sie am Tag des Abiballs umgeben hatte. Heute war ihr Blick leer. Seit die Schulzeit offiziell zu Ende war und bereits etliche Freunde die Stadt verlassen hatten, fühlten sich Lillys Tage unerträglich leblos an.
Es schnürte Lilly den Hals zu. Sie hatte wirklich Angst vor den großen Ferien. Denn es waren keine wie sonst. Nie wieder würde sie mit ihrer alten Mädchenclique auf dem Schulhof zusammenstehen und über die Lehrer lästern oder einen ganzen Tag lang auf der Wiese des Freibads verbringen. Sie würde langsam, aber sicher den Kontakt zur Außenwelt verlieren, zu den «normalen» Menschen. Aber zum Glück hatte sie Natascha! Ihre Freundin ahnte wohl, wie sehr Lilly die Aussicht auf diese nie mehr endenden Sommerferien bedrückte. Jedenfalls hatte Natascha angekündigt, am Wochenende mit ihr einen Ausflug zu unternehmen. Noch zwei Tage! Lilly befürchtete, bis dahin einzugehen. Vor Langeweile, weil ihre Eltern sie am liebsten gar nicht aus dem Haus ließen.
Natürlich durfte Lilly das Haus verlassen, aber nur, wenn ihr Vorhaben garantierte, dass es für sie nicht zu kräftezehrend war. Außerdem musste sie immer einen Notrufknopf an einem Schlüsselband um den Hals tragen. Wie ein Hund sein Halsband, hatte Natascha gewitzelt, als Lilly ihr das Plastikding zum ersten Mal gezeigt hatte. Natascha hatte ihr kurz darauf eine Kette mit riesigen bunten Perlen geschenkt, ein echtes «statement piece» wie sie sich ausdrückte. Die sollte Lilly tragen, um das Notrufhalsband darunter zu verstecken. Es tat so gut, eine Freundin wie Natascha zu haben, die einen auch im größten Kummer noch aufmuntern konnte. Eine Freundin, der nichts peinlich war und die sich nicht abschrecken ließ von Lillys schwächer werdendem Zustand.
Trotzdem war Lilly viel alleine auf ihrem Zimmer. Zu viel. Manchmal hatte sie das Gefühl, seltsam zu werden. Sie führte Selbstgespräche und verbrachte an einigen Tagen mehr Zeit im Internet als mit ihrem geliebten Cello. Cello spielen war ihre große Leidenschaft, und das durfte sie immerhin noch eine halbe Stunde pro Tag. Ansonsten blieb ihr nicht wirklich viel von der realen Welt da draußen, außer dem wöchentlichen Besuch in ihrem Lieblingscafé oder in der Stadtbücherei. Das waren sie schon, ihre wöchentlichen Highlights. Auch Shoppen gehörte nicht mehr dazu, weil es zu anstrengend war, stundenlang durch die Läden zu laufen. Lilly wusste nur zu gut, dass es auch für Natascha kein Vergnügen war, ihre Shopping-Begleitung zu sein. Zwar war ihre Freundin unschlagbar darin, die passenden Teile für Lilly herauszusuchen und sie in der Kabine mit gefühlt hundert angesagten Outfits zu überhäufen. Doch dauerte es meist nicht lange, bis Lilly schwindelig wurde oder ihre Beine anschwollen wie Marshmallows. Wie glücklich war sie gewesen, als sie bei der Suche nach einem Ballkleid schon im ersten Geschäft fündig geworden waren, einschließlich gefährlich hoher Peeptoes.
Der nächste besondere Anlass, ihr Outfit noch einmal zu tragen, wäre wohl der Abiball ihrer Schwester in drei Jahren. Doch es war ganz und gar ungewiss, ob Lilly diesen Tag noch erleben würde.
Len
«Verdammter Mist!», schrie Len und sprang wie ein tollwütiges Eichhörnchen durch die Werkstatt.
Sein Chef Manni sah erschrocken auf und kam sofort herangeeilt: «Was ist los? Noch alles dran?»
Doch seine Worte wurden von Lens Gejammer über seinen schmerzenden Daumennagel übertönt.
«Hast du mir einen Schrecken eingejagt!»
Als er sich vergewissert hatte, dass sein Schützling keinen ernsthaften Schaden genommen hatte, klopfte Manni ihm freundschaftlich auf die Schulter und widmete sich wieder seinen Balken in der Kantenschleifmaschine.
Len fluchte leise weiter. Das war schon das zweite Mal an diesem Tag, dass er mit dem Hammer danebengehauen hatte! Höchste Zeit für eine Zigarettenpause, dachte er und gab seinem Meister ein Zeichen, dass er sich für ein paar Minuten verdünnisieren würde.
Er schob sich durch den schmalen Gang zwischen der langen Werkbank und einem Stapel Sperrholzbrettern zur kleinen Veranda. Sie lag wie eine kleine Oase der Ruhe eingebettet zwischen der Maschinenhalle und dem Holzlager, an dessen Wand riesige Efeupflanzen rankten. Davor stand eine massive Bank, die Len gleich zu Beginn seiner Ausbildung gezimmert hatte, und ein Tisch aus umgedrehten, leeren Bierkästen mit einer Holzplatte obendrauf.
Gerade als er sich gesetzt, eine Lucky Strike angezündet und den ersten Zug tief inhaliert hatte, hörte Len, wie die Kreissäge ausgeschaltet wurde. Er musste grinsen. Denn das bedeutete, sein Chef würde ihm folgen und sicher wieder bei ihm schnorren.
Ehe Manni fragen konnte, hielt Len ihm eine Zigarette hin und gab ihm Feuer.
«Solange du hier arbeitest, werde ich es nie schaffen, von dem Dreckszeug loszukommen», beschwerte sich Manni und schubste Len unsanft zur Seite. Doch seine sympathischen, hellblau leuchtenden Augen verrieten, dass er eigentlich keine Lust hatte, tatsächlich mit dem Rauchen aufzuhören. Und dass er Lens Gegenwart sehr zu schätzen wusste.
Er hatte ein faltiges, sonnengegerbtes Gesicht, sah aber extrem lässig aus mit seinem schlichten Jeans-T-Shirt-Wuschelfrisur-Stil und seiner Kutte, die er an kälteren Tagen auch in der Werkstatt trug.
Mit einem tiefen Seufzer ließ Manni sich neben seinen Lehrling sinken.
«Du bist doch das schlechte Vorbild für mich», witzelte Len. «Ich meine, ein tätowierter Chef, der ‹Louder than hell› auf seinem Arm stehen hat, weil er Heavy-Metal-süchtig ist … Also, wenn das mein Alter wüsste.»
«Du kannst ihm doch eh nichts recht machen, oder?»
Statt zu antworten, schloss Len die Augen, um die kräftigen Strahlen der Junisonne auszukosten, die sich nach tagelanger Pause endlich wieder blickenließ.
Er mochte Manni sehr, was sicher damit zu tun hatte, dass seine Eltern ihn gleich zu Beginn in eine Schublade gesteckt hatten, aus der es kein Entkommen mehr gab. Jedenfalls hatten sie ihm seit der ersten und letzten Begegnung keine Chance gegeben, ihn näher kennenzulernen. Und das bloß, weil er harte Musik liebte und die alljährliche Pilgerfahrt nach Wacken zum Höhepunkt des Jahres erklärte. Auch dieses Jahr würde er sicher wieder auf das Metal-Festival in Norddeutschland fahren. Manni hatte sogar eine Art Zeitleiste in die Bank geritzt, um sich täglich daran zu erfreuen, dass das Großereignis immer näher rückte.
«Erzähl», sagte Manni, um das allmorgendliche Update über das leidige Dauerthema Elternzoff zu eröffnen, «hat dein Vater sich wieder eingekriegt?»
Len seufzte, als er an den letzten Streit denken musste. Wie so oft in den vergangenen Monaten hatten sein Vater und er sich so lange angeschnauzt, bis Len es nicht mehr ertragen konnte. Fluchtartig hatte er sein Elternhaus verlassen und sich in der Tischlerei verschanzt.
Mannis Reich war Lens Schutzburg. Hier fühlte er sich wohl, hier wurde er nicht ständig kritisiert, hier wurde er gefordert und gefördert. Außerdem war es wirklich ein Segen, dass die Werkstatt auf der anderen Seite des Rheins lag. Als Len vor knapp zwei Jahren seine Lehre zum Tischler begonnen hatte, dauerte es nicht lange, bis ihm das Pendeln mit Bus und Bahn von Kerpen zu Mannis Schreinerei im östlichsten Zipfel von Köln zu nervig und zu teuer geworden war.
Als im vergangenen Winter die Situation zu Hause eskalierte, bot Manni ihm an, den hinteren Teil seiner Werkstatt als Refugium zu nutzen. Kostenlos. Dort lag eine kleine Abstellkammer mit Küchenzeile sowie ein winziges Bad. Len baute die Räumlichkeiten nach und nach um, holte seine wichtigsten Sachen rüber und richtete sich, so gut es ging, ein. Auf einen Fernseh- oder WLAN-Anschluss musste er seitdem zwar verzichten, dafür hatte er aber seine eigenen vier Wände. Er nannte es sein Luxusloft. Ein Platz, an dem er sich in seiner freien Zeit ungestört aufhalten und mit seiner Gitarre beschäftigen konnte.
Die Streitigkeiten mit seinem Vater fielen seitdem nicht weniger heftig aus, aber immerhin weniger häufig. Wann immer es Len schlechtging, machte er es sich auf seinem selbstgezimmerten Futon gemütlich und komponierte weiter an seinen Songs herum. Stundenlang zupfte er an den Saiten herum und variierte Akkorde, bis sie es verdienten, auf Notenpapier festgehalten zu werden. Und wenn es eine richtig gute Melodie war, versuchte sich Len sogar an einem passenden Text. Meist fielen die Zeilen viel zu gefühlsduselig und traurig aus, um sie laut zu singen. Aber die Musik machte etwas mit ihm. Sie heilte seine Wunden ein Stück weit.
«Du willst also nicht drüber sprechen?» Manni riss ihn aus seinen Gedanken.
Len winkte resigniert ab. «Ach, es ist doch immer die gleiche Ansage. Ich soll mein Leben nicht vergeuden und mehr draus machen … bla, bla, bla.» Gedankenverloren strich er über das schwarze Schweißband an seinem linken Handgelenk.
Manni nickte verständnisvoll und nahm einen kräftigen Zug. «Was soll denn so schlecht daran sein, wie du dein Leben lebst?»
Len zuckte mit den Schultern. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, kam ihm in den Sinn. So oder so ähnlich fühlte es sich jedenfalls an.
«Mein alter Herr», fügte Manni hinzu, «wäre froh gewesen, wenn ich meinen Weg so straight gegangen wäre wie du.»
Es sollte aufmunternd gemeint sein, da war sich Len sicher. Trotzdem kam es ihm nicht richtig vor. Er hatte schon so viel falsch gemacht in seinem jungen Leben.
«Ich weiß nicht, was daran straight sein soll, die Schule abzubrechen und mit zwanzig immer noch keinen Plan vom Leben zu haben», sagte er.
Manni erhob sich, drückte den glimmenden Zigarettenstängel in einem improvisierten Aschenbecher aus und klopfte Len auf die Schulter.
«Ich wäre stolz auf dich, wenn du mein Sohn wärst. Ehrlich! Was geschehen ist, ist geschehen.»
Damit verschwand sein Chef nach drinnen. Len blickte ihm noch einen kurzen Moment hinterher, dann ließ er müde seinen Kopf sinken. Kurze Zeit später war wieder das Kreischen der Kreissäge bis auf die Veranda zu hören.
Nur noch eine Woche, dachte Len, dann würde der schlimmste aller Jahrestage zum zweiten Mal über ihn hereinbrechen. Je näher der Tag kam, desto unwohler fühlte er sich in seiner Haut. Und er hatte absolut keinen Schimmer, wie er ihn überstehen sollte.
Lilly
«Hammer, der absolute Wahnsinn!», kreischte Lilly. Sie nahm den Helm ab und schüttelte ihr langes, glattes Haar, das während der Freiluftfahrt wild umhergeflattert war.
«Willst du auch mal?», fragte Natascha und grinste breit.
Für einen kurzen Moment war Lilly versucht, das verlockende Angebot ihrer Freundin anzunehmen, die geliehene Vespa auch mal zu fahren. Der Parkplatz war menschenleer und breit genug, um auch ohne Führerschein eine Proberunde zu drehen. Doch allein die Vorstellung, das Ding selbst zu steuern, wühlte sie auf. Die Fahrt raus zum See war aufregend genug gewesen, und ihr Adrenalinspiegel ließ sie ohnehin schon schwindeln.
«Ach, lass mal», sagte Lilly etwas wackelig auf den Beinen und winkte ab. Sie streifte den Notrufknopf ab, stopfte ihn in die Tasche und erklärte: «Lass uns lieber ans Wasser gehen. Ich hab einen Mordshunger.»
Das war zwar geflunkert, aber Lilly wollte nichts riskieren. Natascha war nämlich sehr gut darin, andere in ihrer Euphorie mitzureißen. In Wahrheit hatte Lilly keinen besonders großen Appetit. Überhaupt musste sie sich meist zu regelmäßigen Mahlzeiten zwingen, wofür ihr alltäglicher Medikamentencocktail verantwortlich war. Sie hasste all die unzähligen Tabletten, vor allem die großen ACE-Hemmer. Aber sie wusste, dass sie sie am Leben hielten. Und sie wollte Natascha nicht enttäuschen. Schließlich hatte sich die Freundin bei der Vorbereitung des Ausflugs große Mühe gegeben.
«Ich habe extra vegane Muffins gebacken!», sagte Natascha stolz und klopfte vielversprechend auf ihren übergroßen Liebeskind-Shopper, der den gleichen altrosa Farbton hatte wie das Moped, das sie von Bastis Mutter für den Ausflug ausgeborgt hatte. Sogar eine Fleecedecke hatte Natascha vorsorglich in der Klappe unter dem Sitz verstaut, sodass sie es sich bei ihrem Picknick am See richtig gemütlich machen konnten. Jedenfalls wenn das Wetter mitspielte. Gewitter lag in der Luft. Und vom gestrigen Regen würde das Gras auch noch etwas nass sein. Aber das war Lilly egal. Hauptsache, sie kam mal raus.
Es hatte einiges an Überredungskunst gekostet, bis ihre Eltern diesem Ausflug zugestimmt hatten. Manchmal fühlte Lilly sich regelrecht zu Hause eingesperrt. Auch wenn sie wusste, dass die Eltern sich nur Sorgen machten. Sorgen, dass Lillys Kreislauf zu sehr beansprucht würde und ihr Herzmuskel sie endgültig im Stich ließ, so wie es die Ärzte manches Mal prognostiziert hatten während ihrer nun bereits 15 Jahre andauernden Krankheitsgeschichte. Wegen einer im Kleinkindalter verschleppten Infektion war die Angst ständiger Begleiter der Familie.
Nur gut, dass Natascha nicht so ängstlich war. Sie hatte Lilly mit der Idee zu diesem Ausflug überrascht und sich von der unerträglich schwülen Luft in den vergangenen Tagen nicht von ihrem Vorhaben abhalten lassen.
Sie wollten ihr bestandenes Abitur feiern. Und noch auf etwas anstoßen, das Natascha am Telefon nicht verraten wollte.
«Gib’s zu, du hast dich doch in Basti verknallt», rief Lilly ihrer Freundin hinterher, als diese sich bereits mit Decke und Tasche Richtung Wasser aufmachte.
Irgendeinen Grund musste es ja geben, warum Natascha so unternehmungslustig war und darauf gedrängt hatte, sich mit ihr zu treffen. Lilly wusste, dass ihre Freundin sich in letzter Zeit mehrfach mit Basti getroffen hatte, obwohl Natascha angeblich nichts von ihm wollte. Auf dem Abiball-Foto hatte das allerdings bereits ganz anders gewirkt.
«Quatsch», entgegnete Natascha, «ich hab mir bloß vorgenommen, uns einen richtig schönen Nachmittag zu machen.»
Lilly schmunzelte unbemerkt in sich hinein. Sie war sich sicher, dass Basti mehr für Natascha war als bloß der gute Kumpel, für den sie ihn ausgab.
«Und was war das nun mit dem Foto?»
Natascha blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr um. Lilly war gespannt, welche Ausrede sie sich diesmal einfallen lassen würde. Denn bislang hatte ihre Freundin nur mit einem augenrollenden Smiley geantwortet, als Lilly sie via WhatsApp mit dem Schnappschuss vom Abiball und drei Fragezeichen konfrontiert hatte.
«Erstens will er gar nichts von mir, und zweitens habe ich gar keine Zeit für einen Freund.» Nataschas Protest wirkte so energisch, dass Lilly nun doch bereit war, ihr zu glauben. Wundern tat sie sich trotzdem.
«Wieso denn keine Zeit? Du kellnerst gerade mal zwei Abende die Woche.»
«Ich …» Natascha hielt kurz inne und runzelte die Stirn.
«Ich … ich kann eigentlich gar nichts mit ihm anfangen. Ich meine … Also, ich muss …», stammelte sie. «Es ist so: Ich muss –»
Lilly fiel ihr amüsiert ins Wort: «Du musst ihn erst besser kennenlernen, ich weiß! Das behauptest du immer, wenn du einen Typen interessant findest. Aber meinst du nicht, dass zehn Jahre dann doch reichen, um abzuchecken, ob er auch gut genug für dich ist?»
Nach außen hin wirkte Natascha viel selbstbewusster und flippiger, als sie eigentlich war. Aber in Bezug auf Männergeschichten war Lillys Freundin sogar noch langweiliger als sie selbst. Immerhin hatte Lilly sich in der zehnten Klasse mal in einen Austauschschüler aus Irland verliebt und Natascha damit monatelang in den Ohren gelegen. Der Kerl hätte ihre Gefühle allerdings nicht einmal ahnen können, so schüchtern war Lilly damals gewesen. Aber Natascha schwärmte nur für Männer aus einer Parallelwelt: Ryan Gosling oder Manuel Neuer zum Beispiel. Also Typen, denen sie ohnehin nie begegnen würde. Den jeweils aktuellen Schwarm nannte sie immer ihren «Einschlafmann», weil er sie ins Reich der Träume begleitete. In der realen Welt dagegen war Natascha noch nie verliebt gewesen.
Etwas verlegen verzog Natascha ihre Mundwinkel. «Du hast ja recht», seufzte sie und setzte sich wieder in Bewegung. «Aber … Ach, ich muss dir nachher noch was erzählen. Komm!»
Als sie das Ufer nach etwa 500 Metern erreicht hatten, atmete Lilly schwer. Und als der Blick endlich frei wurde zum Bootssteg auf der gegenüberliegenden Seite des Sees, vermutete sie kaum noch Sauerstoff in ihren Adern.
Natascha blieb stehen. «Wir könnten auch ’ne Runde Tretboot fahren, wenn du willst.»
Lilly holte so unauffällig wie möglich tief Luft und seufzte. Sie würde so gerne, aber es ging einfach nicht.
«Oh, sorry! Das war dämlich von mir», sagte Natascha leise. Sie hakte Lilly unter und zog sie weiter. Nach ein paar Metern hellte sich ihr Gesicht wieder auf. «Ich kann doch alleine treten», schlug sie vor.
«Ich weiß nicht», antwortete Lilly mit einem Blick auf die dunklen Wolken, die langsam, aber stetig näher rückten. «Das Wetter wird wahrscheinlich nicht lange genug halten.»
Sie war unsicher. Eigentlich hatte sie große Lust auf Bootfahren. Schließlich waren richtig heiße Tage in Norddeutschland eher die Ausnahme als die Regel. Und auf dem Wasser war die schwüle Hitze sicher besser auszuhalten. Andererseits wollte sie Natascha nicht noch mehr zumuten. Manchmal kam es ihr so vor, als sei sie nicht bloß ihre beste und längste Freundin, sondern auch ihre Seelsorgerin, Krankenpflegerin und Animateurin. Es musste auf Dauer deprimierend sein, sich mit ihr abzugeben. Aber irgendwie hatte Natascha ein Talent dafür, ganz normal mit ihr umzugehen. Ein Verhalten, das sonst eigentlich niemandem so richtig glückte. Die meisten gaben sich mit ihr viel Mühe, aber genau das war das Problem. Lilly konnte es nicht ausstehen, wenn man sie behandelte wie ein rohes Ei. Auch wenn es wohl kaum eine Stunde in ihrem eintönigen Alltag gab, in der sie nicht an ihr verdammtes, krankes Herz dachte, so wollte sie wenigstens nicht durch betroffene Blicke oder mitleidige Floskeln zusätzlich mit der Nase drauf gestoßen werden.
«Okay, dann lass uns am besten schnell einen schönen Platz suchen», schlug Natascha vor und schaute sich um. «Wie wäre es dort?»
Sie deutete auf ein grünes Fleckchen unter einer ausladenden Trauerweide. Lilly nickte. Gemeinsam breiteten sie die Decke aus, streiften ihre Ballerinas ab und setzten sich. Sogar an Eistee und Erdbeeren hatte Natascha gedacht. Mit Sekt würden sie nicht anstoßen. Natascha musste fahren, und Lilly war Alkohol verboten.
«So, und hier sind die vegansten aller veganen Muffins», sagte Natascha und holte aus ihrem Shopper eine Tupperdose mit köstlich aussehenden Küchlein. «Mit Öl statt Butter und Ei und Fair-Trade-Zitrone. Zufrieden?»
Lilly musste lachen und griff zu. «Du bist die Beste!», sagte sie und biss genüsslich in einen der Muffins. «Ich weiß ja selbst, dass es manchmal nervig ist, sich vegan zu ernähren, aber –»
«Du willst diesen Planeten als ein guter Mensch verlassen», führte Natascha den Satz zu Ende. «Ich weiß.»
Eine Weile aßen sie schweigend weiter und starrten aufs Wasser. Hier im Schatten ließ es sich gut aushalten. Es war so friedlich und idyllisch, dass Lilly ganz wehmütig wurde. Auch wenn sie im Alltag versuchte, ihre Herzmuskelschwäche so weit wie möglich von sich wegzuschieben, waren Momente wie diese Fluch und Segen zugleich. Wann immer das Leben einfach nur leicht schien, so wie an diesem ruhigen See, der mit Hunderten Seerosen verziert und von unzähligen quirligen Insekten bevölkert war, wurde Lilly schwer ums Herz. Je schöner, desto schwerer. Und diese Welt war manchmal unerträglich schön.
An düsteren Tagen aber, wenn sie sich besonders schwach fühlte und sich selbst und ihren Körper nicht ausstehen konnte, wenn jeder Atemzug schmerzte und die Beklemmungen kaum auszuhalten waren, erschien ihr die Aussicht auf das Ende durchaus verlockend. Auch wenn dieses seltsame Gefühl meist nur ein paar Minuten währte. Wohingegen sich dieses «Einfach-alles-Scheiße»-Gefühl, wie sie es ihrem Therapeuten gegenüber mal zusammengefasst hatte, sich auf mehrere quälende Stunden oder sogar Tage ausbreiten konnte.
«Was hältst du davon, deine Eltern zu überreden, dass wir diesen Sommer mal an die Ostsee fahren?», nuschelte Natascha mit vollem Zitronen-Muffin-Mund und riss Lilly damit aus ihren trüben Gedanken.
«Da können wir sie genauso gut fragen, ob ich einen Joint rauchen oder mich schwängern lassen darf», entgegnete Lilly und steckte sich eine der süßen, saftigen Erdbeeren in den Mund.
«Du bist fast 18! Und außerdem: Was sollen sie dagegen haben?» Natascha richtete sich auf. «Wir können ja auch mit der Bahn fahren. Hin und zurück am selben Tag. Bloß ein bisschen am Strand chillen und spazieren gehen.»
Lilly seufzte. Nicht einmal an der Abifahrt nach Sylt hatte sie teilnehmen dürfen! Sie kannte sämtliche Argumente ihrer Eltern in- und auswendig: Es sei unverantwortlich, in ihrem desolaten Zustand zu reisen. Außerdem dürfe sie keine Zeit verlieren, «wenn es so weit ist». Wenn sich tatsächlich ein Spenderherz für sie finden ließe. Stumpf wiederholten die Eltern die Argumente der Ärzte und erstickten damit jede weitere Diskussion im Keim. Aber das war unfair! Denn Lilly wollte ja leben. Sie wollte so leben wie alle Leute in ihrem Alter. Sie wollte Fahrrad fahren, ausgehen und auf Abifahrt gehen.
Das Schlimmste aber war: Lilly hielt es kaum aus, wie sehr ihre Eltern sich an die Hoffnung klammerten, sie könne eines Tages tatsächlich durch eine Organspende gerettet werden.
In ihrer Wut über dieses Verhalten warf sie ihnen vor, sich hinter der Hoffnung auf ein Spenderherz zu verstecken. Sie nannte es zynisch ihr «Totschlagargument» und knallte meist alle Türen auf dem Weg hoch zu ihrem Zimmer. Und wenn sie dann heulend auf ihrem Bett lag, dauerte es oft keine Minute, bis ihre Mutter anklopfte, sich leise ins Zimmer schlich und zu ihr legte. Ohne ein Wort zu sagen, lagen sie einfach nur da, hielten sich in den Armen und weinten.
Lilly schloss die Augen. Es war eine wunderbare Vorstellung, mit Natascha wegzufahren. So wie vor drei Jahren, als es ihr noch besser ging und sie mit der Musik-AG zu einem Konzert nach Dresden gereist waren. Zusammen mit einer anderen Klassenkameradin hatten Natascha und sie noch ein paar Tage dranhängen dürfen. Doch seit der Oberstufe war es mit Lillys Gesundheit stetig den Bach runtergegangen. Die Eltern wurden immer ängstlicher. Zuerst war der obligatorische Familienurlaub in den Sommerferien nach Italien gestrichen worden. Auch wegen der Hitze, die Lillys Kreislauf zusehends strapazierte. Es folgten weitere Einschränkungen. Einschränkungen, die die ganze Familie bestraften. Anfangs versuchte Lilly noch, die in zunehmender Regelmäßigkeit wiederkehrenden Symptome wie Schwindel, Luftnot und Abgeschlagenheit zu verheimlichen. Aber es fiel ihr immer schwerer, ihrer Mutter etwas vorzumachen. Die Krankheitszeichen setzten meist urplötzlich ein. Lilly wurde dann schwarz vor Augen, und sie musste sich einen sicheren Platz suchen, um einen Augenblick zu verschnaufen. Wie eine alte Frau, die vom Treppensteigen erschöpft war. Auch wenn Lilly wahrscheinlich nie erfahren würde, wie es war, eine alte Frau zu sein.
«Also, was meinst du?», fragte Natascha. «Sollen wir deiner Mutter ein paar Muffins übrig lassen und sie nachher fragen?»
Lilly sah ihre Freundin skeptisch an. «Natascha, das ist eine überaus zauberhafte Idee», erwiderte Lilly in dem näselnden Tonfall ihrer Mutter. «Wenn es erst mal so weit ist, könnt ihr all das nachholen, worauf ihr bislang verzichtet habt.»
Natascha lachte und verstand wohl, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu insistieren. Sie schenkte Lilly einen Eistee in einen der mitgebrachten Becher ein und begann ebenfalls die freundliche, aber bestimmte Art von Angela Heinemann zu imitieren: «Lilly Schatz, es gibt doch so vieles, was ihr hier bei uns unternehmen könnt. Wie wäre es, wenn ihr euch in den Wintergarten setzt und ein Puzzle macht?!»
Lilly prustete laut los. Natascha hatte ihre Mutter viel besser drauf als sie selbst. Kein Wunder, ging Natascha doch schon seit dem Kindergarten bei ihnen zu Hause ein und aus. Natascha mochte Lillys Eltern, und umgekehrt. Überhaupt waren Lillys Freunde immer gern zu ihr gekommen und hatten oft bewundernd gesagt, sie habe ja so tolle Eltern und ein so tolles Haus. Doch mit den Jahren wurden die Besuche weniger. Auch Laura brachte kaum noch jemanden mit, weil es sicher keinen Spaß machte, seine freie Zeit an einem Ort zu verbringen, an dem die Krankheit der großen Schwester alles dominierte. Und wo all die unausgesprochenen Sätze für beklemmende Stimmung sorgten.
Sobald Natascha allerdings beim gemeinsamen Abendessen mit am Tisch saß, was durchaus mehrmals die Woche vorkommen konnte, war die Atmosphäre viel entspannter. Lillys Mutter versuchte stets durch vermeintlich beiläufige Fragen herauszubekommen, was ihre Töchter so trieben, wenn sie mal nicht unter ihrer Kontrolle standen. Und Natascha ärgerte sie dann ein bisschen, indem sie üble Knutschereien und Mutproben andeutete, auf die Angela jedes Mal total ansprang. Das wiederum amüsierte alle anderen am Tisch einschließlich des Vaters derart, dass die Sorgen für einen Moment vergessen waren.
Lilly streckte ihr von Sommersprossen übersätes Gesicht in Richtung Sonne. Die warmen Strahlen blitzten durch die Zweige der Trauerweide hervor. Und schon nach kurzer Zeit bemerkte Lilly, wie sehr die Sonne knallte. Ganz sicher würde sie bei ihrem sehr hellen Hauttyp einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie sich nicht im Schatten aufhielt. Wenn sie schlecht drauf gewesen wäre, hätte sie jetzt vermutlich spöttisch gedacht, dass ihr das eigentlich vollkommen egal sein konnte. Schließlich musste sie sich im Gegensatz zu allen anderen nicht vor Falten im Alter oder gar Hautkrebs fürchten.
Aber sie wollte den Nachmittag genießen. Jedenfalls solange es noch ging.
«Was wolltest du eigentlich noch erzählen?», fragte Lilly, ohne ihre Augen zu öffnen. Sie wollte gar nicht wissen, ob die dunklen Wolken näher kamen oder nicht.
Weil keine Antwort kam, blinzelte Lilly kurz in Nataschas Richtung und sah, dass die Freundin ebenfalls ihre hübsche Nase in die Sonne hielt.
«Hallo, jemand zu Hause?», fragte sie und schob sich geschickt eine weitere Erdbeere in den Mund.
«Was?» Natascha machte es sich mit einem zufriedenen Seufzer auf der Decke bequem, indem sie sich auf den Rücken legte und ihre Arme hinter dem Kopf verschränkte.
«Na, du meintest doch eben, du willst mir noch irgendwas erzählen. Hat es vielleicht doch mit einem gewissen Herrn B. zu tun?», bohrte Lilly weiter nach und ließ sich ebenfalls wieder auf die Decke sinken. Es war einfach herrlich, so entspannt in das grüne Blätterdach emporzuschauen.
Doch Natascha schien sich nicht wirklich entspannen zu können. Unruhig rutschte sie hin und her und richtete sich schließlich mit einem Ruck wieder auf.
«Sag mir lieber, was ich mit meiner Sonnenbrille gemacht habe!» Ungeduldig kramte sie in ihrer Tasche herum. Und Lilly wusste auch, warum sie so panisch wurde. Es war eine Dolce & Gabbana, die Natascha zwar gebraucht ersteigert hatte, für die sie aber dennoch lange hatte kellnern müssen.
Lilly schob ihre Hand als Schattenspender vor die Stirn, damit sie Nataschas Gesicht besser erkennen konnte, und grinste in sich hinein.
«Was?», entfuhr es Natascha. «Hilf mir lieber, zu suchen! Hoffentlich habe ich sie nicht irgendwo auf dem Weg verloren.»
Lilly ließ sie noch ein paar Augenblicke schmoren, dann konnte sie sich ihr Lachen nicht mehr verkneifen.
«Auf deinem Kopf, du Witzpille!», erlöste sie ihre Freundin schließlich.
Natascha fasste sich ungläubig an die Stirn und bekam einen Lachkrampf. Dabei hätte sie ihre Brille gar nicht mehr gebraucht. Die Sonne wurde inzwischen verdrängt. Immer schneller türmte sich der tiefgraue Wolkenberg auf. Da ertönte in der Ferne bereits ein Donnern.
«Wollen wir noch abwarten, ob es wirklich losgeht?», fragte Natascha und blickte argwöhnisch in Richtung des düsteren Himmels.
«Kann es sein, dass du dich vor einer Antwort drückst?», fragte Lilly spöttisch.
«Nein, Quatsch. Ich … Ich meine ja nur. Wenn es gleich anfängt zu regnen, können wir wohl kaum zum Roller sprinten.»
Noch ehe Lilly überlegen konnte, wie die Worte gemeint waren, spürte sie auch schon die ersten Regentropfen auf ihrer Haut.
«So ein Mist!», rief Natascha und begann hektisch die Sachen zusammenzupacken.
Mittlerweile prasselten bereits dicke Regentropfen durch das Blätterdach. Eilig rafften sie sämtliche Sachen zusammen und machten sich auf den Rückweg.
Als Lilly später auf dem elterlichen Sofa saß und sich bei der Lektüre diverser Frauenmagazine erholte, war sie trotz vorzeitig abgebrochenem Ausflug sehr glücklich über den gelungenen Nachmittag. Natascha hatte sie sicher durch den Regen nach Hause gefahren. Beide waren bis auf die Unterwäsche nass geworden, aber es war ein warmer Sommerregen, nach dem sich die Haut wunderbar weich und gesund anfühlte. Natascha hatte es vorgezogen, sofort weiter nach Hause zu fahren, um sich umzuziehen, aber versprochen, gleich morgen noch einmal vorbeizukommen. Dann würde Lilly sie ausquetschen und endlich erfahren, was ihrer Freundin auf der Seele brannte.
Jetzt standen erst mal Lauras Matheprobleme auf der Familien-Agenda. Lilly konnte beobachten, wie die Sorgenfalten ihrer Mutter immer tiefer wurden, je länger Laura darüber lamentierte, wie fies es sei, in den Sommerferien Nachhilfe nehmen zu müssen.
«Herr Schröder hat Mundgeruch», protestierte sie. «Und Schuppen!»
«Du solltest dich weniger auf Sympathien oder Antipathien konzentrieren und vielmehr auf deine Versetzung ins nächste Schuljahr!», mahnte ihr Vater.
Lilly lag bereits auf der Zunge, dass Laura sowieso niemals wie gewünscht in die Fußstapfen des Vaters treten würde. Sie hatte gar kein Interesse daran, sein Architekturbüro zu übernehmen. Doch sie wollte weder ihrer Schwester in den Rücken fallen noch sich ihre gute Laune verderben lassen.
«Wie wäre es, wenn wir jetzt erst mal zu Abend essen?» Ihre Mutter hatte hektische Flecken am Hals, was kein gutes Zeichen war. Unwirsch begann sie, den Tisch zu decken.
«Ich helfe dir», bot Lilly an.
«Bleib du ruhig liegen, deine Schwester kann mir helfen.»
Laura schnaubte, ging aber ohne Widerworte in die Küche, um Teller und Besteck zu holen. Wahrscheinlich war sie froh, der Diskussion über ihre schlechten Noten zu entkommen.
«Erzähl lieber, wie es war heute», fügte ihre Mutter noch hinzu und sah Lilly eindringlich an. Ganz so, als würde sie an Lillys leicht geröteten Wangen ablesen wollen, ob sie nicht doch über die Stränge geschlagen hatten.
«Bis zum Regen war es ein richtig cooler Tag. Das wollen wir jetzt öfter machen», erklärte Lilly begeistert.
Ihre Mutter stutzte. «Ach ja?» Unsicher sah sie ihren Mann an, der allerdings noch immer intensiv damit beschäftigt war, Lauras Matheaufgaben durchzusehen, und deren vermeintliche Lösungen mit gehobenen Augenbrauen und einem leichten Kopfschütteln quittierte.
«Wollte Natascha heute nicht mitessen?», bohrte ihre Mutter weiter nach.
Irgendwie hatte Lilly das Gefühl, etwas stimmte nicht.
«Mum, was soll das? Frag doch endlich, was du eigentlich wissen willst!», zischte Laura nun in ihre Richtung.
«Laura!», ermahnte sie ihr Vater. Hatte er etwa nur so getan, als würde er sich in Lauras Matheheft vertiefen? Was war hier los?
«Ich wette, sie hat’s nicht geschafft, es dir beizubiegen», sagte Laura und begann, die Teller auf dem Tisch zu verteilen. Offensichtlich hatte sie alles mit angehört.
Lilly verstand nicht und blickte irritiert in die Runde.
«Natascha hat einen Studienplatz in Freiburg», erklärte Laura, und ihre Stimme wirkte auf Lilly beinahe überheblich.
«Was …?» Lilly wurde augenblicklich übel. Es fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. «Ist das wahr? Natascha geht weg aus Lüneburg? Und ihr wusstet das eher als ich?», hörte Lilly sich fragen.
Dann fühlte sie, wie ihre Mutter ihr die Hand zum Trost auf die Schulter legte.
«Es tut mir so leid für dich», flüsterte sie.
Wut, Enttäuschung und Angst – alles schien sich zu vermischen und in null Komma nichts in ihrem Körper auszubreiten. Tränen stiegen in Lilly auf, bis sie die Gesichter ihrer Familie nur noch verschwommen wahrnahm. Wortlos sprang sie auf, pfefferte mit aller Wucht die Zeitschriften vom Sofa, sodass sie lautstark aufs Eichenparkett knallten und sich im ganzen Raum verteilten. Dann lief sie, so schnell es ging, auf ihr Zimmer. Ihr Herz stach in der Brust. Ihr verdammtes krankes Scheiß-Herz.
Ehe Lilly sich aufs Bett schmiss, drehte sie den Schlüssel im Türschloss um. Sie wollte allein sein.
Ein Zustand, an den sie sich besser, so schnell es ging, gewöhnte.
Len
Nur diesen einen Tag, ermahnte sich Len innerlich. Nur diesen einen musste er sich verdammt noch mal zusammenreißen. Er wollte seiner Mutter nicht zusätzlichen Kummer bereiten, weil er sich mit seinem Vater stritt. Nicht an diesem Tag!
Also hatte Len zähneknirschend eingewilligt, zum Mittagessen nach Hause zu kommen. Wenn er ehrlich zu sich war, musste er sich allerdings eingestehen, dass er an Sonntagen wie diesen ohnehin nicht gerne allein in der Werkstatt war. Die große Halle konnte manches Mal recht einsam sein, so abgelegen, wie sie am Waldrand lag, am Ende eines öden Gewerbegebietes ohne jegliche Infrastruktur. Unter der Woche arbeiteten Manni und er gewöhnlich zu zweit dort. Die Wochenenden verbrachte Manni aber lieber bei seiner Freundin Nele in der Kölner Innenstadt, wenn ihm nicht wie kürzlich irgendein dringender Kundenwunsch einen Strich durch die Rechnung machte. Dann packte Len selbstverständlich mit an, weil er wusste, wie abhängig die Werkstatt von jedem einzelnen Auftrag war. Viele Kunden gab es nicht, die sich Mannis individuelle Küchen, Tische oder Schränke leisten konnten. Auch das war ein Grund, warum Len sich ausgerechnet für diesen Ausbildungsplatz und nicht für eine der sich ihm gebotenen Alternativen entschieden hatte: Er mochte die Spezialisierung auf Möbel, auf wertige Einzelstücke, die mit viel Liebe zum Detail angefertigt wurden.
Außerdem war ihm Manni und sein Ein-Mann-Betrieb bereits beim Vorstellungsgespräch so sympathisch gewesen, dass Len einfach auf sein Bauchgefühl gehört und trotz aller Warnungen seines Vaters wegen der unsicheren Auftragslage den Ausbildungsvertrag sofort unterschrieben hatte.
Inzwischen konnte er gar nicht genug arbeiten, um all das gutzumachen, was sein Chef für ihn tat. Sogar dessen Lieferwagen, einen roten Pick-up, durfte Len sich ausleihen, wann immer er ihn brauchte. Also sorgte Len dafür, dass er gute Arbeit leistete, pünktlich und zuverlässig war. Und er sorgte dafür, dass immer genügend Snacks, Bierchen und Zigaretten greifbar waren, wenn sie eine Pause machten. Manchmal kümmerte Len sich sogar um ein gemeinsames Mittagessen.
Heute aber würde er sich von seiner Mum bekochen lassen müssen. Seit Tagen schon hatte Len keinen Appetit mehr, und an diesem ganz besonderen Tag erst recht nicht. Er würde sich arg zusammenreißen müssen, um seine Mutter Elli nicht zu enttäuschen.
«Schön, dass du da bist», sagte sie kaum hörbar, als sie ihn zur Begrüßung ein paar Sekunden länger als üblich in die Arme schloss.
Sie drückte ihn so fest, als hätten sie sich seit Jahren nicht gesehen. In gewisser Weise stimmte das sogar: Seit einer gefühlten Ewigkeit hatten sie einander nicht wirklich in die Augen geschaut, auf den Tag genau zwei Jahre. Len hätte alles dafür gegeben, dass es anders war. Aber er konnte die Zeit nicht zurückdrehen.
Seufzend trottete er seiner Mutter in die offene Küche hinterher und ließ sich auf seinem Stammplatz an der Stirnseite des Esstisches nieder, der im Durchgang zum Wohnzimmer stand. Das Reihenhaus war klein, aber die Miete günstig. Und es lag in einer – wie beide Eltern immer betonten – guten Nachbarschaft. Und darauf waren Elli und Jörg Behrend stolz.
Schweigend beobachtete Len, wie seine Mutter sich an den Töpfen zu schaffen machte.
Sie schien noch dünner geworden zu sein und kam Len irgendwie alt vor, trotz ihres recht jungen Alters von 46 Jahren. Die tiefdunklen Ränder unterhalb ihrer grünen Augen schminkte sie für gewöhnlich heller. Und doch konnte man deutlich erkennen, dass sie in letzter Zeit viel geweint und wenig geschlafen hatte. Aber sie versuchte ihren Zustand – wie immer – zu überspielen.
«Erzähl mal, woran arbeitest du gerade?», fragte sie und begann, Kartoffeln mit einem Stampfer zu malträtieren.
Len war überrascht. Seine Mutter hatte ihn noch nie so konkret auf seine Arbeit angesprochen.
«Och», erklärte er lustlos. «Mal dies, mal das. Im Moment richten wir für so einen unausstehlichen Geldsack ein Wochenendhäuschen in der Eifel ein», erklärte Len und schenkte sich ein Glas Apfelschorle ein, die seine Mutter bereitgestellt hatte.
«Geldsack?»