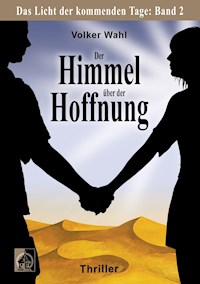
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Licht der kommenden Tage
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des packenden Thrillers »DOGONBLUT«. Eric Harder und seine Frau Vera wollen endlich Gewissheit haben, was vor einem Jahr in Timbuktu geschehen ist. Doch was sie herausfinden, lässt böse Ahnungen aufkommen. Was passiert im Land der Dogon? Ist der mysteriöse Arnháton-Kult immer noch aktiv? Der alte Arthur Roth könnte helfen, aber ist er wirklich ein Freund?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch:
Die Fortsetzung des packenden Thrillers »DOGONBLUT«. Eric Harder und seine Frau Vera wollen endlich Gewissheit haben, was vor einem Jahr in Timbuktu geschehen ist. Doch was sie herausfinden, lässt böse Ahnungen aufkommen. Was passiert im Land der Dogon? Ist der mysteriöse Arnháton-Kult immer noch aktiv? Der alte Arthur Roth könnte helfen, aber ist er wirklich ein Freund?
Über den Autor:
Volker Wahl hat viele Jahre in der Werbebranche gearbeitet und malt in seiner Freizeit Aquarelle. Das Titelbild basiert auf einem seiner Werke.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
1
Es war nun schon mehr als vier Monate her, seit man Diome Biribi entführt hatte. Noch immer hielt man ihn die meiste Zeit in der recht komfortabel ausgestatteten Zelle gefangen. Nur fünfmal war er herausgeführt und in einen Raum gebracht worden, der einem Operationssaal glich. Jedes Mal hatte er Todesängste ausgestanden. Nie hatte man ihm gesagt, warum er hier gefangen gehalten wurde. Wieder und wieder hatte er versucht, ein Gespräch mit seinen Entführern zu beginnen. Doch die Antworten der Männer beschränkten sich auf knappe Anweisungen. Keiner ließ sich auf eine Unterhaltung mit ihm ein.
Seine Bewacher waren hellhäutiger als er. Sie sprachen aber ebenso wie er französisch. Diome stammte aus Mali. Er gehörte zu der Volksgruppe der Dogon und war ein Schwarzafrikaner. Manchmal fragte er sich, ob er in die Hände einer Bande von Rassisten gefallen war. Doch abgesehen davon, dass niemand ein Wort mit ihm sprach, behandelte man ihn nicht abwertend oder wie einen Feind. Fast hatte er den Eindruck, dass ihm so etwas wie Respekt entgegen gebracht wurde. Der Raum, in dem man ihn gefangen hielt, war sogar recht groß. Er hatte eine Fläche von etwa dreißig Quadratmetern. Er verfügte über einen Tisch, zwei Stühle, ein Bett, zwei offene Schränke. Sogar eine kleine Couch und ein Fernseher mit DVD-Player befanden sich darin. Außerdem eine Küchenzeile mit den nötigsten Utensilien und ein richtiges Badezimmer mit WC. Er war praktisch in einer kleinen Wohnung untergebracht.
„Um einen Menschen, den man als Feind betrachtet, gefangen zu halten, ist die Unterbringung zu luxuriös“, dachte Diome. Er wurde ja auch mehr als ausreichend mit allen möglichen Verbrauchsartikeln und Lebensmitteln versorgt. Fast so als wäre er ein Gast in einem Hotel.
Dass man ihm nicht sagte, warum er hier gefangen gehalten wurde und ob es eine Aussicht gäbe, wieder nach Hause zu kommen, machte ihm Angst. Höllische Angst. Daran konnte auch die bequeme Unterbringung nichts ändern. Aber am schlimmsten waren die Tage, an denen er in den Operationssaal geführt wurde. Da wäre er am liebsten gestorben. Auch wenn er die Prozedur schon bereits fünfmal über sich ergehen lassen musste, so fürchtete er sich bereits jetzt wieder vor dem nächsten Eingriff.
Die Behandlung, der man ihn unterzog, war nicht besonders schmerzhaft. Offenbar bestand die erste Injektion, die man ihm dabei verabreichte, aus einer lokalen Anästhesie. Doch die unbarmherzige Gleichgültigkeit, mit der ihm die Ärzte oder was auch immer diese Menschen waren, die ihm das alle zwei bis drei Wochen antaten, ließen ihn stets das Schlimmste erwarten.
Als man ihn zum ersten Mal in den Operationssaal schleppte, hatte er sich noch gewehrt. Voller Panik hatte er damals um sich geschlagen. Hatte versucht sich loszureißen und irgendwie zu fliehen. Doch seine Befreiungsversuche waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Männer, die ihn aus seiner Zelle holten, waren meist zu dritt oder zu viert. Sie waren kräftig und offenbar sehr geübt im Umgang mit unwilligen Gefangenen. Schnell und unsanft hatten sie ihm die Hände auf den Rücken gebunden und ihn in den Gang gezerrt. Am Anfang hatte er noch laut um Hilfe geschrien. Die Männer hatten es aber völlig ignoriert. Als sie dann vor dem OP-Saal angekommen waren, verabreichte man ihm eine lokale Betäubung im Beckenbereich und eine Beruhigungsspritze. Was dann mit ihm geschah, bekam er niemals richtig mit. Es fand jedes Mal ein Eingriff an seinem Beckenknochen, direkt über dem Gesäß statt. Etwa eine Stunde hantierten die Ärzte jedes Mal an dieser Stelle. Dann wurde er in seine Zelle zurückgebracht.
Wenn er dann die Stelle abtastete, an der man in seinen Körper eingedrungen war, konnte er jedes Mal nur eine kleine unscheinbare Narbe mit den Händen erfühlen. Er hatte dann praktisch keine körperlichen Schmerzen. Nur das Gefühl völliger Wehrlosigkeit und des absoluten Ausgeliefertseins. Dann brach er meist schluchzend zusammen und spielte in Gedanken unzählige Selbstmordvariationen durch.
Kameras in verschiedenen Winkeln seiner Unterkunft beobachteten ihn ständig. Diome ahnte, dass er pausenlos den Blicken seiner Wächter ausgeliefert war. Sollte er wirklich einen Selbstmordversuch unternehmen, dann würden vermutlich seine Bewacher hereinstürzen um dies zu verhindern.
Auf irgendeine Weise war er wichtig für die Leute, die ihn gefangen hielten. Soviel war ihm klar. Sonst würde man sich nicht die Mühe machen und ihn so großzügig versorgen. Das Essen, das er bekam, war reichlich und schmackhaft. Auch wenn es nicht die Speisen waren, die er von seiner Heimat an den Felsen von Bandiagara her kannte. Was er hier bekam war eher orientalisch oder aus dem Norden Afrikas.
Der Raum, in dem man ihn gefangen hielt, war fensterlos. Tageslicht bekam er weder hier noch auf dem Gang zu dem Operationssaal zu sehen. Ob es Tag oder Nacht war zeigte ihm nur die Digitaluhr neben seinem Bett.
Das Fehlen von Fenstern beraubte ihn auch der Möglichkeit zu erahnen, ob er sich noch in Mali befand oder an einen anderen Platz der Welt geschafft worden war. Manchmal hatte er intensiv gelauscht, um anhand von Geräuschen ermitteln zu können, was sich in der Außenwelt befand. Doch es drang nichts bis in seine Zelle durch. Kein Geräusch, das ihm hätte verraten können, ob er nahe seiner Heimat war, oder vielleicht weit, weit weg.
Er fragte sich, ob er nun in den Händen von Terroristen war, die immer noch versuchten, die Herrschaft über Teile Malis zu bekommen? Berichte von Geiselnahmen aus der Vergangenheit schilderten einen weniger humanen Umgang mit Gefangenen. Auch hätte er dann irgendwann die üblichen Parolen von seinen Wächtern gehört.
Doch noch hatte Diome diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Vielleicht war er ja verwechselt worden. „Für diese Weißen sehen wir Farbigen doch alle gleich aus“, spekulierte Diome.
Er dachte zurück an seine Familie. An seine Eltern, seine Brüder und Schwestern an den Felsen von Bandiagara. Wie sehr fehlten ihm all diese Menschen von dem Dorf Jongu, in dem er sein bisheriges Leben verbracht hatte. Es war für ihn immer mehr als nur ein zufälliger Wohnort. Es war seine Heimat. Der Ort seiner Vorfahren. Der Ort, der sein Leben in allen Facetten geprägt hatte. In jeder Beziehung war er das Zentrum seines Volkes. Ein Leben fernab von der Falaise von Bandiagara hatte er sich bisher nicht vorstellen können. Die Menschen dort, die Erde, die Felsen, die Riten und Bräuche. All das gehörte zu ihm. Und all das wurde ihm seit Monaten genommen.
Diese Sehnsucht nach der Heimat und den Menschen, die er liebte, machte ihn unendlich traurig. Und an manchen Tagen zornig. Unbeschreiblich zornig. Dann hämmerte er mit den Fäusten gegen die Tür seiner Zelle. Oder er zertrümmerte Teile der Zimmereinrichtung. Meist hatte das zur Folge, dass mehrere Wärter in seine Zelle gestürzt kamen und ihn mit Gewalt auf sein Bett beförderten. Dort hielten sie ihn solange fest, bis er sich beruhigte. Manchmal dauerte das über eine Stunde. Erstaunlicherweise harrten die Männer stets solange bei ihm aus. Währenddessen kümmerte sich eine Reinigungskraft um den Schaden, den er bei seinen Wutausbrüchen angerichtet hatte. Wenn er sich dann irgendwann beruhigt hatte, verließen die Männer seine Zelle und Diome war wieder allein. Allein mit seinen Ängsten, Hoffnungen und Erinnerungen.
Als sich heute wieder die Tür seiner Zelle öffnete, waren die Wärter diesmal nicht alleine. Sie hatten eine junge Frau in ihrer Begleitung. Wie immer wartete man auf Diomes Reaktion und vergewisserte sich, dass keine Gewalt nötig war, um ihn aus seiner Unterkunft zu holen.
Das Erscheinen der jungen Frau verunsicherte Diome zunächst. Für einen Moment dachte er darüber nach, ob er die zierliche Person als Geisel nehmen könnte, um sich so eine Fluchtmöglichkeit zu verschaffen. Doch er hatte inzwischen zu oft die Erfahrung gemacht, dass er gegen die Übermacht seiner Wärter keine Chance hatte. Und so verwarf er diese Option.
„Bitte folge uns. Es wäre schade, wenn wir Gewalt anwenden müssten“, richtete die junge Frau das Wort an ihn. Auch sie hatte die Hautfarbe der Menschen, die an der Küste des Mittelmeers lebten.
„Was habt ihr mit mir vor?“, fragte Diome misstrauisch und trat einem Schritt zurück.
„Wir werden dich wieder in den Operationssaal bringen. Das kennst du doch bereits. Du weißt doch, dass wir dir dort keine Schmerzen bereiten werden.“ Die junge Frau trat auf Diome zu und bevor er erneut zurückweichen konnte ergriff sie seine rechte Hand. Mit beiden Händen hielt sie sie fest. Überrascht ließ Diome es zu.
„Diome. Ich bitte dich. Zwinge uns nicht dir weh zu tun. Ich möchte, dass du dich entspannst und mir vertraust. Du hast es selbst in der Hand, ob die nächste Stunde für dich angenehm wird oder nicht. Lass einfach geschehen, was unvermeidlich ist.“ Immer noch hielt sie seine Hand umfasst. Diome versuchte sich von ihr zu lösen, doch er spürte, wie ihr Griff fester wurde.
„Wollt ihr wieder an mir herumschneiden?“, fragte Diome erneut.
„Du wirst nichts davon spüren. Wie immer. Das verspreche ich dir.“
„Warum sagt ihr mir nicht, warum ich hier bin? Warum lasst ihr mich nicht einfach nach Hause gehen? Wer seid ihr überhaupt?“ Wieder spürte er Wellen von Angst, Zorn und Trauer in seinem Inneren aufkommen. Instinktiv machte er einen weiteren Schritt zurück. Doch die junge Frau ließ auch jetzt seine Hand nicht los und trat nun ganz dicht an ihn heran.
„Ich werde bei dir bleiben. Ich werde die ganze Zeit ganz nah bei dir sein. Bitte tue mir den Gefallen und bleib einfach ganz ruhig. Ich weiß wie schwer das alles hier für dich ist. Aber glaube mir. Ich werde in jedem Augenblick bei dir sein.“ Nun stand sie so dicht vor ihm, dass er ihr Haar riechen konnte. Sie führte seine Hand, die sie immer noch festhielt an ihre Taille und schlang nun ihre Arme um ihn. Reglos ließ er es geschehen und zog sie ebenfalls an sich. Fast wie betäubt nahm er den Duft ihrer Haut in sich auf. Ihr weicher Körper, der sich an ihn schmiegte ließ ihn nach und nach sein Misstrauen vergessen. Ein letztes Mal fragte er sich, warum er heute nicht, wie sonst üblich, mit Gewalt aus der Zelle geführt wurde. Doch als er ansetzte diese Frage auszusprechen, legte ihm die Frau sanft ihren Zeigefinger auf dem Mund.
„Glaube mir. Jetzt ist nicht die Zeit Fragen zu stellen“, flüsterte sie leise. „Komm einfach mit mir.“
Sie führte ihn an ihrer Hand aus seiner Zelle und sie gingen, in Begleitung der Wärter, mehrere Gänge entlang bis sie den Operationssaal erreicht hatten.
„Bitte lege dich auf den Tisch“, wies ihn die junge Frau an.
„Es ist gut, dass du da bist“, erwiderte Diome und hielt sich an ihrer Hand fest, als ob er ohne sie in einen Abgrund stürzen würde. Währenddessen legte er sich folgsam auf den OP-Tisch.
„Wir werden dir nun wie immer etwas geben, damit du dich gut fühlst und keine Schmerzen hast. Entspanne dich einfach.“ Ihr Ton hatte etwas Beruhigendes und Sanftes. Diome spürte den Einstich der Spritze fast gar nicht. Sein Blick haftete auf ihrem Gesicht. Er hielt ihre linke Hand fest umschlossen, während ihre rechte Hand über sein Haar fuhr.
„Du bist etwas ganz Besonderes. Weißt du das?“, fragte sie ihn.
Die Wirkung der Injektion hatte bereits eingesetzt. Diome wollte mit einer Frage antworten, doch seine Zunge fühlte sich schwer an. Unsagbar schwer. Im nächsten Moment hatte er bereits seine Frage vergessen. Er hatte nun das Gefühl, dass die Hand der jungen Frau ihn sanft emporschweben ließ und er mit ihr diesen Raum verlassen würde. Die Welt um ihn herum löste sich auf und er nahm seine Umgebung nun nicht mehr mit Augen und Ohren wahr, sondern mit Sinnen, die er bisher noch nicht kannte. Immer noch fühlte er ihre Hand. Doch nun spürte er etwas Größeres, in das er eintauchte. Etwas Vollkommenes. Etwas von unvergleichlicher Reinheit. Etwas, das ihn mit unendlicher Liebe willkommen hieß.
„Danke, dass du mir vertraut hast“, flüsterte die Frau und ließ nun Diomes leblose Hand los.
„Er ist tot“, meldete der Arzt, der die tödliche Injektion verabreicht hatte.
Die junge Frau strich Diome ein letztes Mal liebevoll über den Kopf. „Er hätte der Auserwählte sein können. Aber wir werden weiter suchen müssen.“
2
Eric Harder sah hinauf zum Himmel. Kleine Cumuluswolken kündigten die Regenzeit an. Die schwüle Luft machte das Atmen schwer. Selbst hier in Bamako, der Hauptstadt Malis. Doch noch rechnete niemand damit, dass die wenigen Wolken am stahlblauen Himmel endlich das langersehnte Nass auf die Erde niederlassen würden.
Auch wenn die drückende Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit im Juni dafür sorgten, dass jede Tätigkeit mit enormen Anstrengungen verbunden war, zog Eric dieses Klima, dem mitteleuropäischen Wetter mit den winterlichen Kälteperioden, vor. Entspannt wendete er die Steaks, die saftig vor ihm auf dem Grill lagen. Im Augenblick war er völlig mit sich und der Welt zufrieden.
Nachdem er alle Fleischstücke gewendet hatte, sah er zu Vera hinüber. Sie saß mit zwei Gästen auf der Veranda vor dem gemeinsamen Haus. Ausgelassen plauderten sie und erzählten sich gegenseitig amüsante Anekdoten aus ihrem Leben.
Erics Blick haftete auf Vera und noch immer staunte er, welches Glück er doch hatte, dass sie vor etwa einem Jahr in sein Leben getreten war. Viel hatten sie damals gemeinsam erlebt. Einige lebensgefährliche Situationen hatten sie überstanden und dabei immer wieder festgestellt, dass sie als Paar zusammengehörten. Eric konnte sich, seit den ersten gemeinsamen, abenteuerlichen Wochen, ein Leben ohne Vera nicht mehr vorstellen. Und ihr ging es nicht anders.
Noch immer beobachtete Eric, wie Vera ihren Gästen von der chaotischen Hochzeitsfeier, die vor einem halben Jahr im winterlichen Deutschland stattfand, erzählte und dabei ihre Zuhörer immer wieder zum Schmunzeln und Lachen brachte. Eric war seinem Schicksal unendlich dankbar für diese Frau. Täglich dankte er Gott dafür in einem stillen Gebet.
Sogar beruflich zeichnete sich in den letzten Wochen wieder eine vielversprechende Perspektive ab. Nachdem die Missionsgesellschaft, für die er einige Jahre gearbeitet hatte, ihre Arbeit in Mali eingestellt hatte, musste Eric die Arbeit bei den Dogon abbrechen. Noch immer gab es Anschläge im Norden Malis. Seine Arbeitgeber wollten ein neues Projekt im Nachbarland Burkina Faso starten. Eric musste sich entscheiden, ob er dort anfangen wollte oder sich in Bamako einen neuen Arbeitgeber suchen sollte. Da Vera noch immer für die Vereinten Nationen in Mali Aufbauarbeit leistete, entschied sich Eric dafür in Bamako zu bleiben. Nach einigen Wochen des Zweifelns und Suchens fand er ein französisches Institut, das den Mut hatte, auch in unsicheren Zeiten die Sprachforschung unter den Dogon zu betreiben, leider ohne das Ziel, eine Bibelübersetzung für die Dogon anzufertigen. Auch wenn das erforderte, dass er immer wieder einige Wochen außerhalb von Bamako verbringen müsste, so bedeutete es für Vera und ihn immerhin, dass kein Umzug in ein anderes Land notwendig war. Außerdem hätte Veras Arbeitgeber, die UNO, kein Projekt in Burkina Faso.
„Und unsere Trauzeugen steckten dann im Schnee fest.“ Vera erzählte immer noch von ihrer Hochzeitsfeier. Laura Roth, die als Praktikantin bei den Vereinten Nationen in Bamako arbeitete, hielt sich den Bauch vor Lachen. „Die Hälfte unserer Hochzeitsgäste hatte ebenfalls gemeldet, dass sie es nicht rechtzeitig zur Feier schaffen würden. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es uns vor dem Standesamt ging. Wir mussten nun auf unsere Trauzeugen warten. Ich habe mir in meinem viel zu dünnen Kleid den Hintern abgefroren und Eric stand da mit nassen Füßen. Die Standesbeamtin wusste nicht, ob sie nun lachen oder weinen sollte.“
„Ich glaube, ich werde niemals im Winter heiraten“, erklärte Laura, die sichtlich amüsiert war.
„Wir hatten beide im Dezember Heimaturlaub. Das wollten wir unbedingt nutzen um zu heiraten. Und unsere Verwandten leben nun einmal alle in Deutschland. Wir hatten also keine andere Wahl“, fügte Eric hinzu. „Und als wir danach zur Kirche fuhren, mussten wir uns erst einmal die Parkplätze vom Schnee freischaufeln. Sogar der Pfarrer half mit.“
„Na, das Schaufeln hattest du ja schon einmal ein halbes Jahr vorher, hier in Mali bei den Goldgräbern, geübt.“ Vera zwinkerte ihm verschmitzt zu.
„Aber der Pfarrer hatte wohl auch Erfahrung im Schneeschippen. In Windeseile schaufelte er den Schnee beiseite. Das war wirklich ein Mann des Wortes und der Tat.“
„Sie haben einmal als Goldgräber gearbeitet?“, fragte nun Lauras Großvater interessiert.
„Ich hatte nur einmal geholfen, als Not am Mann war“, winkte Eric ab. „Davon erzähle ich ein anderes Mal. Jetzt sind die Steaks fertig. Ich hoffe, ihr habt alle Appetit.“
Mit anerkennenden Bemerkungen über Erics Grillkünste und Veras Salate befüllte sich die kleine Gruppe ihre Teller. Bevor Eric sich setzte, füllte er die Weingläser nach. „Auf diesen wunderbaren Abend. Wie schön, dass Sie, liebe Laura, sich von Vera in die Geheimnisse der UNO einweisen lassen. Und dass Sie sogar Ihren Großvater mit nach Mali gebracht haben. Zum Wohl.“ Alle stießen mit ihren Weingläsern an und prosteten sich zu.
„Es ist wirklich bemerkenswert, dass Sie ihre Enkeltochter nach Westafrika begleiten“, richtete Eric das Wort nun an den erstaunlich rüstigen Senior.
„Laura und ich hatten immer eine sehr enge Beziehung.“
„Hawkeye ist einfach der coolste Mann, den ich kenne“, warf Laura ein und strahlte ihren Großvater an. Die Achtzehnjährige hatte wirklich eine besondere Beziehung zu dem rüstigen Rentner.
„Hawkeye?“, fragte Eric nach.
„Ich nenne meinen Opa immer Hawkeye. Weil er doch ein Detektiv ist. Und mit seinen Adleraugen immer alles sieht.“
„Aha.“ Eric nickte lächelnd. „Einen Detektiv hatten wir bisher noch nicht zu Gast.“
„Na ja. Ich habe viele Jahre als Detektiv gearbeitet.“ Arthur Roth winkte ab. „Vor einigen Monaten bin ich in Rente gegangen. Und da Laura dieses Praktikum hier in Mali machen wollte, haben wir gedacht, dass ich meinen Ruhestand genauso gut auch in Afrika verbringen kann.“
„Da hatten Sie sicher ein spannendes Berufsleben.“ Vera nahm sich noch von dem Reissalat.
„So spannend ist die Arbeit eines Detektivs eigentlich nicht. Die meiste Zeit verbringt man nur damit, darauf zu warten, dass die Zielperson endlich in Aktion tritt. Sie glauben gar nicht wie viele endlose Stunden ich damit verbracht habe, in meinem Auto zu sitzen und die Haustüren von untreuen Ehefrauen zu beobachten.“
„Aber du hast doch auch schon geholfen richtige Verbrechen aufzuklären“, bemerkte Laura.
Arthur lächelte vielsagend. „Ja, sicher. Aber darüber darf ich nicht reden. Das weißt du doch.“
Eric musterte den sympathischen alten Mann. Mit seinem kahl rasierten Schädel und dem muskulösen Körper wirkte er fast wie ein Boxtrainer. „Ich nehme an, dass man als Detektiv nicht ungefährlich lebt. Es gibt doch sicher Leute, die es gar nicht mögen, wenn jemand in ihrem Privatleben schnüffelt?“
„Gefährlich wird es nur, wenn man es nicht schafft unentdeckt zu bleiben. Ein guter Detektiv versteht es aber, nicht aufzufallen. Ich konnte zum Glück fast immer meine Ermittlungen so erledigen, dass niemand etwas mitbekam.“ Dann zeigte Arthur auf eine kleine Narbe unter seinem linken Auge. „Aber manchmal ist es nicht zu vermeiden, dass es zu einem Handgemenge kommt.“
„Zum Glück hat ihre Enkeltochter eine weniger abenteuerliche Berufswahl getroffen.“ Eric blickte zu Laura hinüber.
„Wirklich entschieden habe ich mich noch nicht“, erklärte die junge Frau. „Aber die Arbeit bei der UNO hier in Bamako finde ich bisher total interessant.“
„Den Eindruck habe ich auch“, bestätigte Vera. „Laura arbeitet als Praktikantin sehr selbstständig. Ich bin sehr froh, dass wir sie in unserem Team haben.“
„Danke.“ Laura lächelte selbstbewusst. „Ich lerne hier wirklich sehr viel.“
Arthur hob sein Weinglas. „Es freut mich sehr, dass Laura unter Ihrer Führung bei der UNO so viele Erfahrungen machen kann.“ Dann fügte er noch hinzu: „Ich finde wir sollten uns duzen. Als Senior in dieser Runde, biete ich euch das ‚Du‘ an.“
„Das freut mich sehr“, stimmte Vera zu. Alle hoben ihre Gläser und stießen an.
Dann erhob sich Eric wieder und ging zum Grill. „Wer möchte noch ein Steak?“ Doch alle meldeten, dass sie überaus gesättigt seien. Also legte Eric nur noch ein Fleischstück für sich selbst auf den Grill.
„Deine Eltern müssen sehr stolz auf dich sein, Laura“, meinte Eric.
Laura sah kurz zu Arthur hinüber „Meine Eltern sind gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Es war ein Autounfall. Dann bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen. Da ich sonst keine näheren Verwandten habe, inzwischen ist auch meine Großmutter gestorben, ist Hawkeye alles was von meiner Familie übrig ist.“
„Oh. Das tut mir leid.“ Eric war ehrlich betroffen. Erinnerungen an seine erste Frau und seine Tochter stiegen in ihm auf. Beide kamen ebenfalls bei einem Autounfall um. Doch Eric verdrängte diese Gedanken. Er wollte nicht, dass die ausgelassene Stimmung darunter litt. „Gut, dass dein Großvater dir so zur Seite stehen konnte.“
„Ich habe versucht, mein Bestes zu geben“, erklärte Arthur. „Aber Laura war schon sehr früh eigenständig. Da ich ja auch berufstätig war, haben wir uns für ein Internat entschieden.“
„Aber trotzdem warst du immer für mich da.“ Laura Augen glänzten bei diesen Worten. „Wir haben täglich gechattet oder uns per SMS geschrieben. Ich glaube, du weißt mehr über mich, als die meisten Eltern über ihre eigenen Kinder wissen.“
„Und jetzt ist er sogar mit dir nach Afrika gezogen. Beeindruckend“, staunte Vera.
„Bisher konnte ich ja selten selbst vor Ort sein, um das Leben meiner Enkeltochter mitzubekommen. Da möchte ich wenigstens in meinem Ruhestand noch bei Laura sein.“
Laura erzählte noch einige lustige Begebenheiten aus Arthurs Leben. Die Unbefangenheit der vergangenen Stunden kehrte wieder ein. Als die Nacht hereinbrach, verabschiedeten sich die beiden und bedankten sich bei Vera und Eric für den schönen Abend.
„Bis morgen, im Büro.“ Vera reichte Laura die Hand.
„Ich werde wie immer pünktlich sein. Auch wenn ich heute bei euch mit Wein abgefüllt wurde“, flachste Laura.
Als die Gäste gegangen waren, nahm Eric Vera in die Arme. „Es war ein wunderschöner Abend.“
„Ja. Laura und Arthur können wirklich gut erzählen.“
„Du aber auch. Und dafür liebe ich dich. Und auch für die tausend weiteren Dinge, die so typisch für meine Vera sind.“
„Ich liebe dich auch.“ Vera schlang ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn.
Als Arthur und Laura nach Hause fuhren, hing Arthur seinen Gedanken nach. Es tat ihm gut, dass er in Lauras Leben einen wichtigen Platz einnahm. Laura war auch für ihn das Wichtigste auf dieser Welt. Dass Laura so gerne von seiner Arbeit als Detektiv erzählte, machte ihn stolz. Doch die ganze Sache hatte einen entscheidenden Fehler. Einen Fehler, den Laura niemals erfahren durfte. Arthurs Arbeit hatte nicht nur aus Ermittlungen bestanden. Arthur war auch für gezielte Tötungen zuständig. Für Morde. Unzählige Morde.
3
In Jongu, einem Dorf an der imposanten Felswand von Bandiagara, war der Großteil der Bewohner damit beschäftigt, die Vorbereitungen für ein bevorstehendes Fest zu treffen. In etwa drei Wochen sollte den Ereignissen gedacht werden, die sich vor einem Jahr in den Felsenkammern hoch über dem Dorf ereignet hatten.
Jahrzehnte lang hatte, in einer der schwer erreichbaren Höhlen an der Felswand, Nommo-Tuwa residiert. Ein außerirdisches Wesen, das in den spirituellen Vorstellungen der Dogon so etwas wie eine Gottheit darstellte. Von diesem Wesen und dessen Vorfahren hatten die Dogon Informationen über den Kosmos erhalten, über die, bis vor 80 Jahren, noch kein Europäer verfügte. Beispielsweise über die Existenz von Sirius B.
Dieses Wesen, das fast ausschließlich aus Wasser bestand, hatte zudem die Fähigkeit kranke Menschen zu heilen. Auch deshalb wurde es von den Dogon verehrt.
Vor etwa zwanzig Jahren zeigte selbst Nommo-Tuwa erste Krankheitssymptome. Die Dogon konsultierten damals Max Strobel, einen deutschen Arzt. Der Mediziner betreute die Krankenversorgung der Dogon, nutzte aber zugleich die abgelegene Lage des Gebietes von Bandiagara, um sich vor den deutschen Behörden zu verstecken. Sein Wissen um geheime Experimente aus der NS-Zeit drohte ihm zum Verhängnis zu werden.
Strobel gelang es, das außerirdische Wesen zu heilen und über Jahre hinweg gesund zu erhalten. Da der Organismus des Aliens fast ausschließlich auf Wasser basierte, schlugen die homöopathischen Therapien zunächst gut an.
Vor einem Jahr wurde allerdings klar, dass auch Strobl nicht mehr helfen konnte. Bis zu dem letzten Augenblick seiner Existenz nutzte das Wesen seine Fähigkeit, Menschen zu heilen. So rettete es auch Eric Harder, der der Letzte war, der dieses Privileg genießen durfte.
Von Nommo-Tuwa, dem Wasserwesen, blieb nach dessen Ableben nichts übrig als Wasser, das im Boden versickerte und der maskenartige Helm, den es zur Kommunikation mit den Menschen nutzte.
Stefan Eigner, der Kollege und Vorgänger Erics bei der Arbeit der Sprachforschung unter den Dogon, hatte auch die Sprache Nommo-Tuwas dokumentiert und war jetzt in der Lage, dieses Wissen über die außerirdische Sprache weiterzugeben. Als christlicher Theologe und Linguist war er, ebenso wie Eric, mit dem Ziel zu den Dogon gestoßen, eine Bibelübersetzung in deren Sprache zu erstellen. Da sich Nommo-Tuwa, kurz vor seinem Ableben, zum Christentum bekehrt hatte, folgten inzwischen einige Dogon diesem Beispiel und entschieden sich ebenfalls für ein Leben mit Jesus Christus. Auch wenn Stefan Eigner mittlerweile nicht mehr die finanzielle und logistische Unterstützung einer Missionsgesellschaft hinter sich hatte, sah er es trotzdem als seine Aufgabe, den Menschen im Dogongebiet die Bibel als Wort Gottes zu verkünden. Nebenbei lehrte er sie die Sprache Nommo-Tuwas. So konnten sich die Menschen auf die Ankunft eines neuen Nommo-Wesens vorbereiten, die für das Jahr 2027 erwartet wird.
Weil die ‚Global Bible Campaign‘, die Missionsgesellschaft, mit der sowohl Stefan als auch Eric ins Land gekommen waren, sich inzwischen nicht mehr in der Lage sah, in Mali für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen, betrieben die beiden Männer praktisch ohne Einkommen ihre missionarische und linguistische Arbeit bei den Dogon.
Während Stefan die gesamte Woche unter den Dogon in Bandiagara wohnte, machte Eric von Bamako aus seine Sprachforschungen und besuchte nur gelegentlich die Dogondörfer.
Alabenu Ugui, ein Bewohner des Dorfes Jongu, hatte alle Ereignisse um Nommo-Tuwa in den letzten Jahren mitbekommen. Auch die vergeblichen Versuche der seltsamen Arnháton-Sekte, eine Verschmelzung der Dogonkultur mit einem neu initiierten Echnaton-Kult zu bewirken. Erst zeigte sich die Gemeinschaft der Dogon recht offen gegenüber dem Arnháton-Kult, da es scheinbar einige Gemeinsamkeiten gab. Als sich jedoch zeigte, dass die Sekte zu dominant auftrat, widersetzte sich das Dogonvolk der beabsichtigten Verschmelzung. Die Arnhátonjünger wurden abgewiesen und zogen sich zurück.
Alabenu war, ebenso wie eine kleine Anzahl anderer Dogon, nicht damit einverstanden, dass der Kontakt zu den Arnhátongläubigen abgebrochen wurde. Er war nach wie vor der Meinung, dass die Wurzeln der Dogon in die Zeit Echnatons zurück reichten. Heimlich hatte er in den letzten Monaten die Beziehungen zu der Sekte weitergeführt. Isai, einer der Kundigen des Arnháton-Kultes, ließ sich immer wieder von Alabenu über die Ereignisse an der Falaise von Bandiagara unterrichten. Willig spähte der Dogon so viel wie möglich in seinem Umfeld aus.
Isai, der Arnháton-Kontaktmann aus Koulikoro, hatte in den letzten Tagen verstärkt Interesse an dem Verbleib des Helmes gezeigt, mit dem Nommo-Tuwa in der Lage gewesen war, sich akustisch zu äußern. Ohne diesen Helm wäre es dem Wasserwesen nicht möglich gewesen, Töne zu erzeugen und damit über eine eigene Sprache zu kommunizieren. Da dieses Objekt das Einzige war, das das Alien hinterlassen hatte, bestand natürlich auch von Seiten der Sekte großes Interesse daran. Zwar hatte nie einer der Arnhátonjünger Nommo-Tuwa selbst gesehen, doch hatte Alabenu ausführlich dem Kundigen darüber berichtet. Doch über den augenblicklichen Verbleib konnte er nichts sagen. Irgendwann hatte Seydou, der Dorfälteste, verkündet, dass der Kunogoro, wie der maskenartige Helm genannt wurde, seine letzte Ruhestätte gefunden hätte. Jeder in der Dogongemeinschaft gab sich mit dieser Aussage zufrieden. Außer Alabenu. Der fragte, mehr oder weniger unauffällig, unter den Bewohnern nach, wo das Objekt nun sein könnte. Bisher jedoch ohne Erfolg.
Nützlicher waren für Isai, der inzwischen von Koulikoro in das abgelegene Zentrum des Arnháton-Kultes umgezogen war, Alabenus Informationen über die Identität der Personen, die von Nommo-Tuwa geheilt worden waren. Recht schnell bekam er von dem Verräter eine fast komplette Liste mit Namen.
Und ein Mann, der zu den Menschen gehörte, die von Nommo-Tuwa geheilt wurden, war Diome Biribi, der inzwischen auf dem OP-Tisch der Arnháton-Sekte verstorben war.
4
„Das ist ja wunderbar!“ Eric strahlte Vera an.
„Und du freust dich auch wirklich?“, hakte Vera etwas skeptisch nach.
„Ja, sicher“, bestätigte Eric ehrlich. „Wir bekommen ein Baby. Das haben wir uns doch so gewünscht.“ Vera wusste, dass Eric trotz seines ehrlichen Kinderwunsches doch einige Bedenken hatte. So sehr er zwar das Land Mali und seine Menschen liebte, war ihm doch, trotz seines Gottvertrauens, nicht wohl bei dem Gedanken an die gesundheitlichen Risiken, denen man in Westafrika ausgesetzt war.
„Du bist schwanger. Ich werde Vater. Und du wirst eine wunderbare Mutter sein. Ich bin glücklich“, versicherte Eric und küsste seine Frau auf die Stirn.
„Ich liebe dich.“ Vera schlang ihre Arme um Erics Hals. „Du bist der beste Mann und der beste Vater für unser Kind, den ich mir vorstellen kann.“
Beide standen in dem Wohnzimmer und hielten sich eng umschlungen. Immer wieder flüsterten sie sich Zärtlichkeiten zu und gaben ihrer Freude über das neue Leben in Veras Bauch mit Küssen und Liebkosungen Ausdruck.
Irgendwann löste sich Vera aus Erics Armen. „Wie wäre es, wenn wir die gute Nachricht mit einem Ausflug nach Timbuktu feiern?“
Eric hielt diesen Vorschlag zunächst für einen Scherz. „Ja. Ein paar Ferientage in einer Stadt am Rande der Sahara, umgeben von Islamisten, die das ganze Land erobern wollen. Das wollte ich auch gerade vorschlagen.“
„Ich habe das ernst gemeint“, korrigierte Vera. „In dieser Woche ist der Flugverkehr sogar wieder aufgenommen worden. Es ist vielleicht die letzte Möglichkeit für uns, Timbuktu zu besuchen.“ Dann ergänzte sie: „Ich wollte ja schon immer einmal diesem Literaturhistoriker von der berühmten Ahmed-Baba-Bibliothek begegnen. Als wir uns vor einem Jahr kennenlernten, hast du mir ja viel von ihm erzählt. Es muss ein weiser Mann sein. Meinst du, wir könnten ihm einen Besuch abstatten?“
„Wer weiß, ob Abdul Battuda noch immer dort lebt oder arbeitet? Außerdem sind die Städte im Osten Malis für uns Europäer zu unsicher. Das weißt du doch“, gab Eric zu bedenken. Seine zukünftige Rolle als Vater ließ ihn noch vorsichtiger werden, als er ohnehin war. Außerdem war es noch nicht lange her, dass er den Unfalltod seiner ersten Frau Susanne und seiner Tochter verarbeitet hatte. Nun wollte er alles tun, um eine ähnliche Tragödie zu vermeiden.
„Du weißt, wie sehr ich mir wünsche, die legendäre Stadt Timbuktu mit eigenen Augen zu sehen. In ein paar Monaten gibt es vielleicht gar keine Möglichkeit mehr, dorthin zu gelangen.“
Eric schüttelte den Kopf. „Vieles von dem, was sehenswert gewesen ist, wurde durch die Extremisten zerstört. Selbst die Ahmed-Baba-Bibliothek haben die Terroristen in Brand gesteckt. Lass uns doch lieber in den Süden Malis fliegen. Dort ist es sicherer.“
Vera setzte ihr süßestes Lächeln auf. „Im Süden Malis gab es den ersten Ebola-Fall des Landes. Möchtest du wirklich deine schwangere Frau einem solchen gesundheitlichen Risiko aussetzen?“
Eric musste sich nun ernsthaft bemühen, um ebenfalls ein Lächeln aufzusetzen. „Du meinst es wirklich ernst?“
Vera nickte, mit einem verschmitzten Grinsen. „Ja.“
„Du willst unbedingt nach Timbuktu?“
„Unbedingt.“
„Aber nur für zwei Nächte.“ Eric unterstützte sein Angebot, indem er zwei Finger hob.
„Das ist absolut akzeptabel, mein Schatz.“
„Und dann verzichtet die junge Mutter auf künftige Abenteuerurlaube?“
„Versprochen.“ Wieder schmiegte sie sich an Eric. „Du bist der beste Mann und der beste Vater für unser Kind. Das sag ich doch immer.“
5
Als Sagara Diakité mit seinem Motorrad über die ‚Pont des Martyrs‘ fuhr, beschlich ihn ein beklemmendes Gefühl. Hier auf der sogenannten Märtyrer-Brücke, die in der malischen Hauptstadt Bamako den Niger überspannte, war er vor einem Jahr ungewollt an einem Anschlag auf Eric Harder beteiligt. Wie gerne würde er diesen Abschnitt seines Lebens ungeschehen machen. Doch was geschehen war, ließ sich nun einmal nicht ändern. Glücklicherweise ging die ganze Sache am Ende noch einmal gut aus. Und selbst das Gericht, dem er sich zum Schluss freiwillig gestellt hatte, verurteilte ihn aufgrund seiner Geständigkeit und der aktiven Beteiligung an der Aufklärung des Tathergangs, nur zu einer Bewährungsstrafe.
Seit dieser Zeit hatte sich einiges in Sagaras Leben verändert. Zwar besuchte er noch immer regelmäßig seine Heimat an den Felsen von Bandiagara, doch lebte er jetzt vorwiegend in Bamako. Hier hatte er eine Ausbildung zum IT-Spezialisten begonnen und hier würde er sich auch bald taufen lassen.
Als vor einem Jahr die dramatischen Ereignisse mit der altägyptischen Sekte ihren Höhepunkt erreicht hatten, war er Stefan Eigner begegnet, der als Übersetzer eine wichtige Position in der Gemeinschaft des Dogon-Volkes innehatte. Durch ihn hatte sich zunächst so etwas wie Verständnis für das Christentum geregt. Und als Sagara sich dann, nach seinem Umzug nach Bamako, einer christlichen Gemeinde angeschlossen hatte, reifte in ihm der Entschluss, sich auch taufen zu lassen.
Bisher praktizierte das Volk der Dogon fast ausschließlich eine animistische Religion, die sich aus Maskentänzen, Ahnenverehrung, landwirtschaftlichen Fruchtbarkeits-Ritualen und Totemzeremonien zusammensetzt. Wenige sind bisher zum Islam übergetreten. Und noch weniger zum Christentum. Doch Sagara fühlte, dass seine Entscheidung richtig war.
Seine Taufe würde in eineinhalb Wochen stattfinden. Er hatte alle Freunde und Verwandten, die ihm wichtig waren, dazu eingeladen. Doch immer wieder gab es Momente, in denen er an seiner Entscheidung zweifelte. Immerhin hatte er sein ganzes bisheriges Leben den Traditionen der Dogon gewidmet. Zwar half es ihm, wenn er bei diesen Anfechtungen betete oder wenn er das Gespräch mit Christen wie Stefan Eigner oder Eric suchte, doch wünschte er sich, dass er ein eindeutiges Zeichen bekäme. Eric hatte versucht, Sagara deutlich zu machen, dass er dieses Zeichen bereits bekommen hatte. Nommo-Tuwa, das außerirdische Wesen, das selbst eine Entscheidung für Jesus Christus traf, hatte Sagara vor dem Tod bewahrt. Das solle er als Anlass nehmen, ein neues Leben als Christ zu beginnen. Von seinem Intellekt her hatte er das verstanden, doch fühlte er sich noch immer unsicher.
Während er auf der Brücke das nördliche Ufer des Niger erreichte, suchte er verzweifelt nach einer Lösung, die ihm endgültige Sicherheit bei seiner Entscheidung verschaffen würde.
„Ich möchte ein Zeichen von Gott bekommen. Ein unmissverständliches Zeichen“, raunte er vor sich hin. Ihm war nicht klar, wie das Zeichen aussehen solle. „Ein Zeichen. Einfach nur ein Zeichen“, wiederholte er, während er durch immer enger werdende Gassen fuhr.
Bis zu seiner Wohnung war es nicht mehr weit. Das Viertel, in dem er lebte, war zwar nach europäischen Maßstäben ein Slum, doch für die hiesigen Verhältnisse recht annehmbar. In einem kleinen zweistöckigen Gebäude bewohnte er das untere Geschoss. Die christliche Gemeinde hatte ihm diese Wohnung vermittelt. Von hier aus konnte Sagara sowohl die kleine Kirche als auch die Schule, in der er seine Ausbildung machte, gut erreichen.
„Ein Zeichen. Einfach nur ein Zeichen“, murmelte er wieder vor sich hin, als er mit seinem Motorrad in seine Straße einbog. Da stand plötzlich ein kleines Mädchen mitten vor ihm auf der Straße. Im nächsten Moment blendete ihn ein grelles Licht. Woher dieses Licht kam, konnte er nicht sagen. Alles spielte sich im Bruchteil einer Sekunde ab.
Blitzschnell bremste Sagara und das Zweirad begann zu schlingern. Die blockierten Räder wirbelten den Staub der lehmigen Straße auf. Nur mit Mühe behielt Sagara das Gleichgewicht. Knapp vor dem Kind kam er zum Stehen.
„Du musst es tun“, hörte er eine Kinderstimme. Er war sich nicht sicher, ob es das kleine Mädchen war, das zu ihm gesprochen hatte. Verwirrt sah er sich um. Außer ihm und dem Kind war niemand auf der Straße zu sehen.
Sagara war derart perplex, dass er einige Sekunden unschlüssig auf der Straße verharrte. Dann kam eine Frau vom Straßenrand herbeigeeilt und hob das Mädchen auf ihre Arme. Im nächsten Moment waren beide in einem der Häuser verschwunden.
„Danke.“ Sagara sah zum Himmel. „Das ist das Zeichen. Es ist die richtige Entscheidung.“
6
Mehr als zwölftausend Menschen hatten sich auf dem Platz der Unabhängigkeit in Bamako, der Hauptstadt Malis, versammelt. Alle kamen sie um zu hören, was Addae Ibudione ihnen zu sagen hatte. Addae war ein charismatischer junger Mann, der seit Jahren dafür warb, dass sich Afrika wirtschaftlich unabhängig vom Rest der Welt machen sollte. Seine Vision war es, dass die Länder Afrikas ihre Bodenschätze selbst vermarkten und die eigene Landwirtschaft Vorrang vor importierten Lebensmitteln haben sollten.
Mit dieser Botschaft hatte der Malier nicht nur Anhänger im eigenen Land, sondern auch immer mehr Mitstreiter in den Nachbarstaaten in ganz Westafrika. Unzählige Gefolgsleute besuchten die Demonstrationen, zu denen er regelmäßig aufrief und auf denen er sprach wie der Führer einer ganzen Nation.
Doch Addae Ibudione war kein Politiker. Er hatte niemals einer Partei angehört und auch niemals ein Bündnis mit politischen Organisationen geschlossen. Er wollte mit seinen Ideen die Menschen direkt erreichen. Er wollte die Bevölkerung Afrikas dazu aufrufen, selbst daran zu glauben, dass es gelingen könnte, eine florierende Wirtschaft aufzubauen, wenn man sich von den Importen der Industrieländer unabhängig macht und in den eigenen Ländern Korruption und Stammesdenken abschafft. Seine Botschaft war einfach: „Wer sich auf Spenden und billige Importe verlässt, der bekommt nur Abhängigkeit. Wer bei dem afrikanischen Nachbarn kauft und selbst etwas produziert, das er dem Nachbarn verkaufen kann, der bekommt Stolz und eine Zukunft“.
Tausende hatte Addae auf diese Weise schon mobilisiert und dazu gebracht, selbst kleine Unternehmen zu gründen und der Lethargie zu entfliehen, von der viele seiner verarmten Landsleute erfasst worden waren.
Auch heute hatten sich Massen von begeisterten Anhängern auf dem ‚Place de la liberté‘ eingefunden. Unter einer der vielen Palmen, die den asphaltierten Bereich säumten, hatte man einen Omnibus platziert. In wenigen Minuten würde Addae auf dessen Dach klettern und dort eine weitere seiner mitreißenden Reden halten.
Auch Laura Roth befand sich in der erwartungsvollen Menge, obgleich sie die überschwängliche Begeisterung der Menschen um sich herum nicht teilte. Sie war eigentlich nur aus purer Neugier an diesen Platz gekommen. Viele Freunde und Bekannte an ihrem Arbeitsplatz bei den Vereinten Nationen hatten ihr erzählt, wie populär Addae Ibudione unter den Menschen in Westafrika sei. Da weder die malische Presse noch die westlichen Medien über den Verfechter eines ‚afrikanischen Sonderwegs‘ berichteten, hatte sie zunächst im Internet recherchiert. Doch die fast ausschließlich von Anhängern veröffentlichten Berichte erschienen ihr viel zu euphorisch und unausgewogen. Um sich selbst ein Bild von dem charismatischen Anführer zu machen, hatte sie sich nun in die fast ekstatisch jubelnde Menge gewagt.
„Addae! Liberté! Addae! Unité!“ hörte Laura die Menschenmenge rufen. Gespannt blickte sie zu dem Omnibus, auf dessen Dach bereits einige Mitstreiter Addaes standen. Immer lauter wurden die Parolen nach Freiheit und Einigkeit gerufen. Laura befürchtete schon, dass der große Redner gar nicht gehört werden könnte, wenn er endlich vor der Menge erschien.
Und wirklich brach ein ohrenbetäubender Jubel los, als sich Addae schließlich zu seinen Mitarbeitern auf das Dach des Gefährts gesellte. Noch nie hatte Laura eine solche Begeisterung der Massen erlebt. Weder bei politischen Kundgebungen, die sie in Deutschland besucht hatte, noch bei Konzerten von internationalen Stars aus der Musikszene. Alle Arme wurden nach oben gereckt und statt dem Schlachtruf „Addae. Liberté. Addae. Unité“, hörte man nur noch: „Addae! Addae!“
Als der Bejubelte dann das Mikrophon ergriff, war es mit einem Mal still. Jeder wollte nun hören, was der Anführer der Massenbewegung zu sagen hatte.
„Meine afrikanischen Brüder und Schwestern“, begann Addae, während er seine rechte Hand zum Gruß ausstreckte. „Ihr habt erkannt, dass wir vor dem Beginn eines neuen Zeitalters stehen.“ Dann machte er eine kurze Pause, die die gespannte Erwartung fast unerträglich machte. „Wir stehen vor dem Beginn des afrikanischen Zeitalters.“ Bei diesen Worten brach wieder überschwänglicher Jubel los. Die extreme Lautstärke der Beifallsbekundungen der Menschen um Laura herum ließ in ihr ein ungutes Gefühl aufkommen. Sie wollte gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn die Masse unkontrolliert in Bewegung käme. Zudem hatten die Reden Addaes sich immer an die schwarzafrikanische Bevölkerung gerichtet. Was wäre, wenn sich der Führer dieser Bewegung offen gegen die Europäer auf dem afrikanischen Kontinent ausspräche. Doch Laura kämpfte die negativen Gefühle nieder und versuchte zu verstehen, was Addae nun seinen Leuten zu sagen hatte.
„Die Zeit ist nun vorbei, in der wir uns mit den Almosen der Weißen zufrieden gegeben haben. Wir lassen uns nicht mehr sagen, dass wir unfähig wären, für uns selbst zu sorgen. Die Zeit ist vorbei, in der wir nur in den Grenzen unserer Clans, unserer Familien, oder unserer Ethnien denken. Denn die Zeit ist reif für all die Afrikaner, die bereit sind sich für die Zukunft unseres Kontinents einzusetzen.“ Wieder wurde er vom Jubel der Menge unterbrochen. Freundlich winkend bat er darum, dass die Menschen sich beruhigen sollten, damit er seine Rede fortsetzen konnte. Doch wenig später brach wieder eine Begeisterungswelle los.
Laura bemerkte, dass auch sie sich der Ausstrahlung dieses Mannes nicht vollends entziehen konnte. Seine Worte ließen keinen Zweifel daran, dass er selbst an seine Botschaft glaubte. Das was er sagte machte Hoffnung und klang vollkommen einleuchtend. Angesteckt von der Euphorie machte auch sie unzählige Fotos mit ihrem Smartphone. Als sie sich dann selbst die Jubelparolen rufen hörte, erschrak sie und beließ es dabei, dass sie dem Rest der Rede aufmerksam zuhörte.
Als nach etwa zwei Stunden die Menge verabschiedet wurde und über die Lautsprecher die Songs einiger afrikanischer Popstars, die ebenfalls Anhänger von Addae waren, ertönten, machte sich Laura mit widersprüchlichen Gefühlen auf den Weg nach Hause. Einerseits machte ihr die Tatsache Angst, dass ein einzelner Mann einen solchen Einfluss auf derart viele Menschen hatte. Es waren ja nicht nur die zwölftausend Zuhörer, die heute hier auf dem ‚Place de la liberté‘ waren. Hundertausende im ganzen Land hörten ebenfalls auf jedes seiner Worte. Und eine weit höhere Anzahl an Getreuen gab es im umgebenden Ausland. Laura versuchte sich bewusst zu machen, dass Addae bisher ausschließlich mit friedlichen Mitteln gekämpft hatte. Meist hatte er zu passiven Widerstand gegen europäische Importe aufgerufen und seine Zuhörer dazu angehalten, Alternativen zu bestehenden Strukturen zu entwickeln.
In diesem Licht betrachtet ließ Laura es zu, dass auch sie in Addae einen Hoffnungsträger für die Zukunft der Menschen in Afrika sehen konnte. Leise sang sie eines der Lieder, die nun über die Lautsprecher gespielt wurden, vor sich hin. Der Text handelte von der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Auch wenn Laura nie die Nöte und Probleme der einheimischen Bevölkerung am eigenen Leib erleben musste, so hatte sie doch das Bedürfnis, mit den anderen Menschen, die durch Addae eine Veränderung zum Besseren erwarteten, verbunden zu sein.
Als Laura in dem Hotel, in dem auch Vera und die anderen UNO-Mitarbeiter untergebracht waren, ankam, bemerkte Arthur sofort, dass sie noch von den Reden Addaes beseelt war. Als sie sein Zimmer betrat, erzählte sie begeistert von der Kundgebung. Der alte Mann hatte gehofft, dass Laura, so wie es sonst für sie üblich war, das Erlebte sachlich und ohne überschwängliche Emotionen aufnehmen würde. Doch Laura schien nun in dieser Angelegenheit ihre gefühlsmäßige Distanz verloren zu haben.
„Die Kundgebung war wohl ein tolles Happening?“, fragte Arthur, mit einem etwas zu herablassenden Unterton.
„Das war nicht nur irgend so ein Happening. Das war eine wichtige Rede, der mehr als zehntausend Menschen zugehört haben“, verteidigte sich Laura.
„Du weißt genau, dass Menschenmassen, wenn sie ohne Sinn und Verstand losziehen, nur Chaos und weiteres Elend verursachen.“ Arthurs Ton war ungewohnt streng. Laura hatte ihren Großvater nur selten in diesem Tonfall reden hören.
„Das, was Addae Ibudione heute gesagt hat, war nicht ohne Sinn und Verstand. Wenn mehr Menschen so denken würden wie er, dann hätten wir all die Probleme nicht, mit denen sich diese Welt herumschlagen muss.“
„Dass Afrika nun einmal so ist, wie es ist, daran kann auch dein Freund Addae nichts ändern. Du solltest nicht allzu viel Vertrauen in ihn setzen.“
„Wenn es nach dir ginge, dann sollte man überhaupt Niemandem vertrauen. Du hast bei deiner Arbeit als Detektiv wahrscheinlich zu viele schlechte Menschen beschatten müssen.“ Dieser Seitenhieb Lauras traf Arthur mehr als es beabsichtigt war. Bisher war Lauras Bewunderung für Arthurs angebliche Detektivarbeit eine unveränderliche Größe in Arthurs Leben. Dass sie jetzt dies als Argument gegen ihn einbrachte, verletzte ihn.
„Du weißt nicht, zu was die Menschen alles fähig sind“, erwiderte Arthur nur kühl. „Glaub mir. Jeder trägt etwas mit sich herum, das niemand wissen sollte.“
Laura blieb trotzig. „Du gehst hierbei doch nur von dem Schlechten im Menschen aus. Kannst du das nicht einmal positiv sehen? Ich hatte immer gedacht, dass du ein Mann bist, der sieht, was möglich ist. Und nicht jemand, der nur die Schwierigkeiten sieht.“
„Ich will dir nur sagen, dass du vorsichtig sein sollst.“ Arthur bemühte sich, wieder ruhig zu klingen. „Wenn sich hier in Afrika Gruppen bilden, die für oder gegen irgendeine Sache sind, dann halte dich besser raus. Zu schnell muss man hier seine Meinung mit dem Leben bezahlen. Ich meine es nur gut mit dir. Verstehst du?“
Laura bemerkte Arthurs flehenden Blick.
„Ja. Ich verstehe, was du meinst.“ Sie nickte zustimmend. „Aber du solltest dir selbst einmal eine Rede von Addae Ibudione anhören. Dann würdest du auch mich verstehen.“ Dann wandte sie sich zu Tür. „Ich gehe jetzt erst einmal in mein Zimmer und dusche.“
„Du hast recht“, stimmte Arthur zu. Als er wieder alleine in seinem Hotelzimmer war, stand er auf und schloss die Tür ab. Dann ging er an den Schrank und holte einen Metallkoffer heraus. Den legte er auf den kleinen Tisch und öffnete ihn. Darin befanden sich einige Kleidungsstücke und Beutel mit verschiedenen Utensilien. Er nahm alles heraus und legte es auf das Bett. Dann löste er in dem scheinbar leeren Koffer zwei kaum sichtbare Verriegelungen und öffnete ein geheimes Fach, das sich in dem Boden befand.
Vor ihm lagen nun, in eine Halterung aus Schaumstoff eingelassen, eine halbautomatische Pistole, vier Ersatzmagazine und eine Pappschachtel mit Munition.
7
Östlich von Kidal, tief in der Wüste, in einem Gebiet, das wegen der fehlenden natürlichen Wasserquellen von keiner Volksgruppe beansprucht wurde, befand sich seit einigen Monaten eine neue Siedlung von etwa 15 einfachen Lehmbauten. Ungewöhnlich an dieser ansonsten unauffälligen Häuseransammlung war die schnurgerade asphaltierte Straße, die an dem Dorf vorbeiführte. Doch wenn sich wirklich einmal ein Reisender diesem Komplex nähern sollte, so würde er nach einer kurzen Überlegung zum Schluss kommen, dass es sich hier um die Überreste eines gut gemeinten aber sinnlosen Siedlungsprojektes handelte, das in dieser lebensfeindlichen Gegend von vorne herein zum Scheitern verurteilt war.
Dass dieser Ort viel mehr war, als eine abgelegene Menschenbehausung, war dem Betrachter weder auf den ersten Blick, noch auf den zweiten Blick bewusst. Die Häuser, die von außen den Eindruck von primitiven Lehmbauten machten, hatten ein höchst modernes Innenleben. Alle Gebäude ragten mehrere Stockwerke in die Tiefe und waren untereinander verbunden. Innovative Technik versorgte die mehr als einhundertfünfzig Bewohner mit Wasser aus den fossilen Quellen der Sahara und mit Strom. Eine riesige, unterirdische Vorratshalle hielt Nahrungsreserven für mindestens vier Monate bereit. Doch war nicht damit zu rechnen, dass diese Reserven sobald verbraucht werden müssten, da im Rhythmus von 20 Tagen ein Versorgungsflugzeug auf der asphaltierten Piste landete.
Hier hatte die Arnháton-Gemeinschaft einen gut versteckten Stützpunkt errichtet, von dem aus sie den Aufbau ihres Kultes in Westafrika leitete. Hier befanden sich Büros, medizinische Räume, Wohnbereiche, ein Kraftwerk und natürlich auch ein integrierter Tempel für die Anbetung Atons.
In einem der Büros hatte gerade eine Besprechung stattgefunden. Man war zu einem einvernehmlichen Schluss gekommen und die meisten Anwesenden hatten inzwischen den Raum verlassen. Isai, der den Rang eines Arnháton-Kundigen bekleidete, ordnete seine Papiere. Ganz oben lag die Liste, die ihm Alabenu Ugui, der als Spitzel im Dorfe Jongu lebte, hatte zukommen lassen. Dort waren die Namen, und weitere Daten, der Menschen aufgeführt, die von Nommo-Tuwa geheilt worden waren. Einer der Namen war mehrfach rot unterstrichen. Der Name war Ogobara Bono.
Ogobara Bono wartete vor dem Touristenbüro des Dorfes Koro auf zwei Kunden, die über die ‚Association des Guides‘ eine Führung durch das Dorf Jongu gebucht hatten. Ogobara arbeitete schon seit Jahren als Touristenführer. Doch innerhalb der letzten zwei Jahre war die Zahl der Reisenden, die sich die Kultur der Dogon vor Ort zeigen lassen wollten, praktisch auf Null gesunken. Bis vor einem Jahr sorgten noch die Jünger der Arnháton-Sekte für eine kleine Anzahl von Touristen, die man durch die Dogondörfer an den Felsen von Bandiagara führen konnte. Doch da sich die Annäherung an diese Sekte als verhängnisvoller Fehler erwies, distanzierten sich die Dogon von den aufdringlichen Schwärmern. Dabei gelang es zwar, die Sektenjünger auf Abstand zu halten, doch damit fielen auch diese letzten Aufträge für die Touristenführer der Dogon aus. Seitdem versuchte Ogobara, zwar weiter bereit zu sein, falls sich doch wieder Reisende in das Pays Dogon trauen sollten, aber notgedrungen musste er sich als Gemüsebauer versuchen. Dies gelang ihm nur mit wenig Geschick. Die Ernte, die er dabei erwirtschaftete, war kläglich.
Dass nun zwei Touristen die Besichtigung eines der Dörfer an der Falaise gebucht hatten, ließ in ihm wieder so etwas wie Hoffnung aufkeimen. Vielleicht war das ja der Anfang einer wirtschaftlichen Wende. Vielleicht haben die Touristen ja doch erkannt, dass es im Dogonland keinen Platz für Extremisten und Terroristen gab. Ogobara bemühte sich positiv zu denken.
Vor etwa einem Jahr war er lebensgefährlich verletzt worden, als er eine Gruppe von Mitarbeitern eines französischen Pharmaunternehmens durch Jongu führte. Seine Heilung hatte er, ebenso wie viele andere Dogon, aber auch Eric, dem außerirdischen Wesen zu verdanken, das Nommo-Tuwa genannt wurde.
Seitdem hatte er aber keine Touristen mehr durch dieses Dorf geführt. Es war aber nicht so, dass er sich nun davor scheute. Der Grund lag allein darin, dass es in den letzten 12 Monaten nur drei Touristengruppen gab. Und die hatten ihn für andere Orte gebucht.
Das Wetter war schwül. Durch die beginnende Regenzeit war die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Da sich aber hin und wieder Wolken vor die sengende Sonne schoben, war die Hitze einigermaßen erträglich.
Die Kunden kamen pünktlich. Ogobara begrüßte sie herzlich. Dies fiel ihm nicht schwer, da er sich ehrlich darüber freute, wieder als Guide arbeiten zu können. Vor ihm standen nun zwei hochgewachsene, hellhäutige, junge Männer, mit tiefschwarzen Haaren und glattrasierten Gesichtern. Ogobara vermutete, dass seine Gäste aus einem der Länder Nordafrikas kamen, die an das Mittelmeer grenzten. Das Äußere der Männer und deren Namen, die der Guide aus den Anmeldeunterlagen kannte, ließen das vermuten.
Nach der Begrüßung signalisierte einer der Männer, dass sie es kaum abwarten könnten, die berühmten Dogondörfer an der Felswand zu besuchen. Colanüsse als Gastgeschenke für die Dorfältesten hatten sie bereits besorgt. Auch waren sie mit dem eigenen Auto, einem geländegängigen Allradfahrzeug, gekommen. Damit konnten sie bis zur Grenze des Bereiches fahren, der für die Bewohner des Dorfes Jongu als heilig gilt. Näher durften sie mit dem Fahrzeug nicht kommen. Dort wartete bereits ein Eselsgespann auf Ogobara und seine Gäste.
Früher hatte der Guide seine Gäste noch mit dem eigenen Auto zu dem kleinen Gehöft gebracht, wo der Eselskarren bereit stand. Doch das konnte er sich inzwischen, mangels Geld, nicht mehr leisten.
Ogobara stieg zu seinen Gästen in den Geländewagen, nahm auf dem Beifahrersitz Platz, schnallte sich an und begann einen Smalltalk. „Waren Sie schon einmal in Mali?“ Einer der Männer setzte sich auf die Rückbank, der andere auf den Fahrersitz.
„Ja.“ Der Mann am Steuer setzte eine Sonnenbrille auf und lächelte. „Schon mehrmals. Mali ist ein faszinierendes Land.“
Ohne zu fragen, wohin er fahren müsse, fuhr der Mann los. Trotzdem wies Ogobara seinem Kunden den Weg. „Fahren Sie bitte diese Straße bis zum Ortsausgang. Gleich hinter dem letzten Haus nehmen wir dann eine Abfahrt nach rechts. Und dann fahren wir nördlich auf die Felswand zu.“





























