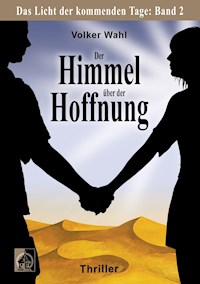6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eric Harder und seine Frau Vera sind wieder in Deutschland. Mit ihrem Sohn Phanuel genießen sie das ruhige Leben in der Kleinstadt. Doch nicht nur die Vergangenheit holt sie ein, sondern auch die Zukunft. Zeichen der Endzeit sind nun unübersehbar. Und selbst ihr alter Freund Arthur Roth muss erkennen, dass Himmel und Hölle in Bewegung sind. Ein Thriller, der alle Register zieht und die Protagonisten so nah begleitet wie nie zuvor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch:
Eric Harder und seine Frau Vera sind wieder in Deutschland. Mit ihrem Sohn Phánuël genießen sie das ruhige Leben in der Kleinstadt. Doch nicht nur die Vergangenheit holt sie ein, sondern auch die Zukunft. Zeichen der Endzeit sind nun unübersehbar. Und selbst ihr alter Freund Arthur Roth muss erkennen, dass Himmel und Hölle in Bewegung sind.
Ein Thriller, der alle Register zieht und die Protagonisten so nah begleitet wie nie zuvor.
Über den Autor:
Volker Wahl hat viele Jahre in der Werbebranche gearbeitet und malt in seiner Freizeit Aquarelle. Das Titelbild basiert auf einem seiner Werke.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
1
Arthur Roth betrachtete seinen neuen Personalausweis. Eine französische „Carte Nationale d‘Identité“. Monatelang hatte er gebangt, ob dieser Tag jemals eintreffen würde. Endlich hatte er nun das verdammte Stück Plastik, mit dem er wieder zurück nach Deutschland reisen konnte.
Auf dem Ausweis befanden sich sein Foto und seine biometrischen Daten. Alles, was auf dieser Plastikkarte stand, war so in den EDV-Systemen der europäischen Behörden erfasst. Und natürlich auch in den Datenbanken des „Rates der Fürsten“, was für ihn viel wichtiger war.
Mit diesem neuen Ausweis konnte er sich endlich in Europa frei bewegen, ohne dass er befürchten musste, dass die Behörden bei Kontrollen an seiner Identität zweifeln könnten. An seiner neuen Identität. An seiner Identität als Jérôme Dumont.
Nun hatte Arthur die Möglichkeit, als Jérôme Dumont ein neues Leben zu beginnen. Sein Freund Hagen hatte ihm unverhofft diese Möglichkeit verschafft. Das war mehr als ein halbes Jahr her.
Sein Freund, der ebenfalls für den Rat der Fürsten arbeitete, hatte heimlich Arthurs Identität mit der eines kürzlich verstorbenen französischen Staatsbürgers getauscht. Da das Ableben noch nicht aktenkundig war, führte Arthur nun dessen Leben weiter.
In den zwei Jahren davor hatte es Arthur vermeiden müssen, in den Scanbereich von Smartphones zu gelangen, die seine DNA heimlich erfassen konnten. Wäre er bisher auf diese Weise gescannt worden, hätte der Rat der Fürsten umgehend für seine Liquidierung gesorgt. Seit den Vorfällen um die Entführung seiner Enkeltochter Laura und die Verweigerung eines Mordauftrags an einem afrikanischen Prominenten, galt Arthur als Gefahr für die Geheimorganisation. In den abgelegenen Dörfern des Dogonvolkes in Mali konnte er ein halbwegs sicheres Leben verbringen.
Irgendwann erfasste dann doch ein Smartphone Arthurs DNA und übermittelte sie an die Datenbank des Rates. Arthurs Freund Hagen entdeckte das glücklicherweise, bevor die Daten von anderen Mitarbeitern wahrgenommen und verifiziert werden konnten. Es gelang Hagen auch, Arthur davon zu unterrichten, dass er sich nun mit seiner neuen Identität frei bewegen konnte, solange man ihn nicht nach einem Ausweis fragte. Den neuen Ausweis würde er sich erst in einer Fälscherwerkstatt an der sizilianischen Mittelmeerküste besorgen. Wie er von Mali aus dorthin gelänge, müsste Arthur selbst organisieren.
Ohne einen Ausweis konnte Arthur selbstverständlich nicht mit dem Flugzeug nach Italien reisen. Auch Fernzüge kamen nicht in Frage, da er auch da mit Ausweiskontrollen rechnen musste. Er besaß etwas Geld, was ihm ermöglichte, auf dem Landweg nach Europa zu reisen. Ohne Papiere hieß das aber, dass er sich Schleppern anvertrauen musste. Wie ein Flüchtling. Und irgendwie war er auch ein Flüchtling. Schon in den letzten zwei Jahren war er ein Flüchtling gewesen. Ein Flüchtling, der vor dem Rat der Fürsten geflohen war und bei den Dogon in Mali Zuflucht gefunden hatte. Jetzt war er ein Mann im Rentenalter, der zurück nach Europa wollte, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Und nach über sechs Monaten hatte er es geschafft. Nun konnte er sich als Jérôme Dumont ausweisen. Innerhalb Europas war die Weiterreise von Italien nach Deutschland kein Problem. Dort würde er seine Enkeltochter Laura ausfindig machen, und nur sie könnte ihn als Arthur Roth erkennen. Für den Rest der Welt wäre er ab jetzt Jérôme Dumont.
Die letzten sechs Monate waren die Hölle gewesen. Nachdem er das Dorf Jongu, an den Felsen von Bandiagara in Mali, verlassen hatte, war er in die Stadt Gao gereist. Gao hatte sich in den letzten Jahren zu dem wichtigsten malischen Flüchtlingsdrehkreuz entwickelt. Migranten aus Mali und den angrenzenden Ländern wie Mauretanien, Senegal, Guinea, Elfenbeinküste oder Burkina Faso, sammelten sich hier, um sich von Schleppern durch die Sahara nach Norden und dann weiter nach Europa transportieren zu lassen. Viele Flüchtlinge glauben, dass sie den Sprung in ein besseres Leben gemacht hätten, wenn sie erst einmal europäischen Boden betreten haben. Dass die Wirklichkeit anders aussieht, bekommen sie von den Schleppern natürlich nicht gesagt.
In Gao hatte Arthur versucht, einen Platz auf einem der LKWs zu bekommen, die Gruppen von Flüchtlingen durch die Wüste an die Mittelmeerküste transportierten. Normalerweise nehmen die Mittelsmänner allein für die Durchquerung der Sahara umgerechnet zwischen 500 und 600 Euro. Doch von Arthur verlangten sie das Vierfache. Sie sagten, das sei wegen seines hohen Alters, da sei das Risiko zu hoch, dass er die Fahrt nicht überleben würde. Arthur wusste, dass das nur ein vorgeschobenes Argument war. Seine helle Haut verriet, dass er kein Afrikaner war. Da rechneten sich die Kontaktmänner der Schlepper aus, dass sie höhere Preise verlangen konnten.
Etwa drei Wochen hatte Arthur in Gao verbracht, um vergeblich auf einen Transport zu warten, der ihn zum üblichen Preis mitnehmen wollte. Während dieser Zeit blieb er in einem der sogenannten „Ghettos“, Häusern in denen man Flüchtlinge unterbrachte, die auf eine Fahrt nach Norden warteten. Hier mussten sie vor den Behörden verborgen bleiben. Offiziell war es die Aufgabe der Polizei, die Machenschaften der Schlepper zu unterbinden. In der Realität verdienten die Polizisten aber an jedem Migranten, der einen Handel mit den Schleppern einging. Für die Unterkunft und die Verpflegung in dem Flüchtlingshaus musste Arthur natürlich extra bezahlen. Und auch daran verdienten die Polizisten. Einfach dadurch, dass sie in diesem Haus nicht nach Schleppern oder Flüchtlingen suchten.
Nach zwanzig Tagen des vergeblichen Wartens und Handelns mit den Mittelsmännern, hatte Arthur beschlossen, von Gao aus nicht nach Norden, sondern nach Osten in Richtung Agadez zu reisen. Agadez in dem Nachbarstaat Niger hat sich ebenfalls zu einem Drehkreuz des Menschenschmuggels entwickelt. Arthur hoffte, dass er hier eher einen Schlepper fand, der ihm nicht sein gesamtes Geld abnehmen wollte, bevor man ihn überhaupt aus Mali herausgebracht hatte.
Arthurs Entscheidung hatte sich als richtig erwiesen. Irgendwann war er von Agadez aus nach Libyen und dann über das Mittelmeer nach Italien gelangt. Mehr als ein halbes Jahr hatte seine Reise gedauert und mehrmals war er nur knapp dem Tod entronnen. Keiner der Menschen, die ihm am Anfang seiner Reise begegnet waren, hätten dem Senior, der auf die 70 zuging, zugetraut, dass er die Strapazen überlebte.
Dass er es bis nach Italien geschafft hatte, darauf war Arthur stolz.
Und auch darauf, dass er dabei nur neun Menschen töten musste.
2
Eric Harder hängte das neue Türblatt des Arbeitszimmers in die Scharniere. Nachdem er geprüft hatte, dass alles gut passte, trat er einige Schritte zurück und betrachtete sein Werk. Wie vieles andere in dem alten Häuschen, das sie nun bewohnten, so hatte er auch diese Tür, mitsamt Türrahmen, selbst eingebaut. Seit er und seine Frau Vera wieder in Deutschland lebten, hatte er ungeahnte handwerkliche Talente entdeckt.
In Babelsgrund, einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt am Main, wo sie seit der Rückkehr aus Mali lebten, hatten sie ein kleines Haus gekauft, das Eric nun nach und nach renovierte. Das mehr als neunzig Jahre alte Gemäuer musste von Grund auf saniert werden, was sehr kostspielig war, so dass Eric versuchte, so viel wie möglich in Eigenleistung zu erledigen. Mittels Fachbüchern und Anleitungen aus dem Internet konnte er sich in den letzten Monaten ein beachtliches Wissen für die notwendigen Maßnahmen aneignen.
Noch waren nicht alle Räume im Haus bewohnbar. In manchen Zimmern hatte er die Wände aufstemmen müssen, um Wasser- und Heizungsrohre freizulegen. Auch elektrische Leitungen mussten teilweise ausgetauscht werden. Die Hälfte des Hauses war eine Baustelle. Doch täglich arbeitete er daran, dass dieser Ort wohnlicher wurde.
Er dachte daran, wie Vera und er dieses Haus ausgesucht hatten. Damals war sie schwanger mit ihrem gemeinsamen Kind. Da sich die Sicherheitslage in Mali, wo sie sich kennen und lieben gelernt hatten, nicht besserte, sahen sie sich gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren. Ihr Kind sollte in einer sicheren Umgebung aufwachsen. So entschieden sie sich schweren Herzens für den Umzug nach Europa. Gemeinsam hatten sie viel in Mali erlebt. Deutschland war ihnen in dieser Zeit fremd geworden. Doch in den fast zwei Jahren, die sie nun hier lebten, konnten sie neue, zarte Wurzeln schlagen. Und seit mehr als einem Jahr waren sie nun auch zu dritt. Vor einem halben Jahr durften sie den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Kindes feiern. Sie hatten ihm den biblischen Namen Phánuël gegeben.
Ein leises Wimmern riss Eric aus seinen Gedanken. Nebenan, im Kinderzimmer, meldete sich Phánuël. Wie an fast jedem Arbeitstag der Woche war Eric mit seinem Sohn alleine im Haus. Vera hatte eine Anstellung in der Verwaltung einer Wochenzeitung mit internationalem Renommee angenommen, um den Lebensunterhalt für die kleine Familie zu verdienen. Der Name der Zeitung war „Frankfurt Global Newstime Magazine“. Mit ihrem abgeschlossenen Studium der Staats- und Verwaltungswissenschaft, fand sie in der Wirtschaft wesentlich leichter einen Job, als es Eric im Bereich der Sprachwissenschaften gelang. So entschieden sie sich, dass Eric sich um Phánuël und den Umbau des Hauses kümmerte, während Vera das Geld für den Lebensunterhalt verdiente.
Das Wimmern war inzwischen einem fröhlichen Brabbeln gewichen. Als Eric das Kinderzimmer betrat, stand der kleine Phánuël schon aufrecht im Bettchen und hielt sich am Gitter fest. Nun erkannte er seinen Vater und strahlte über das ganze Gesicht. Eric liebte diese Momente, wenn der Junge so unverfälscht seine Freude und Zuneigung zeigte. Vorsichtig, doch mit sicherem Griff, nahm er Phánuël aus dem Bett und auf den Arm und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Stirn.
„Guten Morgen, Phánuël. Du bist ja wieder richtig munter.“
Phánuël sah seinem Vater interessiert in die Augen. Der kleine Mann schien alle Eindrücke seiner Umgebung förmlich aufzusaugen.
Eric ging mit Phánuël zum Wickeltisch und mit geübten Griffen wusch er den Jungen und zog ihm eine neue Windel sowie neue Kleidung an. Dann hob er ihn auf und stellte ihn vor sich auf den Wickeltisch. Der Junge konnte zwar schon frei stehen, aber Eric hielt ihn auf dem Tisch trotzdem sorgsam fest.
Immer noch hielt Phánuël festen Blickkontakt mit seinem Vater. Voller Dankbarkeit für dieses kleine Leben konnte auch Eric seinen Blick nicht von ihm lösen. Eric wusste, dass die Existenz Phánuëls einem Wunder glich. In Mali wurde Eric vor fast drei Jahren schwer verwundet und überlebte nur durch das Eingreifen eines außerirdischen Wesens auf dem Gebiet des Dogonvolkes. Von diesem Ereignis wissen nur Erics engste Vertraute. Später hatte Eric erfahren, dass bisher alle Männer, die der Außerirdische geheilt hatte, unfruchtbar wurden. Nur Eric schien von dieser Nebenwirkung nicht betroffen zu sein.
Die Fortpflanzungsfähigkeit Erics rief dann einige Monate später wieder eine dubiose Sekte auf den Plan, die sich seine genetischen Eigenschaften zur Klonung eines uralten Pharaos zunutze machen wollten. Doch Eric überstand auch diese Gefahr. Für Veras junge Kollegin Laura Roth hatte die Verschleppung durch die Sekte tiefgreifendere Folgen. Laura wurde während der Entführung durch kriminelle Wissenschaftler der Sekte künstlich geschwängert. Das stellte sich erst einige Wochen nach dem Ende der Entführung heraus. Dass Laura das Kind trotz aller Widrigkeiten behielt und austrug, war Eric ein Rätsel. Er hoffte inständig, dass Laura ihr Kind ebenso lieben könnte, wie er und Vera Phánuël liebten.
Eric trug Phánuël in die Küche und setzte ihn dort in einer Spielecke ab. Während der Junge dort Bauklötze stapelte, bereitete Eric dessen Frühstück. In den letzten Wochen verzichtete er immer mehr auf Babynahrung. Auch heute gab es ungesüßten, lauwarmen Tee und ein weiches Dinkelbrot ohne Kruste. Darauf gab es einen winzigen Klecks Marmelade. Für sich selbst hatte Eric eine Tasse Tee, eine Flasche stilles Mineralwasser und Brötchen mit Käse bereitgestellt.
Als Eric alles auf dem Küchentisch gestellt hatte, setzte er den Jungen in dessen Kinderstuhl. Nachdem er ebenfalls Platz genommen hatte, sprach er ein kurzes Dankgebet. Phánuël hatte sich diesem Ritual schon früh angepasst. Wenn seine Eltern die Hände zum Gebet falteten, tat er es ebenfalls. Das Wort „Amen“ am Ende der Gebete war eines der ersten Worte, die der Junge gesprochen hatte.
Auch heute griff Phánuël erst nach seinem Brot, nachdem er ein kraftvolles „Amen“ verlautet hatte.
Während der Junge kleine Bröckchen aus dem Brot zupfte, sah er gebannt aus dem Fenster. Eric goss sich Wasser in ein Glas und verschüttete etwas von der Flüssigkeit, die sich auf dem Holztisch sammelte.
„Was beobachtet der Kleine da?“, fragte er sich, als er Phánuëls Blick folgte. Außer dem Baum, der vor dem Haus stand, war nichts zu sehen. Eric vermutete, dass der Junge einen Vogel gesehen haben mochte, der inzwischen weitergeflogen war. Phánuël spielte mit seinen Fingerchen mit den Wassertropfen auf dem Tisch und ließ seinen Blick zwischen dem Fenster und seinen Fingern hin und her wandern. Eric war dieses Verhalten seines Sohnes neu. Das Interesse des Jungen schien von etwas in Beschlag genommen worden zu sein, das Eric nicht erkennen konnte.
Jetzt blieb Phánuëls Blick bei der winzigen Wassermenge vor sich, in die immer noch seine Finger getaucht waren. Als er erneut auf das Fenster starrte, stand Eric auf, um nachzusehen, was sich dort besonderes befand. Doch außer der üblichen Umgebung gab es dort nichts zu sehen. Als er sich wieder setzte, hatte sich die Blickrichtung des Jungen geändert. Jetzt sah er auf die einzige Wand der Küche, an der es weder ein Fenster, noch einen Schrank gab. Dort war einfach nur eine Tapete.
„Na, was siehst du denn da?“, fragte Eric, ohne eine wirkliche Antwort von dem Einjährigen zu erwarten. Phánuël schien seinen Vater gar nicht zu hören.
Eric trat nun hinter seinen Sohn, um dessen Blickrichtung besser folgen zu können, doch da war nur die weiße Wand. Wieder bewegten Phánuëls Finger die winzige Pfütze, aber seine Augen blieben zur Wand gerichtet, als stände dort jemand, den er beobachtete. Eric verschlug es den Atem. „Mit wem kommuniziert Phánuël da?“, fragte er sich.
Nun nahm Phánuël seine Finger vom Tisch und betrachtete freudig die Wasseransammlung vor sich. Eric konnte es kaum glauben. Die Tropfen bildeten eine Form, die sich aus Wasser eigentlich gar nicht bilden lassen dürfte.
Sie hatte eindeutig die detaillierte Kontur eines Engels.
3
Seit Jahrzehnten war das Gelände am Stadtrand von Frankfurt am Main dem Verfall preisgegeben. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte dort eine Lederfabrik gestanden. Doch als im März 1944 die Luftangriffe auf Frankfurt ihren grausamen Höhepunkt erreichten, wurde auch dieser Gebäudekomplex schwer getroffen und brannte völlig aus. Da die Besitzer dabei starben und nach Kriegsende keine Erben auszumachen waren, blieb das Gelände lange Zeit eine Ruinenlandschaft. In den Nachkriegsjahren diente der Schutt noch hin und wieder als Baumaterial für neue Gebäude in der Umgebung, doch eine neue Bestimmung fand sich nicht. Der Erdboden war durch die Lederfabrik mit Chemikalien verseucht, was eventuelle Interessenten abschreckte. Das Grundstück befand sich am Rand eines Waldes und so eroberte die Natur im Laufe der Jahre das Terrain zurück. Nach der Jahrtausendwende ragten einige imposante Bäume aus den Trümmern heraus. Büsche, Gräser und Moose breiteten sich aus und bald war nur noch zu erahnen, dass hier einmal eine Gerberei stand.
Die Gewölbekeller hatten die Bombennächte relativ gut überstanden, so dass dort auch nach Jahrzehnten noch alte Maschinen vor sich hin rosteten. Kanister mit Gerbstoffen waren irgendwann undicht geworden, so dass fast überall ein beißender Geruch in der modrigen Kellerluft lag. Manchmal hatten Schatzsucher oder neugierige Jugendliche auf dem Gelände nach wertvollen Funden gesucht, doch seit einigen Jahren hatte sich niemand mehr für das verfallene Anwesen interessiert.
Nach mehr als siebzig Jahren regte sich nun etwas in einem Raum, der hinter einem Tiefkeller verborgen und von keinem Nachlassverwalter oder Schatzsucher entdeckt worden war. Jahrzehntelang hatte hier absolute Dunkelheit geherrscht. Nun pulsierte auf dem Objekt in der Mitte des Raumes ein kaum wahrnehmbares, blaues Licht, begleitet von einem leisen, extrem tiefen Brummen. Nach wenigen Minuten war auch aus einigen Ritzen des Objektes Licht zu erkennen, das immer heller wurde. Zu dem Brummen gesellte sich ein lauter werdendes kreischendes Geräusch, das in ein Zischen mündete und mit einem Mal verstummte. Ein greller Blitz schien aus der Mitte des Objektes zu kommen, dann tauchte nur noch das schwache Licht am unteren Rand des Objektes den Raum in ein irreales Blau.
Fast unmerklich wurde das blaue Licht in den nächsten Minuten heller. Nichts bewegte sich. Mit der steigenden Helligkeit war nun auch das leise Brummen wieder zu hören. Nach etwa einer Viertelstunde hatte das blaue Licht eine Helligkeit erreicht, die es einem Menschen ermöglicht hätte, das Objekt in dem Raum gut zu erkennen. Doch noch gab es keinen Menschen in dem Raum.
Zu dem Brummen gesellte sich nun ein leises Plätschern aus dem Inneren des würfelförmigen Objektes. Die metallische Oberfläche ließ kaum ein Geräusch hindurch. Trotzdem war bald darauf ein kehliges Gurgeln zu hören und dann auch ein Klopfen. Zuerst nur ein einzelner Schlag, dann immer heftigere, fast panische Schläge. Kurz danach ging an der Oberseite des Würfels eine Luke einen kleinen Spalt weit auf. Das Licht, das dort austrat, war nicht blau, wie das am unteren Rand, sondern weiß und grell. Nun waren auch das Plätschern und das kehlige Stöhnen deutlich zu hören. Eine Hand drückte die Luke ein weiteres Stück nach oben, aber im nächsten Augenblick schwang das schwere Metall wieder nach unten und nahm das weiße Licht mit sich. Doch die Person im Inneren wollte nicht aufgeben. Erneut öffnete sich die Luke und nun waren zwei Hände zu sehen. Sie schoben die Abdeckung so weit zurück, dass sie nun ganz geöffnet blieb. Das Stöhnen aus dem Inneren klang nun weniger panisch, eher wie ein Siegesschrei aus letzter Kraft. Das weiße Licht aus der Öffnung ließ nun Details des würfelförmigen Objektes erkennen. Es hatte eine Seitenlänge von etwa 4,5 Metern. Auch wenn die äußere Form auf den ersten Blick an einen riesigen Container erinnerte, so war dies doch etwas ganz anderes. Die Oberfläche ließ etliche Schweißnähte erkennen. Rundherum waren Lüftungsschlitze angebracht. Unzählige Klappen verbargen Anschlussmöglichkeiten für Kabel unterschiedlichster Art. Das Metall, aus dem das Objekt bestand, war schwarzgrau und matt. Roststellen gab es nicht.
Der Raum, in dem sich der Kubus befand, war fensterlos. Die Grundfläche war fast quadratisch und hatte nur eine Tür, und die war geschlossen. Rechts neben der Tür befand sich ein Schreibtisch, auf dem mehrere Stapel mit Bündeln von beschriebenem Papier lagen. Es waren Unterlagen der Forscher, die das würfelförmige Objekt entwickelt hatten. Links von der Tür und entlang der angrenzenden Wand standen Arbeitstische mit Konsolen, die über Kabel mit dem Kubus verbunden waren. An der Wand, die der Tür gegenüber lag, war eine Metalltreppe montiert, von der ein schmaler Brückengang zum oberen Teil des Würfels führte. Man hatte also für den Ein- und Ausstieg aus dem Objekt vorgesorgt.
Zu den Geräuschen von bewegtem Wasser mischten sich jetzt heftige Atemgeräusche. Die Person im Inneren des Würfels war offenbar extremen Anstrengungen ausgesetzt. Sie wollte oder musste aus dem Objekt hinaus, was die letzten Kraftreserven kostete. Die Atmung wurde nun langsamer und tiefer. Mit einem kraftvollen Stöhnen stemmte sich die Person mit dem Oberkörper durch die Öffnung nach oben und krallte sich mit den Händen an den Sprossen des Brückengangs fest. Einen Augenblick lang verharrte sie so und mobilisierte neue Kräfte, dann zog sie sich weiter hinauf, bis auch die Beine und Füße heraus waren. Auf dem kalten Metall, das den Kubus mit der Treppe verband, lag nun völlig entkräftet ein junger, fast nackter Mann.
4
Vera kam an diesem Abend spät nach Hause. Von ihrem Arbeitsplatz war sie direkt zum Gemeindehaus der Christengemeinde Babelsgrund gefahren, da sie dort noch ihre wöchentliche Bibelstunde besuchte und vorher an einer Besprechung des Organisationskomitees für eine Missionsveranstaltung teilnahm. Sie war inzwischen eines der aktivsten Mitglieder, das die Christengemeinde hatte.
Nachdem sie vor zwei Jahren nach Deutschland zurückgekehrt waren, hatte Vera sich taufen lassen. Die dramatischen Ereignisse, die sie mit Eric durchlebt hatte, hatten einen festen Glauben an einen Gott in ihr erweckt, der mit seinen Geschöpfen etwas Großes und Gutes vorhatte. In Mali hatten sie Wunder erlebt, Bewahrung erfahren und sogar Begegnungen mit einem der Jünger gehabt, die vor zweitausend Jahren Jesus von Nazareth erleben durften. Der Apostel Andreas, der offenbar bis zur Wiederkunft Jesu Christi nicht sterben sollte, hatte ihnen prophezeit, dass Gott noch viel mit ihnen vorhatte. Vera war dazu bereit. Seitdem nutzte sie all die Zeit, die sie nicht zum Broterwerb oder für ihre Familie brauchte, für die Aktivitäten ihrer Christengemeinde.
Eric hielt ihr dabei mit allen Kräften den Rücken frei. Er war begeistert, dass sie ihren Glauben mit so viel Elan lebte. Ihre Entscheidung für Jesus Christus war nicht halbherzig. Sie wusste, dass Gott sich in Jesus offenbart hatte und, dass es eine Erlösung der Welt ohne ihn nicht geben kann. Vera hatte ihm seit ihrer Bekehrung unzählige Fragen über den Glauben, die Bibel, die Kirchengeschichte und alle Aspekte des Alltags mit Gott gestellt. Eric hatte die Fragen, so gut es ging, beantwortet. Im Laufe seines Lebens und seiner Arbeit für christliche Gesellschaften hatte er eine Fülle von Erfahrungen gesammelt. Vera war dankbar für seine Begleitung auf dem Weg des Glaubens. Sie fragte aber auch den Pastor und andere Gemeindemitglieder. Sie las unzählige Bücher, sah Fernsehberichte, hörte Predigten und wollte doch immer noch mehr wissen und neue Erfahrungen mit Gott machen. Erik förderte ihren Erfahrungshunger und freute sich über ihr Wachstum im christlichen Glauben.
Dass Eric mit Vera viele Gemeindeaktivitäten nicht gemeinsam machen konnte, da er sich um Phánuël kümmern musste, war nicht immer leicht. Aber sie fanden doch stets Zeit, sich über die Ereignisse des Tages auszutauschen. Oftmals erst am späten Abend, so wie heute.
Eric zeigte Vera die Fortschritte bei der Renovierung des Hauses und Vera berichtete von ihrer Arbeit bei dem „Frankfurt Global Newstime Magazine“, ihrem Arbeitgeber in Deutschland. Die Zeitung hatte Journalisten in aller Welt, die exklusive Reportagen für das Blatt lieferten. Damit unterschied sie sich von Konkurrenzprodukten, die ihre Nachrichten ausschließlich von Agenturen bezogen. Vera hatte schon in ihrer Zeit bei den Vereinten Nationen Kontakte zu den Journalisten des Blattes geknüpft. Das hatte ihr auch geholfen, als sie sich bei dem Verlag bewarb. In der Frankfurter Zentrale gehörte Vera zu den Führungskräften im Verwaltungsbereich. Zwar gab es einige Unterschiede im Vergleich zu ihrer Arbeit bei den Vereinten Nationen, aber Vera arbeitete sich mit Feuereifer in ihr neues Arbeitsgebiet ein.
Dann erzählte Eric von Phánuël. Vera bedauerte es, dass sie heute erst nach Hause kam, als der Junge schon schlief. Mit leichtem Wehmut hörte sie sich an, was Phánuël an diesem Tag alles erkundet hatte. Eric erzählte auch von dem Ereignis in der Küche.
„Es war seltsam“, begann er. „Es war, als hätte Phánuël etwas Unsichtbares beobachtet. Eine Person oder ein Ding, das nur er sehen konnte.“
„Vielleicht hat er ja nicht etwas angesehen, sondern auf etwas gehört, was dir aber nicht aufgefallen ist“, entgegnete Vera.
Eric überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. „Nein, sein Blick war fest und klar. Ich bin mir sicher, er hat da etwas gesehen.“
„Aber da war wirklich nichts?“
„Er hat zuerst aus dem Fenster gesehen, aber da war noch nicht einmal ein Vogel. Dann hatte er seinen Blick auf die Küchenwand gerichtet, so als ob da jemand stand.“
„Kinder haben ja ganz besonders viel Fantasie. Und unser Phánuël ist da scheinbar keine Ausnahme“, suchte Vera nach einer Erklärung.
„Das war aber noch nicht alles“, kündigte Eric an und holte sein Smartphone hervor. „Während Phánuël etwas gesehen hat, das scheinbar nur er wahrnehmen konnte, hat er mit seinen Fingerchen das hier aus etwas Wasser, das ich verschüttet hatte, geformt.“ Vera nahm das Handy und betrachtete es aufmerksam.
Sie war zunächst sprachlos. Dann sagte sie leise: „Das hat Phánuël gemacht? Unser Junge hat aus Wasser diese Engelsfigur gemacht? Du machst einen Scherz?“
„Nein, wirklich. Kein Scherz. Ich würde das auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Ich konnte es gerade noch fotografieren, bevor die Kohäsionskraft die Figur wieder zu Wassertropfen zusammengezogen hat.“
„Dann hat Phánuël wirklich etwas gesehen“, kombinierte Vera.
„Ja. Das glaube ich auch“, bestätigte Eric. „Aber genauso rätselhaft ist es, dass er die Wassertropfen dazu gebracht hat, diese Kontur zu halten.“
„Glaubst du, dass er mit dem Wasser das gemalt hat, was er gesehen hat?“
Eric nickte lautlos.
Vera zögerte einen Moment, dann sprach sie aus, was beide meinten. Kaum hörbar sagte sie: „Phánuël hat einen Engel gesehen.“
5
Laura wohnte ebenfalls in Babelsgrund. Da sie außer ihrem Großvater Arthur keine Verwandten hatte, war sie froh, dass Eric und Vera ihr bei der Betreuung ihres Sohnes zur Seite standen. Mit der Hilfe der beiden konnte sie trotz ihres Kindes bald ein Studium in Frankfurt beginnen. Von ihrem Großvater Arthur hatte sie seit Monaten nichts mehr gehört. Beim Abschied, nach der Flucht aus dem Arnháton-Zentrum, hatte Arthur ihr schon angekündigt, dass er wenig Gelegenheit haben würde, sich bei ihr zu melden. Dass es aber kaum Lebenszeichen von ihm gab, hatte sie nun doch überrascht.
Die schlimmen Ereignisse in Mali hatte sie zunächst nur schwer verkraftet. Die ungewollte Schwangerschaft durch die Arnháton-Sekte war ein traumatisches Ereignis. Zuerst hatte sie mit dem Gedanken einer Abtreibung gespielt. Sie hatte das Kind nicht gewollt. Die Umstände der Empfängnis waren für sie rätselhaft. Alles deutete darauf hin, dass die Arnháton-Sekte während ihrer Gefangenschaft eine künstliche Befruchtung bei ihr vorgenommen hatten. Was da in ihrem Bauch heranwuchs, war ihr unheimlich. Gegenüber Eric hatte die Sekte von Experimenten gesprochen, bei denen man versuchte, einen vor mehr als dreitausend Jahren verstorbenen Pharao zu klonen. Und alles deutete darauf hin, dass sie nun Teil dieses Experimentes war. Möglicherweise war das Kind, das sie nun ausgetragen hatte, wirklich eine neue Version des Mannes, den die Welt als Pharao Echnaton kennt.
Fast alle Menschen, die sie um Rat gefragt hatte, rieten ihr damals zu einer Abtreibung. Zu grauenvoll war die Vorstellung, mit was Laura bei einem Fehlschlag des Experiments konfrontiert worden wäre. Von Totgeburt oder von schlimmen Missbildungen war die Rede. Aber auch davon, dass Laura das Kind nie wirklich lieben könne.
Laura hörte sich damals die mehr oder weniger gut gemeinten Ratschläge an und ließ sich regelmäßig von Ärzten untersuchen. Auch Eric und Vera hatte sie damals gefragt, aber sie scheuten sich davor, Ratschläge zu geben. Sie vermittelten ihr Kontakte zu Selbsthilfegruppen vergewaltigter Frauen. Jedoch stellte Laura bald fest, dass ihr Fall in vielen Bereichen nicht mit den Fällen der anderen Frauen vergleichbar war.
Entscheidend war für sie ein Erlebnis, das sie in der neunten Schwangerschaftswoche hatte. Sie lag damals in ihrem Bett und war schon lange eingeschlafen. Selten hatte sie sich an ihre Träume erinnert. Doch diesen Traum wird sie niemals vergessen. Sie träumte damals von einer Welt, die scheinbar völlig aus den Fugen geraten war. In diesem Traum befand sie sich im hessischen Frankfurt. Einige Details der Stadt erkannte sie. Manche Gebäude erschienen ihr extrem ungewöhnlich, fast futuristisch. Sie hörte Sirenen, sah Menschen in Panik flüchten und versuchte selbst auch Schutz zu suchen. Aber sie wusste nicht, wovor sie flüchten musste. In ihrer Ratlosigkeit rannte sie den anderen Menschen hinterher. Kurze Zeit später hörte sie in der Ferne Explosionen. Die Menschen um sie erstarrten vor Angst und blickten zwischen den Häuserschluchten nach oben. Das dröhnende Geräusch der Detonationen kam immer näher. Jetzt fragte Laura in ihrem Traum die anderen Menschen, wo sie Schutz finden könnte, aber sie schienen sie nicht wahrzunehmen. Dieses gespenstische Szenario steigerte die Panik in ihr ins Unermessliche. Sie rannte zur Eingangstür des nächstliegenden Gebäudes und versuchte vergeblich die Tür zu öffnen. Wieder rief sie den anderen Menschen etwas zu, aber noch immer standen sie regungslos auf der Straße und blickten gebannt nach oben. Niemand nahm von ihr Notiz. Die Explosionen kamen immer näher. Eine Staubwolke kam meterhoch durch die Straßenschlucht auf sie zu.
Sie rannte zur nächsten Tür. Auch sie war verschlossen. Sofort eilte Laura weiter. Voller Angst blickte sie sich um und sah die Staubwolke immer näher kommen. Dahinter blitzten Detonationen auf. Der Lärm war jetzt ohrenbetäubend.
So versuchte Laura, an mehr als zwanzig Türen, in ein schützendes Haus zu kommen. Auch sonst fand sie keine Nische, die ihr Deckung versprach. Sie war völlig außer Atem. Erschöpft sank sie auf die Knie, um einen Augenblick neue Kräfte zu schöpfen.
Da hörte sie, trotz des gewaltigen Lärms, eine Stimme hinter sich. Erstaunt sah sie sich um und erkannte einen kleinen Jungen, der sie ansah und seine Worte wiederholte: „Hab keine Angst. Folge mir und dir wird nichts geschehen.“ In diesem Moment erschienen Laura die Worte so klar und einleuchtend, dass sie nicht im mindesten daran zweifelte, dass der Junge die Wahrheit sagte.
Die Menschen auf der Straße waren nun nicht mehr erstarrt, sondern blickten nun alle in Richtung des Jungen. Der sah noch immer Laura an und hatte den Menschen den Rücken zugewandt. Langsam hob er nun beide Arme und rief laut: „Folgt mir!“ Dann nahm er Laura bei der Hand und rannte los. Viele der Menschen auf der Straße folgten ihnen. Manche blieben trotz allem stehen. Laura hatte Mühe, das Tempo des Jungen mitzuhalten, immer wieder sah sie sich um. Nun kamen die Bombeneinschläge so nah, dass die Menschen, die ihnen nicht folgten, von den Explosionen zerrissen wurden. Laura schrie auf und umklammerte die Hand des Jungen fester. Jetzt rannten sie auf ein Gebäude zu, dessen Eingangstür sich wie von Geisterhand öffnete. Kaum hatten sie die Tür passiert, war von dem Bombenlärm nichts mehr zu hören. Der Junge eilte mit Laura bis zum Ende des großen Eingangsbereiches, dann blieben sie stehen und drehten sich um. Unzählige Menschen waren ihnen nachgekommen. Allen war die Erleichterung zu spüren, dass sie hier Schutz gefunden hatten. Einige kamen nun auf den Jungen zu und brachen in Tränen aus. Jetzt hörte Laura das Wort „Danke“ aus unzähligen Mündern. Die Menschen fielen vor dem Jungen auf die Knie und gaben lautstark ihrer Dankbarkeit Ausdruck.
Erst jetzt betrachtete Laura das Gesicht des Jungen näher. Irgendwie schien es ihr vertraut. Es war kein gewöhnliches Gesicht. Sie konnte nicht einmal sagen, ob der Junge europäische Züge trug oder die eines anderen Kontinents. Irgendwie hätten die Gesichtszüge zu jedem Ort der Welt gepasst. Eines war aber besonders auffällig. Das Gesicht des Jungen war schmal. Sehr schmal. Dafür war die Stirn ungewöhnlich hoch. Laura wusste, dass sie diese Gesichtszüge schon einmal gesehen hatte. Nicht bei einem Jungen, sondern bei einem erwachsenen Mann. Jetzt fiel es ihr ein, woher sie dieses Antlitz kannte. Auf Bildern hatte sie es gesehen. Auf Bildern, die die Darstellungen eines Pharaos zeigten. Bilder von Echnaton.
In ihrem Traum war Laura über diese Erkenntnis nicht erschrocken. Vielmehr machte sich eine allumfassende Erleichterung in ihr breit. Der Junge hielt immer noch Lauras Hand. Ihm war anzumerken, dass er die Huldigungen der Menge als unangenehm empfand.
„Nein. Dankt nicht mir“, rief er der Gruppe zu. „Ich habe nur Türen geöffnet und euch den Weg gezeigt. Den Weg zu Gott müsst ihr selbst gehen.“ Nun wurde es ruhiger und es war einigen anzumerken, dass sie ein leises Dankgebet sprachen.
Der kleine Echnaton sah nun Laura an und lächelte. „Es sind nicht viele, die gerettet werden. Aber wir können helfen, dass es täglich mehr werden.“
„Und wie können wir ihnen helfen?“, fragte Laura.
„Mit unserem Leben“, antwortete der Junge und sah Laura liebevoll in die Augen. „Einfach mit unserem Leben. Mutter.“
Seit Laura dieses Traumerlebnis hatte, war ihr klar, dass sie das Kind in ihrem Bauch austragen würde. Als sie Vera und Eric ihre Entscheidung mitgeteilt hatte, sagten sie ihr ihre volle Unterstützung und Hilfe zu.
Die Schwangerschaft war problemlos verlaufen. Trotz ihrer inneren Gewissheit, dass ihr Kind einen Auftrag Gottes erfüllen würde, ließ sie sich, so oft es ging, von Fachärzten untersuchen. Glücklicherweise entwickelte sich das Baby in ihrem Bauch prächtig. Erst kurz vor der Geburt entschieden die Ärzte sich dann doch zu einem Kaiserschnitt zu raten, da das Kind in einer ungünstigen Position lag und sich nicht drehen wollte. Laura wünschte sich, dass Vera bei der Geburt dabei wäre. Da Phánuëls Geburt inzwischen einige Wochen zurück lag, kam sie dem Wunsch gerne nach.
„Welchen Namen soll dein Sohn haben?“, fragte Vera, als sie zusagte, bei der Geburt dabei zu sein.
„Thomas“, entschied Laura. „Thomas bedeutet Zwilling. Und Thomas hat ja einen Zwilling, auch wenn der vor mehr als dreitausend Jahren auf dieser Erde gewandelt ist.“ Vera und Eric waren erstaunt darüber, dass Laura so unbefangen mit der Situation umging, dass ihr Kind das Produkt eines gewagten Klonexperiments ist.
„Thomas ist auch ein biblischer Name“, fügte Eric an. „Einer von Jesu Jüngern hieß Thomas. Ich wünsche ihm, dass er ebenso ein Apostel wird, wie sein Namensvetter.“
„Das wird er“, bestätigte Laura. „Da bin ich mir sicher.“
Der Kaiserschnitt verlief planmäßig und ersparte Laura die schlimmen Stunden der Geburtswehen. Als die junge Mutter das erste Mal ihr Kind in den Armen halten konnte, spürte sie eine unendliche Liebe für den Kleinen.
Vera war ein wenig erschrocken, als sie den neugeborenen Thomas das erste Mal sah. Die Ähnlichkeit mit den Darstellungen von Echnaton war unübersehbar. Selbst bei diesem winzigen Baby. Trotzdem gelang es ihr, sich nichts anmerken zu lassen.
Von den kriminellen Machenschaften der Arnháton-Sekte hatten Laura und Eric sowohl den malischen als auch den deutschen Behörden berichtet. Auch hatten sie sich im Laufe der letzten Monate immer wieder bei der deutschen Polizei nach den Fortschritten der Ermittlungen erkundigt. Jedoch wurde von den Beamten immer wieder darauf verwiesen, dass die Zusammenarbeit mit den malischen Behörden schwierig sei und die deutschen Ermittler am Ort der zerstörten Arnháton-Zentrale kaum Beweise sicherstellen konnten. Das, was durch den Absturz des Flugzeugs auf den Komplex und durch die nachfolgenden Explosionen nicht zerstört sei, läge nun unter Tonnen von Sand. Die Aufarbeitung des Falls könne sich noch über Jahre hinziehen. Außerdem läge der Tatort in einer Gegend Malis, die von Jahr zu Jahr unsicherer würde. Die anfangs zurückgedrängten Islamisten sorgten inzwischen wieder für Unsicherheit im Norden Malis. Staatliche Angestellte könnten sich dort ohne militärischen Geleitschutz nicht mehr bewegen. Und das Militär würde an anderen Stellen dringender gebraucht.
So blieb Eric, Vera und Laura nichts weiter übrig, als innerlich mit den Ereignissen in Mali abzuschließen und zu versuchen, den Alltag in Deutschland so normal wie möglich zu verbringen. Da in all den Monaten nichts darauf hindeutete, dass die Sekte auch in Deutschland agierte, drängte sich der Eindruck auf, dass mit der Zerstörung der Arnháton-Zentrale auch die Strukturen derart geschwächt waren, dass man mit der Auflösung der Sekte rechnen konnte. Alles sprach für die Chance, ein neues Leben zu beginnen.
Doch die Arnháton-Sekte hatte keineswegs ihre Aktivitäten eingestellt. Marera, die Priesterin der Arnháton-Gemeinschaft, hatte die Zerstörung der Zentrale überlebt. Kurz danach hatte Marera beobachten können, dass Laura ein Flugzeug nach Bamako bestieg. Und auch danach hatte sie Laura immer aus der Ferne beobachtet. Noch war die Arnháton-Gemeinschaft in einer Phase des Wiederaufbaus. Noch war man auf der Suche nach neuen Geldquellen und neuen Mitgliedern. Aber immer hatte man daran gearbeitet, den Pharao zurück in die Gemeinschaft zu holen. Zweimal hatte man es schon vergeblich versucht, das Kind heimlich zu entführen. Doch jedes Mal war die Entführung an unvorhergesehenen Ereignissen gescheitert. Laura hatte nichts davon mitbekommen. Der nächste Versuch würde gelingen, da war sich Marera ganz sicher. Dann wäre Echnaton wieder im Kreise derer, die ihn als gottgleichen Pharao verehrten.
6
Der Mann, der aus dem würfelförmigen Objekt geklettert war, hatte inzwischen soviel Kraft geschöpft, dass er es wagte, sich zu erheben. Seine Muskeln zitterten, als er seine Beine zwang, den Körper nach oben zu stemmen. Mit beiden Händen hielt er sich an der Metallbrüstung fest. Er hustete und bemerkte den Geschmack von Blut in seinem Mund. Das Gewicht seines Körpers drückte die nackten Füße schmerzhaft in die Metallgitter, die den Kubus mit der Leiter verbanden. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen, um zur Treppe zu gelangen. Von dort stieg er die Stufen herab, bis er den kühlen Betonboden unter den Füßen spürte. Wieder überkam ihn ein Hustenanfall. Er sah sich um und entdeckte zwei graue Kittel an einem Haken an der Wand. Da es recht kühl war, fror der fast nackte Mann, der nur nasse Shorts trug, und ging jetzt recht zügig zu der Wand, um sich einen der Kittel überzuziehen. Dann sah er sich weiter um, in der Hoffnung vielleicht auch ein Paar Schuhe zu finden. Der kalte Betonboden war jetzt äußerst unangenehm, doch Schuhe fand er hier nicht. Er griff nach dem zweiten Kittel und riss die Ärmel ab, um sie sich um die Füße zu wickeln. So war das Problem der fehlenden Schuhe vorläufig gelöst.
Der Mann nannte sich Saul. Dort, wo er herkam, war es ungewöhnlich, dass ein Mensch einen traditionellen Namen hatte. Dort hatten die Menschen nur Kombinationen aus Zahlen und einzelnen Buchstaben als Namen. Das sollte vermeiden, dass jemand wegen seines Namens bevorzugt oder benachteiligt würde. So stellten es jedenfalls die Führungspersönlichkeiten dar. Namen wie im 21. Jahrhundert seien ein überholtes Relikt aus einer dunklen Vergangenheit, erzählte man den Menschen. Ebenso wie alles, was lesbar war. Es gab angeblich bessere Methoden, um Wissen zu verbreiten. Buchstaben und Namen waren gefährlich. Deshalb hatte man die Schrift größtenteils abgeschafft.
Nur Saul und einige andere hatten noch wirkliche Namen, aber nur, weil sie im Verborgenen lebten. In geheimen Siedlungen, die sogar Magog, der Kreis der Herrschenden, nicht entdeckt hatte. Viele in den Zufluchtsorten konnten sogar lesen und schreiben, aber nicht alle. Diejenigen, die sich aus den Ländern Magogs zu ihnen geflüchtet hatten, durften nie lesen lernen und würden es auch niemals können. In den Ländern Magogs musste niemand die Fähigkeit des Lesens haben. Alle Fragen wurden von Gog beantwortet. Und Gog sagte auch Magog, wie man regieren sollte. Es war die perfekte Welt für diejenigen, die ihr Leben voll und ganz in die Hände von Gog und Magog legten.
Aber Saul wusste, dass es auch ein Leben, eine Welt, eine Zeit gab, die den Menschen die Freiheit gab, selbst zu lesen und eigene Namen zu haben. In Sauls versteckter Gemeinschaft gab es noch Papier und sogar ein paar Bücher. Das war ein Verbrechen, aus der Sicht des Magog. Aber die Gemeinschaft hatte es seit Jahrzehnten geschafft, unentdeckt zu bleiben. Und sie hatte sogar den Kubus wieder funktionsfähig gemacht. Das war ein Segen für die Gemeinschaft. Und für Gog und Magog würde es ein schwerer Schlag sein.
Schon drei Männer und drei Frauen hatten versucht, mit dem Würfel zu reisen, doch ohne den gewünschten Erfolg. Von zwei Männern hatte man nie wieder etwas gehört und die restlichen vier hatte man tot in dem Kubus aufgefunden, bevor sie die Reise hatten antreten können. Dass Saul bereit war, die Reise zu wagen, zeugte von enormem Mut und von ebenso viel Opferbereitschaft für seine Gemeinschaft.
Saul wusste, dass sein Einsatz so notwendig war wie kaum etwas in der Geschichte der Menschheit. Er wusste Dinge, die Gog und Magog den Menschen vorenthielten. Deshalb war er auch bereit, sein Leben zu riskieren, um hierher zu gelangen.
An diesen Ort.
In diese Zeit.
Mit der Zeitmaschine.
7
Am nächsten Morgen war Eric, wie an jedem Wochentag, früh aufgestanden, um Vera das Frühstück vorzubereiten. Während sie noch einige Minuten im Bett blieb, dachte er an den Tag zurück, als er Vera das erste Mal geküsst hatte.
Es war 2013, nachdem er unter Lebensgefahr geholfen hatte, verschüttete Goldsucher zu retten. Damals wurde ihnen klar, dass es kein Zufall war, dass sie sich dort in Mali getroffen hatten. Sie waren von Gott füreinander bestimmt.
Eric hatte eine Weile gebraucht, bis er diesen Gedankengang verinnerlichen konnte. Bevor er Vera traf, musste er den Tod seiner Tochter und seiner damaligen Frau Susanne verarbeiten. Beide kamen bei einem Autounfall ums Leben, was Eric damals in eine schwere Krise stürzte. Er begann an Gott zu zweifeln, an seiner Berufung zum Bibelübersetzer, an seinem gesamten Leben. Zu dieser Zeit hatte er Tage, an denen er nicht einmal mehr leben wollte. Der Verlust der beiden liebsten Menschen brachte ihn an die Grenzen des Erträglichen. In diesen Jahren hatte er sich nicht vorstellen können, einmal wieder eine Frau so lieben zu können, wie er es nun mit Vera erleben durfte.
Eric hatte diesen ersten innigen Kuss mit Vera nie wieder vergessen. Auch wenn sie sich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage gekannt hatten, spürten sie doch beide eine Vertrautheit, so als würden sie sich schon eine Ewigkeit kennen. Die dramatischen Ereignisse jener Tage führten noch zu einigen Ablenkungen, schweißten die beiden aber immer enger aneinander. Als sie später, auf dem Weg nach Bandiagara, ein Zimmer in dem Ort Miéna für eine Nacht ganz für sich hatten, spürte er das erste Mal, wie sehr Vera ihn mit Leib und Seele begehrte. Seit dieser Nacht war beiden klar, dass sie zusammengehörten. Seitdem waren sie sich sicher, dass ein liebender Gott mit einem guten Plan sie füreinander bestimmt hatte.
Damals hatten sie noch viel gemeinsam durchzustehen. Eric wurde angeschossen und wäre womöglich gestorben, wenn er nicht durch einen Außerirdischen geheilt worden wäre, der allerdings kurz danach selbst starb. Es waren unglaubliche Dinge, die sie erlebten. Doch durch die Gewissheit, dass diese Ereignisse ihn mit Vera zusammengeführt hatten, waren sie für ihn nur ein Teil von Gottes gutem Plan.
Seitdem wusste er, dass er mit Vera an seiner Seite das größte Geschenk hatte, das Gott ihm machen konnte. Sie war für ihn unendlich kostbar, genauso wie Phánuël, ihr gemeinsamer Sohn.
Inzwischen hatte Eric den Küchentisch gedeckt und war gerade dabei Spiegeleier mit Schinken zu braten. Nebenan hörte er, wie Vera aus dem im ersten Stockwerk gelegenen Schlafzimmer die Treppe herunter kam. Nur in ihr hauchdünnes Nachthemd gehüllt betrat sie die Küche und wie an jedem Morgen war Eric überwältigt von ihrem Anblick. Ihre Haare waren noch etwas zerzaust und gaben ihrem hübschen Kopf eine verwegene Note. Durch das Nachthemd konnte er deutlich ihren schlanken Körper sehen, der ihm noch immer wie am ersten Tag den Atem nahm. Eric liebte Veras Charakter, ihren unverwüstlichen Humor, ihre Intelligenz und ihre Begeisterungsfähigkeit. Aber er liebte auch ihren perfekten Körper. Und an einem Morgen wie diesen liebte er ihn ganz besonders.
„Guten Morgen, Chéri“, hauchte Vera, noch immer etwas schlaftrunken.
„Guten Morgen, mein Schatz.“ Mit einem leichten Seufzer wandte Eric seinen Blick von Vera, um sich weiter der Zubereitung des Frühstücks zu widmen.
Während er mit der Pfanne und einem Küchenspachtel hantierte, leicht nachwürzte und den Herd ausschaltete, trat Vera von hinten an ihren Mann heran. Gerade wollte er melden, dass jetzt alles fertig sei, da lehnte sie sich sanft an seinen Rücken und schlang ihre Arme um seine Brust. Eric war etwas größer als sie, was ihr das Gefühl gab, einen richtigen Mann bei sich zu haben.
Vorsichtig stellte Eric die Pfanne wieder auf den Herd. Er kannte Veras Bedürfnis nach Zärtlichkeit nur zu gut und war für diese Momente, die Vera recht oft hatte, unendlich dankbar. Vorsichtig drehte er sich um und nahm ihr Gesicht in beide Hände. Liebevoll küsste er sie auf ihre zarten Lippen und strich ihr übers Haar. Veras Hände glitten über seine Brust und wanderten hoch bis zu seinem Nacken, den sie jetzt fest umschlang. Den Kuss erwiderte sie mit einer Leidenschaft, die keinen Zweifel daran ließ, dass sie Eric jetzt mit Haut und Haar begehrte.
Ihre Hände griffen nach seinem vollen Haar. Sie zog seinen Kopf zu sich und küsste ihn, als wären sie hundert Jahre getrennt gewesen und müssten alle Zweisamkeit nachholen.
Veras Küsse ließen Eric noch immer in Flammen aufgehen, als wäre es ihr erster Kuss. Noch immer überwältigte ihn das sanfte und zugleich wilde Spiel ihrer Lippen. Noch immer entführte ihre Zunge ihn in Sphären weit jenseits dieser Welt.
Vera war nicht weniger hungrig nach Erics Küssen. Bevor sie Eric traf, gab es schon viele Männer in ihrem Leben. Aber niemand hatte damals das Talent wie Eric gehabt, sie bereits durch einen leidenschaftlichen Kuss in höchste Erregung zu versetzen.
Immer noch eng umschlungen und heftig küssend, schoben sich die beiden aus der Küche in das angrenzende Wohnzimmer. Veras Hände liebkosten jeden Quadratzentimeter von Erics Körper. Und auch Eric hätte sich gewünscht, mehr als nur zwei Hände zu haben, um jeden Teil von Veras Körper gleichzeitig spüren zu können. Immer wieder aufs Neue war er von ihren perfekten Rundungen hingerissen. In jedem Moment, in dem er Vera berührte, wusste er, dass er nichts auf dieser Welt so sehr begehrte wie Vera.
Im Wohnzimmer ließen sie sich auf das Ecksofa fallen und küssten sich heftig weiter. Veras Haar geriet zwischen ihre Münder, so dass Eric, der auf Vera lag, den Kopf einen Moment hob und die Haare zärtlich beiseite schob. Beide sahen sich in die Augen. Beide wussten, sie waren füreinander geschaffen und niemand könnte den jeweils anderen ersetzen.
Vera zog wieder Erics Kopf zu sich. Fordernd verlangte sie seine Küsse. Ihre Hände glitten unter sein Hemd, was ihn noch weiter erregte. Er spürte, wie Veras Körper nach seiner Nähe verlangte. Vorsichtig richtete er sich auf, um sich sein Hemd auszuziehen. Währenddessen streifte Vera sich das Nachthemd ab, so dass sie nun völlig nackt vor ihm auf dem Sofa lag. Eric hatte noch immer seine Hose an, doch mit flinken Fingern hatte Vera ihm auch diese ausgezogen.
8
Arthur hatte sich in Catania auf Sizilien ein Hotelzimmer gemietet. Er saß dort auf einem Stuhl und betrachtete vor sich, auf dem kleinen Tisch, eine Zahnpastatube. Die Tube war aus Aluminium. Arthur nahm ein Messer und schnitt sie ganz am Ende vorsichtig auf. Dann drückte er den Inhalt auf ein Papiertaschentuch. Seit den Ereignissen im Zentrum der Arnhátonsekte fehlte ihm ein Finger. Doch inzwischen hatte er gelernt, mit neun Fingern auszukommen.
Zum Vorschein kam, außer der Zahnpasta, auch ein eng aufgerolltes Bündel mit Geldscheinen. Es war alles, was Arthur während seiner Reise vor den Schleppern verstecken konnte. Mehrmals hatte man ihn und die anderen Flüchtlinge ausgeraubt. Doch niemand kam auf den Gedanken, dass der alte Mann sein Bargeld in einer Zahnpastatube aufbewahrte. So blieb ihm immer etwas Geld, wenn Bestechungen oder Ähnliches notwendig war.
Nun war er in Europa und hatte sogar einen französischen Personalausweis. Eigentlich müsste er niemanden mehr bestechen, dachte er sich. Aber in den letzten Monaten hatte er Erfahrungen gemacht, die ihn auf eine neue Weise geprägt hatten.
Bisher hatte er sich nur für sich selbst und für seine Familie verantwortlich gefühlt. Doch in den letzten Monaten hatte er miterlebt, wie andere Flüchtlinge mit ihm gelebt und gelitten hatten. Ihm geholfen hatten und neben ihm gestorben waren. Mit ihm gehungert hatten und bis an ihre Grenzen gegangen waren. Er hatte erlebt, wie er und die anderen betrogen wurden und um ihr Leben kämpfen mussten. Dabei waren Freundschaften entstanden, die er jetzt nicht einfach abschütteln konnte.
Das Geld, das nun vor ihm lag, würde er gut für den Start in sein neues Leben gebrauchen können. Schließlich kann man auch in Deutschland nicht einfach mit einem französischen Pass auf ein Amt gehen und sich einen neuen Haushalt bezahlen lassen. Es wären einige Investitionen nötig. Doch zwei seiner Begleiter auf der schweren Reise von der Sahara bis hierher wollte er nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.
Da war zum einen Adama Soumbia. Ein junger Mann von 23 Jahren. Arthur hatte ihn in Agadez getroffen. Adama gehörte zur christlichen Minderheit im Niger. 2015, nach der Veröffentlichung der umstrittenen Ausgabe des Magazins Charlie Hebdo, brach auch im Niger, wie in vielen anderen Teilen der Welt, eine bislang nie dagewesene Welle von Gewalt gegen die Christen los. Beginnend in der zweitgrößten Stadt des Landes, kam es später auch in der Hauptstadt Niamey und weiteren Orten zu gewaltsamen Übergriffen. Mehrere Menschen verloren in den nächsten Monaten ihr Leben. Darunter auch Adamas Familie. Zwar unternahm die Regierung Nigers wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Extremisten und damit auch zum Schutz von Christen, aber die Dörfer von Adamas Heimat waren immer wieder Anschlägen und Überfällen von militanten muslimischen Gruppen ausgesetzt. Irgendwann hatte Adama beschlossen, nach Europa zu emigrieren, wo er hoffte, seinen Glauben ohne Gefahr praktizieren zu können. In Agadez trafen Arthur und Adama zusammen und waren seitdem gemeinsam gereist.
Außerdem gab es da noch Mariam Ginta, die sich während ihrer Flucht zum christlichen Glauben bekehrt hatte. Die Zwanzigjährige stieß erst in Dirkou, im Norden des Niger, zu der Gruppe. Eigentlich kam sie aus Mali und gehörte dort zur Volksgruppe der Bozo. Zu dem Zeitpunkt des Zusammentreffens war sie schon seit über einem Jahr unterwegs. In Dirkou wurde sie von ihren Schleppern als Sklavin gehalten. Mit Arthurs Hilfe kam sie frei. Seitdem fühlte er sich für sie verantwortlich.
Arthur wusste, dass die beiden noch lange Zeit in dem Flüchtlingslager südlich von Catania bleiben würden, bis sie die finanziellen Mittel hätten, weiter nach Deutschland zu reisen. Und Deutschland war ihr angestrebtes Reiseziel. Arthur hatte zwar versucht, ihnen ein realistisches Bild von dem zu machen, was sie dort erwartete: kein Land, wo Milch und Honig fließen, sondern eine Gesellschaft, die immer mehr von ihrem Sozialstaat dem Heuschreckenkapitalismus opferte. Das führte dazu, dass immer mehr Menschen vom Mittelstand in die soziale Unterschicht abstiegen. Migranten ohne Ausbildung erwartete nur eine neue Form von Armut, aber immer in Konkurrenz zu einheimischen Verarmten und einer verängstigten Mittelschicht, die den sozialen Abstieg vor Augen hatte. Eine explosive Situation, die nur für die wenigen Superreichen einen Gewinn darstellt.
Doch Adama und Mariam ließen sich von Arthurs Warnungen nicht von ihrem Plan abbringen. Zu verlockend waren die Schilderungen der Schlepper. Zu hoffnungslos die Situation in der Heimat.
Arthur beschloss, den beiden auf ihrem Weg nach Deutschland beizustehen, mit Geld und auch mit sonstiger Hilfe. Sie konnten nur wenig Englisch und überhaupt kein Deutsch. Er wollte bei ihnen bleiben, bis sich in Deutschland eine Hilfsorganisation ihrer annahm.
Arthur würde ihnen helfen. Und das fühlte sich gut an. Und dabei musste noch nicht einmal jemand sterben.
Vorerst jedenfalls.
9
Saul fiel es nicht leicht, seine Emotionen im Zaum zu halten. Er sah so viele Dinge, von denen er bisher noch nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Die Zeit, in die er gereist war, bot so viel, was in dem Jahrhundert, aus dem er kam, undenkbar war. Texte, die für jedermann lesbar waren. Plakate, Schilder mit Firmennamen oder Straßennamen, Zeitungen, Bücher und noch viel mehr.
Und er konnte alles lesen. Da, wo er herkam, wusste man, dass er der deutschen Sprache mächtig sein musste, wenn er aus der Zeitmaschine gestiegen war. Er hatte diese Sprache sogar von Kindesbeinen an gelernt. Natürlich zusätzlich zu Serusar, der Sprache, in der die Menschheit kommunizierte. Die ganze Menschheit. Außer den wenigen Altwissenden, zu denen auch er gehörte.
Saul hatte immer noch nichts weiter an, als seine inzwischen getrockneten Shorts und den grauen Kittel, den er im Raum der Zeitmaschine gefunden hatte. Da der Kittel aber fast knielang war, bemerkte das keiner der Menschen, denen er nun begegnete. Saul hatte nur mit Mühe die Türen öffnen können, die ihn von dem verborgenen Raum bis nach draußen brachten. Nun musste er sich in dieser völlig ungewohnten Welt zurechtfinden.
Hier gab es keinen Gog, der einem immer sagte, was er tun sollte. Dem man jede noch so nebensächliche Frage stellte, um nicht selbst denken zu müssen. Hier war man frei, musste aber auch selbst Lösungen entwickeln. Dort, wo er herkam, in der verborgenen Kolonie der Altwissenden, war einer der wenigen verbliebenen Orte, an denen die Menschen noch lernen konnten, alleine Entscheidungen zu treffen. Der Rest der Welt hatte sich vollends Gog anvertraut. Letztlich nicht freiwillig, aber so gut wie unumkehrbar.
Saul wusste, dass die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts nicht ahnten, dass sich die Welt derart wandeln würde, dass die Menschheit nicht mehr im Stande war, auch nur die einfachsten Buchstabenkombinationen zu lesen. Niemand hier ahnte, was den kommenden Generationen bevorstand. Niemand zweifelte am Fortschritt, der alles besser machen sollte. Kaum jemand nahm die biblischen Prophezeiungen ernst.
Aber er war nicht hier, um die Menschen dieser Zeit zu belehren. Er wusste, dass das Schicksal der Menschheit schon feststand. Nur wenige Menschen hatten in den vergangenen Jahrhunderten die Offenbarungen in der Bibel richtig interpretiert und ihr Leben darauf ausgerichtet. Nur wenige hatten für die Menschen gebetet, die es miterleben sollten, wenn die letzten Siegel des Endgerichts gebrochen werden.
Saul wurde in diese Zeit geschickt, um den Mann zu treffen, der ihm helfen sollte, das mit der Zeitmaschine in die Zeit Gogs und Magogs zu schicken, was dort der Kolonie der Altwissenden am meisten fehlte: das Buch der Bücher.
Bibeln, die den Menschen Kraft und Trost gaben, die letzten Tage der Menschheit zu überstehen. Dort, wo er herkam, gab es keine Bücher mehr, da der Magog dafür gesorgt hatte, dass keine mehr gedruckt werden konnten. Niemand sollte lesen können, da jeder einzig und alleine auf Gog hören sollte. Also brauchte man keine Bücher mehr. Bücher galten sogar als gefährlich. Bücher waren unkontrollierbar. Wer welches gedruckte Buch las, blieb sogar Gog verborgen. Und der Magog tat alles, damit jedes Buch auf der Welt vernichtet werden sollte.
Saul wusste, dass es nun das Wichtigste war, den Mann zu treffen, der es möglich machte, ihn samt der Bibeln mit der Zeitmaschine wieder zurückzuschicken. Alleine würde er es nicht schaffen. Aber mit diesem Mann und anderen Helfern aus dieser Zeit sollte es gelingen. Er musste nur zu der Adresse gelangen, die ihm die Führer der Altwissenden genannt hatten.
Aber wie findet man eine Adresse, wenn man noch nie im Leben nach einer gesucht hatte? Saul wusste, dass er nach Osten gehen musste, wenn er die Zeitmaschine verlassen hatte. Er orientierte sich an der Sonne. Er beobachtete die anderen Menschen dieser Zeit und versuchte ihre Handlungsweisen zu analysieren. Viele Menschen hatten sich in Fahrzeuge gesetzt, die sie transportierten. Ähnliches kannte er auch aus seiner Zeit. Doch da konnten sich nur Leute aus der Kaste Magogs auf diese Weise fortbewegen. Hier waren es wesentlich mehr Fahrzeugreisende.
Saul überlegte, ob hier vielleicht jeder Mensch einfach so in ein Fahrzeug steigen konnte, um sein Ziel zu nennen und sich dann dorthin bringen zu lassen. Da er darauf keine Antwort fand, beschloss er, erst einmal zu Fuß nach Osten zu laufen und die fantastische Welt weiter zu beobachten.
Saul hatte sich schon oft den Kopf darüber zerbrochen, ob Dinge, die in der Zukunft geschehen sind, sich ändern werden, wenn man die Vergangenheit verändert. Welche Auswirkungen würde es haben, wenn er Bibeln vom 21. Jahrhundert in seine Zeit schaffte? Was wäre, wenn diese Bibeln bei Gottes Plan in diesem Jahrhundert fehlten? Können überhaupt ein paar Bibeln den Verlauf der Geschichte ändern?
Den Verlauf der großen Ereignisse in seinem Jahrhundert würden diese Bibeln auf jeden Fall ändern, da waren sich die Führer der Altwissenden sicher. Und auch er zweifelte nicht daran. Aber vielleicht haben ja die fehlenden Bibeln in diesem Jahrhundert erst dazu geführt, dass die großen Katastrophen der Endzeit in Gang geraten? Saul wusste, dass er keine Lösung für dieses Dilemma finden könnte. Zeit-Paradoxen entziehen sich allen menschlichen Versuchen, sie zu verstehen.
Die Adresse, die er finden musste, hatte er sich auf seinen linken Unterarm geschrieben, bevor er sich auf die Zeitreise hierher gemacht hatte. Er hätte auch einen Zettel mit der Adresse auf seiner Reise mitnehmen können. Solange das speziell aufbereitete Wasser, in das man während der Zeitreise tauchte, die gesamte Struktur eines toten Objekts durchdrang, überstand es die Reise. Lebende Objekte, wie er selbst, mussten nicht völlig durchdrungen werden. Es reichte, wenn der Sauerstoff, der dem Körper in den Stunden vor der Zeitreise verabreicht wurde, in gleicher Weise wie das Wasser in dem Kubus aufbereitet wurde. Die Quantenverschränkung zwischen dem Wasser und dem Sauerstoff machte es dann möglich, die Reise mehr oder weniger unbeschadet zu überstehen. Ein Indiz, dass die Sauerstoffanpassung erfolgreich war, zeigte sich darin, dass der Zeitreisende in dem Transportwasser atmen konnte, wie in gewöhnlicher Luft.
Zufällig gelangte er auf einen Wanderweg, der parallel zu einer Schnellstraße nach Osten führte. Dort war er der einzige Fußgänger. Nur ein paar Radfahrer überholten ihn hin und wieder. Nach vier Stunden bekam er Hunger. Er ignorierte dieses Gefühl, ohne größere Mühe. Dort, wo er herkam, musste seine Gemeinschaft oft Nahrungsengpässe überstehen, da sie stets gezwungen war, verborgen zu bleiben.
Bedenklicher als der Hunger war die Tatsache, dass er nichts zu trinken hatte. Er wusste, dass er früher oder später etwas Trinkbares auftreiben musste. Deshalb durchwühlte er die Mülleimer, an denen er vorbei kam. Aber außer ein paar leeren Plastikflaschen fand er dort nichts Brauchbares.
Wenn er nach rechts blickte, sah er etwas, von dem er sicher war, dass es ein Fluss sein musste. Man hatte ihm vor seiner Zeitreise gesagt, dass die Stadt in der der Kubus stand, Frankfurt am Main hieß. Daraus schloss er, dass dieser Fluss möglicherweise der „Main“ war. Diese Schlussfolgerung war richtig.
Er betete, dass es nicht nötig sein möge, dass er das Wasser des Flusses trinken müsse. Er hatte die schlimmsten Befürchtungen, welche Umweltverschmutzung in diesem Jahrhundert herrschen könnte. Kaum hatte er das Gebet mit einem kräftigen „Amen“ abgeschlossen, fielen erste Regentropfen. Schnell steigerte sich der Regenschauer zu einem heftigen Platzregen. Er genoss jeden Regentropfen, denn das Wasser, das an seinem Kittel herunterlief, ließ sich problemlos in die Flasche leiten. Er wusste, dass er bei seinem Auftrag nicht alleine war. Die himmlischen Mächte waren mit ihm.
Er wusste nicht, ob es noch Stunden oder gar Tage dauern würde, bis er den Mann getroffen haben würde, den er für die Erfüllung seines Auftrags brauchte, aber er war sich sicher, dass es ihm gelänge.
Noch einmal sah er auf seinen linken Unterarm. Deutlich war dort die Adresse zu lesen, und auch der Name des Mannes, den er suchte.
Eric Harder.
10
Es war ein lauer Sommerabend. Vera hatte einen ihrer Kollegen zum Grillen eingeladen. Laura würde auch dabei sein, Eric sowieso. Für Lauras Sohn Thomas hatte man schon einen Schlafplatz in Phánuëls Zimmer vorbereitet. Nachdem man die beiden Kleinkinder zu Bett gebracht hatte, sollte die kleine Grillparty starten.
Vera hatte ihren Kollegen Harald bei einem Firmenlauf in Frankfurt näher kennengelernt. Der „David-Goldheimer-Run“ ist eine Laufveranstaltung, bei der Mitarbeiter in Teams von bis zu acht Läufern für ihre jeweilige Firma eine Strecke von bis zu 21,1 Kilometern bewältigen. Der Lauf bringt jährlich bis zu 30.000 laufbereite Firmenangestellte in Bewegung. Auch das „Frankfurt Global Newstime Magazine“ hatte seine Mitarbeiter dazu aufgerufen. Harald Adler gehörte zu den Läufern. Vera lief nicht mit, da ihr Terminplan es nicht zuließ, aber sie koordinierte den Einsatz der Läufer für ihre Zeitung.
In den letzten Wochen hatte Vera Harald mehrmals getroffen, um Trainingstermine während der Arbeitszeit abzusprechen, Firmen-T-Shirts zu verteilen und die Vorbereitung auf den Lauf zu organisieren. Dabei hatten sie auch über ihre jeweiligen Erfahrungen in Mali gesprochen. Als ehemaliger Kriegsreporter hatte Harald auch aus Afrika berichtet. Vera hatte stets den Eindruck, dass es etwas gab, dass Harald sehr beschäftigte, das er aber nicht preisgeben wollte. Da in ihr das Bedürfnis geweckt wurde, ihm zu helfen, hoffte sie nun, dass er bei einem Grillabend gesprächiger sein würde.
Vera wusste kaum etwas über Harald. Inzwischen hatte sie erfahren, dass er Anfang Vierzig war und als ehemaliger Kriegsreporter so etwas wie eine Legende war. Warum er seit ein paar Jahren nicht mehr aus Krisengebieten berichtete, sondern von politischen Großveranstaltungen in Deutschland, war ihr nicht bekannt.