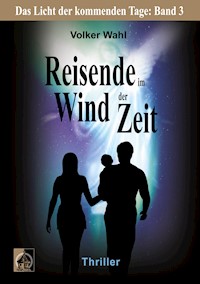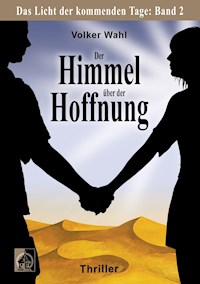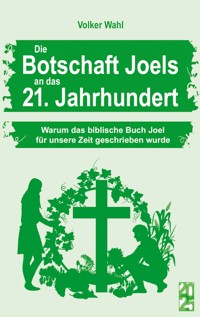
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Botschaft Joels an das 21. Jahrhundert. Warum das biblische Buch Joel für unsere Zeit geschrieben wurde. Kann ein Buch wie die Bibel, das von Jesus berichtet, ernsthaft eine Relevanz für die heutige Zeit haben? Kann das biblische Buch Joel, das vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurde, den Menschen im digitalen Zeitalter helfen, unsere Zeit besser zu verstehen? Lassen Sie sich überraschen, wie eindeutig diese Fragen mit einem klaren JA zu beantworten sind. Entdecken Sie das biblische Buch Joel. Staunen Sie, wie genau es die Probleme unserer Zeit beschreibt und auch deren Lösungen nennt. Die Botschaft des biblischen Propheten Joel und jeder einzelne seiner Verse wird hier konsequent in den biblischen und neuzeitlichen Zusammenhang gebracht. Wer Joels Worte ernst nimmt, darf Hoffnung für die Welt haben, trotz aller Herausforderungen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch:
Kann ein Buch wie die Bibel ernsthaft eine Relevanz für die heutige Zeit haben? Kann das Buch Joel, das vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurde, den Menschen im digitalen Zeitalter helfen, unsere Zeit zu verstehen?
Lassen Sie sich überraschen, wie eindeutig diese Fragen mit einem klaren “JA” zu beantworten sind.
Entdecken Sie das biblische Buch Joel.
Staunen Sie, wie genau es die Probleme unserer Zeit beschreibt und auch deren Lösungen nennt. Die Botschaft des biblischen Propheten Joel und jeder einzelne seiner Verse wird hier konsequent in den biblischen und neuzeitlichen Zusammenhang gebracht. Wer Joels Worte ernst nimmt, darf Hoffnung haben, trotz aller Herausforderungen unserer Zeit.
Über den Autor:
Volker Wahl hat vor vielen Jahrzehnten eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen und arbeitet seitdem in seiner Freizeit in vielen Bereichen des Gemeindelebens mit.
Abkürzungen biblischer Bücher
1. Altes Testament
1Mo 1. Mose (Genesis) 2Mo 2. Mose (Exodus) 3MO 3. Mose (Levitikus) 4Mo 4. Mose (Numeri) 5Mo 5. Mose (Deuteronominum) Jos Josua Ri Richter Rt Rut 1Sam 1. Samuel 2Sam 2. Samuel 1Kö 1. Könige 2Kö 2. Könige 1Chr 1. Chronik 2Chr 2. Chronik Esr Esra Neh Nehemia Est Ester Hi Hiob Ps Psalmen Spr Sprüche Pred Prediger HI Hoheslied Jes Jesaja Jer Jeremia Kla Klagelieder Hes Hesekiel Dan Daniel Hos Hosea Joe Joel Am Amos Ob Obadja Jon Jona Mi Micha Nah Nahum Hab Habakuk zeph Zephanla Hag Haggai Sach Sacharja Mal Maleachi
Elb Elberfelder Bibel Hfa Hoffnung für alle Lut Bibel nach Martin Luther
2.Neues Testament
Mt Matthäus Mk Markus Lk Lukas Joh Johannes Apg Apostelgeschichte Röm Römer 1Kor 1. Korinther 2Kor 2. Korinther Gal Galater Eph Epheser Phil Philipper Kol Kolosser 1Thes 1. Thessalonicher 2Thes 2. Thessalonicher 1Tim 1. Timotheus 2Tim 2. Timotheus Tit Titus Phim Philemon Hebr Hebräer Jak Jakobus 1 Petr 1. Petrus 2Petr 2. Petrus 1Jo 1. Johannes 2Jo 2. Johannes 3Jo 3. Johannes Jud Judas Offb Offenbarung
Die Bibelstellen in diesem Buch werden entweder mit diesen Abkürzungen angegeben oder in voller Länge ausgeschrieben. Die Bibelzitate sind. soweit nicht anders angegeben der Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen entnommen. Weitere verwendete Bibelausgaben sind: Hoffnung für alle Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc. Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Was ist ein Prophet?
JHWH – HERR – Gott
Stellung des Joelbuches
Verszählung im Alten Testament
Der Tag des HERRN
Das erste Kapitel: Die Anfangsverse
Wie eine Heuschreckenplage
Was sollen wir tun?
Der geistliche Aspekt
Die Natur leidet
Das zweite Kapitel des Joelbuches: Die Zeichen häufen sich
Viele Umschreibungen mit dem Wort: „wie“
Der HERR spricht
Wenn Gott eingreift
Gott erstattet die verlorenen Jahre
Das dritte Kapitel: Der Heilige Geist und der Tag Jahwes
Das vierte Kapitel: Das Schicksal der Gerichteten
Weitere Anklagepunkte
Pflugscharen zu Schwertern
Die neue Erde
Was bedeutet das für uns und diese Welt?
Anmerkungen
1. Einführung
„Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt“, hat Jesus im vierten Kapitel des biblischen Lukasevangeliums in einer Synagoge in Nazareth seiner Zuhörerschaft gesagt und wurde dann kurz darauf aus der Stadt hinausgestoßen (Lk 4,21-30). Was hatte die Volksmenge damals derart in Rage versetzt, dass sie einen Prediger, der später von vielen Menschen als Messias anerkannt wurde, mit Gewalt des Ortes verwies?
Jesus hatte sich auf die alten Schriften des Propheten Jesaja bezogen. Dieser Prophet hatte zwischen 740 und 701 v. Chr. im damaligen Südreich Juda gewirkt.1 Das Jesajabuch, als alttestamentlicher Teil der Bibel, besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil (Kapitel 1-39) enthält Gerichtsbotschaften. Im zweiten Teil (Kapitel 40-66) überwiegen der Trost und die Ankündigung der Rettung.2
Es lagen also mehr als 700 Jahre zwischen Jesu Worten und der Niederschrift des prophetischen Textes aus Jesaja 61,1-2: „Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden.“ Mehr als 700 Jahre hatte es gebraucht, damit die Ereignisse geschahen, die der Prophet Jesaja in einer Vision gesehen hatte.
Offenbar lag das, was Jesaja gesehen hatte, so weit in der Zukunft, dass 700 Jahre später kaum jemand mit dem Wahrwerden der Prophezeiung rechnete, oder man die Texte so starr auslegte, dass die Erfüllung durch Jesus nicht in dieses Konzept passte.
Auf jeden Fall konnte Jesaja mit Gottes Hilfe, in seiner Vision, mehrere hundert Jahre in die Zukunft sehen. Im vierten, dritten und zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, zu den Zeiten, als Alexander der Große und danach die Ptolemäer und Seleukiden über Palästina herrschten3, mussten Prophezeiungen von Trost und Rettung völlig absurd wirken. Und auch als Jesus, der Gottessohn und Erlöser, sich auf Jesaja bezog, glaubte ihm erst einmal niemand.
Aber Jesu Predigt in Lukas 4 zeigt, dass Prophetien nicht immer nur an Menschen gerichtet sind, die zur gleichen Zeit wie die Propheten leben, sondern dass durchaus auch mehrere Generationen dazwischen liegen können.
An anderer Stelle wird Jesus gefragt, durch welche Zeichen man die Erfüllung einer Prophetie erkennt. „Lehrer, wann wird denn dies sein, und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll?“, ist die Frage in Lukas 21,7. Jesus antwortet mit einer langen Liste von zukünftigen Geschehnissen und schließt mit: „Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht“. (Vers 28)
Wir sehen, es gibt Zeichen, die uns hinweisen sollen auf das Eintreffen biblischer Prophezeiungen. Und es können durchaus Jahrhunderte zwischen einer Vision und deren Erfüllung liegen.
Bei all der Suche nach Zeichen, die auf biblische Prophezeiungen hinweisen, ist natürlich ein kritisches Hinterfragen wichtig. Der weitaus überwiegende Teil der Geschehnisse, die das private Leben oder die globalen Ereignisse betreffen, sind sicher mit keiner Prophezeiung in Verbindung zu bringen. Beinahe alle Generationen der vergangenen Jahrtausende mussten Katastrophen von nahezu biblischen Ausmaßen erleben, aber letztlich war es niemals das göttliche Endgericht, das Jesus in Lk 21,28 erwähnte.
Immer wieder wurde in den vergangenen zwei Jahrtausenden der „Jüngste Tag“ angekündigt. Meist mit Hinweisen auf biblische Prophezeiungen, manchmal sogar mit raffinierten Berechnungen, wie es der Prediger William Miller gemacht hatte.4 Ausgehend von der Frage eines Engels im achten Kapitel des biblischen Danielbuches „Wie lange wird es verboten sein, jeden Tag zu opfern?“, deutete er die 2300 Abende und Morgen in der Antwort so, dass „ein Tag für ein Jahr gilt“. Mithilfe weiterer Berechnungen kam er auf den 22. Oktober 1844 als Datum der Wiederkunft Jesu. Jedoch hat sich das nachweislich als falsch herausgestellt.
Man sieht, dass beinahe alle Versuche, die biblischen Vorhersagen richtig zu deuten, mit Fehlschlägen verbunden waren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich in der heutigen Zeit kaum ein ernstzunehmender Prediger wagt, prophetische Bibeltexte mit aktuellen Ereignissen in Verbindung zu bringen. Solche Deutungen überlässt man gerne Sekten und religiösen Sonderlingen, denn die Chance, dass der Ausleger mit seiner Interpretation einer Prophetie richtig liegt, ist astronomisch gering.
Sollte man deshalb prinzipiell darauf verzichten, die Visionen der biblischen Propheten mit der heutigen Zeit in Verbindung zu bringen? Das wäre sicher übertrieben, denn Jesus hat ja in Lukas 21 eine Vielzahl von Zeichen genannt, die wir erkennen sollen und erklärt: „So blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht“. (Vers 28)
Und Petrus, einer der Jünger Jesu, zitiert ebenfalls einen alttestamentlichen Propheten in einer Predigt, anlässlich einer heilsgeschichtlichen Schlüsselsituation, nämlich des Pfingstereignisses. Der Prophet Joel hat die Ausgießung des Heiligen Geistes angekündigt, was sich nach Jesu Tod und Auferstehung auch unter den Jüngern erfüllt hat. Somit zeigte sich, dass auch Joel Visionen von zukünftigen Ereignissen hatte. Doch Joels Botschaft ist nicht nur auf das Pfingstereignis im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt beschränkt. Joel spricht von den „letzten Tagen“ und vom „Tag des HERRN“.
Wenn uns Jesus auffordert, wachsam auf die Zeichen der Zeit zu schauen und wir darauf vertrauen dürfen, dass Propheten wie Joel schon vor vielen Jahrhunderten zukünftige Ereignisse von Gott gezeigt bekamen, dann lohnt sich eine Gegenüberstellung der biblischen Texte mit aktuellen Geschehnissen.
Dazu möchte Sie dieses Buch einladen.
Nach einigen einleitenden Kapiteln wird der Text des Joelbuches chronologisch erarbeitet und ausgelegt. Dabei steigen wir Vers für Vers tiefer in die Botschaft Gottes ein, die uns Joel hinterlassen hat. Das Prinzip, uns versweise mit dem Text auseinanderzusetzen, mag den Anschein erregen, die Verse würden unabhängig voneinander ausgelegt. Das ist allerdings nicht der Fall.
Die Joelprophetie wird in diesem Buch als eine einheitliche, zusammenhängende Botschaft verstanden. Als Grundlage für die Auslegung eines einzigen Verses, ohne Berücksichtigung des restlichen Joelbuches ist dieses Buch ausdrücklich nicht gedacht, denn für das tiefere Verständnis eines einzelnen Verses sollte man auch die Informationen zu den vorangegangenen Versen gelesen haben.
So wie das Joelbuch in seiner Gesamtheit zu den Menschen der heutigen Zeit sprechen will, so soll auch dieses Buch als Ganzes dabei helfen, die Botschaft im Kontext unserer Gegenwart zu verstehen.
Lassen Sie sich überraschen, wie konkret Joel in diese Zeit und auch zu Ihnen spricht.
2. Was ist ein Prophet?
Eine sehr knappe Beschreibung, was einen Propheten ausmacht, findet man auf wissen.de.5 Dort wird ein Prophet beschrieben als „Empfänger einer göttlichen Offenbarung durch Gesichte (Vision) oder Hören (Audition) und Künder des Gotteswillens oder des Verborgenen und des Zukünftigen. Verschiedentlich bildeten die Propheten einen eigenen Stand (ursprünglich im Alten Testament; als Priester im römischen Isis- und Serapiskult). Besondere Bedeutung haben die großen Prophetengestalten im Alten Testament als Empfänger, Verkünder und Vollstrecker des Wortes Gottes, besonders von Gericht und Verheißung (Moses, Elias, Elisa), seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. (Amos) auch durch Prophetenbücher überliefert. Im Neuen Testament Johannes der Täufer und besonders Jesus als Erfüllung und Vollstrecker der Prophetie des Alten Testaments.“
Die primäre Aufgabe eines Propheten war also die Verkündigung des Gotteswillens, unabhängig, ob sich dies nun auf die Gegenwart oder die Zukunft bezog. Allerdings erfüllten sich biblische Prophetien oftmals erst in der Zukunft. Joels Ankündigung des Heiligen Geistes traf offensichtlich erst mehrere Jahrhunderte nach der Niederschrift ein.
Das antike Israel war androzentrisch. Das heißt, trotz mancher Ausnahmen wurden alle übergeordneten öffentlichen Ämter (z.B. Rechtsprechung) sowie repräsentative Aufgaben in Familie und Gesellschaft von Männern ausgeführt.6 Jedoch war die Position einer Prophetin auch für Frauen zugängig. Biblische Beispiele dafür im Alten Testament sind7: Mirjam (2Mo 15,20), Debora (Ri 4,4), Hulda (2Kö 22,14), Noadja (Neh 6,14), die Frau des Propheten Jesaja (Jes 8,3).
Die Ankündigung eines Propheten muss nicht zwangsläufig immer eintreffen, da Gott mit seinen Ankündigungen stets auch eine Wirkung hervorrufen will. Ein recht bekanntes Beispiel dafür ist die Geschichte von Jona, der verkündigen sollte: „Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört.“ (Jona 3,4) Doch dann kam es anders: „Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht.“ (Jona 3,10) Jona wusste schon im Vorhinein, dass Gott souverän ist und deshalb seine Entscheidung revidieren kann, wenn die Botschaft des Propheten (Verkünders) seine Wirkung gezeigt hat. Im Fall von Jona, die Reue der Menschen, ihr Glaube an Gott, ihr Fasten, ...!
Über Jesus berichtet das Neue Testament an mehreren Stellen, dass er im Laufe seines Wirkens auch als Prophet anerkannt wurde: Mt 21,11; Mt 21,46; Lk 7,16; Lk 24,19; Joh 4,19.
Zu den Zeiten des Alten Testaments gehörten Propheten wohl zu so etwas wie einer „Berufsgruppe.8 Erwähnt werden diese Gruppen als „Prophetenjünger“, „Prophetenschüler“, „Söhne der Propheten“ oder mit weiteren Bezeichnungen. Einige Beispiele dafür sind: 1Kö 20,35; 2Kö 2,3; 2Kö 6,1. Dennoch war die Fähigkeit der Prophetie eine Gabe Gottes und keine erlernte Fertigkeit.
3. JHWH – HERR – Gott
Laut einer Umfrage zufolge besitzt jeder Zweite in Deutschland eine Bibel. Wie aus einer vom Meinungsforschungsinstitut Insa beim Christlichen Medienkongress in Schwäbisch Gmünd 2018 präsentierten Studie hervorgeht, gaben nur sechs Prozent der Bevölkerung an, regelmäßig in der Bibel zu lesen.9
Noch geringer ist wahrscheinlich der Anteil der Menschen, die den Text der Einführung in ihre persönliche Bibel gelesen und verstanden haben. Weil auch sonst der Anteil der Gottesdienstbesucher und Predigthörer rückläufig ist, bleibt vielen Menschen, die sich Christen nennen, unbekannt weshalb das Wort „HERR“ in aktuellen Bibeln häufig in Großbuchstaben geschrieben wird.
Sehr selten findet man Bibelausgaben, in denen an der Stelle von „HERR“ das Tetragramm „JHWH“ steht. In der Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas steht stattdessen „Jehova“. In der „Jerusalemer Bibel“ aus dem Verlag Herder KG (Freiburg im Breisgau 1968) entdeckt man hier den Gottesnamen „Jahwe“, wie er in unserer Zeit für am wahrscheinlichsten gehalten wird. Und jüdische Übertragungen ins Deutsche benutzen statt „JHWH“ auch die entsprechenden hebräischen Buchstaben oder die Umschreibung „der Ewige“.
Es gibt also viele Versuche, dem Gottesnamen würdig zu begegnen.
Im Text des Joelbuches werden wir wiederholt vom „Tag des HERRN“ lesen. Dieser Tag ist offensichtlich von zentraler Bedeutung. Da dürfte es nicht unwesentlich sein, zu wissen, warum je nach Glaubensverständnis „JHWH“, „HERR“, „Jehova“, „Jahwe“ oder eine andere Darstellung des Gottesnamens genutzt wird.
Der Name „Jahwe“, wie ihn die „Jerusalemer Bibel“ verwendet, ist die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rekonstruierte Aussprache des hebräischen (JHWH). 10 .
Im 2. Buch Mose, auch Exodus genannt, wird im dritten Kapitel von der Gottesbegegnung Mose am brennenden Dornbusch berichtet. Dort erklärt Gott in Vers 15: „So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist meine Benennung von Generation zu Generation.“ In Vers 14 gibt Gott praktisch eine Übersetzung des Namens „Jahwe“ als: „Ich bin, der ich sein werde“ bzw. „Ich bin, der ich bin“.
Die ursprüngliche Aussprache des Gottesnamens ist aber noch nicht vollständig geklärt11. Aufgrund der vier Konsonanten JHWH wird er auch Tetragramm (griech. „Vier-Buchstaben“) genannt. Aus Ehrfurcht vor der Heiligkeit dieses Namens (siehe 2Mo 20,7) wurde seine Aussprache im Judentum schon relativ früh gemieden, und so hat man statt des Gottesnamens ’ădônāj „(mein) Herr“ gelesen. In der jüdischen Übersetzung des Alten Testaments ins Deutsche, aus dem Jahr 1954, durch Naftali Herz Tur-Sinai kann man in der Online-Version12 wählen, ob man sich den Gottesnamen als oder als „der Ewige“ anzeigen lässt.
Im Mittelalter vervollständigte man JHWH fälschlicherweise zu „Jehowah“ bzw. „Jehovah“. Erasmus gibt später den Gottesnamen mit „Jehova“ wieder, weil er diese Lesart für ursprünglich hält. Luther aber folgte der jüdischen Tradition und gab das Tetragramm mit „(der) HERR“ wieder, was zur protestantischen Haupttradition wurde. Heute wird die Namensform Jehova noch bei den „Zeugen Jehovas“ in deren Bibelübersetzungen verwendet.
Wenn wir im Neuen Testament „Herr“ (nur der erste Buchstabe ist ein Großbuchstabe) lesen, ist damit meist zwar Gott, aber nicht der Gottesname gemeint. Der Begriff „Herr“ deutet ein Machtverhältnis an, bei dem sich die Menschen gegenüber Gott häufig als „Diener“ oder „Knechte“ sehen, ein Verhältnis zwischen einem Machthaber und seinem Untertanen.13
In der Bibel ist „HERR“ also nicht gleich „Herr“. Dafür meint aber „HERR“ dasselbe wie „JHWH“ oder „Jahwe“, den Gottesnamen.
4. Stellung des Joelbuches
Das Buch des Propheten Joel ist im Judentum ein Teil des sogenannten Zwölfprophetenbuchs14. Es umfasst die Schriften der Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja und Maleachi, die im Christentum „Kleine Propheten“ genannt werden. Als ältester Beleg für die Existenz einer Zwölfprophetenbuch-Rolle gilt der Hinweis in dem apokryphen Bibelteil Jesus Sirach 49,10. Man kann davon ausgehen, dass die Schriften der 12 „kleinen“ Propheten damals als eine zusammengehörige Schriftrolle gesehen wurde.
Bei der Zusammenstellung der Einzelschriften gestaltete man eine höhere Einheit, in der die Geschichte der Prophetensendungen Gottes an sein Volk repräsentativ zur Geltung kommen sollte. Aufgrund inhaltlicher Hinweise lässt sich klar erkennen, dass die Schriften, die sich einfach datieren lassen, chronologisch in ihrer geschichtlichen Folge stehen.
Die Prophetenreihe beginnt deshalb mit Hosea. Dann folgt Amos, der laut der Überschrift (Am 1,1) gleichzeitig mit Hosea aufgetreten ist, aber sich in Am 7,9 gegen Jerobeam II. (782-747 v. Chr.) wendet. Micha kann man eindeutig nach Amos einordnen. Genauso eindeutig ist es bei Zefanja. Haggais und Sacharjas Auftritte datiert man in die persische Zeit. Die nicht datierten Schriften, wie das Buch Joel, wurden wohl auf Grund thematischer Verwandtschaft zwischen den datierten Schriften eingeordnet.
Als der hebräisch-aramäische Text im hellenistischen Judentum in die altgriechische Alltagssprache, die Koine, übersetzt wurde, entschied man sich für eine andere Reihenfolge mancher Texte des Tanach (mehr dazu im Kapitel: Verszählung im Alten Testament). Dabei entstand die Septuaginta15 (Abkürzung LXX), auch griechisches Altes Testament genannt. Sie ist die älteste durchgehende Übersetzung des Alten Testaments in die Koine. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 v. Chr., vorwiegend in Alexandria. Ein Großteil der Bücher der LXX war bis etwa 100 v. Chr. übersetzt, die restlichen Übersetzungen folgten bis 100 n. Chr.
Die Christen der ersten Jahrhunderte nutzten überwiegend die Septuaginta. Während sie in der griechisch-orthodoxen Kirche bis heute benutzt wird16, basiert heute in der katholischen Kirche die Bibel auf der hebräischen Fassung. Auch der Reformator Martin Luther nutzte die hebräischen Schriften für seine Übersetzung der Bibel ins Deutsche.
Während in der Masora (deutsch ‚Überlieferung‘), dem Zweig der jüdischen Tradition des ersten Jahrtausends, der sich mit der Sicherung des hebräischen Bibeltextes befasst, das Buch Joel zwischen den Propheten Hosea und Amos angeordnet ist (und damit auch in den katholischen und evangelischen Bibeln diesen Platz hat), befindet sich das Buch Joel in den Bibeln, die auf der Septuaginta basieren (z.B. in der griechisch-orthodoxen Kirche) nach Hosea und Amos, zwischen Micha und Obadja.17
Der Inhalt des Buches wird von den meisten Interpreten wiedergegeben, als hätte er keine Relevanz für die heutige Zeit: Anlässlich einer Dürre- und Heuschreckenplage wird zur Hinwendung an JHWH aufgerufen, mit Fasten und Klagen. (1,1-2,17) Die Heuschreckenplage gilt dabei als Zeichen des kommenden Tages JHWHs (des HERRN). Darauf erfolgt JHWHs Ankündigung, die Not zu wenden (2,18-27). Kapitel 3 wird dann im Christentum als Voraussage der Ausgießung des Geistes Gottes über alle Menschen, die nach ihm suchen, verstanden. Kapitel 4 kündigt an, dass der Tag JHWHs kommt und das Weltgericht vollzogen wird. Das Gericht Gottes wird Heil über diejenigen bringen, die zu Gott umkehren, Verderben dagegen vor allem über die ungläubigen Völker. Die Feinde werden endgültig besiegt. Hier findet man auch die Umkehrung des bekannten Satzes aus Micha 4,3 („Schwerter zu Pflugscharen“). In Joel 4,10 erklärt JHWH: „Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Spießen!“
Inhaltsangaben wie diese suggerieren, dass die Prophezeiungen Joels mit dem Pfingstereignis zur Zeit der Apostel erfüllt seien. Dürre- und Heuschreckenplagen hat es schon zur Zeit Joels gegeben. Aufrufe zum Fasten und Klagen ebenfalls.
Dass es aber Ereignisse im 21. Jahrhundert gibt, die im Buch Joel erstaunlich genau beschrieben werden, und die erst in dieser Zeit möglich sind, werden wir hier in den nächsten Kapiteln erarbeiten.
5. Verszählung im Alten Testament
Das Alte Testament (und damit auch das Buch des Propheten Joel) besteht aus den Schriften des jüdischen Tanach, die aber vom Christentum in einer anderen Anordnung übernommen wurden.18
Tanach oder Tenach (hebräisch TNK) ist eine von mehreren Bezeichnungen für die Sammlung heiliger Schriften des Judentums, der Hebräischen Bibel. Der Tanach besteht aus drei Teilen: Tora (Weisung), Nevi’im (Propheten) und Ketuvim (Schriften). TNK ist das Akronym der Anfangsbestandteile dieser Worte. Die Konsonanten Taw, Nun und Kaph werden vokalisiert zu Tanakh/Tenakh bzw. Tanach/Tenach.
Die Einteilung in Verse wurde für den Tanach bereits durch die Masoreten19 (8.–10. Jahrhundert) schriftlich fixiert. Für das Neue Testament geht die heutige Verseinteilung auf den französischen Theologen und Verleger Robert Estienne (genannt Stephanus) zurück.20 Im Jahre 1551 nummerierte er in seinen Bibelausgaben den Text durchgängig nach Kapiteln und Versen. Als Kapiteleinteilung übernahm Estienne die des Engländers Stephen Langton. Im Jahre 1553 veröffentlichte Estienne eine französische Bibel, die die erste vollständige Bibel mit der heute noch aktuellen Bibelverseinteilung war.
Obwohl heutzutage die meisten Versangaben einen Bibelvers eindeutig bezeichnen, gibt es trotzdem in einigen Fällen Abweichungen, je nach Kultur und Tradition.
Meist betreffen die Abweichungen das Alte Testament. Die protestantischen Übersetzungen mit lutherischer oder reformierter Tradition wie z.B. in Deutschland sowie die moderne katholische Ausgabe, stimmen in der Kapitel- und Verseinteilung mit dem masoretischen Text überein. Damit haben die gängigsten deutschen Übersetzungen dieselbe Einteilung.
Übersetzungen, die nicht auf den masoretischen Texten basieren, sondern z.B. auf der Vulgata oder der Septuaginta, können eine leicht veränderte Verseinteilung haben. Das betrifft meist die Psalmen oder einzelne Verse des Alten Testaments.
Bei Übersetzungen auf Basis der Vulgata bildet das ganze Kapitel Joel 3 das Ende von Kapitel 2. Damit hat das Joelbuch bei gleicher Verszahl nur drei Kapitel. In Bibeln, die auf dem masoretischen Text basieren (also die allermeisten Bibeln in Deutschland) haben bei gleicher Verszahl vier Kapitel. Ein direkter Vergleich: Kapitel 2 hat in der King-James-Übersetzung 32 Verse und in der Elberfelder Übersetzung 27 Verse. Joel 3,5 lautet in der King-James-Bibel21: „because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things:“ In der Elberfelder Bibel steht nach masoretischer Verseinteilung ein ganz anderer Vers: „Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der HERR gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der HERR berufen wird.“
Glücklicherweise hat man sich im deutschen Sprachraum im 21. Jahrhundert weitestgehend bei Übersetzungen auf das masoretische Verssystem geeinigt, so dass es äußerst unwahrscheinlich ist, bei Versangaben nicht den Vers zu finden, den der Schreiber gemeint hat.
6. Der Tag des HERRN
Wenn wir im nächsten Kapitel damit beginnen, den Text des Joelbuches zu erarbeiten, werden wir gleich im ersten Kapitel mit dem „Tag des HERRN“ konfrontiert. Dieser Begriff weckt in jedem Leser, je nach Vorwissen oder Weltbild, andere Gedankenverknüpfungen. Manche verbinden damit den „Tag des jüngsten Gerichts“. Für andere ist es der „Tag der Wiederkunft Christi“. Die „Apokalypse“ spielt in vielen Filmen oder Büchern der Popkultur eine Rolle und wird oft mit dem „Tag des HERRN“ gleichgesetzt.
Aber was ist gemeint, wenn wir im Joelbuch, und auch an anderen Stellen im Alten Testament vom „Tag des HERRN“ bzw. „Tag JHWHs“ lesen?
In den prophetischen Visionen vom „Tag JHWHs“ (jôm jhwh), drückt sich die Hoffnung aus, dass Gott seine Widersacher besiegt, seine Gläubigen aber rettet und damit einer göttlichen Gerechtigkeit zum Durchbruch verhilft.22
Die eindrücklichsten Erfahrungen der frühen Israeliten mit dem Gott JHWH waren solche der Rettung vor überlegenen Feinden: vor den Ägyptern am Schilfmeer (2Mo 14f.), vor den Kanaanitern bei Gibeon (Jos 10) und am Bach Kischon (Ri 4f.). Überwältigende Befreiungserfahrungen der Frühzeit wie diese prägten Israels Gottesbild auch in den kommenden Generationen. Offenbar waren es vor allem Propheten, die in Krisensituationen die Fähigkeit und Bereitschaft JHWHs beschworen, seinem bedrängten Volk zu Hilfe zu kommen. Dazu gehören auch namentlich nicht genannte Propheten in den Aramäerkriegen des 9. vorchristlichen Jahrhunderts (1Kö 20; 2Kö 6f.) oder eine prophetische Stimme im ausgehenden 7. vorchristlichen Jahrhundert, dem „assyrischen Jahrhundert“ oder eine Reihe weiterer Propheten. Dabei bekommt der „Tag JHWHs“ zunehmend etwas Universales.
Aber der „Tag JHWHs“ ist nicht nur ein heilvoller Tag. In der hebräischen Bibel gibt es Texte, die ihn gerade als Unheilstag beschreiben. Der Erste, der diese irritierend neue Sicht entwickelte, war möglicherweise Amos: In seiner Vision wird der „jôm jhwh“ nicht „Licht“, sondern „Finsternis“ sein, wird höchstens scheinbar und vorübergehend Rettung bringen, letztlich aber Unheil und Tod. (Am 5,18-20) Der Grund dieser Verkehrung liegt darin, dass Israel seinen Gott derart erzürnt hat, dass das Gericht auch über dieses Volk kommen wird. Davon handelt das Buch Amos von der ersten bis beinahe zur letzten Zeile.
Auch weitere Propheten der Bibel berichten entweder von einem Tag des Heils oder einem Tag des Gerichts, oft auch von beiden Ereignissen. Ausgeprägt entwickelt das Joelbuch eine doppelte Perspektive auf den „Tag JHWHs“: einerseits als Unheils-, andererseits als Heilstag. Gleich zu Anfang erscheint eine Heuschreckenplage (Joel 1,4) als Einbruch des „großen und überaus furchtbaren Tages JHWHs“.
Das Bild der gefräßigen, in Wellen einfallenden Tiere wird die damalige Bevölkerung an die feindlichen Heere erinnert haben, wie Juda sie, bis hin zum traurigen Höhepunkt der Zerstörung Jerusalems 586 v. Chr., immer wieder erlebt hatte. Im zweiten Teil der Joelprophetie aber wechselt die Aussage. Dort wird zunächst verheißen, JHWH werde über Alte und Junge, Hohe und Niedere seinen Geist ausgießen (Jo 3,1f.). Auf diese Weise wird das Volk der Gläubigen gewappnet sein für das Kommen des „großen und furchtbaren Tages JHWHs“, der sich schon in Blut, Feuer, Rauch und Sonnenfinsternis ankündigt.