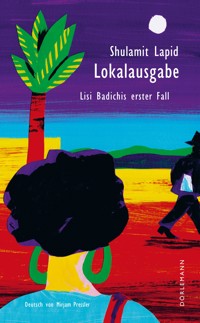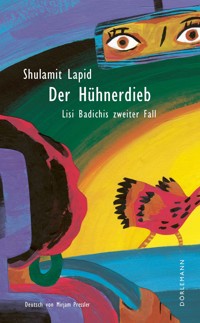
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Lisi Badichi nach der Beerdigung ihres Bekannten, Awner Rosen, nach Hause kommt, hätte sie mit allem gerechnet. Nur nicht damit, dass er quicklebendig auf ihrem Sofa sitzt.Der Polizeiinspektor ist einer internationalen Verbrecherbande auf der Spur und will ihr nun inkognito das Handwerk legen. Es geht um Schmuggel, Mord und Kunstraub – Lisi wittert einen grandiosen Knüller für ihre Lokalzeitung. Sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Und muss bald feststellen, dass sie ihre Nase zu tief in tödliche Angelegenheiten gesteckt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Shulamit Lapid
Der Hühnerdieb
Lisi Badichis zweiter Fall
Kriminalroman
Aus dem Hebräischen vonMirjam Pressler
DÖRLEMANN
Die hebräische Originalausgabe »Pitayon«erschien 1991 bei Keter Books, Jerusalem. Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © by Shulamit Lapid Published by arrangement with the Institute for the Translation of Hebrew Literature © 2023 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Illustration von Irène Schoch Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-903-4www.doerlemann.ch
Inhalt
Kapitel 1
Der Hühnerdieb
Als Lisi Badichi loszog, um über die Beerdigung von Polizeiinspektor Awner »Rosi« Rosen und seiner Freundin Tami Simon zu berichten, wäre ihr im Traum nicht eingefallen, dass der Tote bei ihrer Rückkehr in ihrer Wohnung sitzen würde.
Der Doppelmord an Rosen und Simon war zweifellos das aufregendste Ereignis in Be’er Schewa, seit Birnzweig in das Loch gefallen war, das sich plötzlich auf dem neuen Markt gegenüber dem Lottokiosk aufgetan hatte, und nach drei Tagen leblos herausgezogen wurde. Zum ersten Mal, seit Lisi bei der Zeit im Süden angefangen hatte, bestand eine vollkommene Übereinstimmung zwischen Gedalja Arieli, ihrem Redakteur, und Polizeiinspektor Ben-Zion Koresch, ihrem Schwager: Beide waren interessiert an einer ausführlichen Berichterstattung über die Beerdigung.
»Ausgerechnet am Dienstag«, hatte Arieli geschimpft, als sei Lisi diejenige, die die Termine der Morde und der Beerdigungen in Be’er Schewa bestimmte. »Schicken Sie achthundert Wörter, ich reserviere Ihnen vier Spalten. Ich möchte eine Weitwinkelaufnahme vom Tatort und Porträtfotos der Ermordeten oder das Foto einer Familienfeier, auf dem sie gemeinsam zu sehen sind. Außerdem alles über den Polizisten und seine Geliebte. Sprechen Sie mit der Polizei, den Verwandten, den Nachbarn.« Arieli hatte den Hörer aufgeknallt, und auch Lisi hatte, wie meistens nach einem Telefongespräch mit Arieli, den Hörer mit einem Karateschlag auf seinen Platz befördert. Zehn Jahre war sie nun schon »unsere Reporterin« der Zeit im Süden, und jeder einzelne Bericht, den sie im Lauf dieser Jahre geschickt hatte, war kontrolliert worden. Und obwohl es nie einen Vorwurf wegen übler Nachrede oder eine Beschwerde gegen sie gegeben hatte und sie einige echte Knüller sowohl für die überregionale als auch für die lokale Ausgabe gelandet hatte, reichte das alles nicht, um die Tatsache in Arielis Kopf zu hämmern, dass Lisi Badichi eine professionelle Reporterin war.
»Du sprichst mit dir selbst«, hatte Dorit gesagt, die Fotografin.
»Arieli«, hatte Lisi geantwortet und einen unterdrückten Seufzer ausgestoßen.
»Irgendwann wirst du das Telefon kaputtmachen.«
»Er will Weitwinkelaufnahmen vom Tatort und Porträtfotos von den Ermordeten.«
»Und wo liegt das Problem?«
»Es gibt keins.«
Meinte er denn, dass sie ohne seinen Anruf etwa nicht mit den Nachbarn, den Verwandten und der Polizei gesprochen hätte? Und wie wäre es gewesen, wenn er Auf Wiedersehen gesagt hätte? Wann sagte er ihr jemals Auf Wiedersehen? Wenn er sie entlassen würde, dann würde er Auf Wiedersehen sagen. Sie musste froh sein, dass er sie nicht beschimpft hatte.
Es hatte den Anschein, als würden alle Einwohner Be’er Schewas an der Beerdigung teilnehmen. Seit der Einweihung des Negev-Einkaufszentrums hatte man nicht mehr so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Die Trauerreden wurden vom Polizeipräsidenten gehalten, vom Bürgermeister und vom Rabbiner von Be’er Schewa, der vom »feigen Stolz der Söhne des Bösen« sprach. Lisi beschloss, dass dies die Überschrift ihres Artikels in der Lokalausgabe werden sollte, doch dann fiel ihr ein, dass der Rabbiner genau dieselbe Formulierung bereits beim Gebet für die Soldaten benutzt hatte, die gegen Saddam Hussein und seine Armee kämpften. Der Polizeipräsident versprach, dass der lange Arm der Polizei die niederträchtigen Mörder fassen würde. Angesichts der großen Menschenmenge wurde der Bürgermeister von einem poetischen Geist ergriffen und sagte, die Ehre eines Menschen werde nicht von seiner Stellung bestimmt, sondern der Mensch sei es, der seiner Stellung Ehre verleihe. Und Gott möge die Familien Rosen und Simon trösten.
Alle bei der Beerdigung Anwesenden wussten, dass die teuren Verschiedenen nicht miteinander verheiratet gewesen waren, und alle spürten, dass die Trauerreden so formuliert waren, dass man sich an die beiden als Paar und zugleich als einzelne Personen erinnerte. Umso mehr, als die geschiedene Ehefrau des Polizeiinspektors Awner Rosen, schwarz gekleidet, unter den Trauergästen stand und es schaffte, genau in dem Moment ohnmächtig in die Arme ihrer Freundinnen zu sinken, als ein paar Kameras auf sie gerichtet waren.
Erregtes Murmeln begleitete die Trauerreden, Neugier, die befriedigt werden wollte – das gleiche Gemurmel, das man bei Premieren hörte, bei Festkonzerten oder unter den Schaulustigen eines Bankraubs. Nur unter Einsatz ihrer Ellbogen gelang es Dorit und Lisi, bis zum Grab vorzudringen.
Dorit Dahan war die Tochter des Leiters der Zeit im Süden und arbeitete seit einem Jahr für die Zeitung, seit ihrer Entlassung aus dem Militärdienst. Damals, bei ihrem Eintritt, hatte Lisi sie für ein gelangweiltes Mädchen gehalten, das sich nach Nervenkitzel und Rampenlicht sehnte, doch schon nach kurzer Zeit musste sie feststellen, dass sie den gleichen Vorurteilen zum Opfer gefallen war, die andere ihr gegenüber hegten.
Ihre Zeit bei der Armeezeitung hatte Dorit auf ihre neue Arbeit vorbereitet. Sie stand der Zeitung zu jeder Tages- und Nachtstunde zur Verfügung, schleppte die schwere Fotoausrüstung und zögerte auch nicht, nach Gaza oder Refiach zu fahren, wenn ihr Auftrag das verlangte, oder fremde Fotografen und Fernsehfilmer zur Seite zu stoßen, wenn diese ihr im Weg standen. Dorit vergeudete keine Energie mit unnützem Reden und ließ sich nicht von öffentlichen Größen beeindrucken. Mitleid, Ängste und Ehrfurcht waren ihr fremd. Die Welt zeigte sich ihr nur durch die Linse ihres Fotoapparats.
Lisi kannte Dorit seit deren zwölftem Lebensjahr. Anfangs war es ihr schwergefallen, in diesem schönen Mädchen mit den großen stahlblauen Augen und den kurzgeschorenen blonden Haaren eine Kollegin zu sehen. Bis zu ihrem Eintritt hatte die Zeitung freie Fotografen beschäftigt. Dann hatte sich Dahan an Arieli gewandt und ihn gebeten, seine Tochter für ein Probejahr einzustellen; falls sich erweise, dass sie professionell arbeite, bitte er darum, sie fest anzustellen. Arieli war einverstanden, und Lisi fragte sich verwundert, wie Dahan denn nun in Zukunft seine gelegentlichen kleinen Romanzen handhaben wollte, ohne dass Dorit etwas mitbekam. Ihre Verwunderung hielt aber nur zwei Monate an. Als Dahan hörte, dass Dorit nach Gaza fahren wollte, um dort zwei Repräsentanten der Krisenkommission zu fotografieren, die sich zu einem Interview mit Lisi bereit erklärt hatten, protestierte er lautstark. Als Dorit ihm auch noch mitteilte, dass sie vorhabe, sich eine Wohnung in der Nähe der Redaktion zu mieten, brüllte Dahan: »Nur über meine Leiche!« Doch da erinnerte Dorit ihn an ein gewisses russisches Model und an eine Kosmetikerin. Dahan gab nach und übernahm auch noch die Miete für die Wohnung.
»Du bist dafür verantwortlich, dass ihr nichts passiert«, sagte er drohend zu Lisi.
»Habe ich sie etwa eingestellt? Das warst doch du. Du hast doch gewusst, was mit der Arbeit einer Pressefotografin verbunden ist.«
»Du hast ihr von Tatjana und von Jeannette erzählt.«
»Ich habe ihr gar nichts erzählt. Sie hat doch Augen und Ohren im Kopf.«
Auch Dahan wusste, dass seine Vorwürfe lächerlich waren. In den zehn Jahren, die er mit Lisi arbeitete, hatte sie nie mit irgendjemandem über die Frauen gesprochen, die er gelegentlich in das eine oder andere Hotel der Stadt abschleppte, im Austausch gegen eine verbilligte Anzeige oder eine Reportage, die redaktionell nicht zu rechtfertigen war.
Dorit wurde zu Lisis Bundesgenossin. Lisi wusste, dass Dorit zu jeder Tageszeit zu jedem Auftrag bereit war. Sie würde mit ihrem Motorrad kommen, die Fotoausrüstung in Lisis Auto werfen, »Wohin?« fragen und einen nicht mit überflüssigen Fragen bestürmen. Gemeinsam kamen sie dann auch zur Lokalredaktion zurück. Lisi setzte sich hin und schrieb ihre soundso vielen Wörter, und Dorit ging in die Dunkelkammer und entwickelte ihre Fotos. Manchmal arbeiteten sie bis Mitternacht, und wenn es erforderlich war, standen sie nach zwei, drei Stunden Schlaf wieder auf, um den nächsten Auftrag zu erledigen. Nachdem das einige Male passiert war, begann Dorit, Lisi nachzuahmen – zum Beispiel den Kopf unter kaltes Wasser zu halten, um wach zu werden –, doch im Gegensatz zu Lisi, die sich danach immer die Lippen mit einem fetten roten Stift anmalte und sich riesige Plastikohrringe an die Ohren hängte, kam Dorit mit nassen Haaren an, und auf ihrem kleinen, blassen Gesicht waren noch immer die Abdrücke ihres Kopfkissens zu erkennen. Sie hatte einen knabenhaften Körper, war fast so groß wie Lisi, und ihren Nacken schmückte ein dünner Zopf, der wie ein vergessener Rest aus ihrem fast kahl geschorenen Kopf wuchs. Zum Kummer ihrer Eltern trug sie sommers wie winters T-Shirts, und auch die jungen Männer, die von Zeit zu Zeit bei ihr wohnten, trugen zu diesem Kummer bei. Lisi hingegen fragte sich nur, wer sie waren, wie sie sich wohl vergnügten und wann Dorit dafür Zeit hatte. Dorit war zehn Jahre jünger als sie und litt nicht unter den Hemmungen dem anderen Geschlecht gegenüber, unter denen Lisi gelitten hatte. Ihre Verwunderung darüber behielt Lisi für sich. Von Anfang an war ihre Beziehung auf die Arbeit beschränkt.
»Fotografiere das Publikum«, sagte Lisi zu Dorit, als sie auf dem Friedhof ankamen, »nicht nur die Familienmitglieder.«
»Ein Panorama der ganzen Beerdigung?«
»So viele Leute wie möglich. Vom Parkplatz bis zum Grab. Kannst du alle Trauergäste fotografieren?«
»Schwierig. Sie stehen in einem Kreis. Irgendwas Spezielles?«
»Nein.«
»Ich kann eine Runde drehen und sie von allen Seiten aufnehmen.«
»In Ordnung.«
Lisi überlegte, was sie ihr sagen würde, wenn Dorit merkte, dass sie gar nicht vorhatte, die Bilder zu verwenden.
***
»Lisi, mein Schatz«, hatte ihr Schwager Benzi ins Telefon geflötet, wobei er fast an seiner eigenen Freundlichkeit erstickte. »Kannst du einen Moment bei mir vorbeikommen?«
»Nein, ich fahre zur Beerdigung von Awner Rosen und Tami Simon.«
»Ich auch. Ich nehme dich mit.«
»Benzi! Sag schon, was du willst.«
»Das ist nicht so einfach. Komm vorbei.«
***
»Hallo, Lisi. Was machst du hier?«, fragte ihre Tante Malka, die Protokollschreiberin der Polizeistation.
»Benzi will mich sprechen.«
»Er ist zur Beerdigung gefahren.«
»Er ist nicht zur Beerdigung gefahren. Er hat mich vor zehn Minuten angerufen und herbestellt.«
Der verwunderte Ausdruck auf Malkas Gesicht erstaunte Lisi, denn normalerweise passierte in der Polizeistation nichts, was ihrer Tante entging.
»Fährst du mit Dahans Tochter zur Beerdigung?«, fragte Benzi.
»Guten Tag, Benzi, wie geht es dir?«
»Lisi!«
»Ja, Benzi. Ich fahre mit Dahans Tochter zur Beerdigung. Sie heißt Dorit.«
»Bitte sie, so viele Leute wie möglich zu fotografieren. Wenn möglich, alle.«
»Arieli will Porträts der Ermordeten und ein Foto vom Tatort. Warum lässt du den Rest nicht den Polizeifotografen machen?«
»Bitte, Lisi.«
»Warum?«
»Es soll keiner merken, dass die Polizei interessiert ist.«
»Es geht um den Mord an einem Polizisten! Natürlich ist die Polizei da interessiert! Um was für eine Geschichte geht es, Benzi, Schätzchen?«
»Um gar keine.«
»Keine Geschichte, keine Fotos.«
»Lisi!«
»Schrei mich nicht an. Ich bin nicht Georgette, und auch keine von deinen Verhafteten.«
»Es kann sein, dass jemand, der mit dem Mord zu tun hat, an der Beerdigung teilnimmt.«
»Hast du jemanden im Verdacht?«
»Weiß nicht. Kann sein, dass jemand dort ist, der eigentlich nicht hingehört, und uns dadurch etwas verrät.«
»Es ist nur natürlich, dass die Polizei die Beerdigung eines ermordeten Polizisten fotografiert. Ich verstehe nicht, wofür du mich da brauchst?«
»Lisi, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen zum Friedhof.«
»Und warum hast du mir das nicht am Telefon gesagt? Du hättest uns beiden Zeit erspart. Sogar Tante Malka hat nicht gewusst, dass du mich herbestellt hast. Was kochst du aus, Benzi?«
»Versuche nicht, klug zu sein. Das passt nicht zu dir.«
»Ich bin nicht deine Angestellte, und ich schulde dir gar nichts, Benzi, Schätzchen.«
Lisi wandte sich zum Gehen. »Wandte« war das richtige Wort, denn Ben-Zion Koreschs Büro war so klein, dass man, um hinauszukommen, sich nur umdrehen und die Tür öffnen musste. Die Enge des Zimmers und die donnernde Stimme Inspektor Koreschs hatten schon viele Verdächtige zusammenbrechen lassen; Leute, die unter Klaustrophobie litten, waren bereit, Verbrechen zu gestehen, die sie nicht begangen hatten, nachdem sie eine halbe Stunde in Koreschs Betonwürfel zugebracht hatten.
»Dann werde ich eben Beni Adolam darum bitten.«
Lisi hielt inne und dachte blitzschnell nach. Inspektor Ben-Zion Koresch wollte nicht, dass irgendjemand von seinem Interesse an Fotos von der Beerdigung erfuhr; noch nicht mal bei der Polizei sollten sie es wissen. Er hatte sich an sie gewandt, weil sie seine Schwägerin war, weil er sie kannte und wusste, dass er sich auf sie verlassen konnte. Seine Drohung, sich an Beni Adolam zu wenden, ihren Konkurrenten von der Post im Süden, war nichts anderes als ein billiger Trick, aber Benzi wusste, dass Lisi sich nicht der Gefahr aussetzen würde, er könnte seine Drohung wahr machen, auch wenn die Gefahr ihrer Meinung nach gleich null war.
»Was soll ich Dorit sagen?«
»Wird sie Fragen stellen?«
»Sie muss jeden einzelnen Film abrechnen, den sie verbraucht.«
»Sag ihr einfach, du hättest Arieli nicht genau verstanden, und ich gebe euch neue Filme als Ersatz.«
»Willst du, dass sie die Filme entwickelt?«
»Ja.«
»Dann musst du auch für das Entwickeln bezahlen.«
»Selbstverständlich. Seit wann bist du so geschäftstüchtig? Du bringst den guten Ruf der Presse in Gefahr.«
»Hat sie denn einen?«
Benzi lachte, und Lisi fuhr fort: »Ich will die Geschichte, Benzi.«
»Welche Geschichte?«
»Du kriegst die Filme erst, wenn du mir versprichst, dass ich die Geschichte exklusiv bekomme.«
»Los, fahren wir zu der verdammten Beerdigung.«
»Versprich es.«
»Wenn wir die Identität des Mörders oder der Mörderin feststellen, wirst du die Erste sein, der ich es erzähle.«
»Dafür hast du mich in aller Heimlichkeit hierherbestellt? Das hättest du mir auch am Telefon sagen können. Malka hat überhaupt nicht gewusst, dass du noch da bist.«
»Sag doch, du wärst gekommen, um Einzelheiten über den Doppelmord zu erfahren, ich hätte dir aber noch nichts sagen können.«
»Dein Zimmer stinkt, Benzi, Schätzchen.«
Auf Benzis Lippen erschien eine Art verlegenes Lächeln. Sie betrachtete ihn und fragte sich, was wohl im Busch war. Schon seit Jahren trieben sie nun ihr Nimm-und-gib-Spiel, begleitet von Beleidigungen, Erpressungen und den kleinen Witzen von Soldaten, die schon lange gemeinsam im selben Dreck hocken und gelernt haben, sich gegenseitig zu mögen und zu achten. Gelegentlich passte Lisi, wenn sie einen Abend frei hatte, auf die Kinder von Benzi und ihrer Schwester auf, und an Feiertagen saßen sie gemeinsam am Familientisch, um den sich auch Lisis Schwester Chawazelet und deren Mann Ilan »Sergio« Bachut drängten, der zugleich Benzis rechte Hand bei der Arbeit war.
»Vertraust du mir, Lisi?«
»Klar, so wie ich einer Kobra vertrauen würde.«
»Glaubst du, dass ich ein anständiger und verantwortungsbewusster Polizist bin?«
»Ist jemand anderer Meinung?«
»Antworte.«
»Ja, Benzi, ich glaube, dass du ein anständiger und verantwortungsbewusster Polizist bist.«
»Dann vergiss das bitte nicht.«
»Was ist passiert?«
»Ich brauche dich, Lisi.«
»Mach dir keine Sorgen, ich bin keine Tratschtante.«
»Das weiß ich.«
Lisi erwischte Dorit, noch bevor diese sich auf den Weg zum Friedhof machte, und bat sie, doch Reservefilme mitzunehmen. Sie war wütend auf sich, und sie war wütend auf Benzi. Er hatte es geschafft, dass sie machte, was er wollte, ohne dass er ihr irgendetwas verraten hatte.
***
Schajke Simon, der Vater der Ermordeten, saß auf einer Steinbank. Er trug einen Militärregenmantel und einen Hut, eine dunkle Sonnenbrille schützte seine Augen. Sein Sohn Oded, ein junger Mann von vielleicht sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahren, saß neben ihm, auf dem Kopf eine schwarze Kippa. Um sie herum befand sich eine Gruppe von Leuten, die aussah wie die Veteranen einer ausgewählten Militäreinheit, die man zu einem verschwiegenen Auftrag hervorgeholt hatte. Auf der Bank gegenüber saßen die beiden Schwestern des Ermordeten und eine Verwandte, die das Kopftuch tief in die Stirn gezogen hatte, sodass es bis zu ihrer Sonnenbrille reichte. Die Frauen waren umgeben von Polizistinnen. Zwischen diesen beiden Lagern standen der Bürgermeister, der Polizeipräsident, zwei Abgeordnete der Knesset, die im Süden des Landes lebten, ein paar beduinische Würdenträger, die aussahen wie Palmach-Veteranen, sowie einige Palmach-Veteranen, die aussahen wie beduinische Würdenträger, ansonsten noch ein paar Müßiggänger und Spinner. Aus Tel Aviv waren der Teilhaber der Verstorbenen gekommen, Menasche Melachi, sowie zwei Boutiquenbesitzerinnen und der Inhaber eines bekannten Pubs, was der Trauerversammlung etwas Kosmopolitisches verlieh. Zwischen den sommerlich gekleideten Neugierigen und den winterlich gekleideten Neugierigen befanden sich Polizisten – viele, viele Polizisten. Erwartung lag in der Luft; man nahm an einem wichtigen Ereignis teil, und jeder, der nicht daran teilnahm, war nichts anderes als vom Sturm des Lebens verwehte Spreu.
Schajke Simon mochte etwa fünfundfünfzig Jahre alt sein, groß, stark, misstrauisch und still. Als er noch bei der Armee diente, kursierte der Witz über ihn, er klebe sich sogar Schalldämpfer an die Schuhsohlen. Er war als Kind nach Be’er Schewa gekommen, mit seinen Eltern, war hier in die Schule gegangen und dann zur Armee, wo er den Rang eines Oberstleutnants erreichte. Sein Stern begann zu sinken in den Tagen vor dem Sechstagekrieg, als er im Gegensatz zu den Amerikanern behauptete, die Bewegungen der ägyptischen Streitmächte dienten nicht nur der Verteidigung, und man müsse die Alarmbereitschaft der Ägypter ernst nehmen. Levi Eschkol, damals Regierungschef und Sicherheitsminister, beschloss, den jungen Mann kommen zu lassen und sich anzuhören, was er zu sagen hatte, oder, wie er es formulierte: »Ich wil di jingele ojßhern.« Das Gespräch fand unter vier Augen statt und führte zu zwei Ergebnissen. Eschkol schickte seinen Außenminister Abba Ebben zu Präsident Lyndon B. Johnson und bestätigte einen Monat später Simons Verbannung zur Militärverwaltung in Ramalla. Simon, ein sehr verschlossener Mensch, tat treu seinen Dienst, machte aber aus seinem Herzen keine Mördergrube. Auf seine Bitte hin wurde er zum Studium geschickt (Betriebswirtschaft und Statistik) und nach Abschluss seines Studiums nach Frankreich, als Mitglied einer diplomatischen Vertretung, die sich um den Ankauf von Waffen kümmern sollte.
Das Pariser Leben verdrehte seiner Frau Bilha, einer lauten, stürmischen Blondine, den Kopf. Sie war das genaue Gegenteil von Schajke, sie liebte Einladungen und Tanzen und genoss es, fotografiert zu werden. Sie verliebte sich in einen griechischen Attaché und verließ seinetwegen ihren Mann und die Kinder. Zu ihren Gunsten muss man sagen, dass es ihr trotz ihres Temperaments gelang, ihre Liebschaft geheim zu halten. Im Sicherheitsministerium war man entsetzt, als nach Beendigung seiner Dienstzeit Simons Frau mit ihrem Liebhaber nach Athen fuhr. Niemand vergoss eine Träne, als Schajke Simon nach seiner Rückkehr seine Entlassung aus der Armee beantragte.
Monatelang trieb er sich tatenlos herum, ließ die übliche Abkühlungszeit vorbeigehen und machte nach einem Jahr das, was viele gute Leute vor ihm getan hatten: Er benutzte die Verbindungen, die er während seiner Zeit beim Militär und im diplomatischen Dienst geknüpft hatte, und gründete in Be’er Schewa die Firma Schesek. Die Firma vertrat, wie man hörte, ausländische Waffenhersteller und vermittelte Kontakte mit den entsprechenden Betrieben in Israel. Das Büro befand sich in Simons Haus und wurde von seinem Sohn Oded geführt. Das Haus stand allein auf einer Anhöhe und wurde von einem in den fünfziger Jahren gepflanzten Hain Jerusalemer Kiefern vor fremden Blicken geschützt. Ein hoher Eisenzaun umgab den Hain, und ein verrostetes, quietschendes Gittertor versperrte den Zutritt zum Gelände. Vom Tor zum Haus führte ein schmaler Asphaltweg, und auf diesem Weg stand der Peugeot 504, in dem Schajke Simons Tochter Tami und ihr Freund, Inspektor Awner Rosen, am Dienstag, dem 22. Januar 1991, ermordet worden waren.
Die wenigen Freunde Awner Rosens wussten, dass er sich vor ungefähr fünfzehn Jahren von seiner Frau hatte scheiden lassen, ein Jahr nach der Hochzeit, aber es ist zweifelhaft, ob sie wussten, dass er Tami Simons Liebhaber war. Diese Tatsache sprach sich erst nach seinem Tod herum. Es waren nicht so viele, die Awner gut gekannt hatten, und selbst diese fühlten, dass sie von ihm nur das wussten, was er selbst preisgegeben hatte. Die Polizisten, die mit ihm gearbeitet hatten, sagten, er sei zu schlau gewesen, zu unabhängig und dickköpfig, und sie hätten immer gewusst, dass es schlecht mit ihm ausgehen würde. Er hatte es geschafft, sich bei Untergebenen und Vorgesetzten verhasst zu machen, indem er sich weigerte, Tatsachen zu akzeptieren, und auch weiterrecherchierte, wenn Fälle offiziell abgeschlossen waren. Grundsätzlich hasste er Verbrecher nicht. »Sie machen ihre Arbeit, ich mache die meine«, hatte er oft gesagt. Er behauptete, sie seien weder klug noch wagemutig, und alles, was man tun müsse, um sie zu schnappen, sei, ihnen genug Zeit zu geben. Die einzigen Verbrecher, mit denen er nichts zu tun haben wollte, waren jene, denen Grausamkeit Vergnügen bereitete. Nachdem er einmal einen kleinen Gauner fast totgeschlagen hätte, der die Besitzer des Mikado, des Geschenkladens am Zentralen Busbahnhof misshandelt hatte, zog er es vor, seinen Kollegen die Behandlung der Gauner zu überlassen, denen Grausamkeiten gegen Alte, Frauen oder Kinder zur Last gelegt wurden. Er bevorzugte komplizierte Fälle, die seine kleinen grauen Zellen forderten, obwohl er Teamarbeit und Beinarbeit nicht ablehnte, wenn es die Situation gebot.
In den letzten zwei, drei Jahren hatte er sich viel in Tel Aviv aufgehalten, wo er eine Wohnung besaß, und dort hatte er vermutlich Tami Simon kennengelernt, die mit antiken Möbeln handelte. Nachträglich erklärten die wenigen Bekannten Rosis diese Beziehung für befremdlich, ja sogar für fatal. Rosi war vierzig Jahre alt, weder groß noch klein, weder schön noch hässlich, ein Mensch, der in der Menge nicht weiter auffiel. Wegen seiner Kurzsichtigkeit trug er eine Brille mit dicken Gläsern, hinter denen er die Augen leicht zusammenkniff, um besser sehen zu können. Auf dem linken Ohr hatte er noch während seiner Armeezeit das Gehör verloren, als sein Jeep auf eine Mine gefahren war. Hinter seinem Rücken wurde gewitzelt, er sei der einzige blinde und taube Detektiv der Welt. Trotzdem konnte man feststellen, dass er ziemlich gut aussah, wenn er, was nur alle Jubeljahre vorkam, ein gebügeltes Hemd trug oder seinen Kopf einem Friseur anvertraut hatte. Sein immer braungebranntes Gesicht und die leicht ergrauenden Haare verliehen ihm das Aussehen eines Dörflers, der zu Besuch in der Stadt weilte.
Rosi war in Kfar Ja’akow geboren und aufgewachsen, dort hatte er noch immer – außer zwei Schwestern, Chassia und Ziona – Orangenplantagen und Grundbesitz, was ihn von seinem Gehalt als Polizist vollkommen unabhängig machte. Er trank nicht und rauchte wenig, und selbst wer länger als ein, zwei Wochen mit ihm gearbeitet hatte, erinnerte sich nicht an irgendwelche Frauengeschichten. Das Einzige, was ihn interessierte, war, Verbrechen aufzuklären und Verbrecher dingfest zu machen.
Tami Simon hingegen war etwa dreißig Jahre alt, hatte von ihrer Mutter einen gutgebauten Körper geerbt, blonde Haare und ein schönes Gesicht. Im Gegensatz zu ihrer Mutter war Tami gelassen und vernünftig, was allerdings nicht half, sie vor Klatschkolumnisten zu schützen. Diese berichteten über ihre Verehrer, ihre Sammlung an Kleidern, ihre Einkäufe in Paris, über ihre Stippvisiten in Athen, die Skiurlaube in der Schweiz. Nach den örtlichen Begriffen war Tami Simon dem geheimnisvollen Etwas am nächsten, was man »vornehme Dame« nennen könnte. Niemand wusste, wann und wie sie Rosi kennenlernte und was sie an ihm gefunden hatte. All ihren Bekannten war klar, dass er sich bei den gesellschaftlichen Anlässen, zu denen sie ihn ab und zu mitschleppte, langweilte, und in den letzten Monaten hatten sie sich in der Öffentlichkeit immer weniger sehen lassen. In den Klatschspalten erschienen von Zeit zu Zeit blumige Artikel, in denen einer am Leben der Jeunesse dorée von Be’er Schewa interessierten Leserschaft erzählt wurde, die »Schönheit des Südens« habe sich verliebt, und ihre Heirat stehe kurz bevor, denn endlich habe sie einen Mann nach ihrem Herzen gefunden. In diesen Berichten schwang ein Hauch von Enttäuschung mit. Nach allen investierten Hoffnungen hätten sich die Redakteure der Gesellschaftsspalten ein besseres Ergebnis erwartet. Tami Simon war schön, klug und reich. Sie hatte ihre Kindheit in Paris verbracht, und vor ihrer Einberufung zum Militärdienst lebte sie fast ein Jahr bei ihrer Mutter in Athen. Jeder, der mit ihr in Berührung kam, wusste, dass Tami Simon den Unterschied zwischen dem französischen Empire und dem deutschen Biedermeier schon mit der Muttermilch eingesogen hatte. Ein solches Mädchen erwartete sich doch zweifellos die Heirat mit einem Vermögen in der dritten Generation und einem Hin- und Herjetten zwischen New York und Be’er Schewa. Und dann – Rosi? Den Gerüchten zufolge waren auch ihr Vater und ihr Bruder nicht gerade glücklich mit dem von ihr ausgewählten Mann, doch sie hatten längst aufgehört, sich in Tamis Leben einzumischen, denn schließlich war sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau, verfügte über ein gutes Einkommen und – war dreißig Jahre alt.
Als der Golfkrieg ausbrach und SCUD-Raketen die Stadt Tel Aviv bedrohten, kehrte Tami in das Haus auf dem Hügel zurück. Ihr Vater hatte den Grundsatz der Nichteinmischung fallen gelassen und sie angefleht, nach Be’er Schewa zu kommen, bis der Sturm vorüber sei. Seit Jahren hatte Tami nicht mehr mit ihrem Vater und ihrem Bruder unter einem Dach gelebt, und der Vater nutzte die Gelegenheit und tat alles in seiner Macht Stehende, sie und Rosi zu trennen und das verlorene Schaf nach Hause zurückzubringen. Er behauptete, wie viele andere auch, es sei sinnlos, sich in Tel Aviv den Gefahren auszusetzen, wenn man damit ohnehin niemandem nutze. In Tel Aviv ging um fünf Uhr das Licht aus, und alle krochen, von Angst verfolgt, in ihre gegen Giftgas abgedichteten Zimmer, Geschäfte waren keine zu machen, die Vergnügungsstätten waren geschlossen – was hatte sie dort noch verloren? So viele Familien zogen südwärts, um Schutz vor den SCUD-Raketen zu finden, warum sollte sie das nicht auch tun, wo ihr doch ein eigenes Haus und alle Bequemlichkeiten der Welt zur Verfügung standen? Tag für Tag packte Tami ihre Reisetasche, um nach Tel Aviv zurückzukehren, und Tag für Tag redete ihr Vater so lange auf sie ein, bis sie ihre Tasche wieder auspackte.
Das Haus auf dem Hügel war gebaut wie ein Bienenstock; es bestand aus vier Wohneinheiten, die um ein großes gemeinsames Wohnzimmer lagen. Die Büroräume der Firma befanden sich im ersten Stock des Hauses. Tamis Flügel war, wie die anderen, sozusagen eine abgetrennte Wohnung, hatte einen eigenen Eingang, ein Wohn- und ein Schlafzimmer plus Badezimmer und Toilette. Außer ihrem Vater und ihrem Bruder lebten auf dem Hügel noch Riwka, die Köchin, und Na’omi, das Hausmädchen, zwei unverheiratete Schwestern in den Fünfzigern.
Tami fuhr morgens zu ihrem Laden in Jaffa und kam abends, vor Sonnenuntergang, nach Be’er Schewa zurück. Wenn auch Rosi nach Tel Aviv fuhr, nahmen sie seinen Peugeot. So war es auch an dem Tag, an dem sie ermordet wurden. Tami rief ihren Vater an und teilte ihm mit, sie würden etwas später kommen, sie hätten vor, in Aschkelon zu essen, im Escopia.
Man nahm an, dass sie genau um halb neun auf dem Hügel ankamen, in dem Moment, als im ganzen Land die Warnsirenen ertönten. Tami stieg aus dem Auto, um das Tor zu öffnen, und da schoss jemand zwischen den Bäumen heraus auf sie. Sie war sofort tot. Dann schoss der Unbekannte auf Rosi, der am Steuer saß. Die Kugel durchdrang das Glas und traf Rosi in die Schläfe. In dieser Sekunde oder in den Sekunden zwischen dem Schuss auf Tami und den auf Rosi musste es diesem noch gelungen sein, seinen Revolver zu ziehen und auf den Mörder zu schießen, doch er verfehlte ihn, vermutlich wegen seiner Verwundung und der Dunkelheit. Mit einem weiteren Schuss in Rosis Gesicht tötete ihn der Mörder. Zu diesem Zeitpunkt saßen Schajke, sein Sohn Oded, Riwka und Na’omi mit aufgesetzten Gasmasken im abgedichteten Sicherheitsraum und lauschten dem Radio. Die Entwarnung kam um zehn nach neun, und die Bewohner des Hauses verließen den Sicherheitsraum. Es wurde immer später, und Tami und Rosi waren noch nicht zurück. Schajke setzte sich ans Telefon und begann, nach seiner Tochter zu suchen. Er rief im Escopia an, versuchte es in Rosis Wohnung in Tel Aviv, in Tamis Wohnung in Tel Aviv, dann telefonierte er auch mit Krankenhäusern und der Polizei. Oded, von Unruhe ergriffen, beschloss, mit dem Auto zur Straße Be’er Schewa-Aschkelon zu fahren, vielleicht würde er ja herausfinden, was mit seiner Schwester passiert war. Neben dem Tor entdeckte er den Peugeot und die Leichen von Tami und Rosi. Es war halb elf Uhr abends. Man nahm an, dass die beiden zwischen halb neun und zehn nach neun ermordet worden waren. Wären die Schüsse davor oder danach gefallen, hätte man sie im Haus bestimmt gehört. Im Haus selbst wurden keine Spuren eines Einbruchs gefunden. Tami und Rosi hatten vielleicht den oder die Einbrecher überrascht, bevor es ihnen gelungen war, ins Haus einzudringen.
***
Lisi wusste, dass sie die Familienmitglieder um Fotos der Ermordeten bitten musste. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich in einer solchen Situation befand, doch sie hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt. Sie sah den Zorn und den Abscheu in den Augen der armen Angehörigen, an die sie sich wandte, und sie fand ihn berechtigt. Aber ihr blieb keine Wahl. »Arbeit ist Arbeit«, sagte sie sich, als sie zu Rosis Schwestern trat, sich vorstellte und um ein Foto des Verstorbenen bat. Beide saßen sie da, mit blassen Gesichtern und trockenen Augen, und von ihren Köpfen hingen seidene Tücher bis über ihre Schultern.
»Oh!«, seufzte Chassia, als sie das Wort »Verstorbener« hörte, während Ziona, als habe sie nur auf ein Zeichen gewartet, zu weinen begann. »Er war so ein Lausbub«, stieß sie zwischen einem Schluchzer und dem nächsten aus. »Es wird schlecht mit dir enden, hat unser Vater immer wieder gesagt, als er noch klein war. Wer hätte geglaubt, dass er Polizist werden würde? Als er acht war, hat er aus den Hühnerställen des Dorfes Hühner geklaut.« Sie weinte laut. »Niemand hat je herausgefunden, wer der Hühnerdieb war. Bis unser Vater plötzlich Gackern aus unserem Waffenversteck hörte. In unserem Haus gab es noch ein Waffenversteck, ein Überbleibsel aus der englischen Mandatszeit. Er hat Rosi mit dem Gürtel verhauen. Hätte er gewusst, was dem Jungen passieren würde, hätte er ihn nicht so geschlagen …« Nun brach auch Chassia in Weinen aus. »Ein Glück, dass Mama und Papa das nicht mehr erleben müssen«, sagte sie. Sie wischte sich mit dem Kopftuch die Tränen ab und holte aus ihrer Handtasche ein kleines Foto von Rosi. Lisi notierte auf der Rückseite des Fotos Chassias Namen und die Adresse und versprach, das Bild baldmöglichst zurückzugeben, während sie daran dachte, dass es ihr nie im Leben einfallen würde, in ihrer Handtasche das Foto von einer ihrer Schwestern mitzuschleppen.
Bei der Familie Simon hatte sie weniger Glück. Tamis Bruder sah aus, als wollte er sie verprügeln, während er sagte: »Weg mit Ihnen, Sie Abschaum!«
»Ich finde bestimmt ein Foto von ihr im Archiv«, tröstete Dorit.
»Fotografiere weiter«, antwortete Lisi.
Die Leute machten bekümmerte Gesichter und hörten auf zu tuscheln, wenn sie das Klicken des Fotoapparats in ihrer Nähe hörten. Alle kannten Lisi, und wenn einer die hochgewachsene junge Frau, die ihre großen Füße wie ein müder Seehund vorwärts bewegte – mit halb geschlossenen Augen, sodass es aussah, als schlafe sie im nächsten Moment mitten im Gehen ein – nicht gleich erkannte, dann wusste er spätestens, wer sie war, wenn er Dorit gesehen hatte, die neben ihr ging und ununterbrochen fotografierte.
»Was ist mit der Lasagne, die du mir versprochen hast?«, flüsterte Beni Adolam Dorit zu und pustete gegen den dünnen Zopf in ihrem Nacken.
»Verpiss dich.«
Ganz gegen seine Gewohnheit gehorchte Adolam und verpisste sich.
»Was hat er denn?«, murmelte Dorit, das Auge am Objektiv.
»Er hat vergessen, einen Fotografen mitzunehmen, jetzt läuft er zum Telefon.«
Beide verzogen die Lippen und unterdrückten ein Lachen. Die Konkurrenz zwischen der Zeit im Süden und der Post im Süden hatte groteske Formen angenommen, seit Dorit angefangen hatte, mit Lisi zu arbeiten. Die Tatsache, dass die Zeit eine feste Fotografin hatte, während die Post weiterhin freie Fotografen beschäftigte, war ein weiterer Beweis für Lisi Badichis Überlegenheit gegenüber Beni Adolam. Den Bewohnern von Be’er Schewa konnte es nicht entgehen, dass Lisi sozusagen ein Team hatte, eine Armee, während Beni weiterhin ein Einzelkämpfer war, gezwungen, sich für sein Überleben abzurackern, ohne Rückendeckung durch die Redaktion einer überregionalen Zeitung.
Eine Stimme über Lautsprecher verkündete, der Trauerzug des Verstorbenen Awner, Sohn des Efrajim-Fischl, würde jetzt beginnen, und Lisi und Dorit gingen schnell hinüber zur Aufbahrungshalle.
»Manchmal hasse ich meine Arbeit«, meinte Dorit.
»Ich auch«, sagte Lisi.
Die Leiche unter dem schwarzen Tuch sah klein und mager aus. Ein achtjähriger Hühnerdieb, dachte Lisi, der jetzt in die Ewigkeit eingegangen ist.
***
Als Lisi und Dorit zum Gebäude der Zeit im Süden zurückkehrten, war das Eisengitter vor dem Eingang zur Redaktion abgesperrt, ebenso der Eingang zur Druckerei von Prosper Parpar im ersten Stock des Gebäudes. Ihre Schritte hallten auf dem Asphalt im leeren Hof, und der Mann, der den Hinterhof des Supermarkts sauberspritzte, schaute neugierig zu ihnen herüber, erstaunt, dass jetzt am Abend, da die ganze Stadt in die abgedichteten Sicherheitsräume eilte, noch jemand außer ihm arbeitete. Er sah aus wie ein Neueinwanderer aus Russland, und Lisi nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit einen Bericht über die neuen »Holzhacker und Wasserträger« der Gesellschaft zu schreiben.
Bis Mitternacht hatte Lisi ihren Bericht fertig, fünfhundert Wörter für die Redaktion der überregionalen Zeit und tausend Wörter für die Zeit im Süden. Sie hätte gern die Überschrift »Kebsweib auf dem Hügel« gewählt, doch sie fürchtete, Oded Simon würde sie umbringen. Deshalb begnügte sie sich mit der harmlosen Formulierung »Der Doppelmord im Nobelviertel Omer«.
»Kann ich die restlichen Fotos morgen entwickeln?«, fragte Dorit.
»Ja«, antwortete Lisi und wagte nicht, Dorit zu sagen, dass alle von ihr entwickelten Fotos nie die Zeitungsredaktion erreichen würden.
Die Straßen waren dunkel, und kein Mensch war zu sehen, als die beiden die Redaktion verließen. Müde und schweigend gingen sie zum Parkplatz neben dem Gebäude hinüber. Dort hatte Lisi vor einer Ewigkeit ihren alten Justy geparkt, Dorit ihr kleines Motorrad. Lisi spannte die Schultern und atmete tief die kühle, trockene Luft ein, während ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten.
»Zum Teufel!«, zischte Dorit plötzlich.
»Was ist los?«
»Ich habe vergessen, dass ein Freund bei mir zu Hause ist.«
»Die Sorgen der Reichen«, murmelte Lisi, und beide lächelten im Dunkeln. »Alles, was ich jetzt möchte, ist eine Tasse Kakao und ein warmes Bett.«
Lisi betrat ihre Wohnung, machte das Licht im Flur an, ging ins Zimmer und wollte gerade ihre Tasche auf das Sofa schleudern, als sie entdeckte, dass dort ein fremder Mann lag. Sie hatte das Gefühl, alles Blut ströme aus ihrem Körper. Ihr Mund öffnete sich zu einem Schrei, als der Mann sagte: »Ihr Kühlschrank ist leer.« Seine Stimme war ruhig und sachlich. Awner Rosen sah sehr lebendig aus.
Kapitel 2
Die letzte Gelegenheit
Lisi legte zwei Brotlaibe in den Wagen, ein Päckchen Butter, vier Packungen Hüttenkäse, eine Dose Oliven, vier Päckchen Suppe, zwei Packungen Nudeln, eine Dose Ketchup, eingemachte Pfirsiche, Rasierseife und Rasierwasser. Dann ging sie zum Gemüsestand hinüber und fragte sich, während sie ihre Einkaufsliste studierte, wie sie es schaffen würde, das alles nach Hause zu schleppen.
»Er fängt an, was?«, fragte Albert, der Kassierer, verständnisvoll.
»Wer?«
»Der Bodenangriff.«
»Was?«
»Nun, nun, ich habe nichts gesagt«, sagte er und zwinkerte ihr zu.
Plötzlich kapierte sie, dass er vom Krieg sprach. Sie lachte. »Nein, nein, meine Wohnung ist ratzekahl leer, und meine Mutter will mich heute besuchen.« Sie merkte selbst, wie unglaubwürdig ihre Worte klangen.
»Ich lasse Ihnen die Sachen bringen.«
»Nicht nötig. Ich bin mit dem Auto da.«
»Dann lassen Sie sich wenigstens helfen, die Sachen ins Auto zu bringen.«
»In Ordnung.«
Rosi hatte sie davor gewarnt, die Lebensmittel durch einen Boten liefern zu lassen, und ihr empfohlen, das Auto zu nehmen, aber er hatte ihr nicht verboten, sich beim Einladen helfen zu lassen. Rosi warnte, Rosi wies an, Rosi sprach Verbote aus. »Kaum zu glauben, was mir da passiert«, murrte Lisi in sich hinein. Da lag ein Toter auf ihrem Sofa, und das Erste, was er zu sagen hatte, war nicht: »Schreien Sie nicht!« oder: »Benzi Koresch hat mich zu Ihnen geschickt«, sondern: »Ihr Kühlschrank ist leer.« Dass sie in diesem Moment nicht vom Schlag getroffen wurde, war wirklich ein Beweis ihrer Kraft und Stärke.
Sie hatte in der Tür gestanden, die Tasche noch immer in der Hand, und kein Wort herausgebracht. Erst dann fing sie an zu zittern. Ein Glück, dass er nicht auf sie zukam. Hätte er das getan, sie hätte ihn geschlagen.
»Setzen Sie sich doch, ich bringe Ihnen ein Glas Wasser«, sagte er.
Sie ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen, während er in die Küche ging. Er hielt ihr ein Glas Wasser hin und versuchte es ihr einzuflößen, als er sah, wie heftig ihre Hände zitterten. Energische Hände mit gebräunter Haut und langen, kräftigen Fingern. Es gelang ihr, etwas auszustoßen wie »Geh weg!«, doch wirklich verständliche Worte wurden es nicht. Er ging zurück zum Sofa, fläzte sich hin und beobachtete sie. Dieses Sofa war nun nicht gerade ein Prachtstück, aber es gehörte ihr, und die Selbstverständlichkeit, mit der er es mit Beschlag belegte, ärgerte sie. Als sie wieder bei Kräften war, sagte sie: »Nehmen Sie die Schuhe vom Sofa.«
Das schien ihn aus irgendeinem Grund zu amüsieren. Sie betrachtete ihn, bis er sich wieder beruhigt hatte.
»Hat Benzi Koresch mit Ihnen gesprochen?«, fragte er, nachdem er sich die Lachtränen aus den Augen gewischt hatte.
»Worüber?«
»Wissen Sie, wer ich bin?«
»Sie sind Awner Rosen, Gott hab ihn selig.«
»Hat Benzi Ihnen nicht gesagt, dass ich hier sein würde?«
»Nein. Das hat Benzi mir nicht gesagt. Er hat mich gebeten, alle Trauergäste bei Ihrer Beerdigung fotografieren zu lassen. Und er hat gesagt, er sei ein anständiger Polizist, ich solle ihm vertrauen. Ich habe überhaupt nicht kapiert, um was es ihm ging.«
»Glauben Sie, dass er ein anständiger Polizist ist?«
»Ja.«
»Und Sie vertrauen ihm?«
»Hören Sie, es ist halb ein Uhr nachts. Ich weiß nicht, was für Spielchen ihr spielt, Sie und Benzi. Ich habe keine Ahnung, wie Sie in meine Wohnung gekommen sind, aber ich weiß, dass es sich um unbefugtes Eindringen handelt. Ich schlage vor, Sie erklären mir das alles morgen früh, und jetzt verschwinden Sie! Ich muss morgen arbeiten, und ich bin hundemüde.«
»Gehen Sie ruhig ins Bett. Ich schlafe hier, auf dem Sofa. Morgen früh reden wir weiter.«
»Was soll das heißen, Sie schlafen hier auf dem Sofa?«
»Benzi und ich haben uns überlegt, wo ich mich verstecken könnte und zugleich einen Verbindungsmann hätte. Benzi hat Ihre Wohnung vorgeschlagen, und Sie sollen mein Verbindungsmann sein.«
»Wie nett von ihm!«
»Ich halte das auch für eine gute Idee.«
»Sie müssen sich also verstecken?«
»Ja.«
»Vor der Polizei?«
»Auch.«
»Die Mafia?«
»Was für eine Mafia?«
»Hören Sie, Herr Rosen …«
»Nennen Sie mich Rosi. Alle sagen Rosi zu mir.«
»Ich bin müde. Ich möchte schlafen. Verschwinden Sie von hier.«
»Ich kann nicht.«
»Wen hat man heute begraben?«
»Ich weiß es nicht.«
»Weiß es Benzi?«
»Nein.«
»Weiß es irgendjemand?«
»Auch das weiß ich nicht.«
Er sah nicht aus, als hätte er vor wegzugehen. Er sah aus wie ein unrasierter Mann in einem zu großen, blau-weiß gestreiften Hemd, der sich sehr wohl auf ihrem Sofa fühlte. Über dem Stuhl lag ein khakifarbener Anorak. Lisi war zu müde für weitere Diskussionen. Sie beschloss, schlafen zu gehen. Morgen früh, wenn sie ausgeschlafen war, würde sie sich bestimmt besser konzentrieren können. Schließlich sah es so aus, als würde dieser Mann auch morgen noch hier sein. Immerhin ist der Verstorbene ein Polizist, dachte sie.
Lisi holte ein Laken aus dem Schlafzimmer, dazu ein Kissen und eine Militärdecke, die sie im Schrank fand, und legte alles auf das Sofa. Seit Kriegsbeginn schlief sie im Jogginganzug, mit warmen Wollstrümpfen an den Füßen. Sie war darauf gefasst, falls eine Rakete ihr Haus träfe und es dem Erdboden gleichmachte, von Soldaten und Sanitätern aus den Trümmern gerettet zu werden. Aber nicht in einem ihrer Flanellpyjamas.
Sie duschte und kochte sich dann eine Tasse Kakao.
»Sie hätten mir ruhig auch eine machen können«, sagte er, als sie in ihrem lila Jogginganzug von der Küche zum Schlafzimmer ging.
»Machen Sie sich selbst eine.«
Awner Rosen lachte wieder.
»Finden Sie mich zum Lachen?«, fragte sie mit vor Wut funkelnden Augen.
»Ja.«
»Darf ich wissen, warum?«
»Gute Nacht, Lisi. Wir reden morgen weiter.«
Am liebsten hätte sie ihm den heißen Kakao ins Gesicht geschüttet. Doch sie beherrschte sich, drehte ihm den Rücken zu und ging in ihr Schlafzimmer. Im Bett liegend trank sie ganz langsam ihren Kakao und fühlte dabei in allen Knochen die Anwesenheit des Mannes im anderen Zimmer. Sie hörte keine Schritte, nur wie die Tür geschlossen wurde. Sie hörte Wasser laufen, und eine stöhnende Sprungfeder verriet ihr zu jeder Zeit, wo er sich befand. Es war das erste Mal, dass ein fremder Mann bei ihr schlief, und sie wusste, sie würde nicht einschlafen können, solange dieser Eindringling im Zimmer nebenan lag, dieser grobe, freche Eindringling, dieser zweifelhafte, aufreizende Kerl. Was wusste sie schon über ihn? Nichts!
***
»Du bist wirklich eine kräftige Frau, Lisi«, sagte er, als sie ihre Einkäufe in die Wohnung geschleppt hatte. Auch die Flüchtlingsfrau aus dem dritten Stock hielt Lisi wohl für kräftig; sie war gerade die Treppe heruntergekommen, als Lisi mit dem vollen Karton hinaufstieg, und es war ihr nicht im Traum eingefallen, Hilfe anzubieten. Man sieht mir eben an, dass ich kräftig bin und keine Hilfe brauche, dachte Lisi. Die Frau und ihr Mann, zusammen mit zwei Kindern, hatten ein Zimmer in der Wohnung der Markowitz gemietet, und sie waren sehr freundlich gewesen, als sie ihnen geholfen hatte, die Matratzen in den dritten Stock zu schleppen. Ja, natürlich war Lisi eine kräftige Frau, und alle wussten das. Bestimmt hatte Benzi das auch zu Rosi gesagt. Lisi Badichi ist eine kräftige Frau. Keine Schönheit. Nichts Besonderes. Aber man kann sich auf sie verlassen. Sie ist nicht launisch. Sie hat keine Krisen. Fleißig, aufrichtig und zuverlässig. Kein neuer Motor, läuft aber prima.
»Da ist die Rechnung. Hundertzwölf Schekel und siebzig Agurot.«
»Geld? Ich werde darüber nachdenken müssen.«
»Darüber nachdenken? Du sollst nicht darüber nachdenken, sondern bezahlen!«
Rosi zog einen schwarzen Geldbeutel aus seiner Tasche. Er enthielt siebzig Schekel und ein paar Agurot. Kreditkarten konnte Lisi nicht entdecken.
»Ich kann es dir nicht bezahlen, und ich kann kein Geld von der Bank holen.«
»Warum nicht?«
»Ich bin tot, Lisi. Tote haben kein Bankkonto, und sie haben keine Kreditkarten. Sag nichts. Ich werde einen Weg finden.«
»Und bis dahin bezahle ich deinen Unterhalt?«
Von allem war dies das Ärgerlichste. Sie sollte ihn finanzieren! Eine Frechheit! Sie würde das eine oder andere zu Benzi zu sagen haben. Das Klingeln des Telefons verhinderte weitere Feindseligkeiten.
»Badichi.« Sogar Arielis Kläffen klang ihr jetzt süß in den Ohren. »Ich habe Ihren Bericht um ein Drittel gekürzt. Sie haben zu viel Material über die Trauergäste geliefert.«
»Sie haben gesagt, ich soll achthundert Wörter schicken.«
»Was soll das heißen, ›Tod unter tragischen Umständen‹? Gibt es Tod unter komischen Umständen? Sogar bei Selbstmorden schreiben wir schon nicht mehr ›Tod unter tragischen Umständen‹. Ich möchte für Schabbat eine Hintergrundgeschichte über die Familien der Ermordeten. Achthundert Wörter!«
Lisi schaffte es gerade noch, den Hörer von ihrem Ohr wegzuhalten, als er ihn aufknallte. In der letzten Zeit hatte Arieli angefangen, ihren Stil zu bekritteln. Weil er herausgefunden hatte, dass die Fakten, die sie brachte, immer gut recherchiert und korrekt waren, griff er sie jetzt von einer neuen Seite an. Und nie sagte er guten Tag, nie bitte oder danke.
»Wer war das? Dein Redakteur?« Rosi stand in der Tür, das schnurlose Telefon noch immer in der Hand.
»Hast du das Gespräch mitgehört?«
»Was für eine Art zu reden!«
»Untersteh dich, meine Gespräche mitzuhören.« Es war erst neun Uhr morgens, doch ihre Wut stieg schon in solche Höhen, dass sie das Gefühl hatte, sie würde gleich überlaufen und in Flammen aufgehen, so wie die Ölquellen am Golf.
»Komm, frühstücken wir.«
»Ich frühstücke nicht.«
»Du wolltest mit mir reden.«
»Ich muss zur Arbeit. Du hast meinen Redakteur ja gehört.«
»Er hat gesagt, du sollst eine Hintergrundstory über die Familien liefern. Du machst Frühstück, und ich liefere dir die Fakten, die du brauchst.«
»Warum?«
»Ich ziehe es vor, dass das Material von mir kommt.«
»Zitierfähig, Schätzchen? Wenn du mir was erzählst und mir gleichzeitig verbietest, es zu veröffentlichen, dann bringt mir das nichts.«
»Zitierfähig.«
»Und auf wen soll ich mich berufen?«
»Du kannst den Wahrheitsgehalt nachprüfen, indem du die Betroffenen befragst.«
»Wen zum Beispiel? Awner Rosen?«
»Inspektor Ben-Zion Koresch. Verwandte. Freunde. Polizisten, mit denen Rosen gearbeitet hat.«
»Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben …«
»Warum nicht?«
»Mein Redakteur wird wissen wollen, wer die Quellen sind.«
Lisi saß in der Küche, während er für sie beide das Frühstück vorbereitete. Rühreier, Salat, Brötchen mit Butter, Kaffee, im Finjan gekocht, den er in einem der Schränke gefunden hatte. Der Duft weckte ihren Appetit. Es war Monate her, seit sie das letzte Mal gefrühstückt hatte, und sie beschloss, es zu genießen. Warum eigentlich nicht? Schließlich aß sie ihr eigenes Essen, zusammen mit dem besten Knüller, den sie je erlebt hatte. »Der Tote lebt«, sie sah die Schlagzeile schon vor sich. Dafür würde sie ganz bestimmt eine Prämie bekommen. Und wer weiß? Vielleicht sogar den Sokolow-Preis. Und Adolam – Adolam würde vor Neid zerplatzen. Das wohlschmeckende Frühstück und der Gedanke an Beni Adolam besänftigten sie. Sie räumte das Geschirr in die Spüle, wischte die Tischplatte ab, legte ihren großen Block bereit, senkte die schweren Augenlider und schwieg.
»Vor ungefähr einem Jahr hat sich Interpol an uns gewandt …«
»Wer ist ›uns‹?«
»Die israelische Polizei. Ein Jahr davor …«
»Vor zwei Jahren also?«
»Ja, stimmt, vor ungefähr zwei Jahren erwarb ein amerikanischer Sammler mit Namen Louis Dipl eine Handschrift von Skrjabin.«
»Wer ist das?«
»Ein russischer Komponist, der Anfang des Jahrhunderts gelebt hat. Der Kauf fand nicht durch Sotheby’s statt, aber ihre Musiksachverständigen …«
»Wo? In Amerika?«
»Sie haben eine Niederlassung in New York. Unterbrich mich nicht dauernd. Ihre Sachverständigen für Handschriften im musikalischen Bereich wurden um ein Gutachten zur Authentizität gebeten. Das fiel positiv aus. Nach zwei Monaten wandte sich Dipl an die Sachverständigen mit einem weiteren Klavierwerk von Skrjabin. Als er gefragt wurde, wo er das Dokument erworben habe, antwortete er, es sei durch einen Bekannten aus Paris zu ihm gelangt. Die beiden Werke waren bekannt, und der Käufer bot sie nicht zum Verkauf an.«
»Was heißt das, bekannt?«
»Sie waren gedruckt, wurden gespielt und auf Tonträger aufgenommen. Es waren also keine neu aufgetauchten Werke, und in den Originalen waren keine Differenzen zu den bereits in der Musikwelt bekannten Stücken. Solche Originale sind der Traum eines jeden Auktionshauses. Sie bringen viel Geld und vergrößern das Ansehen. Nun, man nahm an, dass dort, wo die Schriften gefunden worden waren, noch anderes Material zu finden sein könnte, was sukzessive auf den Markt käme. Die Firma beschloss, in aller Stille Ermittlungen anzustellen, um herauszufinden, woher die Noten stammten.«
»Warum haben sie nicht Dipl gefragt?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es ja getan und keine Antwort bekommen. Oder die Antwort befriedigte sie nicht. Dipl stammt aus einer der ältesten und reichsten Familien der USA und ist als erfahrener und besonnener Sammler bekannt. Seine Familie ist im Ölgeschäft, besitzt Steinbrüche und steckt auch in der Schwerindustrie. Sein älterer Bruder, Luther Dipl III., war Senatsmitglied, und sein jüngerer Bruder Harry, der mit Louis die Familiengeschäfte führt, hatte einige Jahre als Botschafter sein Land in Madrid und Athen vertreten.
Bei Sotheby’s nahm man nun an, dass die Handschriften von jemandem stammten, dem es gelungen war, sie aus Russland herauszuschmuggeln, was ja schließlich auch nicht so schwer war. Damals dachte noch niemand an die Möglichkeit, die Noten könnten nach Israel gelangt sein und von dort ihren Weg nach Paris und in die Vereinigten Staaten gefunden haben. Damals waren wir noch nicht beteiligt.
Es vergingen weitere drei Monate, da bat derselbe amerikanische Sammler die Sachverständigen bei Sotheby’s, die Echtheit zweier Ölbilder von Soutine zu bestätigen. Stubenmädchen in rotem Hemd und Sessel mit Hund. Beide Bilder waren signiert, und beide waren 1920 gemalt worden. In der Öffentlichkeit waren sie vorher nie aufgetaucht …«
»Woher weiß man das?«
»Du unterbrichst mich schon wieder. Die Sachverständigen wissen das. Die beiden Bilder waren unbekannt, aber man wusste, dass Soutine in jener Zeit Bedienstete von Hotels, Restaurants oder Privathäusern in ihrer Livree gemalt hat. Die Analyse führte zu dem Ergebnis, dass die Bilder authentisch waren. Selbstverständlich sorgte das Auftauchen der beiden Bilder bei Sotheby’s für große Aufregung, und man versuchte alles, um vom Sammler zu erfahren, wo er sie erworben hatte. Er berief sich wieder auf einen Freund in Paris, war aber nicht bereit, dessen Identität preiszugeben. Da solche Werke in Frankreich als Nationalbesitz angesehen werden und ihr Export ohne offizielle Genehmigung verboten ist, war das der Anlass zu Ermittlungen, aber Dipls Stellung in der Öffentlichkeit und als Kunde von Sotheby’s führten dazu, dass diese Nachforschungen in aller Stille angestellt wurden. Interpol wandte sich an die israelische Polizei, und so kam der Fall zu mir.
Der Chef der Untersuchung teilte mir als Unterstützung Arkadi Katz zu, einen Mann vom Zoll, der vor sieben Jahren aus Russland nach Israel eingewandert war. Die Wahl Arkadis war keine besonders gelungene Idee, denn die russischen Einwanderer sind sehr empfindlich gegenüber allen offiziellen Nachforschungen. Wir fingen an, uns in Galerien herumzutreiben, und versuchten herauszufinden, ob ihnen im Lauf des letzten Jahres Neueinwanderer aus Russland bedeutende Kunstgegenstände angeboten hatten. Soutine erwähnten wir nicht. Wir lernten Galeriebesitzer kennen, Organisatoren öffentlicher Versteigerungen, Neueinwanderer. Wir sahen viele schlechte Kunstwerke und wenige gute, entdeckten Geschmuggeltes und Gestohlenes, wir aßen Tonnen von Blinis, Knisches und Piroschki und wurden zu Fachleuten, was die Maler unter den russischen Einwanderern betraf. Der arme Arkadi! In Russland war er Ernährungsingenieur gewesen, und zum Zoll war er erst gekommen, nachdem er drei Jahre als einfacher Arbeiter bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft gearbeitet hatte. Die Einwanderer waren zum einen neidisch auf ihn, zum anderen auch misstrauisch, aber weil sie allein und verwirrt waren, breiteten sie all ihre Sorgen vor ihm aus. Dem einen waren Gepäckstücke verloren gegangen, die andere hatte einen Sohn, der dringend eine neue Geige brauchte … und aus lauter Frust angefangen hatte zu malen. Und ich, in meiner Verblendung, habe zwei schreckliche Bilder von zwei Malern gekauft, die nichts mehr zu essen hatten. Aber das alles brachte uns in unseren Ermittlungen keinen Zentimeter weiter. Wir waren in eine Sackgasse geraten und beschlossen daher, unsere Richtung zu ändern.
Ich saß in der städtischen Bibliothek mit Büchern über Soutine und Skrjabin. Beide waren in Russland geboren. Skrjabin starb 1915 in Moskau. Soutine war Jude und starb 1943 in Paris. Es hatte keinerlei Verbindung zwischen ihnen gegeben. Ich kaufte Platten von Skrjabin und Bücher mit Reproduktionen von Soutine. Ich verliebte mich in beide und entdeckte zu meinem Erstaunen, dass Liebe sogar bei einer polizeilichen Recherche von Nutzen sein kann. In der Bibliothek der Musikakademie traf ich einen Dozenten, der verrückt nach Skrjabin war und sich sehr freute, eine verwandte Seele zu finden.
›Wissen Sie, dass Skrjabin eine Verbindung mit Israel hat?‹, fragte er.
›Wieso?‹, fragte ich.
›Seine Tochter hat einen russischen Schriftsteller namens David Knut geheiratet, der später nach Israel eingewandert ist.‹
›Leben die beiden noch?‹
›Knut verließ Russland nach der Revolution und ging nach Frankreich. Er und seine Frau, Iren-Ariadne Skrjabin, lebten dreißig Jahre lang in Paris, wo Skrjabins Tochter auch starb. Sie war zum Judentum übergetreten und verknüpfte ihr Schicksal mit dem des jüdischen Volkes. Während der Besatzungszeit durch die Nazis war sie Mitglied der von ihrem Mann gegründeten jüdischen Untergrundbewegung. Die Deutschen erwischten sie mit Sprengstoff, folterten sie und brachten sie dann um. Knut gelang es, in die Schweiz zu entkommen, und nach der Staatsgründung wanderte er nach Israel aus. Er ist schon vor Jahren gestorben. Betty, Skrjabins Enkelin, die Tochter Irens aus erster Ehe, ist zusammen mit ihrem Stiefvater nach Israel eingewandert. Ich glaube, dass Iren noch weitere Kinder hatte, die ebenfalls eingewandert sind.‹
›Kennen Sie sie?‹, fragte ich den Dozenten.
›Betty? Nein. Sowohl sie als auch ihr Mann, ein Amerikaner, der in der Gegend von Be’er Schewa mit Bau- oder landwirtschaftlichen Maschinen zu tun hatte, sind vor über zwanzig Jahren gestorben. Vermutlich an Alkohol und Drogen. Aber wer sie gekannt hat, sagt, sie sei eine tolle Frau gewesen. Man braucht nur ihren Namen zu sagen, und sofort fangen die Gesichter der Leute an zu strahlen vor Liebe und Anerkennung.‹
›Was für Leute?‹
›Die sie gekannt haben.‹
›Erinnern Sie sich an jemanden?‹
›Nein.‹ Der Dozent lächelte verlegen. ›Jemand hat sogar mal eine Geschichte über sie geschrieben. Ihre Mutter war anscheinend sehr musikalisch gewesen, aber die Tochter beschäftigte sich nicht mit Musik.‹
›Besaß sie Werke von Skrjabin?‹
›Werke von Skrjabin?‹ Er schaute mich an, als sei ich komplett verrückt geworden.
Ich hatte also endlich einen Anhaltspunkt. Ich beschloss, nach Be’er Schewa zu fahren, um etwas über Skrjabins Enkelin herauszufinden, die vor über zwanzig Jahren gestorben war. Dabei kannte ich noch nicht einmal ihren Familiennamen. Der Chef meiner Abteilung sprach meine Versetzung mit dem Chef der Abteilung Negev ab, und ich lichtete meinen Anker und segelte los.
Ich begann mit Fabriken für Baumaschinen. Ich fragte nach einem Amerikaner, der mit einer Französin verheiratet gewesen war und Baumaschinen hergestellt hatte. Ich wusste nicht, ob es sich um Traktoren oder um Bulldozer handelte, und ob der Mann Besitzer einer Fabrik oder Händler gewesen war. Ich wagte nicht, zu sehr nachzubohren. Meine Ermittlungen blieben erfolglos. Dann fiel mir ein, dass der Dozent von Alkohol und Drogen gesprochen hatte, und ich befragte alte Polizisten, alte Trinker, alte Drogenabhängige – nichts. Bis …«
Rosi schwieg und lächelte Lisi wie ein guter Vater an, der zum spannendsten Teil der Abenteuergeschichte gekommen ist, die er gerade erzählt.
»Bis was?«, fragte Lisi.
»Rate!«
»Was?«
»Man kann wirklich nicht behaupten, dass du besonders viel quasselst.«
»Du hast gesagt, ich soll dich nicht unterbrechen.«
»Ich beklage mich ja nicht. Also: … bis ich eines Tages im Laden deiner Verwandten saß.«
»Bei Klara und Ja’akow?«
»Bei Klara und Ja’akow. Natürlich wussten sie Bescheid. Leon besaß Traktoren, und Betty die Letzte Gelegenheit oder, wie die Bar auf Französisch hieß, La dernière chance. Betty Knut und Leon? Ihre besten Freunde, sie mögen in Frieden ruhen.«
Lisi lachte laut. Auf Klara und Ja’akow konnte man sich verlassen.
»Hast du sie schon vorher gekannt?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete er. »Wir hatten vor ein paar Jahren mal was miteinander zu tun. Ich habe ihnen geholfen. Übrigens, ich habe dich jetzt das erste Mal lachen gesehen.«
Sie wurde verlegen. »Wollen wir Kaffee trinken?«, fragte sie.
»Ja.«
Sie stand auf, dehnte die Schultern, indem sie die Arme nach hinten führte, und machte sich daran, Kaffee zu kochen. Nescafé, denn sie hatte nicht die Absicht, wegen des ungebetenen Gastes ihre Gewohnheiten zu ändern. Bis das Wasser kochte, konnte sie in der Redaktion anrufen. Vielleicht war ja, während sie hier gesessen hatte, jemand vom Dach eines Hochhauses gesprungen, wer weiß? Dahan war am Telefon.
»Dahan, Schätzchen, ich weiß nicht, ob ich es bis Mittag schaffe. Arieli hat einen Bericht für die Wochenendausgabe verlangt. Was gibt’s Neues?«
»Es hat jemand vom Frauenverband angerufen, du sollst dir anschauen, welche Sicherheitsmaßnahmen sie bei ihren Kinderbetreuungsstätten in Siedlung C und D getroffen haben. Sie sind bis drei Uhr dort, aber sie möchten, dass du noch heute Vormittag kommst.«
»Ich werde morgen früh hingehen. Sag Dorit, dass wir uns morgen früh bei der Kinderbetreuungsstätte in der Siedlung C treffen, um neun Uhr.«
»Dorit entwickelt für dich die Fotos von der Beerdigung. Willst du mit ihr sprechen?«
»Ich komme nachmittags vorbei. Sie soll die Abzüge in meinem Zimmer lassen.«
»Bist du sicher, dass so viele Fotos nötig sind?«
»Nein.«
»Sie ist schon seit sechs Uhr morgens im Labor.«
»Tschüs, Schätzchen.«
Als Lisi in die Küche zurückkehrte, goss Rosi Kaffee aus dem Finjan. Also kein Nescafé für den Herrn. »Muss Dahan die Ausgaben des Labors bewilligen?«
»Du hast schon wieder mitgehört!«
»Glaub mir, deine Gespräche mit Dahan interessieren mich nicht im Geringsten.«
»Ich bin nicht deine Verdächtige, und ich will nicht, dass du mein Telefon anzapfst.«
»Schreib alle Ausgaben auf, die du meinetwegen hast, mit Datum, Art der Ausgabe und die Summe.«
»Und was wird mir das helfen?«
»Du wirst das Geld zurückbekommen.«
»Und wie erkläre ich meinem Redakteur, dass ich die Fotografin unter einem Vorwand beschäftigt habe?«
»Ich habe gedacht, du wärst Reporterin und Redakteurin.«
»Bei der Zeit im Süden, nicht bei der überregionalen Zeit. Und das gibt mir noch lange nicht das Recht, meine Zeitung in die Irre zu führen.«
»Sobald ich hier weggehe, gebe ich dir das Geld zurück.«
»Du brauchst mir keinen Gefallen zu tun. Ich komme allein zurecht.«
»Kauf einen kleinen Block und schreibe alle Ausgaben auf. Den Block lass zu Hause. Komm, trink deinen Kaffee, solange er noch heiß ist. Wo waren wir stehen geblieben?«
»Bei Klara und Ja’akow.«
»Du weißt ja, wie sie sind. Mit ihren Geschichten. Wie er Pianist an der Oper in Alexandria war und wie sie an der Oper in Alexandria im Chor gesungen hat, als sie noch ein Mann war …«
»Das hast du nicht von ihr!«