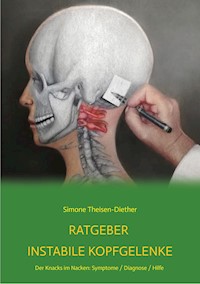3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Der HWS-Stammtisch" erzählen neunzehn völlig unterschiedliche Menschen von ihrem Leben mit einer unsichtbaren Krankheit: einer Kopfgelenksinstabilität und den damit verbundenen Begleiterkrankungen. Die Geschichten sind zum Teil tragisch, berührend und unbegreiflich, manche machen Mut, andere rühren zu Tränen. Alle eint der Wunsch mit ihren Geschichten aufzurütteln, zu helfen und zu verändern. Eine Kopfgelenksinstabilität soll nicht länger unsichtbar bleiben, sondern die Anerkennung von Ärzten, Versicherungen und der Gesellschaft erfahren. Die Betroffenen wehren sich gegen eine ungerechtfertigte Psychiatrisierung und die Vorverurteilung als Simulanten, sie kämpfen gegen Existenznot und soziale Isolation. Das Buch beleuchtet das unbestreitbare "Instabilitäts-Desaster" in Deutschland und Österreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Simone Theisen-Diether, Jahrgang 1976, lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Koblenz. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und verfügt über langjährige Erfahrung in der Kommunalverwaltung. Auch in ihrer Freizeit interessiert sie das kommunale Geschehen, sie engagiert sich im Stadtrat ihrer Heimatgemeinde. Die Inspiration fürs Schreiben ergab sich aus ihrer eigenen Krankheitsgeschichte und den damit verbundenen Erlebnissen. Nach ihrem ersten Buch „Wackelköpfchen" folgt nun das zweite Werk: „Der HWS-Stammtisch - Geschichten einer unsichtbaren Krankheit."
Simone Theisen-Diether
Der HWS-Stammtisch
Geschichten einer unsichtbaren Krankheit
© 2020 Simone Theisen-Diether
Autor: Simone Theisen-Diether
Coverillustration: Katharina Netolitzky
Foto: Godehard Juraschek
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7497-3259-3
ISBN Hardcover: 978-3-7497-3260-9
ISBN: e-Book: 978-3-7497-3261-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Haftungsablehnung
Anatomie und Biochemie für Einsteiger
Eine Liste voller Beschwerden
Wackelköpfchen
Ursachen und Auslöser
Gibt es ein Instabilitäts-Desaster?
Ein neues Buchprojekt
1. Vom Arzt, der zum Patienten wurde!
2. Nur nach vorne!
3. „Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest.“(Rainer Maria Rilke)
4. Kopfgelenke, Ein Ausflug in das schwarze Loch der deutschen Medizin
5. Diagnose: instabiles Genickgelenk
6. Plötzlich instabil
7. Chronisch erschöpft!
8. Plötzlich ohnmächtig
9. Leiden geschafft durch Leidenschaft!
10. Wie ein einziger Tag alles veränderte!
11. Wie der Vagus-Nerv mein Leben zerstörte!
12. Schwachstelle Nacken; Mein Leben mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom und einer HWS-Instabilität
13. Ich fand das jetzt gar nicht lustig!
14. Ein Trainingsplan fürs Leben!
15. Schnitzeljagd mit Langzeitfolgen
16. Selbsthilfe gegen ärztliche Ignoranz!
17. Wie ein Autounfall Fluch und Segen zugleich wurde
18. Vom Athleten zur Bettlägerigkeit
19. Ich bin zu müde, um depressiv zu sein
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf!
Was muss passieren?
Zu guter Letzt!
Nachruf
Quellenangaben
Prolog
Eine japanische Weisheit lautet: „Siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen!“ Das könnte auch gut mein Lebensmotto sein, bei den Stehaufmännchen-Qualitäten, die ich in den letzten fünfzehn Jahren entwickeln musste. Zwanzig Jahre im Judosport haben mir glücklicherweise eine Menge Kampfgeist mitgegeben, sowohl für das Leben im Allgemeinen als auch für das Leben mit einer Kopfgelenksinstabilität. Fallen und wieder aufstehen sind Bestandteile des Lebens, davon wird im Grunde niemand verschont. Allerdings müssen einige mehr kämpfen als andere. Das gilt insbesondere, wenn man es mit so einem speziellen Krankheitsbild wie der Kopfgelenksinstabilität zu tun hat. In diesem Buch haben sich viele Kämpferinnen und Kämpfer vereint, um ihre Geschichte zu erzählen. Der HWS-Stammtisch ist ein Buch von und über Kämpfer!
Dieses Buch ist meiner wunderbaren Mama gewidmet, die leider nicht mehr bei uns ist. Auch sie war eine Kämpferin, eine wahre Löwenmutter. Um Ungerechtigkeit von mir abzuwenden, wäre sie in jede Schlacht gezogen. Ihr Sinn für Gerechtigkeit hat mich nachhaltig geprägt und war mir Antrieb und Inspiration für mein Buch.
Simone Theisen-Diether
Haftungsablehnung
Dieses Buch habe ich nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Es dient ausnahmslos dem Zweck der Aufmerksamkeitsarbeit über das Krankheitsbild Kopfgelenksinstabilität bzw. Halswirbelsäulentrauma oder ähnliche Erkrankungen.
Ich verfüge über keine medizinische Ausbildung. Der Text ist auf der Basis von selbst Erlebtem und den Erfahrungen der Gastautoren entstanden. Die geschilderten Geschichten und Erfahrungsberichte sind nicht auf andere übertragbar und nicht verallgemeinerbar; sie können und sollen in keinem Fall als ärztliche Beratung gesehen werden, eine Diagnose oder Behandlung ersetzen.
Die nachfolgend enthaltenen Informationen sollen daher niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen verwendet werden.
Anatomie und Biochemie für Einsteiger
An einer seltenen Krankheit zu leiden ist oft frustrierend. Betroffene erleben das leidvoll. Eine seltene Krankheit zu haben, die außerdem aus unterschiedlichen Gründen nicht ins System passt, weder in das von Ärzten noch in das von Versicherungen und Sozialleistungsträgern, macht es noch um ein Vielfaches schwerer. Betroffene fühlen sich allein gelassen, sind verzweifelt, rennen gegen verschlossene Türen. Es geht oft so weit, dass die Erkrankung zum existenziellen Problem wird.
Mich hat so eine seltene Krankheit getroffen. Wobei, vielleicht sollte ich besser das Wort „ungewöhnlich“ benutzen. Der Definition nach gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen das spezifische Krankheitsbild aufweisen (1). Wenn ich bedenke, was ich in den vergangenen Jahren alles erfahren habe, scheint es sich eher um eine selten diagnostizierte, als um eine tatsächlich seltene Krankheit zu handeln. Ich spreche von einer funktionellen Instabilität der oberen Halswirbelsäule, also der Kopfgelenke, in Verbindung mit einer sekundären Mitochondriopathie.
Worum handelt es sich dabei? Um das Krankheitsbild nachvollziehen zu können, muss man sich zunächst den Aufbau der menschlichen Halswirbelsäule anschauen (2). Diese wird unterteilt in die klassische Halswirbelsäule (C3 – C7) und den Kopfgelenksbereich (C1, C2 und C2/3). Der Kopfgelenksbereich ist aufgeteilt in das obere und das untere Kopfgelenk.
Das obere Kopfgelenk besteht aus dem ersten Halswirbel Atlas (C1) und den Gelenkflächen des Hinterhauptbeines. Hier sitzt der Schädel mit einem Gewicht von bis zu 7 kg. Der Atlas erhielt seinen Namen von dem Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie. Dieser musste die Last des Himmelsgewölbes auf seinen Schultern tragen, so wie der Atlas hier den Kopf zu tragen hat. Der Atlas ist das sogenannte Nickgelenk („Ja-Gelenk“) und gleichzeitig ein Sperrgelenk für Rotation. Bezeichnet wird dieses erste Gelenk der Halswirbelsäule als atlanto-occipital- oder craniocervicales Gelenk. Der Atlas besitzt als einziger Wirbel keine Wirbelkörper. Dafür besitzt dieser Wirbel rechts und links sogenannte Auftreibungen.
Der Axis, auch C2 genannt, bildet das untere Kopfgelenk (= Atlanto-Axialgelenk). Der Axis hat einen vorne in den Atlas hineinragenden Zahn, den Dens axis. Dieses zweite Halswirbelsäulengelenk ermöglicht Drehbewegungen um je 45°. Es ist das Rotationsgelenk („Nein-Gelenk“). Seitneigungen, Vor- und Rückwärtsbeugungen sind nur im geringen Umfang möglich.
Zum Kopfgelenksbereich gehört auch das dritte Halswirbelsäulengelenk (C2/3). Dieses ermöglicht deutliche Neigungen zu den Seiten, sowie Vor- und Rückwärtsbeugungen des Kopfes.
Die Beweglichkeit der einzelnen Kopfgelenke für sich ist nicht besonders ausgeprägt, das Zusammenspiel beider Kopfgelenke und der übrigen Halswirbel ermöglicht jedoch das große Beweglichkeitsausmaß der Kopfbewegung. Die Stabilität der Verbindung zwischen dem 1. und 2. Halswirbel, dem oberen und unteren Kopfgelenk und dem Kopf wird durch einen straffen Bandapparat gewährleistet (3).
Der Bandapparat soll vermeiden, dass unkontrollierte Streck-, Beuge- und Drehbewegungen das Rückenmark verletzen. Die wichtigsten Bänder (Ligamente) im Bereich der Kopfgelenke sind die Flügelbänder (Ligamenta alaria) und das Querband (Ligamentum transversum atlantis) (4). Letzteres ist zwischen den beiden Auftreibungen des Atlas gespannt. Es ist dafür verantwortlich, den Dens axis in seiner Position zu halten und zu verhindern, dass sich der Dens axis gegen das Rückenmark neigt.
Die Flügelbänder haben vor allem Brems- und Haltefunktion. Sie sollen ein übermäßiges Drehen und Kippen im unteren Kopfgelenk verhindern.
Im Kopfgelenksbereich finden sich Vernetzungen von cervicalen, vegetativen Nerven und den Hirnnerven. Dort befinden sich das Atemzentrum und die Vertebralarterien, die das Kleinhirn, die Seh- und Hörzentren, den Hirnstamm, das Innenohr und den hinteren Teil des Hippocampus (Teil des Gehirns, der für Gedächtnis und Lernen zuständig ist) versorgen. Die obere Halswirbelsäule stellt die beweglichste und gleichzeitig eine extrem sensible Region des menschlichen Organismus dar. Hier werden motorische Abläufe der Kopf-, Rumpf-, Extremitäten-, Augen-, Kau-, Schlund-, Kehlkopf- und Zungenmuskulatur koordiniert (5).
Da der Hals eine so sensible Stelle des Körper ist, kann sich im Prinzip jeder noch so kleine Unfall auf das Genick auswirken. Zum Beispiel kann bei einem Sturz die Kopfbewegung so heftig sein, dass sich die Genickgelenke weiter bewegen, als sie es von Natur aus tun sollten. Und das kann zu kleinen oder auch größeren Rissen in den stabilisierenden Flügelbändern am Axis führen und Schäden der übrigen Bänder, der Gelenkknorpel, oder Verreißen der umliegenden stabilisierenden Muskulatur auslösen. Dann wird die Halswirbelsäule instabil (6). Das hat Folgen.
Die wichtigen Blutbahnen und Nervenstränge und die benachbarten Regionen des Gehirns können durch unnatürliche Bewegungen der Wirbel gedrückt oder gerieben werden. Dadurch können viele verschiedene Symptome, wie beispielsweise Schwindel, Übelkeit, Taubheitsempfindungen oder Sehprobleme auftreten. Durch wiederholtes Gegenstoßen an die Nerven können diese ständig gereizt sein, es kommt zu Entzündungen in dieser Region mit vielen negativen Auswirkungen (7).
Auch ohne tiefergehende anatomische Kenntnisse kann man sich vorstellen, dass Verletzungen im Kopfgelenksbereich eine Vielzahl von Beschwerden mit sich bringen können. Dazu später mehr. Soviel zum ersten Teil der Diagnose. Wie kommt es nun zu einer sekundären Mitochondriopathie, also zu einer Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion?
Hier muss man zunächst unterscheiden zwischen primärer und sekundärer Mitochondriopathie. Bei der primären Mitochondriopathie handelt es sich um eine angeborene Erkrankung. Die Medizin spricht von einer schweren genetischen Erkrankung. Als sekundär bezeichnet man eine im Laufe des Lebens erworbene Mitochondriopathie. Darum geht es im Folgenden.
Betrachten wir also zunächst die Mitochondrien. Die gängigste Definition lautet: Mitochondrien – die Kraftwerke unserer Zellen. Mitochondrien sind kleine, bakterienähnliche Zellorganellen. Jede Zelle enthält zwischen 100 und 2000 solcher Mitochondrien, die in Form von ATP (Adenosintriphosphat) jene Grundenergie liefern, die eine Muskelzelle fähig macht, Kraft zu entwickeln, eine Drüsenzelle befähigt, Hormone herzustellen oder eine Nervenzelle, Informationen weiterzuleiten. (8) Als Energielieferanten sind die Mitochondrien also von enormer Bedeutung für unseren Organismus. Welche Vorgänge lösen nun aber eine Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion aus?
Werden die Nerven im Halsbereich häufig durch falsche Reize beeinflusst, dann werden die Stoffwechselwege beeinträchtigt und Abläufe in Gang gesetzt, die nicht mehr zu stoppen sind. Das wiederholte mechanische Reiben der falsch stehenden Halswirbel an den Nerven kann u.a. auch zu Entzündungen führen. Ein wichtiger Bestandteil einer Entzündungsreaktion ist das Stickstoffmonoxid, auch genannt NO. Wenn durch immer wieder auftretende Reizungen Dauerentzündungen entstehen, kommt es auch fortwährend zur Bildung von NO. Befinden sich große Mengen NO im Körper, erhalten die Zellen zu wenig Energie. Das liegt daran, dass viele Enzyme, die für die energieproduzierenden Vorgänge in den Mitochondrien notwendig sind, von NO blockiert werden. Dadurch steht nicht nur zu wenig Energie zur Verfügung, sondern auch der Stoffwechsel in den Mitochondrien läuft völlig falsch. Es kommt zu einer Mitochondrienzerstörung, diesen Ablauf nennt man Mitochondriopathie (9).
Die biochemischen Hintergründe der Mitochondriopathie empfinde ich als zu komplex, um sie mit meinen eigenen Worten verständlich erklären zu können. Glücklicherweise gibt es verschiedene Veröffentlichungen, die das wesentlich besser können als ich. Beispielhaft möchte ich hier folgenden Absatz zitieren:
„Auch die Halswirbelsäule (HWS) kann der Ursprung für sekundäre Mitochondriopathien sein: Durch direkte (Schleudertrauma) oder indirekte Gewalteinwirkungen (Sturz auf den Steiß) können Schäden an der HWS entstehen, die nachfolgend irreguläre Bewegungen von Atlas und Axis zulassen. Somit kommt es dann wiederholt zum Abklemmen von Arterien mit Durchblutungsstörungen des Kopfes (möglich sogar bis hin zur kurzzeitigen Bewusstlosigkeit), zu Reizungen und Schäden der Hirnnerven und des Nervus sympathicus, neurogenen Entzündungen mit allen denkbaren Folgen inkl. Ausfällen von Sinnesleistungen, Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, massivem oxidativen und nitrosativem Stress, Verlust von Antioxidantien und Mineralstoffen, Stoffwechselveränderungen und vielfachen Funktionsstörungen, die natürlich besonders auch die Mitochondrien betreffen und dadurch schnell zu Multimorbidität führen“ (10).
Allgemein gesprochen bedeutet dies, dass es durch die Instabilität der Kopfgelenke zu Nervenreizungen kommt, die letztendlich einen chronischen Entzündungsprozess in Gang setzen. Dadurch kommt es zu einer andauernden Bildung von Stickstoffmonoxid, und die energieproduzierenden Vorgänge in den Mitochondrien werden gestört. Kurzum, aufgrund eines „Knacks im Nacken“ fehlt es fortwährend an Energie. Der Energiemangel ist nur ein Problem in einer langen möglichen Beschwerdekette.
Wackelköpfchen
Soweit erst mal die Theorie. Wenn man die Ausführungen zu diesem Krankheitsbild auf sich wirken lässt, wird schnell klar, dass wir es dabei nicht mit einer herkömmlichen Krankheit zu tun haben. Das hängt im Wesentlichen mit der Besonderheit der betroffenen Region zusammen, wie bereits die anatomischen Ausführungen gezeigt haben.
Auf meinen persönlichen Fall bezogen, kann ich sagen, dass ich auf der Suche nach einer Diagnose, dem Testen verschiedener Therapieansätze, sowie dem Durchsetzen von Ansprüchen, in der Vergangenheit Einiges erlebt habe. Der Weg war steinig, frustrierend, verletzend, ebenso teuer, tränenreich und voller Rückschläge. Es gab kuriose Begegnungen, unfassbare behördliche Entscheidungen und Mediziner, die mich sprachlos machten, aber glücklicherweise auch viel familiäre Unterstützung und das große Glück, doch noch die richtigen Ärzte zu treffen. Letztlich habe ich meinen Weg gefunden und gelernt, mit den geänderten Lebensumständen umzugehen.
Während dieser Zeit, die sich über viele Jahre zog, habe ich immer vermutet, dass es auch andere Menschen mit den gleichen Beschwerden, der gleichen Erkrankung geben musste. Ich hatte jedoch noch keine anderen Betroffenen kennen gelernt. So blieb es lange nur bei der Vermutung und ich eine Einzelkämpferin. Irgendwann entschied ich mich, meine Geschichte aufzuschreiben, zunächst als ganz persönliches Mittel zur Verarbeitung beziehungsweise Aufarbeitung der Geschehnisse. Aber auch in der Hoffnung, andere Betroffene zu erreichen und eventuell Hilfestellung zu leisten. „Wackelköpfchen“ habe ich mein Buch genannt, weil dieser Begriff ganz schnörkellos die Situation beschreibt.
Zeitgleich mit der Veröffentlichung meines Buches habe ich damit begonnen, nach ähnlichen Büchern zu suchen. Und ich wurde fündig. Bei meinem eigenen Verlag fand ich gleich zwei weitere Bücher Betroffener, die sich im Großen und Ganzen mit dem Thema Halswirbelsäule und Instabilitäten befassten. Ich fand auch noch ein drittes Buch einer Schweizer Autorin. Es gab sie also tatsächlich, andere Betroffene. Die drei Geschichten waren sich verblüffend ähnlich. Die Krankheitsbilder stimmten nicht bis ins Detail überein, aber die Kernaussagen passten. Interessanterweise waren es drei Frauen, die über ihren Weg zur Diagnose, behördliche und rechtliche Hürden schrieben und ihre Gefühle teilten. Jedes der drei Bücher hätte ein „Zwilling“ meines Buches sein können, die Parallelen waren unglaublich.
Mit einer der drei Autorinnen nahm ich Kontakt auf und es entstand ein reger Austausch. Ich war froh, eine Kommunikationspartnerin gefunden zu haben, die mich sofort verstand. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob man mit einer gesunden Person über die Thematik spricht oder mit einer Betroffenen. Schilderungen von Befindlichkeiten und Ängsten sind einfacher, weil das Gegenüber sie auch kennt. Ich erfuhr viel Neues, unter anderem über die unterschiedlichen Ausprägungen von Instabilitäten. Dass diese zum Beispiel auch genetischen Ursprungs sein können, war mir bislang unbekannt. Obwohl ich für mich einen Weg gefunden hatte, mit der Krankheit und den Einschränkungen umzugehen, überwog doch in regelmäßigen Abständen die Neugier, noch mehr über die medizinischen Zusammenhänge zu erfahren, um so eventuell noch kleine Verbesserungen erzielen zu können. Soweit es meine Gesundheit zuließ, las ich in Blogs und Foren und besorgte mir zusätzliche Literatur. Es zeigte sich, dass es eine Vielzahl von Betroffenen gibt, die sich informieren und austauschen möchten. Die Anonymität des Netzes hilft offensichtlich vielen Menschen dabei, sich zu öffnen. Umso überraschter war ich, als ich plötzlich persönliche Rückmeldungen erhielt.
Nachdem zwei regionale Zeitungen über mein Buch berichtet hatten, klingelte zu Hause immer öfter das Telefon. Zumeist begann das Gespräch mit den Worten: „Sind Sie die Autorin von Wackelköpfchen?“ Jedes Mal schnellte mein Puls in die Höhe, weil ich es einfach aufregend fand, mich mit eigentlich völlig fremden Menschen über ein ganz privates Thema auszutauschen. Ich bekam Rückmeldungen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands, mein Buch hatte offensichtlich auch überregional Leser gefunden. Ich freute mich über positives Feedback und den Gedanken, vielleicht ein kleines bisschen helfen zu können. Aber es machte auch gleichermaßen nachdenklich, wie viele Leidensgenossen es gibt. Je mehr Rückmeldungen ich bekam, desto häufiger stellte ich mir die Frage: „Wie viele gibt es noch?“
Jeder telefonische oder schriftliche Austausch zeigte auf, dass alle Betroffenen Einzelkämpfer sind, Einzelkämpfer, die jedoch alle in etwa den gleichen Werdegang schilderten. Nachdem die Probleme auftraten, suchten alle lange nach den Ursachen, gingen von einem Arzt zum nächsten. Oft wurden ihre Beschwerden abgetan, sie der Einbildung beschuldigt, zumeist mit dem Ergebnis, dass rein psychische Ursachen konstatiert wurden. Hatte man endlich eine Diagnose, fand diese keine Anerkennung, Krankenkassen und Unfallversicherungen stellten sich quer, Behandlungskosten wurden nicht übernommen. Viele endeten in Rechtsstreitigkeiten mit Versicherungen, Rententrägern oder Arbeitgebern, das Ganze oftmals einhergehend mit hohen finanziellen Belastungen und häufig auch sozialer Isolation. Grob zusammengefasst ist es das, was alle Betroffenen, mit denen ich Kontakt hatte, erlebten. Weshalb ist das so? Bevor ich versuche, dieser Frage auf den Grund zu gehen, soll im Nachfolgenden zunächst erklärt werden, wie es überhaupt zu diesen Halswirbelsäulenschädigungen kommt.
Ursachen und Auslöser
Was sind die Auslöser für Probleme im Kopfgelenksbereich? Ähnlich wie die Liste der Beschwerden, handelt es sich auch bei der nachfolgenden Aufzählung um eine Sammlung eigener Erfahrungen, Berichte anderer Betroffener und Erläuterungen aus Fachbüchern (12). Wahrscheinlich ist die Liste nicht vollständig, aber die mir bekannten, wesentlichen Risikofaktoren sind enthalten.
Auslöser für Probleme im Kopfgelenksbereich in alphabetischer Reihenfolge
● Anpralltraumata
● Erschütterungen
● Extraktionsgeburten
● Fehlhaltungen und falsches Kraft- und Fitnesstraining
● Gegenstände, die auf den Kopf oder in den Nacken fallen
● Gewalteinwirkungen auf Kopf, Hals, Schultern, Rumpf oder Wirbelsäule
● Genetische Bindegewebserkrankungen (z.B. Ehlers-Danlos-Syndrom)
● HWS-Manipulationen („Einrenken“)
● Kopfüberstreckungen beim Friseur oder Zahnarzt
● Neurotoxische Schäden durch Virusinfektionen oder neurotoxische Schadstoffexpositionen
● Operationen in Vollnarkose (mit Überstreckung der HWS)
● Schütteln eines Babys oder Kleinkindes
● Sportunfälle z.B. bei Kampfsportarten, Wintersportarten, Boxen, Motocross, Bodenturnen, Wasserspringen etc.
● Stürze von Treppen, Leitern, Bäumen, durch Glatteis, vom Fahrrad oder Pferd etc.
● Tritte von Tieren, z.B. Pferde, Kühe etc.
● Verkehrsunfälle
Gibt es ein Instabilitäts-Desaster?
Es gibt also eine Vielzahl von Auslösern für Probleme im Kopfgelenksbereich, die keinesfalls als exotisch einzustufen sind. Viele dieser Ursachen können im alltäglichen Leben auftreten, was grundsätzlich zur Folge hat, dass auch viele Menschen davon betroffen sein können. Es ist nicht zwingend davon auszugehen, dass Personen, die eines der oben genannten Ereignisse erlebten, daraus auch gravierende Probleme davon tragen. Manche haben das große Glück, dass auftretende Verletzungen folgenlos ausheilen. Allerdings gibt es auf der Gegenseite auch eine Vielzahl von Menschen, bei denen gleichgelagerte Ereignisse nicht ohne Folgen bleiben. Vielmehr bildet sich ein chronischer Beschwerdekomplex aus, der alles „auf den Kopf stellt“. Ich habe inzwischen viele dieser Menschen kennen gelernt, deren Schicksale sich verblüffend gleichen. Insbesondere die quälend lange Suche nach dem Grund für ihre Beschwerden sowie nach einem passenden Arzt eint sie alle. Das lässt Raum für die Vermutung, dass die Dunkelziffer von Betroffenen noch viel höher sein muss. Damit komme ich unweigerlich wieder zu der Frage, warum dies ausgerechnet bei Kopfgelenksinstabilitäten, Halswirbelsäulentraumata etc. der Fall ist.
Mangels medizinischer und juristischer Ausbildung möchte ich hier gar nicht versuchen, einen rein wissenschaftlichen Erklärungsansatz zu dieser Frage zu liefern. Um die Frage dennoch fachlich zu beleuchten, möchte ich an dieser Stelle aber einige mutige Aussagen und Erklärungsansätze aus unterschiedlicher Fachliteratur zitieren. Ich wähle bewusst die Bezeichnung „mutig“, da sich Autoren entsprechender Literatur durchaus den Anfeindungen großer Interessenverbände ausgesetzt sehen. Weil der größte Teil der Fachliteratur sich mit dem Thema „Schleudertrauma nach Verkehrsunfall“ befasst, wird in den fünf ausgewählten Zitaten auch zumeist darauf abgestellt, was aber deren generelle Bedeutung in Bezug auf Halswirbelsäulenverletzungen nicht mindert.
„Erhebliche Probleme bereitet allerdings eine größere Zahl von Unfallgeschädigten bei denen die Beschwerden oft ein Leben lang zurückbleiben und bei denen die langwierigen Symptome häufig in keinen kausalen Zusammenhang gestellt werden. Diese Patienten erleiden häufig eine medizinische, versicherungstechnische und juristische Odyssee, bei der die Betroffenen häufig keine Anerkennung ihres Leidens finden, immer wieder als Simulanten diskreditiert werden und dabei oft längere soziale und finanzielle Benachteiligungen in Kauf nehmen müssen.“ (13)
„Läsionen der Halswirbelsäule im Sinne eines Schleudertraumas schädigen den aktiven und passiven Bewegungsapparat des kraniozervikalen Übergangs in einer Weise, die zu einem Beschwerdebild führen kann, dasin seiner Schwere oft in krassem Missverhältnis zur Geringfügigkeit desTraumas selbst steht.“(14)
Zitat aus einem Vorgutachten eines unfallchirurgischen Sachverständigen: „Die Beschwerden der Patientin sind glaubwürdig, aber nicht unfallkausal, weil das Ergebnis des verkehrstechnischen Gutachtens die Annahme einer Verletzung der HWS nicht zulässt.“ (15)
„Es geht in medizinischen Sachverständigengutachten oft um das Problem des rechtlichen Zusammenhangs zwischen der Handlung des Schädigers und der eingetretenen Rechtsgutverletzung, z.B. Körperverletzung, Körperschaden, also darum, ob ein Ursachenzusammenhang zwischen beiden gegeben ist.“ (16)
„Der allergrößte Streitpunkt im Zusammenhang mit Atlasstörungen ist das Halswirbelsäulen-Schleudertrauma …… Dadurch geraten die Kopfgelenke sehr in das Gutachtenwesen hinein, in dem es um die gerichtlicheDurchsetzung von Ansprüchen und um die Anerkennung von Unfallfolgen geht. Hier wird zwar die Wahrheit gesucht, aber, und das ist bekanntermaßen nicht nur in der Medizin so, recht haben und recht bekommen sind zwei sehr unterschiedliche Angelegenheiten. Nennen wir es ein menschliches Grundproblem. In der Realität werden auf Grund dieser Auseinandersetzungen oftmals die Beschwerden von Patienten gänzlich in Frage gestellt und auf psychische Probleme abgeschoben. Ganz ohne Frage haben seelische und emotionale Gründe einen Einfluss und sind zuweilen auch der Auslöser von Schmerzen. Und ebenfalls ohne Frage sind nach langer Schmerzdauer psychische Veränderungen die Regel. Die grundsätzliche Leugnung von Beschwerden, die von der oberen Halswirbelsäule ausgehen, ist aber gerade auf Grund der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar.“ (17)
Nimmt man diese Aussagen als Denkanstoß, verbunden mit eigenen Erfahrungen und den Berichten anderer Betroffener, fügt sich ein Bild der Gesamtproblematik zusammen. An dieser Stelle wage ich einen eigenen Erklärungsansatz.
Alle fünf Zitate gehen auf ein Hauptproblem des – nennen wir es mal - Instabilitäts-Desasters ein. Begriffe wie „unfallkausal“ oder „Ursachenzusammenhang“ machen deutlich, dass es in vielen Fällen auch um die Frage der Schuld und damit der Haftung geht. Verletzungen der Halswirbelsäule sind häufig die Folge von Unfällen verschiedener Art. Wie die Liste der Auslöser zeigt, kommen u.a. Sportunfälle, Verkehrsunfälle, Haushalts- oder Arbeitsunfälle dafür in Frage. Aber auch Auslöser, die man nicht automatisch als Unfall bezeichnen würde, stellen die Beteiligten vor die Kausalitätsproblematik. Denkt man zum Beispiel an die Folgen einer Überstreckung in Vollnarkose oder Verletzungen durch Gewalteinwirkungen. Der gesunde Menschenverstand lässt einen eigentlich zu dem Schluss kommen, dass der Verursacher eines Unfallereignisses auch die Schuld trägt. Da jedoch mit dem Anerkenntnis von Schuld zumeist auch erhebliche finanzielle Folgen einhergehen, hat es sich leider durchgesetzt, Ursachenzusammenhänge erst mal weit von sich zu weisen. Die meisten Betroffenen erleben, dass Versicherungen als erstes die Kausalität von Unfallereignis und eingetretenem Schaden in Frage stellen.
Als Geschädigter ist man dann plötzlich in einer Bringschuld und muss beweisen, dass der Unfall verantwortlich ist für den eingetretenen Schaden. Dabei sind die Hürden unfassbar hoch, denkt man zum Beispiel an die unrühmliche Diskussion der Bagatellgrenze. Danach sind sehr geringe Geschwindigkeiten bei Autounfällen angeblich nicht geeignet, einen bleibenden Schaden an der Halswirbelsäule hervorzurufen. In dem Zusammenhang wird auch regelmäßig das Auto-Scooter-Beispiel herangezogen, wonach ein Zusammenstoß bei niedriger Geschwindigkeit nichts anderes sei, als ein „Rammen“ beim Auto-Scooter.
Unter Umständen wird dem Betroffenen auch eine Aggravation vorgeworfen. Dies ist eine medizinische Bezeichnung für das Übertreiben von Krankheitserscheinungen. Zumeist taucht dieser Vorwurf in Verbindung mit der Haftungsfrage auf. Damit wird dem Geschädigten recht unverblümt vorgehalten, dass er seine Beschwerden übertrieben schlimm darstellt, um eine möglichst hohe Schadenersatzforderung durchsetzen zu können. Der pauschale Vorwurf der Aggravation wird bei genauerer Betrachtung der Realität widerlegt. Wie sich im späteren Verlauf des Buches zeigen wird, leiden die meisten Geschädigten an ähnlichen Beschwerden, völlig unabhängig davon, ob ein Dritter zur Verantwortung gezogen werden kann, was aber die Gegenseite keinesfalls daran hindert, den Vorwurf vorzubringen.
Auch die Diskussion einer Vorschädigung wird immer wieder eröffnet. Ab einem gewissen Lebensalter lässt sich gut mit einer degenerativen Veränderung argumentieren – der berühmte altersbedingte Verschleiß der Bandscheiben zum Beispiel. Dem hat man als Betroffener wenig entgegenzusetzen. Wer macht schon regelmäßig Upright-MRT- oder CT-Aufnahmen seines Körpers, um im Falle eines Falles für solche Argumentationen gewappnet zu sein? Ganz ungeachtet der Tatsache, dass ein altersbedingter Verschleiß nicht automatisch einen Schaden im Bereich der Kopfgelenke begünstigt. Beliebt ist es auch die „Psycho-Karte“ zu ziehen. Das heißt, man wirft dem Geschädigten vor, das Unfallereignis nicht verarbeitet und dadurch psychische Probleme entwickelt zu haben, die das geschilderte Beschwerdebild verursachen. Kurz gesagt, als Geschädigter hat man es oft mit heftigem Gegenwind zu tun.
Zusätzlich erschwert wird diese Problematik häufig auch durch die Tatsache, dass Betroffene selber keinen absoluten Kausalzusammenhang herstellen können. Sieht man von lebensbedrohlichen Schäden ab, wie zum Beispiel Brüchen von Halswirbeln, die man mit den üblichen bildgebenden Verfahren schnell erkennen kann, ist es gerade bei Verletzungen der Halswirbelsäule oft so, dass die Beschwerden erst später auftreten und somit zunächst keiner Ursache zugeordnet werden können. Das war bei mir der Fall und auch bei vielen anderen Betroffenen. Erst als eine abschließende Diagnose vorlag, wurde im Rückblick erkannt, welche Ereignisse dafür auslösend waren. Gerade bei Sportlern kann man dieses Phänomen beobachten. Die üblicherweise sehr gut ausgebildete Muskulatur ist über einen längeren Zeitraum in der Lage, die Schädigung zu kompensieren, bevor diese sich letztlich zeigt und manifestiert. Oftmals ist die Halswirbelsäule auch schon durch ein scheinbar unwichtiges Ereignis aus der Vergangenheit vorgeschädigt und einer erneuter Vorfall löst final die chronischen Beschwerden aus.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, durch welchen es so schwer wird, einer Halswirbelschädigung auf die Spur zu kommen. Wie man anhand der Beschwerdeliste sieht, kann eine Verletzung der Halswirbelsäule einen wilden Symptomemix verursachen. Viele dieser Symptome können auch zu anderen Krankheiten passen, was die Wahrheitsfindung nicht gerade einfacher macht. Die meisten Betroffenen wissen zunächst gar nicht, bei welchem Arzt sie mit ihrem Beschwerdebild vorstellig werden sollen. Egal für welche Fachrichtung man sich entscheidet, der jeweilige Spezialist wird sich nur für den Teil des Körpers interessieren, der in sein jeweiliges Fachgebiet fällt. Es fehlt oft an dem Willen „über den Tellerrand zu schauen“. Oftmals stellt der eigene Hausarzt zunächst die beste Option dar, da dieser seinen Patienten meist schon länger kennt und eine Vertrauensbasis vorhanden ist oder zumindest sein sollte. Gerade bei Halswirbelsäulenschädigungen mit chronischem Beschwerdebild fehlt es an interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Über all diesen Problemen thront die sehr modern gewordene Vorgehensweise, Patienten ganz schnell in die Psycho-Schublade zu stecken. Das ist mein ganz persönliches „Lieblings-Problem“, da ich damit umfangreiche Erfahrungen machen durfte. Es macht mich heute noch wahnsinnig wütend, dass man von mir eine psychiatrische Begutachtung verlangte, obwohl ich einen Berg medizinischer Unterlagen hatte, die eine orthopädische Schädigung belegten. Ich konnte mich zwar erfolgreich gegen die Begutachtung wehren, aber das mildert nicht die Fassungslosigkeit über den Vorgang. Leider bin ich damit nicht alleine. Es scheint regelrecht in Mode gekommen zu sein, Patienten mit ungewöhnlichem Beschwerdebild vorzuverurteilen und ihnen eine psychische Erkrankung zu attestieren. Doch woher kommt diese Psychiatrisierung? Liegt es daran, dass Ärzte das wahre Krankheitsbild nicht erkennen, dies aber nicht zugeben wollen? Ganz nach dem Motto: „Lieber eine psychiatrische Diagnose, als gar keine.“
Oder liegt es möglicherweise an der Lobby der Pharmaindustrie? Bitte verstehen Sie mich hier nicht falsch, ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem ich mir keine Gedanken machen muss, ob ich Antibiotika erhalte, wenn ich sie benötige. Aber es stimmt dennoch nachdenklich, dass man in Deutschland leichter an ein Rezept für Psychopharmaka kommt, als an eine Verordnung für manuelle Therapie. Dem wahren Grund werde ich an dieser Stelle nicht „auf die Schliche kommen“. Interessant finde ich aber in diesem Zusammenhang die Aussage des französischen Soziologen Michel Foucault, wonach die Psychiatrie die Rolle einer gesellschaftlichen Kontrollinstanz und normenstiftenden Machtinstanz spiele, deren Beurteilungen sich gesellschaftlich und politisch auswirken (18).
Wie auch immer dieser Hang zur Psychiatrisierung entstanden ist, für die Betroffenen ergeben sich daraus weitreichende Probleme. Hat man erst eine falsche Diagnose in den Unterlagen, bekommt man diese so gut wie nicht mehr korrigiert. Ein Gutachter schreibt vom anderen ab, so verfestigt sich ein angebliches psychiatrisches Problem immer weiter. Für Gegengutachten muss man zunächst selbst aufkommen und erhält trotzdem keine Garantie auf Korrektur der Krankenakte. Eine psychiatrische Diagnose – und liegt sie noch so weit zurück – wird immer wieder ausgegraben und regelmäßig gegen die Betroffenen verwendet. Nehmen wir das Beispiel eines Verkehrsunfalls mit anschließenden chronischen Halswirbelsäulenproblemen. Hat der Betroffene „dummerweise“ in seiner Krankengeschichte Besuche beim Psychiater oder Psychologen vermerkt – warum auch immer – wird man dies nun gegen ihn verwenden. Die beklagten Halswirbelsäulenbeschwerden werden schnell einer psychischen Belastungsreaktion zugeschrieben und damit ganz einfach die Frage der Haftung abgeschmettert. Diese Vorgehensweise ist leider bittere Realität.
Ein großes Hindernis stellen für viele Halswirbelsäulengeschädigte die ungedeckten Kosten dar. Hat sich erst einmal der Verdacht eingestellt, die Halswirbelsäule könnte der Auslöser allen Übels sein, gibt es zahlreiche Untersuchungsmethoden, um dies auch zu verifizieren. Dazu gehören beispielsweise ein Upright-MRT, eine neurootologische Untersuchung, ein Hirnleistungstest, Genuntersuchungen, die Testung der Augen bei einem Visualtrainer, eine Gesichtsfelduntersuchung, komplexe Labordiagnostik, Röntgen in Funktionsstellung und SPECT-Untersuchung (Sonderform der CT-Untersuchung). Leider fällt fast nichts davon unter herkömmliche Krankenkassenleistungen. Viele Betroffene haben keine andere Wahl, als die Kosten selber aufzubringen, sofern es ihnen irgendwie möglich ist. Da es sich meist um aufwendige Untersuchungsverfahren handelt, sind die Kosten leider entsprechend hoch. Für ein Up-right-MRT fallen durchschnittlich 700,-- bis 800,-- € an. So wird die Frage der Gesundheit ganz schnell eine Frage des Geldbeutels. Je nach Schwere der Schädigung und Anzahl der benötigten Untersuchungen, wird daraus auch schneller als gedacht ein existenzielles Problem. Das kann selbst dann passieren, wenn die Krankenkasse grundsätzlich die Kosten für eine Untersuchung übernehmen würde. Dann muss man als Betroffener aber zunächst einen Arzt finden, der hinter einem steht und die entsprechende Überweisung ausstellt. Ohne ärztliche Begründung wird wahrscheinlich auch die großzügigste Krankenkasse nicht zahlen, so dass wieder nur die Option bleibt, die Kosten selber zu übernehmen.
Als wäre durch die bislang geschilderten Schwierigkeiten nicht schon alles kompliziert genug, werden Halswirbelsäulengeschädigte auch noch mit der Problematik der Unsichtbarkeit konfrontiert. In der Regel sieht man Betroffenen ihr gesundheitliches Problem nicht an. Wir gehen nicht an Krücken, tragen weder Gips, Verband oder Pflaster, äußere Verletzungen sind nicht sichtbar und Merkmale einer körperlichen Behinderung fehlen auch. Mir ist es kürzlich erst wieder passiert, dass ich mit dem typischen Satz bedacht wurde: „Man sieht dir das gar nicht an!“ Ich war auf einer Feier und musste – wie so oft – als eine der ersten gehen. Ich war erschöpft, hatte Muskelschmerzen und war froh, überhaupt etwas länger durchgehalten zu haben. Beim Verabschieden äußerte ich dies dann auch, was den oben zitierten Satz zur Folge hatte. Diese Sätze sind grundsätzlich nie böse gemeint, sie offenbaren aber ein Grundproblem bei der Anerkennung von Halswirbelsäulenschädigungen: man sieht sie nicht. Gut, wenn ich an meine hängende linke Schulter und die oftmals geschwollenen unteren Halswirbel denke, stimmt das nicht hundertprozentig. Aber das sind optische Kleinigkeiten, die einem Laien nicht auffallen. In unserer Gesellschaft ist man anscheinend nur krank, wenn es äußerlich nicht zu übersehen oder gesellschaftlich anerkannt ist. Das ist schon kurios, wenn man bedenkt, dass man Diabetes oder Bluthochdruck auch nicht sehen kann, deren Existenz jedoch niemand in Frage stellen würde. Wenn Sie jemandem erzählen, Sie haben Herzrhythmusstörungen, wird das sofort akzeptiert. Erzählen Sie allerdings, Sie haben eine Halswirbelsäulenschädigung, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit hören. „Das sieht man gar nicht!“
Wenn man das ganze Problem-Spektrum betrachtet, bekommt man ein Gefühl von „David gegen Goliath“. Halswirbelsäulengeschädigte stehen offensichtlich einem übermächtigen Gegner gegenüber. Trotz zumeist sehr schlechter körperlicher Verfassung, kämpfen Betroffene darum, eine ordentliche Diagnose zu erhalten, sie kämpfen um medizinische Hilfe, um Anerkennung ihrer Beschwerden, oftmals um ihre finanzielle Existenz und letztlich um Gerechtigkeit.
Ein neues Buchprojekt
Seit ich das erste Mal konkret mit dem Thema „Kopfgelenksinstabilität“ oder „HWS-Trauma“ in Kontakt kam, sind inzwischen zwölf Jahre vergangen, die Jahre der Ursachenforschung nicht eingerechnet - eine lange Zeit, in der gefühlt wenig bis gar kein Fortschritt für die Betroffenen erzielt wurde. Wenn man die aufgeführten Hürden betrachtet, stellt man sich die Frage: Kann man daran etwas ändern? Wenn ja, wie kann ich dazu beitragen? Diese Frage führte mich die letzten zwei Jahre regelmäßig in einen inneren Konflikt. Auf der einen Seite stand der Wunsch, einfach zu leben ohne Grübeln und Kämpfen. Ich hatte mein Buch geschrieben, meine Geschichte erzählt, eigentlich könnte ich es damit gut sein lassen. Aber es ist ein klassischer Zwiespalt mit dem Engelchen auf der einen und dem Teufelchen auf der anderen Schulter: man bekommt etwas in jedes Ohr geflüstert. So gab es also andererseits auch weiterhin den Wunsch, etwas zu verändern, nach Möglichkeit auch zu helfen. Würde es eventuell etwas bringen, die verschiedenen Einzelschicksale zu bündeln? Könnte ein gemeinsames Buch mit den Geschichten vieler Betroffener für genug Aufmerksamkeit sorgen, dass sich endlich etwas bewegt? Sollte ich versuchen, ein solches Buch zu schreiben? Könnte ich das als medizinischer Laie überhaupt? Fragen über Fragen und über einen längeren Zeitraum keine Antwort in meinem inneren Konflikt! In der Zeit zwischen der Veröffentlichung meines ersten Buches und heute ist eine Menge geschehen, das mich letztlich bei meiner Entscheidungsfindung beeinflusst hat.
Da gab es eine Begegnung, die ich nur als „orthopädisches Missverständnis“ bezeichnen kann, ohne weiter darauf einzugehen. Leider ein teures und zeitaufwendiges Missverständnis. Man lernt auch nach vielen Jahren auf diesem Gebiet nicht aus. Es gab einen Augenarzt, der meine HWS-Beschwerden mit einer Spezialbrille beheben wollte. Die Situation erinnerte mich an die berühmte „Huhn-Ei-Frage“ danach, was zuerst da war. Im übertragenen Sinne kann ich sagen, dass zuerst meine Halswirbelsäulenschädigung vorlag und dann die Sehprobleme folgten. Führen Sie diese Diskussion einmal mit einem Prismenbrillengestell auf dem Kopf; das brachte mich völlig aus dem Gleichgewicht. Ich verließ die Praxis mit einer Spezialbrillenverordnung. Meinen Argumenten war der Arzt nicht zugänglich. Er hatte die „Huhn-Ei-Frage“ ganz offensichtlich anders beantwortet als ich. Die Verordnung landete im Papierkorb. Die Rechnung dieses merkwürdigen Termins reichte ich lieber mal nicht bei meiner Krankenversicherung ein. Dann gab es auch noch den Kampf mit meinem Antrag auf Überprüfung des Grades der Behinderung. Das Amt für soziale Angelegenheiten hatte mir vor vielen Jahren einen Grad der Behinderung (GdB) von 20 zugestanden. Mein Widerspruch damals war erfolglos, also beließ ich es zunächst dabei. Mit dem dazu gewonnenen Wissen wollte ich es aber doch noch einmal versuchen und stellte erneut einen Antrag, dieses Mal vorsorglich direkt über meinen Anwalt. Die Erhöhung des GdB wurde abgelehnt und mein Widerspruch unter totaler Verkennung des Krankheitsbildes ebenfalls zurückgewiesen. Nächster Schritt: Akteneinsicht und Klage einreichen. Der ganze Vorgang zog sich gewaltig in die Länge. Mein Anwalt wartete auf die Übersendung der Akten, um die Klagebegründung fertig zu stellen.
Währenddessen traf mich ein schwerer Schicksalsschlag: meine Mama verstarb völlig unerwartet mit 62 Jahren an einem Darminfarkt. Das riss mir den Boden unter den Füßen weg. Ausgerechnet der Mensch, der mich in all den Jahren des Kampfes und der Krankheit immer unermüdlich unterstützt hatte, der mich angetrieben hatte, nie aufzugeben, immer weiterzukämpfen, war von einem auf den anderen Tag nicht mehr da. Mein ganzer Kampfgeist hatte sich in Luft aufgelöst. Nichts war mir in dem Moment so egal, wie mein GdB. Ich bat meinen Anwalt kurz darauf, meine Klage zurückzunehmen. Ich war kampfesmüde geworden. Vierzehn Jahre nach dem ersten Auftreten der Beschwerden schien mir der Gedanke unerträglich, mich wieder mal untersuchen, begutachten und bewerten zu lassen, um am Ende vermutlich wieder nicht verstanden zu werden. Meine Kraftreserven waren aufgebraucht, und lange Zeit hatte ich die Befürchtung, sie würden sich auch nicht mehr füllen. Aber irgendwann ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass meine Mama sicher geschimpft hätte, weil ich es dem Amt für soziale Angelegenheiten so einfach gemacht hatte. Und sie hätte damit Recht gehabt. Das war der Moment, in dem ich mich dafür entschied, dieses Buch zu schreiben. Der Vollständigkeit halber soll hier auch nicht unerwähnt bleiben, dass ich bei meiner zweiten Untersuchung zur Überprüfung meiner Dienstfähigkeit auf einen bemerkenswerten Amtsarzt traf. Das erste Mal lief es nicht so rund, das habe ich in „Wackelköpfchen“ ausführlich geschildert. Aber dieses Mal fühlte ich mich verstanden; meine Dienstunfähigkeit wurde weiterhin festgestellt. Der Amtsarzt verabschiedete mich mit den Worten: „Machen Sie Ihren Möglichkeiten entsprechend, das Beste aus Ihrem Leben.“ Dieser Satz hat mich nachhaltig berührt und er hat seinen Anteil an meiner Entscheidungsfindung.
Also begab ich mich auf die Suche nach Betroffenen, die ihre Geschichte erzählen möchten. Mein Suchgebiet begrenzte sich auf Deutschland und Österreich. Mit großer Sicherheit würde ich auch über diese Ländergrenzen hinaus weitere Betroffene finden. Es war mir aber wichtig, Geschichten aus Ländern zu erhalten, deren Gesundheitssysteme etc. sich relativ ähnlich sind, um eine Vergleichbarkeit der Problematik sicherzustellen. Ich kontaktierte Selbsthilfegruppen, nutzte die sozialen Medien und alle meine bestehenden E-Mail-Kontakte, bat außerdem zwei meiner Ärzte, entsprechende Flyer zu verteilen und „nervte“ schlichtweg jeden – ob er es hören wollte, oder nicht – mit meinem Suchaufruf.
Herausgekommen sind 19 berührende, spannende, tragische und unglaubliche Geschichten. Jede Geschichte für sich zeigt auf, was ein Leben mit einer Kopfgelenksinstabilität oder ähnlichem Krankheitsbild bedeutet. Jeder erzählt seine Geschichte auf seine ganz eigene Art. Bei den Schwierigkeiten, die jeder einzelne zu bewältigen hat, bleibt es nicht aus, dass hin und wieder auch anklagende Wort fallen, die Dinge zynisch oder mit Galgenhumor geschildert werden. Alle eint aber ungeachtet dessen der Wunsch, mit ihrer Geschichte aufzurütteln, zu helfen und vielleicht zu verändern. Ich ziehe meinen Hut vor diesen Kämpferinnen und Kämpfern und bin ihnen unfassbar dankbar, dass sie dazu beigetragen haben, mein Herzensprojekt zu verwirklichen. Manche Geschichten sind anonym oder unter einem Pseudonym verfasst, andere nennen ihren Namen. Dies war allen Gastautoren freigestellt. Die korrekte Identität und der Wahrheitsgehalt der Geschichten wurden mir gegenüber bestätigt.
Wie Sie schon zu Beginn lesen konnten, handelt es sich um ein hochkomplexes Krankheitsbild. Dabei ist Instabilität nicht gleich Instabilität und kein HWS-Problem ist wie das andere. Neben den bereits erläuterten Begrifflichkeiten soll an dieser Stelle noch kurz erwähnt werden, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen der Krankheit gibt, die aber letztlich alle zum Gesamtthemenkomplex gehören. Dazu zählen beispielsweise: HWS-Trauma, Kopfgelenksinstabilität, chronisches Schleudertrauma, atlanto-axiale Instabilität, cranio-cervicale Instabilität, Ehlers-Danlos-Syndrom, Marfan-Syndrom und Barré-Lieu-Syndrom, um einige zu nennen.
Die in den Geschichten geschilderten Therapieansätze und Behandlungsmethoden beruhen auf den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen und deren jeweiligen individuellen Krankheitsbildern. Diese stellen keine medizinischen Empfehlungen dar und garantieren auch keinen Behandlungserfolg bei Dritten. Dennoch können sie als wichtige Denkanstöße dienen und sollen deshalb aufgezeigt werden.
1. Vom Arzt, der zum Patienten wurde!
Es war ein schöner, warmer Tag im September, als ich mit dem Fahrrad auf der Landstraße Richtung Heidelberg fuhr. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, als ich in der Ferne einen Opel Corsa zügig fahren sah. In einer Kurve kam es dann zur Begegnung. Obwohl ich mich relativ weit rechts hielt, schnitt der Autofahrer seine Kurve in der Ideallinie und ließ sich nach außen tragen. Er hatte nicht gesehen, dass ich dort mit meinem Fahrrad fuhr – wahrscheinlich war er in Gedanken beim letzten Formel-1-Rennen von Monza.
Ein Gefühl der Ohnmacht überkam mich, als ich das Auto direkt auf mich zukommen sah. Alles geschah in Bruchteilen von Sekunden. Obwohl ich noch versuchte auszuweichen, erwischte mich das Auto frontal. Ich stürzte zunächst auf die Motorhaube und dann auf die Straße, Kopf voran. Wie lange ich dort lag, weiß ich nicht mehr. Die Erinnerung daran ist verschwommen – auch ob ich bewusstlos war, kann ich nicht mehr sagen. „Gott sei Dank hast du einen Helm getragen“, dachte ich mir. Mit dem Handy machte ich ein Bild meines Gesichtes um mir einen Überblick über die Verletzungen zu verschaffen. Als Arzt und früherer Rettungssanitäter bin ich gewohnt, zunächst mal Ruhe zu bewahren und das immer gleiche „Programm“ abzuspulen, wenn so etwas passiert. Obwohl ich mein Herz noch bis zum Hals pochen hören konnte, war ich froh, dass ich Herr der Lage war und alles bewegen konnte. Ein paar Schürfwunden im Gesicht, das eine Auge war schon zugeschwollen. Das Knie schmerzte, und auf die Schulter war ich auch gefallen. So lange man alles noch bewegen kann und kein Gelenk in nichtnatürlicher Weise vom Körper ab- oder heraussteht, habe ich ja nochmal Glück gehabt, dachte ich und war innerlich sehr erleichtert. Aus meiner Erfahrung im Rettungsdienst wusste ich sehr genau, dass sich auch ganz andere Eindrücke von derartigen Unfällen ergeben können.
Erinnerungen an unschöne Szenen kamen in mir hoch, von jungen verunfallten Personen, die oftmals noch nicht einmal groß etwas dafür konnten, dass sie sich in dieser Lage befanden, sondern einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Der Fahrer kam auf mich zu, ein junger Mann. Sichtlich bemüht bat ich darum, dass man einen Krankenwagen und die Polizei rufen sollte – wieder so ein Standard aus dem Rettungsdienst. Bei Personenschaden erstmal die Polizei dazu rufen. Innerlich war ich zwar aufgeregt, aber auch irgendwie erleichtert gerade mit dem Leben und ein paar Schürfwunden davon gekommen zu sein. Was der Unfall jedoch für mein weiteres Leben bedeuten würde, konnte ich in diesem Moment noch nicht erahnen.
Es kamen Polizei und Rettungswagen. Die obligatorische Halskrawatte wurde angelegt und wir fuhren mit Blaulicht in die nächstgelegene Universitätsklinik. Irgendwie lustig, dachte ich: Da bist du schon zigmal mit Patienten hingefahren. Jetzt fahren sie dich da mit Blaulicht hin, obwohl es dir doch ganz gut geht, von den paar blauen Flecken abgesehen. Ich gehöre zu denjenigen Personen, die versuchen in allem erstmal das Positive zu sehen: „Guter Perspektivenwechsel“ dachte ich bei mir. „Jetzt kannst du deine Patienten das nächste Mal wieder besser verstehen, wenn sie auf deiner Trage liegen.“ In der chirurgischen Notaufnahme dann das übliche Bild wahrscheinlich jeder Notaufnahme: Überall Patienten, gestresstes Personal und ich durfte in einer kleinen Kabine (immerhin alleine) liegen. Ich kenne das ja selbst aus meiner Arbeit in der Notaufnahme: Zuerst heißt es Triage, also Schwerverletzte haben Vorrang. Da ich davon ausging mit ein paar Blessuren davongekommen zu sein, aber ansonsten noch ganz gut bei Verstand schien, war ich in der Kategorie „kann warten“ eingeteilt. Positiv denkend war ich alles andere als verärgert deswegen, da alles hätte schlimmer sein können.
Es kam die erste Assistenzärztin – sie sah so aus, als hätte man ein Reh auf dunkler Straße mit dem Abblendlicht angeleuchtet. Als junger Assistenzarzt muss man sich an den Stress der Aufnahme oft erst gewöhnen und möchte keine Fehler machen und nun sah sie sich meine Verletzungen an. Sie untersuchte meine Schürfwunden, meldete diverse Röntgenuntersuchungen an, erkundigte sich nach dem Tetanusschutz und nahm mir die Halskrawatte ab. Endlich!! Diese dummen Stehkragen habe ich schon immer gehasst! In der Ausbildung zum Rettungssanitäter haben wir gelernt, wie wir einen Schwerverletzten versorgen. Hier gehört es auch dazu, dass man einmal den Patienten spielt und sich vollständig auf der Trage immobilisieren und eine Halskrawatte anlegen lässt. Ich weiß noch von der Ausbildung, wie beklemmend ich dieses Gefühl damals empfand und wie froh ich war, dieses Ding nach 20 Minuten wieder los geworden zu sein. Wenn ich gewusst hätte, dass eine solche Halskrawatte für die nächsten 10 Wochen mein ständiger Begleiter sein würde, wäre ich wohl die Wände hoch gegangen.
Es folgten Röntgenaufnahmen von Hals, Schulter und Knie. Man sah keinen Bruch. Uff, wieder machte sich die Erleichterung breit. Nach ca. 4 Stunden Wartezeit zwischen keuchenden und weinenden Patienten kam dann der zuständige Facharzt der chirurgischen Aufnahme. Er kam gerade aus dem OP. Chirurgen sind am liebsten im OP, dann muss alles andere warten. „Was haben Sie denn gemacht, Herr Kollege“ scherzte er. „Ich wollte mal sehen wie Sie hier so arbeiten“ entgegnete ich „schließlich ist draußen gerade so schlechtes Wetter“. Es hatte übrigens 25 Grad und schönsten Sonnenschein. Wir verstanden uns auf Anhieb prächtig. Er führte noch einen Ultraschall der Bauchorgane durch und schlug vor noch eine Computertomografie des Schädels zu machen. „Muss das sein?“ fragte ich. Immerhin handelt es sich bei so einer Untersuchung um eine nicht unerhebliche Strahlenbelastung. „Würde ich auf jeden Fall machen“, sagte er. „Da ist gerade ein Corsa mit 40 Sachen in Sie frontal reingerauscht. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch mit mir sprechen“. Also gut, dachte ich. Danach kann ich ja dann nach Hause gehen. Es folgte das erste CT meines Lebens. Alles total easy, viel Platz und nach 5 Minuten war ich wieder draußen. Beunruhigender war es da schon, dass die Schwester unmittelbar nach der Untersuchung wieder zu mir ins Zimmer kam und sagte „Also ich glaube es wäre besser, wenn Sie die Halskrawatte wieder anziehen“. Oh mein Gott. Da wurde es mir das erste Mal Angst und Bange: Was hieß das jetzt? Hatten sie etwas übersehen? Unfälle an der Halswirbelsäule sind aus meinem Gedächtnis immer undankbar – jedenfalls was ich noch aus dem Studium darüber wusste. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Ich hatte ja noch kein Ergebnis, und die Schwestern durften mir nichts sagen. Ich war das erste Mal richtig fertig und hätte anfangen können zu heulen. Mittlerweile war meine Partnerin eingetroffen und versuchte, mich so gut es ging zu beruhigen: „Jetzt warte mal, so schlimm kann es ja nicht sein. Das Röntgenbild war unauffällig und dir geht’s ja bis auf die paar Beulen ganz gut“.
Der Facharzt betrat den Raum und was er genau zu mir sagte weiß ich nicht mehr, nur, dass wir jetzt noch ein MRT machen sollten. Das war schon etwas uncooler. Megaeng, megalaut und so eine bescheuerte Spule vorm Kopf. Ich ertrug es und danach stand die Diagnose fest: okzipitale Kondylenfraktur rechts (Bruch der Gelenkfortsätze des Hinterhauptbeines) mit Gefügestörung der Gelenke C0/C1, knöcherner Ausriss des Ligamentum alare sowie konsekutiver Lateralisierung des Dens axis nach links. Aha. Ich hab ja schon so einiges gehört, aber das war jetzt echt mal was Neues. Man müsste Neurochirurg oder Wirbelsäulenchirurg sein um das zu verstehen. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das jetzt im Genauen für mich weiter heißen sollte: OP oder konservative Versorgung? Würde ich damit Probleme bekommen? Seit ich mich erinnern konnte war ich nie ernsthaft krank gewesen. Schnupfen hatte ich wie alle Männer ertragen und war noch am Leben. Ernstere Verletzungen, bis auf einen unkomplizierten Handgelenkbruch in der Kindheit oder den üblichen Schürf-, Quetsch- und Risswunden, hatte ich noch nie gehabt.
Man verlegte mich direkt auf die „Spine Unit“ der Orthopädischen Universitätsklinik. Ein etwas aufgedrehter Kollege sah mich gegen 23 Uhr (wie sich später heraus stellte, war er der Leiter der Sektion „Wirbelsäule“ und wohl gerade aus einer anstrengenden OP gekommen). Er stellte den radiologischen Befund in Frage und sagte etwas wie „nicht mit dem Leben vereinbar“ und „da kann was nicht ganz stimmen, das wäre ein schweres Krankheitsbild“. So richtig beruhigen konnte er mich damit nicht. Jedenfalls stand schon mal fest, dass ich zur Beobachtung da bleiben müsse. Wieder gingen mir 100 Dinge durch den Kopf: Der Bruch lag an einer äußerst ungünstigen Stelle, die sich in der Nähe des verlängerten Rückenmarks (Medulla oblongata) und einer versorgenden Hirnarterie (A. vertebralis) befindet. Manchmal ist es ein Fluch, zu viel über Medizin zu wissen und zu viel gesehen zu haben, dachte ich noch bei mir. Was ist, wenn es aus dem Bruch zu einer Blutung oder einem Gewebsödem käme (Das passiert oft nach Brüchen. Das Gewebewasser ist eine Reaktion auf einen Bruch). Im verlängerten Rückenmark befindet sich das Elementarste, was das Hirn so zu bieten hat: Das Atemzentrum und die Temperaturregelung. Wäre blöd, wenn da was passiert. Ich hatte echt Todesangst! Ich wurde auf ein Zimmer verlegt. Meinen Bettnachbarn hatte es noch schlimmer erwischt als mich. Er war bei einem Motorradrennen am Hockenheimring gestürzt und hatte fast keine Stelle am Körper, die nicht gebrochen war. Er hatte sogar einen Hubschrauber bekommen. Ich nur einen Rettungswagen mit Blaulicht. Ich war beeindruckt. In diesem Moment hielt ich etwas Sarkasmus ganz gut, um einige Dinge besser zu verarbeiten.
Die Nacht verlief ruhig, ich hatte Kopf- und Nackenschmerzen, mir war schwindlig und ich hatte ein Piepsen auf dem Ohr. Also ließ ich mir ein paarmal von der Nachtschwester etwas bringen. Am nächsten Tag standen dann mehrere Konsile an. Zunächst in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik wegen des Schwindelgefühls und des Ohrgeräusches. Dann in der Hautklinik, wegen der Schmutzeinsprengungen des Straßenasphalts und in der Zahnklinik wegen einer leichten Absprengung der Schneidezähne, die ich mir nebenbei zugezogen hatte. Schließlich noch in der Augenklinik, denn das Auge hatte auch etwas abbekommen. Abends wurde ich dann wieder in der orthopädischen Universitätsklinik abgesetzt und bekam Besuch von der Familie. Am nächsten Morgen durfte ich das Krankenhaus verlassen mit der Maßgabe die Halskrawatte zunächst mal noch 8 Wochen tragen zu müssen, bis der Bruch ganz verheilt sei. Ganz schön doof sowas, kann ich sagen. Wenn ich jetzt durch meinen Beruf Patienten sehe, die mit diesem Ding rumlaufen, sehe ich das mit ganz anderen Augen. Man ist wirklich behindert, kann weder Dinge vom Boden auflesen noch sich entspannt ins Bett legen. Ständig hält einer einem den Hals und Nacken, wie bei einer Giraffe die einen Regenschirm verschluckt hat, nach oben. Solange nur alles gut verheilt, sollte es mir aber Recht sein. Schwindel und Ohrgeräusch waren noch da, aber man sagte mir, dass das am ehesten im Rahmen der Gehirnerschütterung zu sehen ist und einfach etwas Zeit brauche bis es wieder verginge.
Zu Hause angekommen war ich erstmal krankgeschrieben. Mein damaliger Chef war zwar sehr unerfreut, da auch er noch nichts von einer solchen Verletzung gehört hatte und machte den Vorschlag, mit Halskrause könne man doch zumindest Arztbriefe schreiben. Aber der Schwindel und der Tinnitus hatten mich fest im Griff und ich beschloss die Zeit mit Halskrause zu Hause „abzusitzen“, da ich auch keine Lust hatte von allen und jedem auf die augenscheinliche Situation angesprochen zu werden. Ich bemühte mich parallel um eine Zweitmeinung bei einem sehr renommierten Wirbelsäulenspezialisten in Heidelberg, der mittlerweile emeritiert, also in Rente war. Unzählige auch komplexeste Wirbelsäulenoperationen gehen auf sein Konto. Er hat nicht nur eigene Operationsinstrumente, sondern auch ganze OPs entwickelt, die nach ihm benannt wurden. Kurzum wollte ich diese Koryphäe kennen lernen und um seine Erfahrung und Einschätzung bitten. Nachdem ich seine Sekretärin so lange genervt hatte, dass er neben allen privaten arabischen Patienten meine CT-Bilder, die ich ihm zugeschickt hatte begutachtet, klingelte bei mir zu Hause das Telefon. Ich wusste erst gar nicht wer dran ist, aber er kam direkt zur Sache und murmelte etwas von „müssen nochmal ein paar Bilder machen“ und „wir haben ein 3-Tesla-MRT hier im Haus, am besten kommen sie gleich“. Zur Erklärung: In Tesla wird die Feldstärke des MRT gemessen. Je höher, desto schönere Bilder – jedenfalls habe ich mir das im Studium mal so gemerkt. 3 Tesla ist schon mal ziemlich gut würde ich sagen. Ich setzte mich also ins Taxi und fuhr mit Halskrause in eine große Privatklinik in Heidelberg, wo ansonsten Fußballprofis aus Deutschland ihre Knie untersuchen lassen und fand mich mal wieder – sie werden es erahnen – mit Kopfspule im MRT wieder. Ich war echt fertig an dem Tag und musste heulen. Die Vorstellung operiert zu werden und die Folgen und Risiken, die sich aus einem solchen Eingriff ergeben würden waren zu viel für mich. Die medizinisch-technischen Assistentinnen taten ihr Bestes und beruhigten mich so gut sie konnten; ich lag über eine Stunde im MRT. Dadurch, dass alle Strukturen am Übergang zwischen Kopf und Hals so fein sind, müssen sehr dünne „Schichten“ gefahren werden, die enorm viel Zeit kosten, während man in völliger Stille daliegen muss. Nachdem die Untersuchung abgeschlossen war sagte die MTA, die mir die Spule vorm Gesicht entfernte: „Der Herr Professor ist selbst da und schaut sich gerade die Bilder an. Er ist extra aus der OP gekommen. Das ist sehr ungewöhnlich und macht er sonst nie.“
Da saß ich nun. Noch mit etwas verheulten Augen und 2 Köpfe größer als die Koryphäe, von der ich schon so viel gehört hatte. Er kam auf mich zu und erzählte mir, dass wir noch ein Spezial-CT machen müssten, bei dem der Kopf gedreht wird um das vollständige Ausmaß der Verletzung beurteilen zu können. Am besten natürlich wieder sofort und in seiner alten Klinik ca. 70 km entfernt, die er über Jahre geprägt hat und die genau wisse, welche Diagnostik er benötigt (Anm.: Weil er es ihnen bestimmt tausendmal eingeimpft hat). Ich rief also meine Eltern an und fragte, ob sie mich direkt mal eben kurz 70 Kilometer in seine alte Klinik fahren könnten. Dort angekommen wurde ich mit offenen Armen empfangen („Sind Sie der Patient fürs Dvorak-CT?“ Darauf ich: „Bitte was?“ MTA: „Kommen Sie von Prof. XY und wurden uns angekündigt?“ ich: „Wusste gar nicht, dass ich schon so berühmt bin“).
Mit den Bildern wieder zurück nach Heidelberg und wie ich es fast nicht anders erwartet hatte, saß er da noch und arbeitete an seinem Computer. Um 21 Uhr abends! Wir führten ein Gespräch in dem er mir zu verstehen gab, dass man operieren sollte, da es ansonsten sehr unangenehme Schmerzen und sonstige Probleme geben könne und es sich um eine Instabilität der oberen Halswirbelsäule (also Diagnose: Wackelköpfchen) handele mit der nicht zu spaßen sei. Der Befund sei: „hocheindeutig“. Experimentell wollte er sodann eine Platte von der Kopfhinterseite in den ersten Halswirbelkörper einbringen. „Die nehmen wir in einem Jahr wieder raus oder lassen sie drin. Das sehen wir dann mal“. Das Vorgehen zeigt, wie selten eine solche Verletzung ist. Nämlich so sehr, dass es überhaupt kein Standardvorgehen dafür gibt. Ich entschied mich nach einer kurzen Nacht mit wenig Schlaf gegen einen operativen Eingriff. Risiko und Erfolgsaussichten standen für mich nicht im Verhältnis.
Nach 8 Wochen erfolgte eine Kontrolluntersuchung bei einem anderen Wirbelsäulenspezialisten der Uniklinik. „Der Kopf ist ja noch dran“ scherzte er. Es erfolgte ein erneutes CT und die Empfehlung noch für weitere 2-3 Wochen die starre Halskrawatte zu tragen, weil der Bruchspalt noch sichtbar sei. Danach würde ich das Ding endlich ablegen können. Dann war der Tag endlich gekommen. Ich werde diesen Moment nie vergessen: Wenn man nach 10 Wochen ohne längere Unterbrechung das erste Mal die starre Halskrawatte abnimmt, ist es, als ob der Kopf wie ein rohes Ei auf einer Wolke aus Schaum balanciert. Jede Kopfbewegung tut weh. Man kann seinen Kopf nicht zur Seite drehen und nicht nach oben oder unten schauen. Man muss sich echt erstmal zusammennehmen, um keine Panik zu bekommen. Nach 30 Minuten zog ich den Kragen freiwillig wieder an und beschloss, dass ich es ein paar Stunden später noch einmal probieren wolle. Die Muskulatur hatte sich verkürzt und war abgebaut. Ich musste mich erst langsam wieder daran gewöhnen meine eigene „Wassermelone“ mit einem Gewicht von 4-5 kg auf dem Hals zu tragen. Klingt total doof, weil man es ansonsten ja immer automatisch macht und überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet. Ich war aber froh, wieder normal atmen zu können. Ich war erleichtert, weil ich dachte, nun wieder mein altes Leben leben zu können. Der Schwindel und der Tinnitus waren noch da, was mich etwas beunruhigte. Aber wenigstens konnte ich wieder meinen eigenen Kopf zwischen den Schultern tragen.
Die Wochen danach machte ich sehr langsam. Bei der Arbeit war ich in meinem Alltag naturgemäß eingeschränkt. Wenn man wie ich gewohnt ist, viele Dinge auf einmal zu machen und parallel zu bearbeiten muss man sich erstmal an ein langsames Arbeitstempo im Rentnermodus gewöhnen. Vor dem Unfall war ich als Arzt im OP eingeteilt. Zwischen den OPs schrieb ich Arztbriefe, telefonierte mit den Schwestern und Kollegen und kümmerte mich parallel noch um meine Freizeitgestaltung am Abend oder dem bevorstehenden Wochenende. Nach einer OP musste ich das erste Mal feststellen wie es ist, auf einmal nicht mehr scharf sehen zu können, wenn man operiert. Dass einem dabei schwindelig wird und dass man ständig Nackenschmerzen hat. Für die Nächte ließ ich mir etwas verschreiben um wegen des Tinnitus nicht wach zu liegen. Die Briefe machte ich bei der Arbeit lieber in Ruhe auf Station, nicht mehr zwischendurch. Ich brauchte viel mehr Zeit für mich, um mich zu „Sammeln“ und ließ mich des Öfteren im OP ablösen. Die Kolleginnen und Kollegen machten schon ihre kleinen Scherzchen indem sie sagten „Willst du schon in Rente gehen?“ oder wenn ich wegen des Schwindels nicht mehr ganz kerzengrade gelaufen bin „Hast du schon einen gezwitschert?“. Ich war wegen dieser liebevollen Neckereien nie böse. Im Gegenteil: Ich fand es gut, dass man offen damit umgeht und nicht hinter dem Rücken getuschelt wird. Es zeigte mir aber auch, dass ich nach dem Unfall noch nicht ganz auf der Höhe war.
Es vergingen die Wochen, Monate und Jahre nach dem Unfall. Ich ließ mich wegen Nackenbeschwerden behandeln, machte eine erweiterte ambulante Physiotherapie, Reha, Akupunktur, Osteopathie, nahm zahlreiche Medikamente für und gegen alle möglichen Symptome wie Schwindel, Ohrgeräusche und Nackenschmerzen ein. So richtig befriedigend half nichts! Noch immer leide ich unter den Symptomen, durch die sich fast mein gesamtes Privat- und Berufsleben grundlegend geändert haben: Früher ging ich nach jedem Arbeitstag, ganz gleich wie stressig er auch war, noch zum Sport. Entweder ins Fitnessstudio, Joggen oder Radfahren. Limits gab es kaum und es tat einfach gut noch etwas für sich selbst zu tun und den Kopf frei zu bekommen vom Alltag. Heute nach dem Unfall bin ich froh, wenn ich mit der Arbeit überhaupt fertig werde. Immer wieder muss ich die Arbeit unterbrechen wegen Schwindelgefühlen, Augenflimmern oder Nackenschmerzen. Mein Arm schläft ein, ich fühle mich unsicher. Ich mache dann meine Stabilisationsübungen, wie sie mir mein Physiotherapeut beigebracht hat. Es fällt auch schwer mich damit zu konzentrieren, denn man muss sich richtiggehend zusammenreißen, um noch einen klaren Gedanken fassen zu können. Ich habe das Glück bei einem Arbeitgeber gelandet zu sein, der großes Verständnis für meine Einschränkungen hat. So kann ich auch morgens nach dem Aufstehen etwas später zur Arbeit kommen, wenn der Schwindel mal wieder nicht verschwinden will oder etwas früher nach Hause gehen, wenn die Stabilisationsübungen nicht den gewünschten Effekt zeigen. Ich habe verständnisvolle Kollegen, die für mich einspringen können. Wenn man es nicht so machen könnte, müsste ich mich noch wesentlich häufiger krankmelden, als bisher.
Zu allem Übel kam dann noch die Tatsache, dass sich meine damalige Partnerin, mit der ich einen gemeinsamen Sohn habe, von mir trennte. Für sie war es auch eine zusätzliche Belastung, dass ich unter den Symptomen litt. Obwohl ich stets versuchte mich zusammen zu reißen, ist man doch nicht mehr derjenige, der man vorher war und das spiegelt sich leider auch in der Beziehung wieder. Sie hat mich gut unterstützt, Verständnis gezeigt, aber es wurde ihr schlussendlich doch alles zu viel. Heute haben wir uns das Sorgerecht für unseren Sohn aufgeteilt und ich darf ihn fast jedes Wochenende sehen. Natürlich fallen einige Dinge weg, die man sonst gerne mit seinem 4-jährigen Sohn machen würde: Auf den Schultern tragen, Rennen, ausgelassen Toben – das geht aufgrund der Einschränkungen nicht mehr. Mir wird sofort schwindelig und übel, ich bekomme starke Nackenschmerzen. Aber wir machen dafür andere schöne Dinge zusammen.