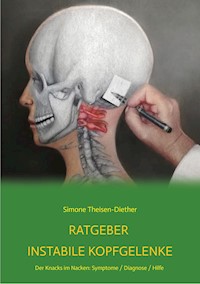3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit einem Schlag hatte sich alles verändert. So, oder so ähnlich, beginnen oft Geschichten über Schicksalsschläge. Hier war es anders, der Prozess verlief schleichend, die Beschwerden kamen erst nach und nach, wodurch es vermutlich umso schwerer war, dem Problem auf die Schliche zu kommen. Am Ende einer jahrelangen Odyssee durch Arztpraxen stand eine erstaunliche Diagnose: Kopfgelenksinstabilität. Nachdem endlich Klarheit herrschte, tat sich ein neues Problem auf: Der Amtsschimmel begann zu wiehern! Die Frage der Dienstfähigkeit entwickelte sich zum behördlichen Spießrutenlauf. Am Ende stand der Gewinn von Lebensqualität. Dieses Buch ist kein medizinischer Ratgeber, vielmehr ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Simone Theisen-Diether, Jahrgang 1976, lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Koblenz. Sie hat einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und verfügt über langjährige Erfahrung in der Kommunalverwaltung. Auch in ihrer Freizeit interessiert sie das kommunale Geschehen, woraus zwischenzeitlich ein Mandat im Stadtrat wurde. Die Inspiration fürs Schreiben ergab sich aus ihrer eigenen Krankheitsgeschichte und den damit verbundenen Erlebnissen.
Simone Theisen-Diether
Wackelköpfchen
Mein Leben mit einer
Kopfgelenksinstabilität
© 2016 Simone Theisen-Diether
Autor: Simone Theisen-Diether
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback:
978-3-7345-6016-3
ISBN Hardcover:
978-3-7345-6017-0
ISBN e-Book:
978-3-7345-6018-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Der Anfang
Kein Ende in Sicht oder "Bloß nicht aufgeben!"
Die Diagnose
Neustart mit Hindernissen
Endlich auch orthopädische Hilfe
Der Genosse
2010-2014:Licht und Schatten
Nikolaus 2014
2015 oder "Schlimmer geht immer!"
Die Upright-Kernspintomographie
Die neurootologische Untersuchung
Der Hirnleistungstest
Dienstunfähig?
Dienstunfähig - und nun?
Fazit: Das Leben mit einer Kopfgelenksinstabilität
Was ich noch sagen wollte
Literaturnachweise
Tagebucheintrag, Freitag, 29. Juli 2016: Ich fühle mich gerade echt beschissen. Die Hitzewelle ist seit gestern vorbei. Eigentlich Grund zum Aufatmen. Aber irgendwie muss ich heute Morgen eine falsche Bewegung gemacht haben. Vermutlich beim Umräumen im Vorratsraum, danach ging es los. Zuerst kamen die Kopfschmerzen, dann ging der Nacken zu. Als ich mich auf dem Stuhl sitzend seitlich zu einer Schublade beugte, drehte sich alles. Also das volle Programm, aus dem Nichts heraus. Nach 30 Sekunden war das wieder o. k., aber seitdem habe ich Schmerzen im Nacken-, Schulterbereich und der Kopf ist total zu. Auf dem linken Auge sehe ich graue Punkte. Ganz toll, heute ist Freitag. Jetzt kann ich das ganze Wochenende schauen, wie ich die Probleme in den Griff bekomme, einen Physio-Termin bekomme ich vor nächster Woche nicht. Mal wieder Opfer der Unberechenbarkeit geworden.......
Der Anfang
Dass irgendetwas nicht stimmte, merkte ich zum ersten Mal Ostersonntag 2004 in der Kirche. Mir wurde schlecht, mein Kreislauf machte mir zu schaffen. Ich verließ die Kirche und setzte mich draußen auf die Mauer. Nach kurzer Zeit war alles wieder in Ordnung. Der Vorfall war zwar ungewöhnlich, aber mal ehrlich, wer macht sich denn ernsthaft darüber Gedanken, wenn es einem einmal nicht gut geht. Volle Kirche, enge Bänke etc., da war ich wahrlich nicht die Erste, die das nicht vertrug. Gut, das war vorher noch nie vorgekommen, aber trotzdem schnell wieder verdrängt. Zumindest bis zum nächsten Tag. Da war ich mit Freunden in einem Lokal verabredet. Kaum saß ich am Tisch, ging es wieder los. Ich hatte das Gefühl, kurz vor einer Ohnmacht zu stehen, die Gespräche am Tisch bekam ich gar nicht mehr mit und mein Blick war auch irgendwie getrübt. Ich fühlte mich wie unter einer Dunstglocke. Ich erinnere mich noch, dass ich schnell das servierte Wasser trank, mit der Hoffnung auf Besserung, geholfen hat es aber nicht viel. Mit dem Gedanken, an einen Magen-Darm-Infekt oder eine anrollende Grippe, ließ ich mich lieber wieder nach Hause fahren. Noch am gleichen Tag wurde es wieder besser und ich hakte das Thema ab.
Eine ganze Weile war alles beim Alten, aber das war es natürlich noch lange nicht. Im Laufe des Jahres 2004 hatte ich immer wieder mit Übelkeit und Magenproblemen zu tun, und das, obwohl ich eigentlich immer über einen sprichwörtlichen „Saumagen“ verfügt habe. Unvermeidbar landete ich dann auch irgendwann bei einer Magenspiegelung, die aber zu keinem Ergebnis führte. „Reizmagen“ lautete die wenig zufriedenstellende Diagnose. Aber damals dachte ich mir, lieber einen Reizmagen als andere fiese Dinge, die ein Gastroenterologe hätte finden können. An Galgenhumor mangelte es mir zum Glück nie. Nun gut, ich versorgte mich in der Apotheke mit „Iberogast-Tropfen“ und „Maaloxan-Tütchen“, die fortan mein stetiger Begleiter wurden.
„Viel hilft viel“ wurde meine Devise und so nahm ich bei jedem Anflug von Übelkeit und Magenproblemen eine Ladung aus meiner Handtaschen-Apotheke. So wirklich geholfen hat das nicht, aber mangels Alternativen oder anderer Ideen ging das so über Monate.
In dieser Zeit war ich noch ehrenamtlich als Übungsleiterin beim Judo aktiv. Immer öfter bemerkte ich während des Trainings ein Unwohlsein, ein leichtes Benommenheitsgefühl oder Übelkeit. Das zog sich über einen längeren Zeitraum. Es verging kaum eine Trainingseinheit ohne Probleme. Ich wusste zwar nicht, was genau mit mir los war, aber ich merkte, dass ich nicht mehr in der Lage war, den Kindern die Übungen korrekt vorzumachen. Während der Betreuung an einem Wettkampftag saß ich am Mattenrand und dachte zunächst, meine Brille sei beschlagen, ich sah meine Umgebung verschwommen, wie durch eine Nebelwand. Nach kurzer Zeit besserte sich meine Sicht wieder. Aber solche Vorfälle kamen immer wieder vor. Ohne das Ausmaß der körperlichen Schädigung auch nur zu erahnen, spürte ich instinktiv, dass nach 21 Jahren nun Schluss sein musste mit Judo. Mein Körper war den Anforderungen an diesen Sport einfach nicht mehr gewachsen. Unbewusst ahnte ich wohl bereits, dass eine Sportpause mein Problem auch nicht lösen würde. Also vollzog ich einen kompletten Schnitt und kehrte der Judomatte den Rücken. Dieser Schritt war für mich sehr schmerzhaft und es verging eine lange Zeit, bis ich wieder eine Judohalle betreten konnte, ohne traurig zu werden. Vor einiger Zeit traf ich zufällig eine alte Freundin aus Judotagen, der es ähnlich gegangen war. Sie musste ebenfalls verletzungsbedingt mit Judo aufhören. Genauso, wie sie sich dabei fühlte, erging es mir auch. Man gerät irgendwie in eine Identitätskrise, wenn man sein ganzes Leben dem Sport gewidmet hat und sich dann von heute auf morgen alles ändert.
Heute kann ich deutlich besser damit umgehen. Das Mitfiebern bei Judokämpfen macht mir wieder Spaß und ich habe auch wieder Kontakt zu einigen Trainingskameraden aus dieser Zeit. Dennoch war der zeitliche Abstand wichtig, um das „Matten-Aus“ richtig zu verdauen.
* * *
Judo – der sanfte Weg!
Mit sieben Jahren kam ich – eher zufällig – zum Judo. Niemand in meiner Familie hatte zuvor Erfahrung mit diesem Sport gemacht. Ein Bericht in einer Lokalzeitung hatte das Interesse meiner Eltern geweckt. Eine junge Frau konnte sich dank ihrer Judokenntnisse gegen einen männlichen Angreifer wehren. „Den Sport sollten wir uns mal anschauen“, wurde schnell entschieden. Und so machte ich kurz darauf die erste Bekanntschaft mit einer Judomatte, als ich mir ein Training im Nachbarort anschaute. Ich war sofort fasziniert von den vielen Menschen in den weißen Anzügen und den grünen und roten Matten, die in korrekten Mustern auf dem Hallenboden lagen. Die anwesenden Kinder schienen Spaß zu haben, das wollte ich auch versuchen.
Kurz darauf startete ein Anfängerlehrgang, zu welchem ich mich anmeldete. In einer kleinen Gruppe lernten wir zunächst einmal pro Woche die Grundtechniken, wie richtiges Fallen, Abschlagen, Judorolle, den ersten Wurf und den ersten Haltegriff. Am Ende des Anfängerkurses stand die erste Gürtelprüfung an. Davor hatten wir alle gehörig Respekt, aber der Trainer trickste uns geschickt aus. Er gab an, dass wir die bevorstehende Gürtelprüfung zunächst in einer Generalprobe üben würden. Nach Beendigung der Generalprobe gratulierte er uns allen zum bestandenen Gelbgurt. Geniale Idee, das hätte ich mir bei manch späterer Prüfung – nicht nur im Sport – auch gewünscht. Mit dem ersten Gürtel rückte auch der erste Wettkampf näher. So richtig motiviert war ich nicht, besser gesagt, ich hatte Angst. Der Wettkampf war auch nicht wirklich erfolgreich, ich bekam zweimal ordentlich „auf die Mütze“ und verlor meine Kämpfe. Aber irgendwie weckte das meinen Ehrgeiz, das sollte mir nicht noch mal passieren. Aus einmal Training in der Woche wurden zweimal, einige Jahre später dann dreimal plus weitere Einheiten im Kraftraum. Der Judoverein wurde zu meiner zweiten Familie.
Wettkämpfe und Gürtelprüfungen ängstigten mich nicht mehr, ich hatte Spaß daran, mich mit anderen zu messen. Ich wurde in verschiedenen Altersklassen Rheinlandmeisterin und auch Rheinland-Pfalz-Meisterin, wurde in die Rheinland-Auswahl berufen und reiste – mal mit dem Verein, mal alleine mit meinen Eltern – durch Deutschland um Turniere zu bestreiten. Den ein oder anderen Gewinn eines international besetzten Jugendturniers konnte ich auch verzeichnen. Um mich weiterzuentwickeln, nahm ich an Gasttrainings in anderen Vereinen teil und besuchte regelmäßig Lehrgänge.
In meinen intensivsten Wettkampfjahren hatte ich einen enormen Trainingsumfang. Von der damaligen Fitness hätte ich heute noch gerne etwas. Dreimal pro Woche stand meine Trainingsgruppe auf der Matte. Zusätzlich trafen wir uns im Kraftraum oder absolvierten Konditionstraining. Tempo-Steigerungsläufe am Rhein waren besonders beliebt. An den trainingsfreien Tagen wurde häufig noch in Eigenregie geübt. So hatte ich zum Beispiel selbstkonstruierte Wackel-Holzbretter, auf denen ich mein Gleichgewicht schulte. Auch im Urlaub in den Sommerferien zog ich die Laufschuhe an. Aber der Aufwand hatte sich gelohnt. Zwar wurde ich weder Deutsche Meisterin noch Mitglied in der Nationalmannschaft, aber für mein persönliches Empfinden war ich weit gekommen und ich erfreue mich noch heute an den errungenen Pokalen, die auf dem Speicher stehen.
Neben den eigenen Wettkampferfolgen, gab es auch Trainingserlebnisse, die man nicht mehr vergisst. Ich kam in meinem Verein hin und wieder in den Genuss, mit einem Europameister und zweimaligen Olympia-Fünften zu trainieren. Das war dann zwar kein Training auf Augenhöhe, aber hinterher strotzte man trotzdem vor Stolz. Im Rahmen der Olympiavorbereitung im Jahr 1992 gab der Bundestrainer der Herrennationalmannschaft in unserem Verein ein Gasttraining, an dem ich teilnehmen durfte, so etwas bleibt unvergessen.
Das Ziel eines jeden Judokas ist der schwarze Gürtel. Mit 17 Jahren hatte ich es geschafft. Ich war das einziges Mädchen in meiner Prüfungsgruppe und unglaublich stolz, endlich den 1. Dan tragen zu dürfen.
Auch wenn es heißt „der sanfte Weg“, der Sport ist hart. Irgendein Körperteil ist immer mit Tape umwickelt, meine Liste von Prellungen, Zerrungen oder Kapselrissen ist lang. Besonders fies war immer der sog. Mattenbrand. Das passiert, wenn man mit hoher Geschwindigkeit mit der Haut über die Matte scheuert. Brennt und sieht blöd aus. Wenn man mal den möglichen Zusammenhang zwischen dem Judosport und meiner Halsverletzung außer Acht lässt, bin ich ansonsten aber ganz gut weggekommen. Die schlimmste bewusste Verletzung war eine Nierenprellung, die ich mir während des Trainings zuzog. Einen Tag nach dem unsanften Aufkommen begann meine rechte Körperhälfte anzuschwellen. Ich kam mir vor, wie halbseitig schwanger. Laut Urologe hatte ich zwar keine bleibenden Schäden zu befürchten, aber es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich wieder mehr anziehen konnte, als schlabberige Jogginghosen. Ungünstig war allerdings der Zeitpunkt, wenige Monate vor dem Abitur. Damals überlegte ich mir, die Seiten zu wechseln, vom Wettkämpfer zum Übungsleiter.
Aber das Leben im Judoverein bestand nicht nur aus harten Trainingseinheiten, Wettkämpfen und Gürtelprüfungen. Wir haben auch viel gefeiert. Wir ließen keine Gelegenheit aus, um hinter der Sporthalle Würstchen auf den Grill zu legen. Mehrfach nahmen wir an Fahrten in französische Partnerstädte teil und empfingen im Gegenzug Gäste aus Frankreich. Der Höhepunkt für mich, wie vermutlich für die ganze Trainingsgruppe, war unsere Japanreise. Im Jahr 1994 nahmen wir am Deutsch-Japanischen-Simultanaustausch des deutschen Sportbundes teil und verbrachten drei spannende Wochen im Mutterland des Judo.
Rückblickend kann ich sagen, die Jahre im Judoverein waren großartig. Eine Erfahrung, die mich für mein gesamtes Leben geprägt hat und die mit Sicherheit großen Anteil daran hat, dass ich in meinem Kampf um die Wahrheit nie aufgegeben habe. Judo ist ein besonderer Sport, der sich an besonderen Werten orientiert. Der Deutsche Judo-Bund (www.judobund.de) hat insgesamt 10 Werte herausgestellt, die durch Judo in besonderer Weise vermittelt werden können. Die beiden nachfolgenden Werte haben mich persönlich am meisten beeinflusst und mir in meinem Leben - auch außerhalb der Judomatte - oftmals geholfen:
Mut
„Nimm im Randori (Übungskampf) und Wettkampf dein Herz in die Hand. Gib dich niemals auf, auch nicht bei einer drohenden Niederlage oder bei einem scheinbar übermächtigen Gegner.“
und
Selbstbeherrschung
„Achte auf Pünktlichkeit und Disziplin bei Training und Wettkampf. Verliere auf der Matte nie die Beherrschung, auch nicht bei Situationen, die du als unfair empfindest.“
* * *
Kein Ende in Sicht oder „Bloß nicht aufgeben“!
Der Sport hatte einen enormen Teil meiner Zeit beansprucht. Was sollte ich nun mit der vielen Freizeit anfangen? Irgendwie führte mich der Weg zum örtlichen CDU-Vorsitzenden und so landete ich in der Kommunalpolitik. Kommunalrecht hatte mich schon an der Fachhochschule interessiert, das müsste doch der passende Sport-Ersatz sein, dachte ich mir. Wie genial diese Entscheidung war, sollte ich erst nach fünf Jahren realisieren.
Der Verzicht auf meinen Judosport hatte natürlich nicht zur Folge, dass meine gesundheitlichen Probleme besser wurden. Weit gefehlt, im Jahr 2005 ging es erst richtig los. Nachdem sich neben Übelkeit, Magenproblemen usw. nach und nach auch nervige Kopfschmerzen meldeten und sich der Kopf im Ganzen zunehmend merkwürdig anfühlte, keimte in mir der Verdacht auf, dass ich es hier mit mehr zu tun hatte, als einem „Reizmagen“. Rückblickend betrachtet, hatte ich damals bereits kurzzeitig meinen Nacken in Verdacht.
Und dann kam der 31.Mai 2005. Dieses Datum ist mein persönlicher Stichtag, da damals erstmalig mein Hals ins Spiel kam. Ich war mit meiner Arbeitskollegin bei einer Fortbildung in Bonn. Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, wurde der Vortrag durch eine Beamer-Präsentation unterstützt. Um einen guten Blick zu haben, saß ich mit leicht nach hinten geneigtem Kopf dort. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es dauerte, bis mir schlecht wurde, aber es kam ohne Vorwarnung und war deutlich heftiger als zuvor. Mir war übel, heiß und kalt zugleich und meine Beine wurden zitterig. Was tun? Einige Zeit habe ich noch versucht, mich auf meinem Stuhl zu halten, aber es ging nicht mehr. Mit meiner bereits bekannten Handtaschen-Apotheke ging ich zur Toilette und versuchte den Zustand mit meinen Hausmitteln in den Griff zu bekommen. Keine Chance. Ich war im Kopf so benommen und mir war so schlecht, dass meine Kollegin und ich die Fortbildung abbrachen und heimfuhren.
Völlig verschreckt suchte ich am nächsten Tag meinen Hausarzt auf. Dieser diagnostizierte einen verspannten Nacken und verwies mich an einen Physiotherapeuten. Zu diesem Zeitpunkt noch völlig ahnungslos hinsichtlich Anatomie und Empfindlichkeit der Kopf-Hals-Region, ließ ich mich mehrfach „einrenken“. Im ersten Moment sorgte es auch immer für Linderung; nur hielt diese leider nicht lange an.
Nachdem ich im Anschluss an den 31-Mai-Vorfall zwei Wochen krankgeschrieben war, freute ich mich, wieder arbeiten gehen zu dürfen. Schließlich stand der lange von mir geplante Abteilungsausflug an. So viel vorab, dieser Ausflug endete für mich nicht, wie erhofft.
* * *
Die Behörde
Nach dem Abitur begann ich im Alter von 19 Jahren die Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin in einer Behörde. Dabei handelte es sich um einen dualen Ausbildungsgang, der sich in 50% praktische Ausbildung vor Ort und 50% Theorie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung aufteilte. Ohne Zweifel, die drei Ausbildungsjahre waren eine ziemlich gute Zeit. Ich fühlte mich auf Anhieb wohl und fand schnell Anschluss. Regelmäßige Azubi-Feiern sorgten für ein gutes Klima, genauso wie Mittagspausen beim Italiener oder die wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaft, wobei in diesem Fall die Betonung nicht unbedingt auf „Arbeit“ lag. Die Behörde war groß genug, um Einblick in vieleverschiedene Bereiche zu erhalten, aber trotzdem noch so überschaubar, dass man die meisten der Kollegen irgendwann – zumindest vom Sehen – kannte.
Auch die Zeiten an der Fachhochschule waren absolut in Ordnung. Klar, den Stoff musste man irgendwie lernen, aber dafür war bereits mittags Feierabend. Fast schon Luxus, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Über die Funktion der Kurssprecherin landete ich irgendwann auch in der Studentenvertretung. So etwas passiert mir immer wieder, da ich nur schwer meine Meinung zurückhalten kann. So wurde ich einige Zeit später in der Behörde auch zur Stellvertreterin des Jugendvertreters gewählt. Aber der Vorteil an diesen Posten ist, dass man neben den üblichen Aufgaben auch die Festivitäten planen darf. Daran hatte ich Gefallen gefunden. Ich war also rundum integriert und bereute zu keinem Zeitpunkt, diesen beruflichen Weg eingeschlagen zu haben.
Nach bestandener Prüfung im Jahr 1999 erhielt ich eine Stelle im Referat „Organisation“. Besser konnte es nicht laufen. Ich war während der Ausbildung oft dort eingesetzt, mochte die Kollegen und die Arbeit war interessant. Die ständige Nähe zur Behördenleitung muss man zwar mögen und der Sitzungsdienst bei den politischen Gremien ist auch nicht jedermanns Sache, aber für mich war es und wäre es auch heutenoch – zumindest inhaltlich betrachtet – meine Traumstelle. Wir waren eine gute Truppe und so lag es nahe, dass wir nicht nur zusammen arbeiteten, sondern auch gemeinsam feierten. Meine Begeisterung für die Organisation von Festen und dergleichen fiel bei den Kollegen auf fruchtbaren Boden. Alles begann mit der spontanen Idee, mit der Abteilung an der jährlichen Karnevalsveranstaltung in einheitlichen Kostümen aufzutreten. In dem Jahr mussten wir besonders viel Unmut der Belegschafteinstecken, da aufgrund von Um- und Anbauarbeiten viele Kollegen in andere Büros umziehen mussten. Also lag das Kostüm nahe, wir verkleideten uns als Umzugsfirma, ausgestattet mit Plakaten, welche die kreativsten Beschwerden der letzten Monate zeigten. Für Platz eins des Kostümwettbewerbs reichte es leider noch nicht, aber das war ja auch erst der Anfang.
Ich weiß gar nicht, wie viel Freizeit und wie viele Mittagspausen ich in den folgenden Jahren investierte habe, um weitere Aktivitäten zu planen, aber ich tat es gern, insofern war das also egal. Wir hatten wunderbare Abteilungsfeiern und –ausflüge, Weihnachtsfeiern und Karnevalsveranstaltungen, einmal sprang sogar der Sieg im Kostümwettbewerb raus. Insgesamt gehörte ich zehn Jahre dieser Abteilung an. Etwa zeitgleich mit dem vermehrten Auftreten meiner Beschwerden, begann auch das gute Team zu bröckeln. Kollegen wechselten in einen anderen Bereich oder gingen in den Ruhestand. Beeinträchtigt von meiner gesundheitlichen Verfassung wurden die privaten Zusammentreffen immer weniger, es fand sich niemand, der die Planungen übernehmen wollte. Im Rückblick kann ich sagen, die Zeit von 1996 bis 2006 waren für mich sehr gute Jahre in der Behörde. Dass ich gesundheitlich bereits große Probleme hatte,bekamen nicht viele Kollegen mit. Ich fühlte mich anerkannt, respektiert und als Teil der Behörden-Familie.
Warum ich Ihnen das erzähle? Weil sich dies schlagartig änderte, als ich aufgrund meiner Beschwerden nicht mehr reibungslos funktionierte. Im Hinblick auf das, was Sie in späteren Abschnitten noch lesen werden, finde ich es wichtig, eine kurze Darstellung aus meiner Zeit als gesunde und damit unproblematische Mitarbeiterin in Erinnerung zu haben.
* * *
Also noch mal zurück zu besagtem Abteilungsausflug. Wir fuhren mit dem Zug nach Braubach, von dort mit dem Markusburgexpress, einem sehr rustikalen Bimmelbähnchen, hinauf zur Burg. Nach der Burgführung ging es zu Fuß wieder hinab mit anschließender historischer Stadtführung. Zum Abschluss war ein Tisch in einem gemütlichen Altstadtlokal reserviert. Es war also keine mehrstündige Gewaltwanderung oder sonstige körperlich anstrengenden Aktivitäten geplant, sondern ein geselliger, normalerweise für jedermann zu bewältigender Ausflug. Ich freute mich sehr auf den Tag. Aber bereits nach dem Abstieg von der Marksburg ging es wieder los. Mir zitterten die Beine. Ich versuchte es zu ignorieren und machte tapfer die Stadtführung mit. So lange ich in Bewegung war ging es, aber als später im Lokal das Essen serviert wurde, fühlte ich mich schon wieder bedenklich schlecht. Übelkeit, Kopfschmerzen und schon wieder diese Benommenheit im Kopf. Obwohl ich eigentlich schon wusste, dass meine Magenmittel keine echte Hilfe waren, verzog ich mich auf Toilette und nahm Tropfen und Pulver ein. Natürlich ohne Erfolg. Ich muss so elend ausgesehen haben, dass mir die Gastwirtin anbot, mich in ihren Privaträumen aufs Sofa legen zu können. „Peinlich, oh wie peinlich“, ging es mir nur durch den Kopf, aber ich nahm das Angebot an. Ich befürchtete, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren, zitternd lag ich auf einem fremden Sofa. Damals dachte ich, das müsse eine Panikattacke sein. Heute weiß ich es besser. Nach einer Weile konnte ich mich wieder aufrappeln. Ich war total beschämt, auch wenn ich für meine Beschwerden nichts konnte. Aber der Gedanke, dass meine Kollegen nebenan sitzen und feiern, während ich irgendwie versuche, meinen Körper unter Kontrolle zu bekommen, war peinlich und hilflos zugleich. Der Tag endete damit, dass mich zwei Kolleginnen – viele Züge früher als geplant – nach Hause begleiteten, wo ich mich völlig ratlos und überfordert mit der Situation vor eine Rotlichtlampe setzte.
Aber recht schnell meldete sich wieder mein Kämpfergeist. Es musste doch möglich sein, meinen körperlichen Zustand wieder zu verbessern. Zusätzlich zu dem zur Routine gewordenen „Einrenken“, meldete ich mich in einer Physiotherapiepraxis für ein Gerätetraining an. Den Sommer 2005 verbrachte ich damit, meine Halsmuskulatur aufzubauen. Das ging gründlich schief. Wahrscheinlich hatte ich noch mein Leistungsvermögen aus Judotagen vor Augen oder es waren die falschen Übungen für mein Problem. Ich weiß es nicht mehr im Detail, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass während der drei Trainingsmonate die Blockaden im Halswirbelsäulenund Brustwirbelsäulenbereich zunahmen. Ich hatte Schmerzen in der linken Gesichtshälfte, das linke Ohr und die Zähne taten weh. Also brach ich das Gerätetraining wieder ab.
Getreu dem Motto „Aufgeben ist was für Weicheier“ – an markigen Sprüchen aus meiner Judozeit mangelte es mir nicht – versuchte ich etwas anderes. Ich war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt, diesen körperlichen Zustand zu akzeptieren kam für mich nicht in Frage. Glauben Sie mir, ich bin heute froh, dass ich damals noch nicht wusste, was noch auf mich zukam. Vielleicht hätte ich sonst resigniert.
Mein Hausarzt empfahl mir einen Orthopäden. „Der behandelt nur Privatpatienten“, wurde mir vielversprechend mitgeteilt. Ja, ich bin privatversichert. Das ist Fluch und Segen zugleich. Aber später mehr dazu. Der Orthopäde erkannte auf dem Röntgenbild eine Steilstellung der Wirbelsäule. Er verordnete mir eine sogenannte Trigger-Osteopraktik zur Linderung der Schmerzen. Ach ja, und ich bekam die obligatorischen Einlagen verschrieben. Neue Hoffnung kam auf. „Ich besorge mir die Einlagen und gehe zu diesem „Triggern“ und dann bin ich bald wieder fit.“ Denkste. Haben Sie eine Vorstellung davon , was Trigger-Osteopraktik ist? Ich versuche mal, es zu beschreiben. Bei der Behandlung werden die Trigger (verkürzte und verdickte Muskelfasern) mit Hilfe von Stoßwellen bearbeitet. Dadurch sollen die Trigger als Hauptursache von chronischen Schmerzen und Verspannungen beseitigt werden. Das heißt, auf Stellen des Körpers, die ohnehin schon schmerzen, wird besonderer Druck ausgeübt. Ja, es fühlt sich genauso fies an, wie es sich anhört. Aber ein Versuch war es wert.
Nach der Behandlung fühlte ich mich immer ganz besonders elend. Den 30minütigen Heimweg konnte ich häufig nicht mehr selber bewältigen, so dass meine Mutter fahren musste. Von Dezember 2005 bis März 2006 habe ich mich in regelmäßigen Abständen der Behandlung unterzogen. Zusätzlich ging ich weiterhin zum „Einrenken“ zu einem Chiropraktiker. Meine Probleme blieben jedoch bestehen. Ich stellte fest, dass es schlimmer wurde bei sportlichen Aktivitäten, wie beispielsweise Wandern, Crosstrainer oder Hanteltraining und bei Zugluft am Hals.
Eine neue Idee musste her. Im Mai 2006 begab ich mich in eine Praxis für Physikalische Therapie und Krankengymnastik. Dort wurden Hals und Rücken mobilisiert. Zunächst stellte sich erfreulicherweise eine Verbesserung ein. Doch kurz darauf, Ende Juni 2006, traten plötzlich Kopfschmerzen auf und ein Druckgefühl im Kopf, das mich lange nicht mehr los ließ. Zwischenzeitlich hatte ich den Orthopäden gewechselt. Der Neue kam auf die Idee, wegen des anhaltenden Druckgefühls die Nasennebenhöhlen röntgen zu lassen. Die Diagnose lautete dann Nasennebenhöhlenentzündung. Die verordneten Antibiotika halfen nicht. In den nächsten Wochen blieben die Kopfschmerzen und der Druck im Kopf mein ständiger Begleiter. Ich nahm Unmengen „Paracetamol“. War ich zu Beginn der Beschwerden noch optimistisch, das Problem schnell zu lösen, fing der schlechte körperliche Zustand nun doch an, mir an die Substanz zu gehen. So langsam wurde auch mein Arbeitsalltag immer beschwerlicher. Mit dem ständigen Druck im Kopf fiel es schwer, sich den ganzen Tag zu konzentrieren.
Im August 2006 suchte ich daher einen Neurologen auf. Das angefertigte EEG war ohne Befund. Es folgten die üblichen Routine-Fragen, wie „Haben Sie Stress?“ Entnervt von den vorausgegangenen Terminen beim Hausarzt, zweier Orthopäden und diverser Röntgenaufnahmen – die allesamt ohne Erfolg blieben – lautete meine Antwort: „Ich bin Beamtin, ich habe keinen Stress!“ Der Neurologe, so glaube ich zumindest, fand die Antwort lustig. Im Nachhinein kann ich auch darüber lachen, aber in dem Moment fühlte ich mich einfach nicht erstgenommen. Bei dieser Gelegenheit: sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Aussage war nicht wirklich so gemeint. Wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal spreche und erst dann nachdenke. Nun ja, zuletzt legte mir der Neurologe nahe, ich solle ein Migräne-Tagebuch führen. Aha, neue Diagnose: Migräne.
Natürlich führte ich kein Migräne-Tagebuch. Nach den unzähligen Besuchen beim Chiropraktiker erhärtete sich mein leiser Verdacht, der Knackpunkt könnte sprichwörtlich im Nacken liegen. Bislang ging nur leider keiner der Ärzte richtig darauf ein. Ich führte also die Physikalische Therapie fort, obwohl mir irgendwann auffiel, dass die Kopfschmerzen, der Druck im Kopf, das Benommenheitsgefühl und das Rauschen auf den Ohren nach der Behandlung besonders schlimm waren. Anfangs trat bei Behandlungspausen noch eine Linderung ein. Seit Oktober 2006 bestanden die Probleme jedoch dauerhaft. Daher brach ich auch diese Behandlung ab und blieb zermürbt und ratlos zurück. Zwischenzeitlich hatten wir Ende 2006, mit mir war es kontinuierlich bergab gegangen und keine Lösung in Sicht. Um die Feier an meinem 30. Geburtstag zu überstehen, musste ich alle paar Stunden Schmerzmittel nehmen. Mein gesellschaftliches Leben fing auch an zu leiden. Immer öfter musste ich Einladungen kurzfristig absagen, weil es mir nicht gut ging, oder mich bei Ausschusssitzungen im Rathaus entschuldigen. Auf der Arbeit wurden die Fehltage mehr. Die beiden letzten Urlaube in den Jahren 2005 und 2006 standen auch unter dem Einfluss meiner Probleme.
Irgendetwas musste ich mir einfallen lassen. Man kann wirklich nicht behaupten, ich sei der alternative Typ. Im Grunde bin ich total rational und verlasse mich auf das, was ich sehen und verstehen kann. Spirituelle Ansätze sind mir fremd, Sie können mich maximal dabei erwischen, wie ich mein Horoskop in einer Frauenzeitschrift lese. Aber dem wird natürlich nur dann Bedeutung beigemessen, wenn etwas Positives drinsteht. Selbst, wenn meine Tanten mal wieder über die Ausstrahlung des Goloringes, Keltenmythen usw. sprechen, schüttele ich innerlich den Kopf. Aber der Leidensdruck war inzwischen so groß, dass ich bereit war, andere Wege einzuschlagen. Und so landete ich Ende 2006 bei einer Heilpraktikerin, die auch kinesiologisch, also nach einem alternativ-medizinischenDiagnose- und Behandlungskonzept, arbeitete. Ich habe ernsthaft versucht, mich auf die Behandlung einzulassen. Auch wenn jeder Termin damit anfing, dass ich große Hausschuhe, ähnlich denen bei einer Schlossbesichtigung, anziehen musste. Auf jeden Fall bekam ich eine neue Diagnose: Quecksilbervergiftung, und den dringenden Rat, meine drei alten Amalgamfüllungen entfernen zu lassen. Die Erklärung schien mir einleuchtend: das Quecksilber setze sich im Nervensystem ab. Durch die bisherigen Behandlungen würden die Ablagerungen immer wieder aufgewühlt.
Also kamen die Füllungen raus und es folgte eine Entgiftung mit grünen Algen-Tabletten. Soweit ich weiß, ist das kein ungewöhnlicher Weg, bestimmt war die Zahnsanierung samt Entgiftung insgesamt sinnvoll, nur leider änderte dies nichts an meinem Befinden. Wieder unzählige Warteund Behandlungszimmerstunden umsonst. Aber dafür stapelten sich wieder die Rechungen. Falls Sie das wundert: auch eine private Krankenversicherung zahlt nicht alles. Ach ja, und einer der drei sanierten Zähne ist auch weg. Er hat wohl den Verlust des Amalgams nicht verschmerzt und musste ein halbes Jahr später raus. Erfolg auf ganzer Linie also. Als die Heilpraktikerin anfing, den Grund meiner Beschwerden im familiären Bereich zu suchen und mir vorschlug, eine Familienaufstellung zu machen, war meine Toleranzgrenze erreicht. Das war in meinen Augen nicht mehr alternativ, sondern Hokuspokus. Weitere Termine nahm ich dort nicht mehr wahr.
Keine Ahnung, wie es anderen Personen in meiner Lage gegangen wäre, aber ich fing ernsthaft an, mir Sorgen zu machen. Die Kopfschmerzen, der Druck und all die anderen Beschwerden in der Kopfregion, mangels besseren Wissens befürchtete ich einen Hirntumor haben zu können. Das musste ich klären. Im Januar 2007 hatte ich meine erste MRT-Untersuchung. Nachdem ich den Fragebogen ausgefüllt und bei Grund der Untersuchung „Halswirbelsäule (HWS)/Kopf“ angegeben hatte, empfing mich die Dame in der Radiologie mit den Worten: „Seit wann haben Sie den Bandscheibenvorfall?“ Moment, gab es da eine Diagnose, von der ich nichts wusste? Zum wiederholten Male wurde ich mit dem klassischen Schubladendenken im deutschen Gesundheitssystem konfrontiert. Halswirbelsäule, das muss die Bandscheibe sein. Aus Angst vor dem Untersuchungsergebnis verkniff ich mir eine entsprechende Antwort. Es dauerte ewig, bis uns ein Arzt das Ergebnis mitteilte. Ich weiß noch genau, wie ich im Wartezimmer zu meiner Mutter sagte: „Was ist, wenn die mir jetzt sagen, ich habe einen Gehirntumor?“ Meine Mutter versuchte mich zu beruhigen, aber wir waren beide nervös. Die Erleichterung war groß, als mir mitgeteilt wurde, dass nur eine kleine Wurzeltaschenzyste im Bereich des 6. Halswirbels als Zufallsbefund entdeckt worden sei, die aber laut Neurochirurgen nicht ursächlich für meine Probleme sein könne und auch dort bleiben könne, wo sie sei.
Die Erleichterung hielt nicht lange an, da ich immer noch nicht wusste, was mit mir los war. Kopfschmerzen mit Druck am linken Hinterkopf, größte Probleme morgens beim Aufstehen, Rauschen auf den Ohren, Gefühl im Kopf wie ein Dampfkessel mit Überdruck, Benommenheit, Dusselgefühl, verspannte Halsmuskulatur links und weiterhin Übelkeit und Magenprobleme, dafür musste es doch eine Erklärung geben. Neu in meiner Sammlung waren jetzt auch noch Darmprobleme. Kaum hatte ich gegessen, musste ich auf Toilette. Das war so schlimm, dass manchmal der kürzeste Weg noch zu lang war.
Privat war mit mir Anfang 2007 schon nicht mehr viel los. Beruflich versuchte ich mein Leistungsvermögen so gut zu halten, wie es ging. Aber es war nicht mehr zu verbergen, dass etwas mit mir nicht stimmte. Eine liebe Kollegin brachte es einmal auf den Punkt: „Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst.“ Im Januar 2007 verbrachte ich auf Empfehlung eine Woche zur Intensiv-Behandlung bei Orthopäden in Süddeutschland. Ich bekam einen ersten Hinweis, dass ich mit meinem Verdacht HWS/Hinterkopf richtig lag. Aufgrund einer Facetteninstabilität im Bereich des 2. bzw. 3. Halswirbels entstünden bei mir die Blockaden, wurde mir mitgeteilt. Behandelt wurde dieser Bereich merkwürdigerweise jedoch nicht. Die Ärzte dort kümmerten sich nur um meine Hüfte, da ich angeblich eine Hüftfehlstellung hätte. Na ja, nach 21 Jahren Judo war das kein Wunder, wenn ich an die tausendfach wiederholten Würfe mit eingedrehter Hüfte denke. Wieder eine neue Diagnose also, aber irgendwie hatte ich Zweifel und behielt den Gedanken an meinen Hals im Blick. Da jedoch trotz Intensivbehandlung keine Besserung eintrat, vielmehr die Symptome durch die Behandlung verstärkt wurden und auch jeder Versuch Sport zu machen, um mich zu stabilisieren, zu schlimmeren Beschwerden führte, wurde ich unsicher, ob ich mit dem Hals-Verdacht tatsächlich auf der richtigen Spur war.
Mehr zufällig stolperte ich im Februar 2007 über das Thema Umweltgift und setzte in meiner Verzweiflung zunächst alles auf diese Karte. Einige meiner Symptome konnten auch von einer Holzschutzmittelvergiftung kommen. In meiner damaligen Wohnung waren alle Decken mit Holzpaneelen verkleidet. Das könnte passen, dachte ich. Eine von mir beauftragte Baubiologin testete die Wohnung und konnte Formaldehyd nachweisen. Im März 2007 suchte ich dann einen Umweltmediziner auf, der mir nach einer Reihe von Tests mitteilte, ich hätte eine toxikologische Granulation der weißen Blutkörperchen. Puh, das hörte sich gar nicht gut an. Aber zumindest gab es mal wieder eine neue Diagnose. Ich glaube, in meinem Umfeld habe ich für reichlich Verwirrung gesorgt, da ich in regelmäßigen Abständen mit einer neuen Diagnose ankam. Aber was sollte ich machen? Irgendwie passten meine Symptome immer ganz gut auf die jeweiligen Diagnosen. Und wenn die Not groß genug ist, probiert man die empfohlene Therapie aus. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es fast drei Jahre dauern sollte, bis jemand wirklich herausfand, was mir fehlte.