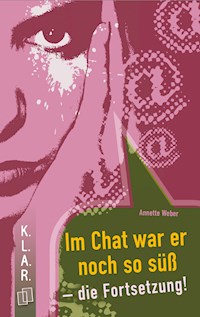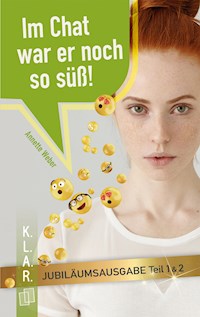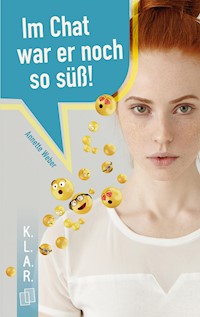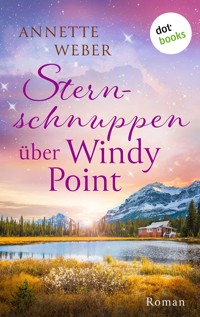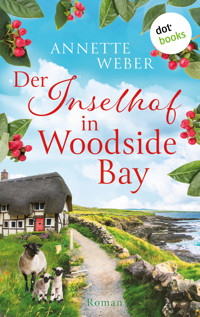
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verliebt auf der Isle of Wight
- Sprache: Deutsch
Zwischen den Wellen glitzert das Glück: Der romantische Feelgood-Roman »Der Inselhof in Woodside Bay« von Annette Weber als eBook bei dotbooks. Ein alter Schäferhof am Meer … Eigentlich wollte Noah nur auf die Isle of Wight zurückkehren, um das Erbe seines verstorbenen Vaters zu sichten. Doch dann erinnert er sich, wie frei und glücklich es sich anfühlte, als Kind mit der Schafherde über die Insel zu ziehen. Kann er das Risiko wagen, dem alten Beruf des Schäfers neues Leben einzuhauchen? Als Noah der jungen Hundetrainerin Eva begegnet, scheint plötzlich alles möglich: gemeinsam Hütehunde ausbilden, den regionalen Wollhandel wiederaufleben lassen und mit hunderten von Schafen auf Wanderschaft gehen. Doch Evas schwierige Vergangenheit drängt sich bald schon zwischen die beiden – und dann schlägt während einer Wanderung die Natur unerbittlich zu … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Inselhof in Woodside Bay« von Annette Weber ist der dritte Wohlfühlroman in ihrer »Verliebt auf der Isle of Wight«-Reihe, in der alle Bände unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein alter Schäferhof am Meer … Eigentlich wollte Noah nur auf die Isle of Wight zurückkehren, um das Erbe seines verstorbenen Vaters zu sichten. Doch dann erinnert er sich, wie frei und glücklich es sich anfühlte, als Kind mit der Schafherde über die Insel zu ziehen. Kann er das Risiko wagen, dem alten Beruf des Schäfers neues Leben einzuhauchen? Als Noah der jungen Hundetrainerin Eva begegnet, scheint plötzlich alles möglich: gemeinsam Hütehunde ausbilden, den regionalen Wollhandel wiederaufleben lassen und mit hunderten von Schafen auf Wanderschaft gehen. Doch Evas schwierige Vergangenheit drängt sich bald schon zwischen die beiden – und dann schlägt während einer Wanderung die Natur unerbittlich zu …
Über die Autorin:
Annette Weber, 1956 in Lemgo geboren, schreibt seit über 20 Jahren Romane, in die sie stets ihre Begeisterung für Pferde einfließen lässt. Annette Weber ist verheiratet, hat drei Söhne, fünf Enkelkinder und lebt in der Nähe von Paderborn.
Die Autorin im Internet: www.annette-weber.com/ und www.sina-trelde.de
Bei dotbooks veröffentlichte Annette Weber in ihrer »Verliebt auf der Isle of Wight«-Reihe auch die Romane »Das Cottage in Seagrove Bay« und »Die Teestube in Freshwater Bay« sowie ihre »Gut Werdenberg«-Familiensaga mit den Bänden »Stürme einer neuen Zeit« und »Hoffnung eines neuen Lebens«.
***
Originalausgabe April 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-938-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Inselhof in Woodside Bay« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annette Weber
Der Inselhof in Woodside Bay
Roman
dotbooks.
Teil 1
Kapitel 1
Noah
Madonna ging es nicht gut. Das konnte ich ihren Ohren ansehen. Sie hingen herab wie Fahnen, die man auf halbmast gesetzt hatte. Die Kleine nagte lustlos an ihrem Heu herum. Die Ohren und der Appetit waren deutliche Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich wusste, dass ich auf die kleinsten Anzeichen achten musste. Darum begann jeder Morgen damit, den Blick aufmerksam über die große Herde gleiten zu lassen. Schafe waren leidensfähig, und man musste genau hinschauen, wenn man rechtzeitig bemerken wollte, ob eines erkrankte. Alle Tiere hatten im Moment dickes lockiges Fell, so dass man nicht erkennen konnte, ob sie abgemagert waren. Aber die Ohren waren immer ein untrügliches Zeichen. Wenn sie herunterhingen, musste man eingreifen.
Madonna befand sich etwas außerhalb der Herde, auch das war ein Indiz dafür, dass sie krank war.
Ich sah mich nach meinen Hunden um.
»Anuk!«, rief ich.
Augenblicklich spitzte die Border-Collie-Hündin ihre Ohren und schaute in meine Richtung.
»Come by!«
Das war der Befehl, die Herde von links zu umkreisen.
Anuk sprang sofort auf. Sie liebte es, für mich zu arbeiten, und begann, die Schafe zu umrunden. Als sie bei Madonna angekommen war, gab ich ihr den Befehl, sich abzulegen. Dann ging ich langsam zurück.
»Walk on«, rief ich.
Langsam trieb Anuk das Schaf auf mich zu. Das gefiel Madonna nicht. Sie versuchte, der Hündin zu entwischen, aber Anuk hatte das sofort durchschaut. Sie rannte nun in einer Zickzacklinie hin und her und trieb das Schaf weiter auf mich zu.
»Buddy! Keep off!«, rief ich den anderen Border Collie zu Hilfe. Er umkreiste Madonna nun von rechts, und gemeinsam schafften sie es, das Schaf zu mir zu treiben. Als es auf Armeslänge vor mir stand, gab ich den Hunden den Befehl, von dem Schaf abzulassen: »Lie down!« Dann zog ich das Kraftfutter aus meiner Hosentasche und lockte es an. Madonna war eines meiner ältesten Schafe, und wir kannten einander. Trotzdem war sie natürlich ein Fluchttier, da waren sie alle gleich, und darum setzte sie alles daran, wieder zu entkommen. Also griff ich ihre Schnauze mit der einen Hand, meine andere Hand legte sich um ihr Becken, und dann zog ich sie so nah an meinen Oberschenkel, dass sie nicht entwischen konnte. Dabei bog ich ihren Kopf nach hinten. Madonna kannte den Griff und ließ ihn fast stoisch über sich ergehen. Ich tastete ihren Körper ab, drehte dann ihren Kopf zu mir und öffnete ihre Lippen. Da sah ich die entzündete Veränderung an den Schleimhäuten. Als ich die Stelle berührte, zuckte Madonna zusammen.
»Hee, ruhig, ich hab’s schon«, redete ich beruhigend auf sie ein.
Sie betrachtete mich nun voller Vertrauen.
Lippengrindinfektionen waren Gott sei Dank keine sehr schlimmen Infektionskrankheiten und durch eine Creme meist recht schnell zu heilen. Darüber war ich sehr froh. Madonna gehörte nämlich zu den Schafen, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen waren. Sie war schon vier Jahre alt, hatte in jedem Jahr Zwillingslämmchen bekommen und zeigte sich stets als geduldiges Mutterschaf. Sie war so etwas wie die graue Eminenz in meiner Herde, ein echtes Leitschaf. Auch die anderen Schafe hatten großen Respekt vor ihr, und sie ersetzte mir manchmal sogar den Hütehund, wenn sie die Herde anführte oder in die eine oder andere Richtung trieb. Wenn sie krank war, ging es mir auch sofort schlechter.
Für einen kurzen Moment ließ ich sie wieder frei und ging zu dem Medizinschränkchen, der sich im Stall befand, um eine Creme für sie zu suchen. Als ich zurückkam, hatte sich Madonna schon wieder aus dem Staub gemacht. Da waren die Schafe wie die Menschen – Medikamente mochten sie nicht. Ich rief Anuk erneut und leitete sie an, Madonna wieder zu mir zu treiben. Sobald sie vor mir stand, griff ich beherzt in ihr Fell und klemmte sie anschließend zwischen meinen Beinen fest.
»Hallo? Ist hier jemand?«, hörte ich eine Stimme. Sie kam aus dem Stall.
»Ich bin hier draußen!«, rief ich zurück.
Dann drehte ich Madonnas Kopf zu mir und öffnete ihre Lippen mit dem Zeigefinger. Mit der anderen freien Hand drehte ich den Deckel der Tube auf und drückte ein Stück der Creme heraus, um es anschließend auf Madonnas Lippen zu schmieren. Madonna blökte verärgert, aber das ignorierte ich.
»Hier draußen? Wo? Ah, hallo!«
Anuk und Buddy schlugen gleichzeitig an.
»That’ll do!«, mahnte ich und machte ihnen ein Zeichen, sich wieder hinzulegen. Sie gehorchten sofort.
Eine junge Frau tauchte am Rand der Wiese auf. Ich hatte sie noch nie vorher gesehen. Sie sah aus wie eines dieser Emo-Mädchen, schwarze Haare, asymmetrische Bobfrisur, blaue Augen, Metall in der Nase und im Ohr. Um den Hals trug sie ein enges Lederband, das mich an ein Hundehalsband erinnerte. Sie blickte mich verstört an. Offenbar fand sie es komisch, dass ich ein Schaf zwischen den Beinen hatte – und das konnte ich sogar verstehen. Es gab nicht viele Menschen, die wussten, dass man Schafe auf die Weise fixierte. Überhaupt gab es nur wenige Menschen, die sich mit Schafen auskannten.
Ich gab Madonna frei, und sie rannte blökend auf die Wiese.
»Was machen Sie?«, wunderte sich die junge Frau.
»Ich habe Madonna die Lippen eingerieben«, meinte ich und grinste. Sie musste mich für völlig verrückt halten.
»Madonna?«
»So heißt mein Schaf!«
»Ihr Schaf heißt Madonna?«
»Warum nicht. Meine Schafe haben alle Namen«, versuchte ich zu erklären. Gleichzeitig konnte ich ihr ansehen, dass sie an meinem Verstand zweifelte.
»Aber Madonna? Ist das nicht ein komischer Name für ein Schaf?«
»Ich weiß nicht«, gab ich zurück. »Wie heißen Schafe denn sonst?«
Sie überlegte einen Moment lang.
»Dolly«, sagte sie dann.
»Und die 499 anderen Schafe?«
Jetzt zuckte sie die Achseln und sah ein bisschen überfordert aus.
»Weiß nicht. Dora vielleicht. Warum? Wie heißen Ihre denn?«
Ich sah mich um, zeigte dann auf mein Lieblingsschaf.
»Das ist Katy Perry«, erklärte ich. »Und das daneben ist Ava Max. Die da vorne mit den Sommersprossen ist Beyoncé …«
Jetzt lehnte sie sich an die Stallwand und starrte mich fassungslos an. Dann fing sie an zu lachen.
»Sie verarschen mich, oder? Sie können sie überhaupt nicht unterscheiden, stimmt es?«
Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen.
»Natürlich kann ich das!«, widersprach ich empört. »Sie sehen doch alle ganz verschieden aus.«
»Sie haben alle schwarze Nasen und lange weiße Locken.«
»Man muss eben genauer hinschauen«, erklärte ich.
Es war ihr anzusehen, dass sie mir nicht glaubte. Aber das konnte ich auch nicht ändern. Es gab viele Menschen, die davon überzeugt waren, dass Schafe alle gleich aussähen, und dann achteten sie nicht darauf, ob die Ohren spitzer oder die Augen schmaler waren. Zugegeben, ich hatte das selbst erst lernen müssen, aber nun konnte ich das ohne Probleme. Ich war mir sogar sicher, dass ich die meisten meiner Schafe mit geschlossenen Augen voneinander unterscheiden konnte, schon allein, weil sich die Wolle so anders anfühlte. Es war wie bei Eltern, die eineiige Zwillinge bekamen. Sie konnten ihre Kinder ja auch auseinanderhalten.
»Aber Sie sind sicher nicht zu mir gekommen, um mich nach den Namen meiner Schafe zu fragen«, erinnerte ich sie.
Sie sah immer noch irritiert aus. »Nein, natürlich nicht. Ich wollte wissen, ob du Wolle für mich hast.«
Von jetzt auf gleich war sie zum Du übergeschwenkt. Wahrscheinlich hatte ich mir ihre Zuneigung erarbeitet.
»Nicht mehr so ganz viel«, musste ich zugeben. »Höchstens 20 Kilo. Die Schafe werden aber im nächsten Monat geschoren. Dann kannst du so viel haben, wie du möchtest.«
Sie betrachtete Katy Perry.
»Die haben eine tolle Mähne«, stellte sie fest. »So lockig – und bestimmt auch ganz weich.«
Jetzt versuchte sie, Katy Perry zu streicheln, aber die machte einen erschrockenen Satz in meine Richtung. Durch den Satz nach vorne kam Bewegung in die Schafherde. Alle zuckten nun zusammen und rannten ein Stück in eine andere Richtung. Nun sah auch die Emo-Frau ganz erschrocken aus.
»Huch! Entschuldigung«, murmelte sie.
Ich winkte ab. »Schafe sind keine Kuscheltiere«, erklärte ich. »Sie sind ziemlich schreckhaft und außerdem Fluchttiere.«
»Aber dich scheinen sie zu mögen. Katy Perry flüchtete gleich zu dir«, stellte sie fest.
»Na ja, sie kennen mich«, winkte ich ab. »Aber sie mögen mich nur, weil sie von mir das Futter bekommen. Darauf muss ich mir nicht so viel einbilden.«
Jetzt lachten wir beide. Wenn sie lachte, sah sie sympathisch aus. Ihre hellblauen Augen bildeten einen großen Kontrast zu den schwarzen Klamotten und den schwarzen Haaren. Ich fragte mich, was sie wohl mit der Wolle machen wollte. Vielleicht strickte und nähte sie Kuscheltiere und verkaufte sie auf Flohmärkten. Sie war eigentlich so eine typische Flohmarktfrau – keine Ahnung, woran ich das ausmachte, aber das fiel mir so zu ihr ein. Keine feste Stelle, mehr so Freiberuflerin.
»Das sind Teeswaterschafe«, erklärte ich nun. »Ich züchte sie extra, weil sie ganz hochwertige Wolle haben. Also, wenn du Wolle zum Stricken und Filzen brauchst …«
Sie zögerte einen Moment. »Ich bin Künstlerin«, sagte sie dann.
Na bitte! Ich und meine Menschenkenntnis!
»Wir haben mit einer Gruppe freischaffender Handwerker und Künstler die Alte Weberei in Ryde gekauft. Ich mache Wollkunst, andere stellen Plastiken aus Stoff- und Wollresten her, aber wir haben auch Künstler, die mit Holz und Farbe arbeiten«, berichtete sie weiter. »Wir haben ein großes Atelier, und gegenüber sind die Räume für die Handwerker. Färber und Filzerinnen haben wir, aber wir suchen noch Leute für die Weberei und die Spinnerei. Und im Innenhof wollen wir ein Café errichten, damit die Leute es eine Weile bei uns aushalten.«
»Tolle Idee!«
Das klang total spannend. Ich mochte es, wenn alte Gebäude erhalten blieben und zu Kunst- und Szeneprojekten umgestaltet wurden. Sofort musste ich an meine Freundin Peggy denken, die ständig dabei war, alte Gebäude instand zu setzen. Sie hatte sich noch nicht entschieden, ob sie auf der Isle of Wight bleiben oder nach London zurückkehren wollte. Ich musste ihr unbedingt von diesem Projekt erzählen. Vielleicht hätte sie Lust darauf, dort mitzuarbeiten. Das wäre auch für meine Freunde und mich toll, denn dann würden wir sie noch eine Weile bei uns behalten.
»Ich frage mal herum«, bot ich an. »Ich kenne jemanden, der vielleicht Interesse hätte.«
Ich betrachtete die junge Frau nun genauer. Ihr Alter ließ sich schlecht schätzen. Allenfalls Anfang 20. Sie hatte noch ein sehr junges Gesicht, auch wenn sie versuchte, sich mit den schwarzen Haaren und dem Kajal um die Augen älter zu machen.
»Kann ich mir die Wolle mal anschauen?«, wollte sie nun wissen.
Ich nickte. »Ich hab sie drüben im Haus.«
Bereitwillig kam sie mit. Offensichtlich war ich nicht der Typ von Mann, vor dem man Angst haben musste.
»Ich heiße übrigens Noah«, sagte ich so nebenbei. »Noah Powell. Und du?«
»Freya Irons.«
»Wohnst du schon länger hier auf der Insel?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin aus Birmingham. Ich bin mit den anderen Künstlern auf die Insel gekommen. Wir haben ein Gebäude gesucht, in dem wir ein größeres Projekt zusammen aufbauen können, und die alte Weberei hat uns gefallen.«
Ja, das klang tatsächlich nach einem guten Plan. Ich bewunderte es, wenn sich Menschen zu einem künstlerischen Projekt zusammenschlossen. So etwas hätte ich für mich auch gerne gefunden. Wir Landwirte waren irgendwie alle Einzelgänger, dabei würde es uns sicherlich besser gehen, wenn auch wir uns zusammenschlössen. Ich arbeitete manchmal mit dem Vater meiner Freundin Ruby zusammen, der früher auch Schafe gezüchtet hatte. Nur eine kleine Hobbyzucht, aber er kannte sich gut mit den Tieren aus. Wenn ich mal wegmusste, übernahm er es, meine Herde zu füttern und einen Blick auf die Schafe zu werfen. Im Gegenzug dazu hatte ich immer Futter und Medikamente für ihn beim Großhändler eingekauft, außerdem Pflanzen und Dünger für seine Frau Linda besorgt, die einen wunderschönen Garten hatte. Das war eine richtig gute Win-win-Situation. So sollten wir Landwirte eigentlich immer arbeiten. Aber die viele Arbeit ließ uns oft keine Zeit, uns abzusprechen. Außerdem gab es viele bornierte Dickschädel unter den Landwirten, die ihr eigenes Ding machten und keine Kompromisse eingehen wollten.
Jetzt führte ich Freya durch unseren Garten und damit durch die Hintertür ins Haus. Wir gingen zusammen durch das Wohnzimmer, dann auf den Flur und die Treppe hinauf. Sie schaute sich überall um.
»Wohnst du allein hier?«
»Eigentlich mit meiner Mutter zusammen«, musste ich zugeben. »Aber sie ist vor einem Monat auf Weltreise gegangen, und nun bin ich mit meinen Schafmädels allein.«
»Mit deiner Mutter«, sagte sie und rümpfte die Nase. Wahrscheinlich hielt sie mich für eines dieser Muttersöhnchen, das sich noch nicht von seiner Mama abgenabelt hatte. Erst überlegte ich, ihr das alles zu erklären, dass eigentlich ich derjenige gewesen war, der auf Weltreise gegangen war, und dass mich meine Mutter zurückgeholt hatte, als mein Vater starb. Gemeinsam hatten wir damals zunächst beschlossen, die Schäferei und die Schafe zu verkaufen, doch dann war alles anders gekommen. Ich hatte meine Freundin Ruby wiedergetroffen, die diese Insel liebte wie einen Goldschatz, und durch Ruby hatte ich auch Nele, Mathew, Colin und Peggy kennengelernt. Wir waren gute Freunde geworden, und durch sie wurde ich auf der Insel langsam wieder heimisch. Doch warum sollte ich ihr das alles erklären? Es hätte wie eine Rechtfertigung ausgesehen. Ich wohnte in meinem Elternhaus bei meiner Mutter. Daran gab es nichts zu kritisieren. Ich verstand mich gut mit ihr. Und ich war kein Mann, der an seiner Mutter klebte wie ein kleines Kind. Punkt.
Ich führte Freya ins obere Stockwerk, die Wohnung, in der meine Mutter eigentlich lebte. Da sie nun für längere Zeit leer stand, hatte ich die beiden großen Jutesäcke mit der Wolle hier deponiert. Als ich mit Freya über den Flur ging, fiel ihr Blick auf mein Strickzeug, das ich dort im Wollkorb liegen hatte.
»Cool, deine Mutter strickt ja!«, rief Freya interessiert und beugte sich über das Strickzeug. »Darf ich mal gucken?«
Sie wartete meine Antwort gar nicht ab, sondern breitete die Rundstricknadel so aus, dass sie das Zopfmuster des Pullovers besser sehen konnte.
»Das ist mein Strickzeug«, korrigierte ich sie. »Meine Mutter ist auf Weltreise, das habe ich doch schon gesagt. Und ich stricke mir aus der hauseigenen Wolle einen dicken Pullover für den Winter.«
Jetzt war sie platt. Das konnte ich ihr ansehen. Nachdenklich musterte sie mich von oben bis unten.
»Du bist ja ein ungewöhnlicher Typ«, stellte sie fest.
»Weil ich stricke?«, gab ich zurück. »Viele Menschen stricken …«
»Aber du?«
»Weil ich ein Mann bin, oder was?«
Sie mochte es nicht auf sich sitzen lassen, dass sie in diesen Klischees dachte, und winkte darum schnell ab. »Nee, ist schon gut. Entschuldige. Ich finde das eigentlich richtig gut.« Sie betrachtete mich nun neugierig. »Willst du damit sagen, dass du deine Wolle selbst verarbeitest?«, rettete sie sich schnell auf ein Gebiet, auf dem sie sich wohl sicher fühlte.
»Genau das mache ich«, erklärte ich, und dann berichtete ich ihr von meinen neuen Marktstrategien. Schäfer zu sein, reichte heutzutage nicht mehr aus. Die Wolle wurde zu Dumpingpreisen verkauft. Auch das Fleisch für die Schafe war dem Auf und Ab des Marktes unterworfen. Und so war ich mit meinen Schafen eher als Landschaftsschützer unterwegs. Besonders auf der Isle of Wight, die vom Tourismus lebte, war das eine schöne und wichtige Aufgabe. Meine Schafe pflegten die Natur und hielten das Gras kurz, ohne die Bäume und die Grasnarbe zu beschädigen. Sie verdichteten den Boden, und durch ihre Tritte wurden die Grasnarben gefestigt. Das war besonders an den Küsten wichtig. Außerdem gab es noch einen ganz anderen biologischen Vorteil: Überall, wo Schafe geweidet hatten, entstanden durch den natürlichen Dünger zahlreiche Pflanzenarten.
»Schafe sind die eigentlichen Natur- und Kulturpfleger«, berichtete ich nicht ohne Stolz. »Sollte es einen Preis für den besten Naturschutz geben, müssten meine Schafe ihn bekommen. Darum erhalten wir Geld vom Land, wenn wir mit den Herden durch die Landschaft ziehen.«
»Verstehe«, sagte sie und sah nun irgendwie beeindruckt aus. »Und die Wolle?«
»Ich arbeite mit einer Spinnerei zusammen, die unsere Schafwolle zu Wollknäueln verspinnt. Einiges verarbeiten sie zu Decken und Tischwäsche, anderes wird verstrickt oder verfilzt. Und dann gibt es natürlich auch richtige Wolle als Knäuel zu kaufen. Auch bei mir.«
Jetzt war die junge Emofrau wirklich fasziniert von mir.
»Du bist unser Mann!«, rief sie begeistert. »Genau so jemanden wie dich brauchen wir. Jemand, der uns Wolle liefert, aber der auch unser Konzept mitträgt. Wir wollen durch Vorträge und Projekte weitere Förderer gewinnen. Wir wollen ein richtiges Kulturzentrum werden. Mit Pressestelle, Berichten über Social Media, mit Kursen und Schulungen.«
Voller Respekt betrachtete sie mich. »Genau so jemanden wie dich haben wir gesucht. Jemanden, der absolut authentisch ist.«
Ich musste lachen. Ich hatte mich noch nie gefragt, ob ich authentisch war.
»Also bitte«, willigte ich ein. »Da bin ich. Ich stehe euch zur Verfügung.«
»Auch für Vorträge oder Vorführungen?«
»Klar. Wenn ihr mögt.«
Jetzt war sie total zufrieden. Sie sagte sogar: »Dich schickt der Himmel.« Dann strahlte sie mich an, als wenn ich das Beste sei, das ihr an diesem Tag passiert war. »Gibst du mir deine Handynummer?«
»Unbedingt. Und ich brauche deine.«
Sie war viel schneller darin, meinen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer als neuen Kontakt zu speichern. Dann ließ sie ihr Telefon durchklingeln, und auf die Weise hatte ich auch ihren Namen und ihre Adresse. In Sachen digitale Geschwindigkeit war sie mir auf alle Fälle weit überlegen. Auch was die Direktheit betraf …
»Hast du Lust, dir unsere Weberei anzuschauen?«, wollte sie wissen.
»Klar. Unbedingt.« Ich mochte es, interessante Menschen kennenzulernen.
***
Freya rief mich bereits am nächsten Tag an und hätte mich am liebsten sofort zu sich eingeladen, aber so schnell war ich leider nicht. Wenn ich wegwollte, musste ich das immer organisieren. In dem Fall waren Schafe wie kleine Kinder.
Aber am Freitag darauf klappte es. Nachdem ich die Tiere gefüttert hatte, lud ich die Wolle, die ich noch vom letzten Schnitt übrig hatte, auf den Beifahrersitz meines Pick-ups und machte mich auf den Weg zur Alten Weberei nach Ryde. Es war nicht weit. Als ich durch den Wald von Woodside fuhr, wurde es schon dunkel. Auch wenn sich der Frühling langsam bemerkbar machte, hatten wir erst Anfang April. Zu dieser Jahreszeit gab es noch nicht viele Touristen auf der Insel, und mir kam auf dem ganzen Stück bis zur Brücke kein einziges Fahrzeug entgegen. Am Wootton Creek lagen die kleinen Schiffe der Inselbewohner im Wasser, der helle Schein der Straßenlaternen warf ein warmes Licht auf den Hafen, und das sah so romantisch aus, dass ich das Tempo zurücknahm und langsam über die Brücke fuhr. Bei dem Ausblick fiel mir wieder ein, warum ich auf diese Insel zurückgekehrt war. Sie wirkte so unglaublich friedlich – ein bisschen heile Welt in einer unruhigen Zeit.
Nicht einmal Wölfe gab es auf der Insel. Während sich in ganz Europa die Schäfer Sorgen um ihre Herden machten und die Wölfe mitunter meterhohe Zäune durchbrachen, um ein Schaf zu reißen, hatten die Tiere hier ein idyllisches Leben. Natürlich gab es den einen oder anderen Hund, der die Schafe von links nach rechts trieb, und das war schlimm genug, denn die trächtigen Mutterschafe konnten durch den Schock Fehlgeburten erleiden. Aber das war kein Vergleich zu dem, was ein Wolf anrichten konnte.
Hier auf der Isle of Wight verlief das Leben in einem anderen Rhythmus. Besonders im Winter schien die Insel wie die Tiere in einen gemütlichen Winterschlaf zu fallen, die Welt drehte sich langsamer. Jetzt, wo es allmählich Frühling wurde, zeigte sie sich von ihrer milden Seite. Die Möwen waren uns den ganzen Winter über treu geblieben, jetzt flogen sie kreischend durch den Wind.
Ich wählte den Kate Hill, eine der wenigen Schnellstraßen der Insel, die parallel zur Küste führte. Schon von Weitem war das Ryde Castle zu sehen, das hell erleuchtet die Landschaft überragte, als müsste es über die Küste wachen. Ein wunderschöner Fixpunkt in der Dunkelheit. Zehn Minuten später passierte ich das Straßenschild Ryde, und eine Straßenecke weiter gelangte ich mit Hilfe des Navis auf einen Hof und hatte mein Ziel erreicht. Ich parkte meinen Wagen neben einem großen Scheunentor, stieg aus und ging zu einer Tür hinüber, an der sich einige Klingeln befanden. Doch noch bevor ich sie betätigen konnte, öffnete sich bereits die Haustür, und Freya stand vor mir. Obwohl es ziemlich dunkel war, bildete ich mir ein, ihre blauen Augen leuchten zu sehen.
»Da bist du ja! Komm rein!«
Wir reichten einander die Hand – eine Geste, die nicht zu ihr passte, aber es hätte auch nicht gepasst, uns in den Arm zu nehmen.
»Ich habe die Wolle im Auto«, sagte ich hastig. Ich war ein wenig verlegen und versuchte, das zu überspielen und meinen Besuch zu rechtfertigen. Aber Freya winkte ab.
»Erst mal lernst du unsere Wohngemeinschaft kennen«, meinte sie und führte mich auf den Flur. Sie klang ebenfalls ein wenig nervös. Offenbar war es ihr auch wichtig, einen guten Eindruck bei mir zu machen. Aber sie musste sich gar nicht anstrengen – sie war mir sympathisch, und für Künstler und Handwerker hatte ich sowieso immer ein großes Herz.
Der Flur war ziemlich dunkel. Nur eine alte Glühbirne leuchtete von der Decke. Alles wirkte noch sehr improvisiert, was kein Wunder war, denn sie waren ja gerade erst eingezogen.
»Eine Wohngemeinschaft beginnt immer in der Küche«, begann sie ihre Führung.
»Stimmt.« Ich musste lachen.
Als ich in Kolumbien gewesen war, hatte ich auch ein paar Monate lang in einer WG gelebt, und auch damals hatten wir eigentlich überwiegend in der Küche gesessen.
Ein freakiger Typ stand am Herd und kochte Spaghetti. Am Tisch saß eine junge Frau und zappte an ihrem Handy herum. Jetzt sahen sie sich zu mir um und betrachteten mich neugierig. Freya stellte sie mir vor. Der Typ hieß Oscar, die junge Frau Willow. Und noch eine vierte Person schien es zu geben, Robin, der offenbar noch in der Werkstatt arbeitete.
Ich begrüßte die WG-Bewohner und nannte ebenfalls meinen Namen. Doch bevor wir ein paar Worte miteinander wechseln konnten, schob mich Freya schon in den nächsten Raum.
»Das hier ist unser Wohnzimmer, aber da sitzen wir nur, wenn unsere Eltern zu Besuch kommen«, fuhr sie fort und lachte.
»Das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor«, mutmaßte ich, denn es herrschte hier noch ziemliches Chaos. Immerhin, das Wohnzimmer war sehr groß und zeigte ein paar beeindruckende Kunstwerke. Auch ein Wollbild war dabei.
»Hast du das gemacht?«, wollte ich wissen.
Freya nickte. »Und das Textilbild ist von Willow«, erklärte sie dann. »Oscar malt, und Robin macht Holzkunst. Aber das kannst du dir gleich anschauen, wenn ich dir die Werkstätten zeige.«
Ich war echt gespannt. Die improvisierte Atmosphäre gefiel mir gut.
Vom Wohnzimmer aus gingen verschiedene Türen ab, die alle halb geöffnet waren. Freya führte mich in einen Raum, der nicht besonders groß war. Der gehörte ihr. Eigentlich bestand das Zimmer überwiegend aus einem großen Bett, über das eine bunte Patchworkdecke gebreitet war. Einen kleineren Tisch und zwei Stühle gab es ebenfalls. Freya hatte ein großes Papier auf dem Tisch ausgebreitet, das an allen Seiten überstand. Sie schien einen Entwurf gezeichnet zu haben.
»Schön habt ihr es«, bemerkte ich, nur, um etwas zu sagen, denn im Grunde war das Zimmer gar nicht als Zimmer zu bezeichnen. Es war ein Ort, in dem man übernachtete, vielleicht mal den einen oder anderen Freund zum Lieben mitbrachte, aber kein Ort, an dem man sich länger aufhielt. Doch das schien Freya nicht so wichtig zu sein. Sie lebte sicherlich eher in ihrem Atelier.
»Es ist alles noch im Aufbau«, erklärte sie. Offenbar hatte sie meine Unsicherheit bemerkt. »Wir wohnen erst seit einem Monat hier. Aber das wird sicher noch schön. Wir haben große Pläne.«
Ich schaute aus dem Fenster. Von hier aus bekam man einen Eindruck davon, was für ein großes und beeindruckendes Gebäude man vor sich hatte. In einem der unteren Fenster brannte Licht. Ich sah jemanden mit einer Kettensäge ein Stück Holz bearbeiten. Das musste Robin sein.
Freya trat neben mir an das Fenster.
»Da unten sind unsere Ateliers«, erklärte sie nun. »Und auf der anderen Seite sollen die Handwerksräume entstehen. Magst du sie dir mal anschauen?«
Natürlich wollte ich das. Ich war irgendwie ziemlich beeindruckt von dem großen Projekt.
Mit Freya ging ich nun wieder die Treppe hinunter, dann führte sie mich über den Hof. Als wir an meinem Pick-up vorbeikamen, schulterte ich den Sack Wolle und trug ihn hinter Freya her.
Im Gegensatz zu den Wohnräumen waren die Ateliers schon vollständig eingerichtet. Es gab zahlreiche Regale, die mit Kisten vollgestellt waren, in denen sich sehr unterschiedliche Wollen befanden. Einige Wollfasern waren struppig, andere sehr weich und fein, einige waren glatt, andere stark gekräuselt. Ich erkannte die Wolle von Merinoschafen sofort, die ganz besonders edel war. Aber auch grobe schwarze Wolle gab es, die wahrscheinlich von den Karakulschafen stammte.
»Du bist gut ausgestattet«, stellte ich fest.
Freya lachte. »So schöne weiche lockige Wolle wie von deinen Schafen fehlt mir noch in meiner Sammlung.«
»Das ist in Zukunft kein Problem mehr«, versicherte ich ihr. »20 Kilo kannst du jetzt haben, aber im Mai werden sie geschoren. Dann kannst du so viel haben, wie du willst.«
Freya sah mich bewundernd an.
»Toll. Ich komme vorbei«, versprach sie.
Ich winkte ab. »Ich bin zu der Zeit leider nicht da. Ich bin Wanderschäfer. In zwei Wochen geht es los, und dann bin ich Tag und Nacht auf der Insel unterwegs.«
Jetzt war Freya richtig beeindruckt.
»Echt? Wanderschäfer? Das muss ja total romantisch sein.«
Ich musste lächeln. »Man ist den ganzen Tag draußen«, dämpfte ich ihre Begeisterung. »Das ist nicht immer romantisch. Aber ich liebe es. Ich habe es schon als Kind geliebt.«
»Im April ist es noch ziemlich kalt«, überlegte Freya. »Schläfst du trotzdem draußen?«
Ich nickte. »Aber nicht unter freiem Himmel. Ich begleite die Schafe mit dem Wohnmobil. Das ist nicht so romantisch, aber warm.«
Ich konnte Freya ansehen, dass sie enttäuscht war. Wohnmobil, das klang nach Camping in einer Plastikkiste. Die Menschen wünschten sich immer, dass die Welt auf den Farmen stillstand und so blieb, wie sie sie aus den Bilderbüchern kannten. Mit Schweinchen im Stroh und Kühen auf der Wiese, der Bauer auf dem Melkschemel, den Eimer zwischen den Beinen.
»Tut mir leid, wenn ich deine Romantik zerstöre«, meinte ich. »Aber auch auf den Farmen hat sich die Welt gedreht. Selbst mein Vater war schon mit einem Wohnwagen unterwegs. Nur mein Großvater hat noch in einem Schäferkarren geschlafen. Aber der befindet sich jetzt im Heimatmuseum in Carisbrooke Castle.«
»Na klar, ich weiß ja«, sagte sie schnell, aber so ganz sicher war ich mir nicht.
Freya hatte nun den einen Jutesack geöffnet und tauchte ihre Hand in die Wolle.
»Sie fühlt sich wunderbar an«, sagte sie, zog ein paar Wollfäden heraus und zerpflückte sie mit ihren Fingern. An der Art und Weise, wie sie das machte, konnte ich sehen, wie vertraut ihr das Material war.
»In den Werkstätten wird auch eine Färberei entstehen«, berichtete sie. »Eine Freundin von mir will sie ins Leben rufen. Und sie färbt nur mit Naturmaterial. Das passt bestimmt gut zusammen.«
»Ja, die Wolle lässt sich gut färben«, pflichtete ich ihr bei. »Ich habe das sogar schon selbst gemacht.«
»Färbst du die Rohwolle?«, wollte sie wissen.
Ich nickte. »Ich bin nicht der große Spezialist«, erklärte ich. »Aber für das, was ich gebraucht habe, habe ich die Rohwolle gefärbt und später gesponnen.«
»Gesponnen auch noch?« Sie war jetzt total fasziniert. »Du bist wirklich ein ungewöhnlicher Typ.«
»Danke«, sagte ich, dabei wusste ich gar nicht, ob das ein Kompliment sein sollte.
Ich ging ein paar Schritte durch ihr Atelier. Einige große Wollbilder lehnten an der Wand. Allein diese riesigen Formate waren beeindruckend, aber auch die Art, wie die Wolle miteinander verwoben war, begeisterte mich. Einiges war geflochten, anderes miteinander verdreht, dann wieder hingen einzelne Fäden herunter. Diese Wollbilder waren farbig, doch auch die Farben gingen in warmen Tönen ineinander über.
»Toll sieht das aus«, musste ich zugeben.
Sie strahlte mich nun an. »Dafür, dass du angeblich nichts von Kunst verstehst, bist du ziemlich interessiert.«
»Ich finde es immer spannend, wenn Menschen etwas mit den Händen schaffen«, führte ich aus, und da waren wir absolut einer Meinung.
Freya zeigte mir noch die anderen Ateliers: die abstrakte Malerei von Oscar und die Textilkunst von Willow – beide genauso spannend wie Freya. Besonders beeindruckt aber war ich von Robin, der mit der Kettensäge riesige Holzskulpturen erschuf – aus dem Nichts und ganz ohne Plan.
Die Werkstätten besichtigte ich zuletzt. Sie waren bis jetzt nur riesige leere Räume, die durch die kleine Glühlampe an der Wand kaum in ihren Dimensionen zu erfassen waren. Aber Freya schilderte sie mir so plastisch, dass ich sie mir richtig gut vorstellen konnte. Noch war nicht für alle Handwerkskünste ein Künstler gefunden. Die Weberei war noch unbesetzt, und auch für das kleine Café suchte man noch einen Teilhaber. Ich versprach Freya, mich umzuhören, und dachte daran, Peggy anzurufen. Ich konnte mir gut vorstellen, dass sie sich in diesen Räumen wohlfühlen würde.
Als Freya und ich uns abends trennten, drückten wir einander kurz. Ich hatte mehr und mehr das Gefühl, wir hatten eine gemeinsame Seele.
Kapitel 2
Eva
Mein Handy klingelte, und ich sah Mums Foto auf dem Display. Jetzt musste ich tief durchatmen. Einen Moment kämpfte ich mit mir. Dann nahm ich an.
»Mum?«
»Evilein? Ich bin’s.«
An ihrer schmeichelnden Stimme ahnte ich, dass sie etwas von mir wollte. Und natürlich wusste ich auch, um was es ging. Dad hatte heute seinen großen Tag. Er bekam einen Ehrenpreis für Medizin. Weil er in der Plastischen Chirurgie so großartige Leistungen gezeigt hatte, verlieh ihm das University College Hospital in London diesen wichtigen Preis, ein Meilenstein in seiner Karriere. Natürlich war das ein Anlass für eine große Feier, bei dem sich die bekanntesten medizinischen Koryphäen die Hand reichten. Dabei durfte auch die Familie nicht fehlen. Selbstverständlich würden meine Schwester Chelsea und mein Bruder Jacob da sein, schließlich waren sie selbst Chirurgen und wollten gerne auf die Karriere meines Vaters aufbauen.
Einzig ich war das Problem – Eva Loggins, jüngste Tochter der Familie, verträumte Nachzüglerin, in Watte gepacktes Nesthäkchen, gedankenverlorene Idealistin und gutgläubiges Schäfchen. Jedenfalls wenn man dem Urteil meiner Eltern folgen wollte. Dieses Urteil fällten sie aber nur in ihren vier Wänden. Wenn jemand Außenstehender dazukam, redeten sie anders über mich. Dann fanden sie Worte wie unbeirrbare Idealistin oder zielstrebige Naturschützerin. Das alles war schräg, falsch und furchtbar peinlich. Eine lange Zeit hatte ich versucht, meinen Eltern zu erklären, was mir lieb und wichtig war, und worauf ich meine Zukunft gerichtet hatte. Aber das verstanden sie nicht, oder sie wollten es nicht verstehen.
»Das machst du doch nur übergangsweise, oder?«, hatte meine Mutter gestichelt, und mein Vater hatte hinzugefügt: »Oder bis dich ein toller Mann wach küsst und mit in sein Reich nimmt.«
Ah, das tat weh. Zumal mir klar war, dass der »tolle Mann« nur dann für meine Eltern ein richtiger Mann war, wenn er über ein Medizinstudium verfügte. Fachgebiet Chirurgie, versteht sich!
Es führte dazu, dass ich die Diskussionen mit meinen Eltern aufgegeben hatte und nur mir selbst vertraute.
Ich war gerade dabei, Ron das Geschirr anzulegen, das er als Blindenführhund tragen musste, ein Gespann, das um den Körper gelegt wurde und in einer Führstange endete, die man gut halten konnte. Ich brauchte beide Hände dazu, und darum klemmte ich mir das Handy nun zwischen Kinn und Schulter.
»Schon klar, Mum. Du willst, dass ich zu Dads Feier komme. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe.«
»Evilein, du musst. Du weißt, wie viel es Dad bedeutet«, beeilte sich meine Mutter zu sagen und hatte dazu noch diesen beschwörenden Tonfall, dem ich mich so schwer entziehen konnte. Was sie sagte, war nicht die ganze Wahrheit. Natürlich freute sich Dad, wenn ich kam, schließlich war ich seine Jüngste, aber in diesem Fall war es ihm besonders wichtig, neben seinem medizinischen Sachverstand auch seine großartige Familie vorzuzeigen. Und ob ich da das perfekte Aushängeschild war, bezweifelte ich. Klar, Dad würde uns alle voller Stolz präsentieren, über Chelsea und Jacob sagen, welche wichtigen Arbeiten sie in der Chirurgie verrichteten. Und auch mir würde er irgendwas andichten, das in seine Vorstellung von geglückter akademischer Bürgertochter passte.
»Sie ist Assistentin in der tiergestützten pädagogischen Arbeit und ermöglicht Behinderten, einen selbstbestimmten Alltag zu erleben«, hatte er beim letzten Mal behauptet, nur um zu vermeiden, zu erzählen, dass ich schlichtweg Hunde trainierte. Blindenhunde, aber auch Hütehunde oder Schutzhunde. Ich schämte mich überhaupt nicht für meine Arbeit. Im Gegenteil: Ich liebte sie über alles. Beschämend fand ich nur, dass ihm meine Tätigkeit so peinlich war. Für viele meiner Kunden war meine Arbeit die wichtigste der Welt. Ohne sie konnten sie ihren Alltag gar nicht bewältigen. Wie zum Beispiel der alte Mr Williams, der auf der Isle of Wight lebte und sehr plötzlich und schnell erblindet war. Er war so ein liebenswerter Mensch und tat sich schwer mit seiner Erblindung. Durch die Ausbildung meines Blindenhundes Ron würde er ganz neu ins Leben eintauchen können.
»Evi?«
Mums Stimme klang besorgt. Sie hatte Angst, dass ich nach einer Ausrede suchte.
»Schon gut«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich muss allerdings noch mit Ron trainieren. Er geht ja schon in der nächsten Woche weg, und bis dahin muss er fit sein.«
Dass ich Ron auch auf meiner großen Hundevorstellung vorführen wollte, verschwieg ich ihr, aus Angst, dass sie mir sonst versprechen würde, im Gegenzug, zu meiner Präsentation zu kommen. Mum bildete sich immer ein, sie würde meine Arbeit durch ihr Erscheinen aufwerten, doch das Gegenteil war der Fall. Sie erzählte dann allen möglichen Gästen irgendwelche Dinge aus meiner Kindheit, von denen sie glaubte, dass es großartige Leistungen waren, und das führte dazu, dass sie mich völlig aus dem Konzept brachte, weil ich mich so für sie schämte. Sie verstand nicht, dass ich in der Welt, in der ich lebte, gut war.
»Die Feier beginnt erst um sieben«, war wieder meine Mutter zu hören. »Das schaffst du doch, oder?«
»Vielleicht. Wenn ich mich beeile …« Natürlich schaffte ich das.
»Ich schicke dir den Fahrer, okay?«
Das war das Letzte, was ich wollte. Ich wollte unabhängig sein, dann konnte ich mich jederzeit von der Feier verabschieden.
»Nein, bloß nicht. Ich komme mit dem Auto«, beeilte ich mich zu sagen, und als Mum verstört schwieg, fügte ich hastig hinzu: »Ich parke den Wagen auch in der Seitenstraße.«
Mein alter Bulli passte natürlich nicht zu den Limousinen, die bei uns in der Auffahrt standen.
Mum atmete nun erleichtert aus.
»Das wäre wundervoll.« Sie ließ es offen, ob sie damit die Tatsache meinte, dass ich kam, oder dass ich in der Seitenstraße parkte. »Wir freuen uns auf dich, Evi.«
Ich verdrehte innerlich die Augen. Wenn sie nur dieses alberne »Evi« weglassen würde.
»Also dann, bis nachher«, verabschiedete ich mich hastig und beendete das Telefonat.
Ron hatte sich zu meinen Füßen abgelegt. Jetzt schaute er mich vertrauensvoll an. Wir verstanden einander.
»Zur Straßenbahn«, wies ich ihn an, und er stand auf.
Ich ergriff die Führstange, und wir liefen los.
Eine ganze Zeit lang hatte ich Ron mit der Leine trainiert, aber diese Führstange war gerade für ältere Menschen geeigneter. Dadurch konnten sie den Hund deutlicher spüren, und das machte sie sicherer.
Mir fiel die Trennung von Ron schon jetzt schwer. So einen klugen Hund wie ihn hatte ich noch nie gehabt. Er war der erste Schäferhund, den ich als Blindenhund ausbildete. Sonst hatte ich immer Golden Retriever oder Labradore für den Blindendienst eingesetzt. Die Rasse der Schäferhunde dagegen erschien mir deutlich geeigneter, weil sie viel selbstbewusster waren. Ron ließ sich durch nichts ablenken. Wenn er sich seinen Weg durch Menschengruppen bahnte, wenn er anderen Hunden begegnete oder Kinder ihn streicheln wollten, ignorierte er sie und machte nur das, was in seinem Job erforderlich war. Er führte seinen Auftrag aus, konsequent und ohne Umwege. Und wenn etwas Unerwartetes dazwischenkam, hatte er viele Ideen, damit umzugehen. Er war unglaublich klug. Instinkt, sagte man ja bei Tieren gerne, aber ich war mir sicher, dass Ron mitdenken konnte.
Blindenhunde kannten über siebzig Befehle, wie langsam gehen, Straßenbahn, Tür anzeigen, Ampel suchen, Platz suchen. Ron beherrschte achtzig. Den Weg zur Straßenbahn kannte er in- und auswendig. Er führte mich auf dem Bürgersteig entlang und achtete darauf, dass er links von mir ging. Als ein Radfahrer unseren Weg kreuzte, hielt er an und stellte sich so vor mich, dass ich stehen blieb und der Radfahrer an uns vorbeifahren konnte. Dann kamen die Straßenbahnschienen. Sicher führte mich Ron über die Straße, wartete schließlich an der Haltestelle auf die Bahn. Die ganze Zeit über hielt er seine Ohren gespitzt. Seine braunen Augen suchten die Umgebung ab.
Er war so ein wunderbarer Wegbegleiter. Ich würde ihn total vermissen. Das Einzige, was mich tröstete, war, dass ich noch eine ganze Zeit mit Mr Williams und Ron gemeinsam trainieren und ihn auf die Weise wiedersehen würde. Aber schon jetzt wusste ich, dass ich ihn innerlich loslassen musste. Er sollte Mr Williams’ Hund werden, und die beiden mussten genauso eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln wie Ron und ich.
Nun fuhr die Straßenbahn ein.
»Tür suchen«, befahl ich.
Rons Blick glitt aufmerksam an der Bahn entlang. Als sie hielt, führte er mich zu einer Tür. Die Menschen beobachteten ihn respektvoll.
»Ein Hund!«, rief ein Kind. »Darf ich ihn mal streicheln?«
»Jetzt nicht«, sagte ich. »Er muss sich konzentrieren.« Und zu Ron gewandt, sagte ich: »Tür öffnen.«
Ron ging mit mir auf die Straßenbahntür zu und drückte mit seiner Schnauze gegen den Türöffner. Nun hatte er die Aufmerksamkeit aller Menschen auf sich gezogen, die sich an der Haltestelle befanden.
»Ist der schlau!«
»Mama, guck mal, der hat die Tür aufgemacht.«
Ich war richtig stolz auf ihn. Ron zeigte mir nun an, dass eine Stufe kam, führte mich anschließend in die Straßenbahn, suchte einen Sitzplatz und drängte mich in diese Reihe hinein. Ich setzte mich, und er legte sich vor mich, als wenn er mich beschützen wollte. Dabei achtete er darauf, dass er niemandem im Weg lag.
Wir absolvierten einen langen Spaziergang durch Southampton, bei dem es zu verschiedenen Herausforderungen kam, doch Ron zeigte keine Schwäche. Er war einfach perfekt.
Am späten Nachmittag kehrte ich nach Hause zurück. Die anderen Hunde begrüßten mich begeistert.
Ich hatte mir ein Grundstück am Rand von Southampton gekauft, das ziemlich einsam lag, und mir dann ein Tiny House daraufgestellt. Es war die Spezialanfertigung eines Tischlers und war ein absolutes Raumwunder, besaß ein ausgeklügeltes System von Schlafzimmer unter dem Dach, einem Wohnzimmer-Küchenbereich im Parterre und einem Badezimmer daneben. Das war zwar minimalistisch geplant, doch mir reichte dieses Haus völlig aus, um darin zu leben. Ich war sowieso fast nur draußen im Garten bei meinen Hunden. Da ich keine Nachbarn hatte, störte sich auch niemand am Hundegebell. Das Grundstück war unendlich groß, und ich hatte Platz genug, die Hunde auszubilden. Auch für die Schafe, die mir unser Nachbar immer zum Trainieren zur Verfügung stellte, gab es Platz genug.
Ich umarmte Millie und Amber, meine beiden Border Collies, wuschelte Joker, dem Riesenschnauzer, durch den Bart und ließ mich von meinem Shepherd Flint umkreisen. Dann nahm ich die Hunde mit ins Haus und machte ihnen das Fressen für den Abend fertig. Sie beobachteten mich wachsam dabei.
So gerne wäre ich heute noch mit ihnen über die Wiese getollt, aber die Pflicht rief in Gestalt von Dad. Während ich die Hundenäpfe nebeneinander auf dem Flur verteilte – jeder Hund erkannte seinen an der Farbe und auch an dem Ort, an dem sie standen –, machte ich mir Gedanken um mein Outfit. Ich besaß eigentlich nur gute Outdoorkleidung, zahlreiche Regenjacken, Vliesjacken, Hoodies, T-Shirts und Jeans, dazu Gummistiefel, Trekkingschuhe und Turnschuhe, doch damit konnte ich heute ganz bestimmt nicht bei Dad punkten.
Ich kramte in meinem Schrank herum und fand einen Blazer, den meine Schwester Chelsea mir mal geliehen hatte und nicht zurückhaben wollte. Er war weiß mit bunten Patchworkflicken, die ziemlich stylish aussahen. Mit den Klamotten der Gäste konnte der zwar wahrscheinlich nicht mithalten, aber der Blazer war immerhin schicker als eine Vliesjacke. Ich kombinierte ihn mit einem schwarzen T-Shirt und einer weißen Hose, dazu meine Turnschuhe, ein paar Armbändchen, eine Kette – das musste reichen.
Flint lag auf dem Teppich neben dem Spiegel und beobachtete mich. Er überlegte wohl, ob ich ihn mitnehmen würde, und meist tat ich das auch, aber für heute war das ein No-Go. Die Illusion musste ich ihm sofort nehmen.
»Nein«, sagte ich freundlich. »Flint muss hierbleiben.«
Ein treuherziger Blick. Hunde konnten so unglaublich traurig gucken. Aber ich war daran gewöhnt und wusste, dass ich das aushalten musste.
»Bleiben«, wiederholte ich noch einmal.
Da zog er den Schwanz ein und lief zu den anderen. Gemeinsam machten sie es sich vor dem Ofen gemütlich. Sie verstanden sich meist gut. Zwischen Flint und Joker hatte es eine Zeit lang kleine Kämpfe gegeben, schließlich waren sie beide sehr dominant, mittlerweile aber waren sie gute Freunde. Ich war froh, dass sie sich gegenseitig hatten. Das würde sich ändern, wenn ich am kommenden Wochenende meine Hundevorstellung hatte. Danach würden sich sicherlich Joker, Flint und Amber verkaufen. Nur Millie würde ich behalten. Sie war trächtig und würde in einigen Monaten Junge bekommen, die ich dann für meine neue Ausbildung als Hütehunde vorbereiten würde.
Wenn ich daran dachte, dass ich meine Hunde nach der Hundeshow weggeben würde und ihnen danach ermöglichen musste, einen ganz neuen Lebensweg zu gehen, wurde ich ganz schwermütig. Aber so war es in meinem Job. Die Hunde waren nur für einen Abschnitt lang meine Lebensgefährten. Danach stand für alle ein neues Arbeitsleben an.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Eigentlich musste ich schon seit zehn Minuten unterwegs sein, aber ich wollte mich wenigstens noch kurz umziehen und ein bisschen schminken. Dann rannte ich zum Auto. Als ich durch den Garten zum Auto lief, fiel mir ein, dass ich noch gar kein Geschenk hatte. Das Schönste, was mir einfiel, waren Blumen aus dem eigenen Garten. Ich pflückte einen dicken Strauß, und dabei ließ ich mir Zeit. Das hatten sie verdient.
Wie immer kam ich auf den letzten Drücker.
In der Auffahrt unseres Hauses reihte sich Limousine an Limousine. Wie versprochen parkte ich meinen Bulli in der Seitenstraße und ging auf unser Haus zu. Ich erkannte Mums Kopf am Küchenfenster und hatte das Gefühl, dass sie erleichtert aufatmete. Die verlorene Tochter war heimgekehrt.
Kaum hatte ich die Haustür erreicht, da wurde sie auch schon von innen aufgerissen, und Mum lächelte mir zu. Es war ein angespanntes Lächeln.
»Kind! Wie schön.«
Es fühlte sich komisch an, mit 27 noch als Kind bezeichnet zu werden. Aber daran hatte ich mich schon fast gewöhnt. Sie machte es nur bei mir, nicht bei meiner Schwester Chelsea und erst recht nicht bei meinem Bruder Jacob.
Meine Mutter küsste mich auf die Wange, nahm mir die Blumen ab – »die sind sicherlich aus deinem Garten« – und schob mich dann auf die Terrasse. Ich spürte ihre Blicke in meinem Rücken, konnte geradezu fühlen, wie sie meine Kleidung musterte. Ich brauchte nicht hinzuschauen, wusste auch so, dass es nicht ihren Vorstellungen entsprach. Aber so war ich eben! Lange Zeit hatte ich mich bemüht, so zu werden, wie meine Eltern mich gerne gehabt hätten, aber das hatte nicht geklappt. Tiere waren für mich die besseren Menschen, und seit ich in meinem kleinen Tiny House mit dem großen Garten und den Hunden lebte, ging es mir gut. Dass meine Eltern das nicht verstanden, konnte ich nachvollziehen, aber ich wollte es nicht ändern. Mein Leben gefiel mir, und für nichts in der Welt würde ich es gegen ein Leben wie das von Chelsea oder Jacob eintauschen.
Ich betrat die Terrasse und kam gerade rechtzeitig, um Prof. Dr. Dr. Paul Michael Brain, Chefarzt der berühmten Healthcare-Kliniken in London und gleichzeitig Professor an der Oxford University, bei seiner Rede zuzuhören. Er holte weit aus, begann damit, wie sich Dad schon als Assistenzarzt einen Namen gemacht hatte, wie er schließlich die Abteilung zunächst als Oberarzt und nun als Chefarzt zu großer Anerkennung geführt hatte. Menschen aus aller Welt kamen, um sich ihre Wangen, Nasen oder Kiefer nach einem Unfall wieder richten zu lassen.
Ich wollte das gar nicht kleinreden. Mein Vater war tatsächlich ein außerordentlich guter Chirurg. Ich kannte Fotos von Menschen, die durch einen Tumor oder eine schwere Verletzung völlig entstellt waren, und Dad verhalf ihnen zu einem neuen Gesicht. Dabei war es nicht nur damit getan, dass die Knochen und Plastiken an ihrem Platz saßen, es mussten auch die Nerven und Gefäße wiederhergestellt werden. Ich konnte mir gut vorstellen, dass mein Dad viele Menschen durch seine geschickte Operation vor der Verzweiflung gerettet hatte. Die anschließende soziale Behandlung überließ er allerdings lieber seinen Kollegen. Einfühlsame Gespräche lagen ihm nicht. Das ließ der Redner natürlich unter den Tisch fallen, genauso wie unerwähnt blieb, dass Dad auch zahlreiche Schönheitsoperationen durchführte und damit den Hauptteil seines Geldes verdiente. Sogar meine Mutter hatte er zweimal im Jahr unter seinem Messer, was dazu führte, dass Mum stets ein wenig gequält lachte und aufpasste, dass sich die Haut an Kinn und Mundpartie dann nicht zu sehr spannte.
Umso entsetzter war sie immer, wenn ich lauthals lachte. Chelsea behauptete, dass sich mein Mund dann von einem Ohr zum anderen verzog. Was für ein Vergehen! Mum war sich bestimmt sicher, dass ich mit dieser Unart aufhören würde, wenn ich die vierzig erreicht hatte.
Dad wurde nun nach vorne gerufen, um seine Medaille und eine Urkunde in Empfang zu nehmen. Anschließend verlas er seine Dankesrede, die mindestens genauso lang war wie die seines Vorredners. Ich sah, wie einige Gäste verstohlen zu dem Büfett schielten. Ja, Hunger hatte ich auch.
Endlich war der offizielle Teil beendet. Der Sekt wurde ausgeschenkt, und man prostete sich zu. Dad steuerte nun auf mich zu, mit diesem Dr. Dr. Brain im Schlepptau. Nervös trank ich einen Schluck von meinem Sekt und bildete mir sofort ein, dass er mir zu Kopf stieg.
»Eva! Wie schön, dass du kommen konntest«, sagte Dad und nahm mich kurz in den Arm. Dann wollte er weitereilen, aber Mr Brain schien es auf mich abgesehen zu haben.
»Ist das deine Tochter, William?«, rief er und reichte mir im selben Moment die Hand. »Sie müssen das sein. Sie sehen aus wie Ihre Mutter!«
Auch das noch. Ich bemühte mich um ein Lächeln.
»Ja? Finden Sie?«
»Wie aus dem Gesicht geschnitten!«
Ich ließ das einfach unkommentiert im Raume stehen. Natürlich. Mit dem neuen Gesicht sah meine Mutter aus wie 27. Wir waren Schwestern! Zwillinge! Vorsichtig blickte ich mich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Das Büfett könnte meine Rettung sein. Hier stand Chelsea. Auch wenn wir nicht so ganz viele Gemeinsamkeiten hatten, wäre mir sicherlich etwas eingefallen, über das ich mit ihr Small Talk halten konnte. Doch der Typ war klebrig. Er stellte sich mir nun so in den Weg, dass es unhöflich gewesen wäre, an ihm vorbeizugehen.
»Ich habe gehört, dass Ihre ganze Familie in der Medizin tätig ist«, fuhr dieser Dr. Dr. fort. »Ihr Bruder ist auch in der Plastischen Chirurgie, nicht wahr? Und Sie?«
Da war sie wieder, diese Gretchenfrage.
»Nein, ich mache etwas ganz anderes«, antwortete ich.
Nun schaute sich meine Mutter nach mir um. Sie hatte offenbar meine letzten Worte gehört. Wenn es um die Familienehre ging, waren ihre Ohren überall.
Doch bevor sie an meine Seite gesprungen war und diese komplizierte Sache mit der tiergestützten Dingsda von sich gab, outete ich mich.
»Ich bin Hundetrainerin.«
»Hunde ...« Der Typ sah aus, als wenn ich den Verstand verloren hätte.
»Das sind diese Vierbeiner, mit dem Fell …«
Ich versuchte es auf die humorvolle Art, aber der Typ war überzeugt, sich verhört zu haben. Nun sprang meine Mum ein.
»Eva ist als Assistentin in der tiergestützten Arbeit tätig. Sie ermöglicht es Behinderten, einen selbstbestimmten Alltag zu leben«, begann sie.
Der Dr. Dr. machte ein Gesicht, als wenn er gar nichts mehr verstand. Ich nickte bloß höflich und überließ es meiner Mutter, ihr Gespräch mit Mr Brain fortzuführen.
Schnell ging ich zum Büfett hinüber. Chelsea schien schon auf mich zu warten. Sofort kam sie zu mir.
»Ich hätte nicht erwartet, dass du kommst«, sagte sie. Ihr Ton hatte etwas Versöhnliches.
»Ist doch selbstverständlich«, erwiderte ich und schnappte mir zwei von diesen Röllchen mit Käse, die so unwiderstehlich gut aussahen. Dann gab ich etwas von dem Salat mit den Erdbeeren auf meinen Teller und fügte Dressing hinzu. Chelsea ließ mich nicht aus den Augen.
»Geht es dir gut?«, wollte sie wissen.
»Fantastisch«, gab ich zurück.
Das war natürlich nicht die Wahrheit. Welchem Menschen ging es schon fantastisch. Aber mir ging es gut. Ich liebte meinen Job und mein Zuhause. Ich hatte eine Beziehung mit einem tollen Mann, auch wenn Daniel im Moment weit entfernt von mir war. Wir hatten zusammen als Backpacker in Neuseeland gearbeitet. Ich war dann nach Hause gefahren und hatte als Hundetrainerin angefangen, er wollte nachkommen, das hatte er mir fest versprochen. Dass er immer noch nicht da war, war der einzige Wermutstropfen in meiner persönlichen Biografie. Aber ich wusste, wie schwer es war, sich von Neuseeland zu trennen.
»Du siehst ein bisschen überarbeitet aus«, bemerkte Chelsea.
»Das bin ich auch«, gab ich zu. »Ich habe am Wochenende eine Hundeshow, und bis dahin muss ich mit einigen Hunden noch ein bisschen trainieren. Darum wäre ich heute Abend …«
Ich brach ab. Chelsea würde nicht verstehen, warum man wegen eines Hundetrainings auf eine bedeutsame Familienfeier verzichtete.
»Dad ist es sehr wichtig, dass du da bist«, ermahnte sie mich in ihrer Große-Schwester-Manier.
»Weiß ich ja«, winkte ich ab. »Und er kommt ja auch zu meiner Hundeshow, um sich anzuschauen, was ich alles so leiste.«
Nun zog Chelsea überrascht die Augenbrauen hoch. Diese Äußerung verwirrte sie.
»War ein Witz«, meinte ich. »Du weißt ja, dass ihn meine Arbeit nicht die Bohne interessiert. Im Gegenteil. Sie ist ihm peinlich.«
Ich spürte plötzlich, dass ich schlucken musste. Das irritierte mich selbst. Offenbar machte es mir doch mehr aus, als ich mir eingestehen wollte.
»Sollen Mum und ich zu der Hundeshow kommen?«, fragte Chelsea und betrachtete mich mitleidig.
»Bloß nicht!«, rief ich entsetzt. »Das würde mich echt stören.«
Chelsea nickte. Eigentlich hatten wir beide ein gutes Verhältnis zueinander. Sie hatte mich sogar in meinem Jahr in Neuseeland besucht, und es hatte ihr tatsächlich gefallen. Auch mit Daniel hatte sie sich gut verstanden.
Daniel! Da war er wieder, der Gedanke an ihn. Ich hatte ihn zu meiner Show eingeladen, aber er musste absagen. Er arbeitete gerade auf einer Rinderfarm und konnte nicht weg. Außerdem war der Flug viel zu lang und zu teuer, um mich nur kurz zu besuchen. Aber er konnte ja auch für länger bleiben. Sogar für immer, wenn er wollte. Ich verdiente mit meinem Job genug für zwei. Doch er kam nicht. Das war das eigentliche Problem.
Seufzend griff ich zu einem Wrap, der mit Frischkäse und Putenbrust gefüllt war.
»Hallo!«
Dieser schöne Typ hatte mich schon eine ganze Zeit lang beobachtet. Nun war er neben mir aufgetaucht. Seine Augen hatten etwas Wachsames und erinnerten mich an einen Husky. Er war perfekt angezogen, eine gute Mischung aus lässig und schick.
»Dich kenne ich noch nicht. Du bist die Jüngste, oder?«
Ich biss gerade in meinen Wrap und konnte nicht sprechen. Also nickte ich.
»Ich bin Brian Rylie, Assistenzarzt deines Vaters. Chelsea und Jacob habe ich schon kennengelernt, aber du scheinst dich nicht so für Familienfeste zu begeistern.«
Was sollte ich sagen? Ich schluckte den Bissen herunter.
»Geht so«, wich ich höflich aus. »Ich bin immer ziemlich beschäftigt.«
Jetzt kam sie wieder, die Frage. Ich konnte es diesem Brian ansehen.
»Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?«
»Ich trainiere Hunde.«
»Wie meinst du das?«
Er hoffte, dass er das falsch verstanden hatte. Aber Pech gehabt. Das Schicksal konnte manchmal gnadenlos sein!
»Ich bilde Hunde als Schutzhunde oder Hütehunde aus.«
»Hütehunde?«
Er konnte und wollte es nicht glauben. Die Tochter seines Chefs war eine Hundemutti.
»Gerade habe ich auch einen Blindenhund ausgebildet. Er hat morgen seine Prüfung, danach geht er dann zu seinem ersten Arbeitseinsatz.«
Der Typ betrachtete mich weiterhin freundlich, auch wenn ein spöttischer Zug in seinem Mundwinkel erschien.
»Das hört sich interessant an.«
So ein Schleimer!
»Das ist es auch.«
»Und diese Hunde – leben die alle bei dir?«
Ah, jetzt kamen wir den kritischen Gesichtspunkten schon näher. Er war wahrscheinlich einer der Typen mit Hygienetick.
»Genau. Ich habe ein Tiny House etwas außerhalb von Southampton. Dazu gehört ein großes Grundstück, und dort kann ich die Tiere in Ruhe trainieren.«
Er nickte, doch nun zuckten seine Nasenflügel leicht.
»Sie wohnen also bei dir?«
»Klar. Ich stehe nicht auf Zwingerhaltung.«
»Sie gehen also bei dir ein und aus? In deinem Tiny House?«
Klarer Fall. Wahrscheinlich jemand mit einem krankhaften Waschzwang, jemand, der sich alle drei Minuten die Hände mit Sagrotan wusch und sie dann auch noch desinfizierte.
»Wir sind immer zusammen, die Hunde und ich«, erklärte ich. »Nur im Bett schlafe ich allein.« Ich zwinkerte ihm zu. »Meistens jedenfalls.«
Jetzt schien er Angst zu bekommen. Vielleicht hatte er ein Bild vor Augen, wie ich ihn in einem Hundekörbchen vernaschte. Jedenfalls machte er einen Schritt zurück, um Abstand zu gewinnen.
»Riechen sie nicht etwas streng?«, wollte er wissen.
Ich spürte, wie mir das Gespräch auf die Nerven ging. Warum konnten mich Menschen wie er nicht in Ruhe lassen?