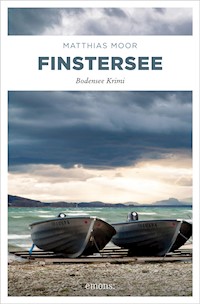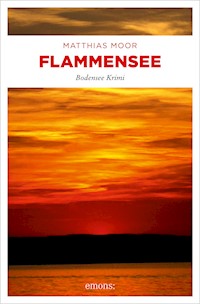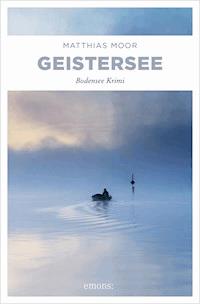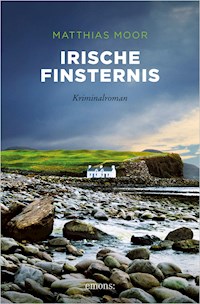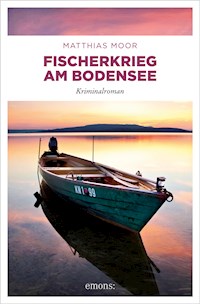Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Ein intensiver Thriller, der unter die Haut geht. Journalistin Mary musste als Kind erleben, wie ihre Eltern bei einem Brand ums Leben kamen. 25 Jahre später begegnet sie zufällig einem Mann, den sie damals gesehen zu haben glaubt – und gerät Schritt für Schritt in einen Alptraum. Verstörende Erinnerungen tauchen auf, die eine ganz andere Geschichte vom Tod ihrer Eltern erzählen. Wurden sie ermordet? Welche Rolle spielte der mysteriöse Mann? Auf der Suche nach der Wahrheit kehrt Mary nach Irland zurück und gerät in eine gefährliche Welt voller Lügen und Geheimnisse, in der sie bald um ihr Leben fürchten muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Matthias Moor, Jahrgang 1969, lebt seit über dreißig Jahren am Bodensee. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Gymnasiallehrer und als freier Journalist und liebt den Bodensee mit seinen vielgestaltigen Landschaften. Wenn mal nichts anliegt, fährt er am liebsten mit seinem Boot zum Angeln auf den See hinaus. Neben dem Bodensee ist Irland seine Seelenheimat.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-276-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Die Erinnerung, sagt Jean Paul, ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Manchmal mag das zutreffen. Öfter aber ist die Erinnerung die einzige Hölle, in die wir schuldlos verdammt werden.
Prolog
Ich war zu spät, viel zu spät, und hatte ein schlechtes Gewissen. Statt nach Hause zu gehen, war ich bei Owen geblieben. Aber was sollte man auch machen, wenn der Fluss voller Lachse war? Vor zwei Tagen hatte es wie verrückt geregnet, der Owenduff war zu einem reißenden Wasser geworden, und da stiegen im August die Lachse aus dem Meer. Große, schlanke silberne Tiere mit der Kraft des Atlantiks. So sagte das Daddy immer. Wie Pfeile schossen sie aus den schwarzen Fluten und fielen laut klatschend wieder hinein. Na los, holt uns doch, hieß das für uns. Aber erwischt hatten wir noch nichts. Wie sollte man denn da nach Hause gehen? Dad würde mich verstehen, hoffentlich. Doch jetzt musste ich los. Wenn ich nicht zum Abendessen käme, gäbe es richtig Ärger.
Owen fischte weiter, er war auch schon zwölf und ein Junge und ich erst zehn. »Mary, warum gehst du ausgerechnet jetzt?«, fragte er, als ich das Ufer hochkraxelte.
Ich erklärte es ihm, aber er zuckte nur mit den Achseln, wandte sich ab und war mit den Gedanken schon wieder bei den Lachsen. Ich hätte heulen können, bestimmt würde er heute noch einen fangen!
Ich dachte mir nichts dabei, als ich plötzlich die Rauchsäule sah, ungefähr da, wo unser Hotel stand. Ich lief am Fluss entlang, hier im Moor gab es keine Wege. Lief durchs nasse Ufergras, auf weichen Matten aus Moos, auf schwarzem Torf, durch ölige Pfützen und lila blühendes Heidekraut. Ich war so wütend! Auf meine Eltern, weil ich immer so früh nach Hause musste. Und auf mich, weil ich nicht mutig genug war, um bei Owen zu bleiben. Die Sonne war warm, ich keuchte und schwitzte und rannte wie eine Verrückte, als könnte ich es doch noch bis zum Abendessen schaffen.
Ich weinte, vor Scham und vor Wut.
Ich war barfuß, wie immer im Sommer, weil ich es liebte, den weichen Boden unter meinen Füßen zu spüren. Gras und Moos waren patschnass vom Regen, bei jedem Tritt schmatzte es, und manchmal blieben meine Füße im Torf stecken, oder Strünke von Heidekraut griffen nach ihnen, als wollten sie mich aufhalten. Ich fiel hin, Schlamm spritzte mir ins Gesicht, der klebrige Torf umschloss meine Hände und Füße wie eine zweite Haut, doch ich raffte mich auf und lief weiter.
Ich konnte den Fluss riechen, er roch so frisch wie sonst nur im Frühling, als würde das Wasser blühen.
Ich hatte Seitenstechen und blieb kurz stehen, die Rauchsäule stieg schwarz in den blauen Himmel. Ich dachte: Daddy hat in den letzten Tagen im Park gearbeitet, und jetzt verbrennt er tote Äste von den alten Eichen und Kastanien. Und er wird stocksauer auf mich sein, denn eigentlich hatte ich ihm helfen wollen. Hatte es ihm sogar versprochen. Aber ich ging lieber mit Owen zum Fischen, als Blätter zusammenzurechen und schwere Äste zu schleppen. Doch Daddy würde mich verstehen. Er war der beste Lachsangler auf der ganzen Welt. Er kannte jeden Stein im River Owenduff und wusste, hinter welchen die Lachse lagen. Er war mein König, der König des Moors. Er würde mich böse anschauen, wenn ich gleich da wäre, und ich würde sagen, dass ich mit Owen beim Fischen gewesen war. Ich würde vor Ehrfurcht zittern, die Augen richtig groß machen, ihn flehend und auch ein bisschen trotzig ansehen und sagen, dass überall im Fluss Lachse sprängen, dass man da doch unmöglich nach Hause gehen könne, und da würde er noch kurz streng schauen, doch dann laut loslachen, mich auf den Arm nehmen und fragen, ob wir wenigstens was gefangen hätten.
Aber dieses Gespräch fand niemals statt. Denn es waren nicht alte Äste, die brannten. Als das Haus zwischen den Bäumen des Parks hervorkam, blieb ich abrupt stehen. Es war das Hotel, unser Hotel, mein Zuhause, und es stand in Flammen.
Ich rief: »Mum! Dad!«
Keine Antwort. Das Auto stand da, sie mussten also hier sein. Warum waren sie nicht vor dem Haus und warteten auf mich? Suchten sie mich am Fluss? Doch Daddy kannte die Pools, er hätte mich gleich gefunden! So wie es aussah, brannte es schon eine ganze Weile. Und Mum wäre auf jeden Fall hiergeblieben, damit ich nicht auf die Idee käme, ins brennende Haus zu gehen.
Aber genau das würde ich jetzt tun. Wenn sie nicht hier draußen warteten, waren sie drinnen. Brauchten vielleicht meine Hilfe, waren ohnmächtig vom Rauch, lagen im Wohnzimmer, oder die Flammen versperrten den Weg nach draußen.
Ich schluckte, als ich vor dem Haus stand. Die Fensterscheiben waren geborsten, scharfe Splitter lagen auf den Blumenrabatten. Im Dach klaffte ein Loch, aus dem die Flammen loderten. Die weiße Hauswand war schwarz von Ruß.
Wie festgezaubert stand ich da, starrte auf die Flammen, wie sie aus dem Dach leckten, und die Angst kroch wie ein Gift in meine Poren. Würgte meinen Hals. Ginge ich da rein, würde ich vielleicht sterben. Ich könnte umdrehen und zu Owens Eltern rennen, aber das dauerte eine Viertelstunde hin und eine wieder zurück oder noch mehr, weil Owens Vater von der vielen Farmarbeit nicht mehr so gut zu Fuß war. Dann wären meine Eltern vielleicht schon erstickt!
»Mum! Dad!«, rief ich, doch niemand antwortete, nur das Feuer rauschte. So klingt der Tod, dachte ich.
»Dad«, rief ich noch einmal, voller Zorn, weil er verdammt noch mal nicht antwortete. Weil sie mich zwangen, da hineinzugehen.
»Mum!«, schrie ich, und meine Stimme überschlug sich. Noch mehr Tränen liefen über meine schmutzigen Wangen, als ich die paar Stufen hoch zur Haustür stieg.
Sie stand offen, mit pochendem Herzen ging ich rein. Es war rauchig und heiß, doch nicht der behagliche Geruch, wenn abends ein Torffeuer im Kamin prasselt, stattdessen brannte der Rauch wie Brennnesseln in meinen Lungen. Auf den Dielen lag Asche wie eine dicke Schicht Staub. Ich hustete, würgte, das Holz war so heiß an den Füßen, gleich würden sie schmelzen.
Wären sie tot, wollte ich auch sterben. Wollte wie sie verbrennen. Ich sehnte mich schon nach den Flammen, sie wären weniger schlimm als die Schmerzen und die Scham und die Angst in mir drin. Ich rief noch einmal, doch heraus kam nur ein Flüstern.
»Daddy? Mum?«
Nur ein Flüstern, weil ich es schon wusste. Wusste, dass ich jetzt allein war und es für immer bleiben würde.
Ich ging weiter, wie in Trance, der Tod zog mich zu sich. Die lachsfarbenen Tapeten im Wohnzimmer waren voller Ruß. Die Stoffsessel brannten, auch die schweren Vorhänge an den Fenstern.
Auf dem Tisch zerbrochenes weißes Geschirr auf grauer Asche, Scherben waren auf dem Boden verstreut.
Dort lagen auch meine Eltern.
Obwohl die Haut verkohlt und Haare und Kleider verbrannt waren, erkannte ich meinen Vater, seinen großen, starken Körper.
Meine Mutter, zierlich und schlank.
Sie hatte keine Augen mehr, da waren nur zwei dunkle Höhlen.
Warum sind sie nicht weggelaufen? Wollten sie sterben?
Da fiel es mir ein: der Knall, den wir am Fluss gehört hatten. Als wäre irgendwo etwas explodiert. Und ich? Hatte mir nichts dabei gedacht. War einfach bei Owen geblieben.
Ich sah auf die Scherben, mein Blick verschwamm, und ich bekam keine Luft. Das Geschirr, sie hatten schon zu Abend gegessen, ohne mich. Ich sah sie vor mir, wie sie schweigend aßen, konnte das Stew und das Torffeuer riechen. Eigentlich war es dafür noch zu warm, aber weil ich es so liebte, feuerte Daddy für mich auch im Sommer an. Und ich war nicht gekommen! Sie tauschten Blicke, als ich das Esszimmer betrat. So wollten sie mich fürs Zuspätkommen bestrafen. Vielleicht hätte es mein Vater nicht lang ausgehalten und plötzlich gegrinst.
Eigentlich hätte ich bei ihnen sein müssen.
Ich will tot sein, dachte ich, so wie ihr.
Was dann passierte?
Ich habe keine Ahnung.
Wie ich von dort wegkam?
Woher soll ich das wissen?
Zu wem ich lief? Ob man mich fand?
Es ist nicht mehr wichtig.
Es ist ein Vierteljahrhundert her.
Vielleicht bin ich losgelaufen zu Owens Eltern. Ihr Hof lag nur eine knappe Meile entfernt, und seine Mutter war immer da.
Vielleicht, vielleicht.
Wahrscheinlich hat man es mir erzählt, doch ich habe es vergessen. Vergessen wollen, vergessen müssen.
Und jetzt? Will ich es nicht mehr wissen.
Weil es nicht mehr wichtig ist.
Weil es nicht mehr zu ändern ist.
Weil alles nicht mehr zu ändern ist.
An diesem Abend war meine Kindheit plötzlich zu Ende.
Eine Kindheit, die nur glücklich gewesen ist.
Hey, wer kann das schon von sich behaupten?
Wer hat schon einen solchen Schatz, hm?
Ich verlor meine Welt und kam in eine, die mir kalt und fremd geblieben ist.
Ich habe alles zerstört.
Man kann auch sagen: Dieser Abend war das Ende meines Lebens.
1
Draußen ist es kalt, Regen fällt, bläuliches Dämmerlicht mitten in der Nacht, halt Norwegen Anfang Juli.
Hier drinnen ist es heiß, das Feuer im Schwedenofen tanzt an den Wänden des kleinen Schlafzimmers, und es riecht nach verbranntem Holz.
Ich liege auf dem Rücken und schaue zu Ole, auf seinen nackten Körper im Feuerschein, aber nur ganz kurz, nur um mich zu vergewissern, dass das hier wirklich passiert.
Er hat meinen Hals geküsst, seine Lippen haben zärtlich mit meinen Brüsten gespielt, jetzt gleitet er Stück für Stück, Kuss für Kuss, quälend langsam – wunderbar langsam – meinen Bauch hinab.
Ich schließe die Augen und kann die Spur seiner Küsse unter meiner Haut spüren, als wäre sie aus dünner Seide. Diese Küsse sind zärtlich und hungrig, so wie sie sein sollen.
Ich schließe die Augen, will ihn nur spüren, nicht sehen. Sonst wäre es zu nah, es ist jetzt schon viel zu nah. Morgen werde ich es bereuen.
Mein Atem zittert, als er zwischen meinen Beinen ist. Von dort wollen seine Lippen nicht mehr weg. Seine Zunge weiß genau, wie sie es anstellen muss, als hätte sie das schon etliche Male gemacht, dabei ist es erst unsere dritte Nacht. Ich spreize meine Beine.
Just flow.
Ich öffne die Augen, als es vorbei ist. Er lächelt mich an, sehr zärtlich und noch immer hungrig.
Ich lächle zurück, ich muss das jetzt tun, es war sehr schön, das bin ich ihm schuldig.
Meine Fersen drücken ihn tief in mich hinein, und schon ist es bei ihm so weit. Sein heißer Atem fließt über mein Gesicht, und ich zwinge mich, ihn anzusehen, seinen erlösten Blick zu ertragen, ihm noch ein Lächeln zu schenken.
So macht man das, oder nicht?
Die Wahrheit ist: Ich bin schon wieder weggedriftet, habe mich längst von ihm losgekettet und in Sicherheit gebracht, bin meilenweit entfernt, obwohl er noch in mir ist.
Er spürt, dass er mir viel zu nah gekommen ist, wendet seinen Blick ab und gleitet neben mich.
Meine Augen sind zu, als könnte ihn das aus der Welt schaffen. Noch ein Lächeln, das ihm zeigen soll, wie erschöpft und glücklich ich bin. Ich höre seinen Atem, rieche seine Haut, sie riecht nach Lust und einem herben Parfum, das gar nicht zu ihm passt.
Ich stelle mir seine dunkelbraunen Augen vor, wie sie mich betrachten, sein schwarzes Haar und diese lederfarbene, haarlose Haut, die ich schon wieder küssen will. Ole sieht aus wie so ein Elb aus »Herr der Ringe«, dachte ich, als ich ihn vor vier Wochen zum ersten Mal in einem Labor der Uni Trondheim traf. Nur die spitzen Ohren fehlten. Da ahnte ich schon, wohin das führen würde.
Er liebt mich, ich kann es fühlen, will mich für sich, und das treibt mich von ihm weg.
Jedenfalls wird es ihm wehtun und mir auch, aber alles andere wäre viel schlimmer.
Ja, es war schön, dieser Mann hat mich für eine Weile in den Himmel gebracht. Wäre ich eine andere, könnte ich mir ein Leben mit ihm vorstellen.
Nach drei Nächten kann ich sagen: Ole ist nicht nur ein variantenreicher Liebhaber, mit dem wohl auch in zwanzig Jahren noch guter Sex möglich wäre, er ist auch klug, stellt was dar und hat genau diese Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit, der ich so leicht verfalle. Ein Mann, der entspannt, feinfühlig und selbstbewusst genug wäre, um mit so einer wie mir klarzukommen, zumindest für eine Weile.
»Warum siehst du mich nicht mehr an?«, fragt er plötzlich mit einem ironischen, beleidigten Unterton, und ich bin erschrocken, dass er noch da ist.
Da muss ich wohl die Augen öffnen.
Muss lächeln.
Seine Augen wirken zufrieden, schläfrig. Like the cat that got the cream. So wie meine. Doch in seinen ist noch etwas anderes.
»Du willst fort, hm?«, sagt er mit seiner tiefen, weichen Stimme. »Kannst es kaum erwarten, morgen im Flieger zu sitzen und von mir wegzukommen.«
Stimmt, denke ich, sage aber nichts, sehe ihn nur an.
Er seufzt. »Du lässt dich nie wirklich auf jemanden ein, hab ich recht, Mary?«
Ich zucke mit den Achseln. Betrachte seinen schlanken, nackten Körper, nach dem ich am liebsten schon wieder greifen würde.
»Ich lebe in Frankfurt, du in Trondheim«, sage ich. »Du kannst nicht weg aus Norwegen, ich nicht aus Deutschland.«
»Das ist es nicht. Du lebst doch eh alle paar Monate woanders.«
»Eben.«
»Dein Base Camp könnte auch in Trondheim sein. Zumindest könntest du es versuchen. Ich weiß, dass du dich in Norwegen wohlfühlst.«
»Im Sommer schon.«
»Du kennst den Winter doch noch gar nicht.«
Ich lächle und schweige.
Er sieht mich durchdringend an, und ich rücke unwillkürlich ein Stück von ihm weg.
»Du bist immer auf der Flucht, nicht wahr? Es ist komisch, aber immer wenn ich an dich denke, sehe ich dich an einem Gate am Flughafen sitzen. Ich habe mich gefragt, warum. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Dein Leben ist wie auf einem Flughafen: immer auf dem Sprung woandershin, Hauptsache, nicht bleiben müssen, keine Beziehungen eingehen, sich nicht stellen müssen.«
»Quatsch«, sage ich abschätzig und verdrehe die Augen.
»Dein Leben ist wie das dauernde Suchen nach etwas, das du sofort, wenn du es hast, wieder wegstößt.«
Du spinnst, denke ich, doch seine Worte schneiden wie ein Seziermesser unter meine Haut. Und das macht mich wütend.
»Was bildest du dir ein, mich nach ein paar Tagen verstehen zu wollen? Wie anmaßend ist das denn? Was soll das?«
»Es kommt auf die Nächte an«, sagt er mit einem süffisanten Grinsen und rückt an mich heran. »Aber sorry, ich wollte dich nicht verletzen.«
»Arschloch«, sage ich schroff, wende mich ab und stehe auf.
Er schweigt, sichtlich getroffen. Ich nehme Feuerzeug und Zigaretten und gehe ins Bad. Verschließe die Tür hinter mir, er soll auf keinen Fall zu mir kommen und mich umarmen wollen oder irgend so etwas. Ich will schreien und presse stattdessen meine Fingernägel in den Oberschenkel, bis es nicht mehr so wehtut. Beiße in die zur Faust geballte andere Hand, so lange, bis der Schmerz in mir drin wieder auszuhalten ist. Mit zitternden Händen stecke ich mir eine Zigarette an, inhaliere tief und blase den Rauch durchs gekippte Fenster. Wische die paar Tränen aus den Augen und glotze auf die Bissspuren in meiner Hand. Noch fester, und es wäre Blut geflossen.
Ich will ein Igel sein mit tausend Stacheln.
Ein Maulwurf, der sich tief in der Erde vergräbt.
Im Bad ist es kalt wie in einem Gefrierschrank. Ich schaue in den Spiegel und betrachte mich im fahlen Morgenlicht: die nackenlangen, verstrubbelten schwarzen Haare mit dem Pony, der meine Augen verdeckt, wenn ich es will; diese tief liegenden Augen, die immer leicht entrückt wirken, als wäre ich zugleich hier und woanders; die etwas zu schmalen Lippen und der etwas zu breite Mund … Ziemlich hübsch, nur zu mager, fand Ole mit seinem perfekten Elbenkörper. Blödsinn, meinte ich, doch er hat recht, wenn ich meine kleinen Brüste, die hervortretenden Rippenbögen, den Jungshintern und die staksigen Beine betrachte: Fünf, sechs Kilo mehr würden mir guttun.
Ich rauche und stresse mich zu viel und esse zu wenig. Weil ich nicht sehr groß bin, sehe ich von hinten wie ein junges Mädchen aus. Oder wie ein dürrer Junge.
Ich trete nah an den Spiegel heran und studiere mein Gesicht. Die ständige Unruhe sieht man mir an. Wie immer bin ich zu blass, und meine Augen und Mundwinkel zucken unwillkürlich. Ich lächle. Dabei zieht sich mein rechter Mundwinkel weiter nach oben als der linke, zusammen mit meiner rechten Augenbraue. Ole findet, das habe etwas Aristokratisches. Meine Tante, die kalte Schlange, bei der ich aufgewachsen bin, meinte, es passe zu meinem arroganten Wesen.
Am schönsten findet Ole meine Augen. Diese graugrünen, tief liegenden Augen mit hellbraunen Einsprengseln, sie hätten zugleich etwas Zartes, Nachdenkliches und Kühles, außerdem würden sie funkeln vor Energie, Zähigkeit und Willenskraft. Das hat mir gefallen. Stimmt, so bin ich, hab ich gedacht. So hat mir das noch nie jemand gesagt.
Ich wende den Blick ab und setze mich mit meinem nackten Hintern auf den eiskalten Klodeckel. Meine Füße fühlen sich an, als würden sie jeden Augenblick auf den Fliesen festfrieren. Ich ziehe den Zigarettenrauch tief in mich hinein, als könnte er mich wärmen. Mein Herz schlägt immer noch viel zu stark und viel zu schnell. Gut so, dass ich ihn auch verletzt habe! Was denkt er, wer er ist? Ich bin wütend und beleidigt und getroffen, wie er mit ein paar Sätzen mein Leben auf den Punkt gebracht hat. Wie leicht ich zu lesen bin. Wie er mich nach ein paar Nächten erkannt hat. Ich habe wieder Tränen in den Augen, doch ich weiß nicht, warum – ob aus Wut oder Scham oder weil ich ihn jetzt schon vermisse.
Ich friere, hebe meinen Hintern von dem kalten Deckel und schaue hinaus in den Morgen, hinaus auf die schlafenden Schären. Doch, sie sind wunderschön. Noch wolkenverhangen, grau und schwer wie bei einer Beerdigung, aber wenn später die Sonne scheint, ziehen die grauen Häuser ihre bunten Kleider an, lachen die Salzwiesen und das himmelblaue Meer und die orangefarbenen Flechten auf den glänzenden Felsen. Die feuchte Luft, die durchs gekippte Fenster fließt, riecht nach Tang, Fisch und Salz. Nach dem weiten, wilden Atlantik. Wind und Brandung sind zu hören, der Sound der Freiheit.
So wie damals in Irland.
Mir ist zum Heulen zumute. Ich komme mir wie so eine beknackte, hypersensible Heulsuse vor, und das ist so ziemlich das Letzte, was ich sein will. Sonst bin ich nie so, kann aber gerade nichts dagegen tun.
Mir ist so kalt, doch mich kriegen keine zehn Pferde zurück zu Ole ins Bett.
Ich war zu lange hier. Drei Monate waren die Schären mein Zuhause. Habe schon angefangen, Wurzeln zu schlagen. Mich wie eine Flechte an einem Felsen festzukrallen.
Nicht gut.
Es ist höchste Zeit, wieder zu verschwinden.
2
Unruhig sitze ich am Flughafen in Oslo und warte auf meinen verspäteten Flug nach Frankfurt. Unruhig, als hätte ich dringende Termine. Am liebsten würde ich eine rauchen. Ich betrachte die Werbung auf den riesigen Bildschirmen: Schweizer Uhren an den Armen schöner, verwegener, erfolgreicher Männer. Beim Bergsteigen, Segeln, im Anzug auf dem Weg zum Meeting. Es sind Uhren, die auch im Erdinnern nicht schmelzen, die auf dem Mars intergalaktische Zeitzonen anzeigen und die nach einem Atomkrieg noch ticken. Ein Flughafen ist ein guter Ort, um Uhren zu bewerben, weil jeder ständig auf seine blickt. Weil es hier wirklich auf Minuten ankommt. Weil die Zeit nur schwer totzukriegen ist. Und trotzdem hat man immer Angst, dass einem nicht mehr genug davon bleibt.
Ich hasse Flughäfen, und ich hasse Warten. Ich muss daran denken, was Ole gestern Nacht sagte, dass mein Leben so ist wie das auf einem Flughafen. Was ja hieße, dass ich mein Leben hasse, aber so stimmt das nicht.
Ich kriege ihn jedenfalls nicht aus dem Kopf. Habe brennende Sehnsucht nach ihm, genau deshalb werde ich ihn nie wiedersehen. Heute früh habe ich ihm per SMS unmissverständlich klargemacht, dass er mich nicht anrufen und mir nicht schreiben soll. Und weil er nicht hören wollte und mich mit Anrufen und WhatsApps quälte, habe ich seinen Kontakt gelöscht.
Ist das kalt? Ungesund? Selbstzerstörerisch?
Vielleicht.
Ich vermute, ich war nicht immer so.
Ich glaube nicht an Beziehungen, einer leidet dabei immer. Irgendwann will einer von beiden nicht mehr, zieht weiter und lässt den anderen mit seinen Schmerzen zurück. Und wenn du dich öffnest, wirklich öffnest, bist du sowieso verloren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der andere vor dir zurückschreckt, erschrocken von den Narben und dunklen Tiefen. Sich von dir wegstößt, um nicht mit hinabgezogen zu werden, und sich lieber wieder auf die Suche macht. Nach etwas Neuem, Einfachem, Unverbrauchtem. Unvernarbtem. So ist das, man muss nur die Augen aufmachen. Da bin ich lieber für mich und habe ein freies Leben, so wie eine Katze. Du streifst allein durch die Welt, und wenn dir danach ist, schaust du mal nach einem Kater. Und stellst auf keinen Fall die falschen Fragen, vor allem nicht an dich selbst.
Diesmal tut es sehr weh, noch viel mehr als gedacht. Ich hatte die Hände zu lange auf der heißen Herdplatte. Doch der Schmerz wird vergehen, in ein paar Tagen wird er abgeebbt sein. Man kann sich schützen.
Ole ist Meeresbiologe an der Uni Trondheim. Ich habe ihn wegen meiner Reportage besucht. Drei Monate habe ich auf Mausund gelebt, einer kleinen Inselgruppe mitten im Nordatlantik. Ich habe über das Leben mit den Lachsfarmen recherchiert, die es in der Gegend hinter jeder Schäre gibt. Ich habe mit den Menschen darüber gesprochen, wie sich ihr Alltag und ihre Arbeit verändert haben, was es mit ihnen macht, wenn tagtäglich Millionen Zuchttiere ins Meer vor ihrer Haustür scheißen.
Da war der Taucher Arne, der jeden Tag mit einem fetten Schlauch zum Grund der Netzgehege taucht, um Fischleichen herauszusaugen. Er war Berufstaucher geworden, weil er die Schönheit des Lebens unter Wasser liebte, jetzt sah er eingepferchte Masttiere und wie sie an Krankheiten, Parasiten oder Missbildungen litten. Es sind, dachte ich, so ganz andere Lachse als diese wunderbaren schlanken Fische, die nach einem heftigen Sommerregen aus dem weiten Atlantik in den Owenduff aufsteigen.
Arne erzählte, dass er von den bleichen Lachsleichen träume, auch von den gräulichen Feldern aus Kot, die als schleimiger Morast den Meeresgrund bedecken. Ja, er schäme sich für das, was die Firma, was er, was sie alle dem Meer und den Tieren antäten, er ekle sich vor seiner Arbeit, aber die werde gut bezahlt.
Ich fragte die Arbeiterin Nora, was es mit ihr mache, wenn sie stundenlang und Tag für Tag die verfetteten Masttiere mit verstümmelten oder weggefressenen Flossen am Fließband aufschneide, die glibberigen Gedärme rausziehe und die Fische filetiere. Sie zuckte mit den Schultern und sagte, dass ihre Haut immer nach Fisch rieche, auch nach der heißen Dusche, als sei sie selbst so ein Lachs. Sie meinte, dass sie als alleinerziehende Mutter nun mal auf den Job angewiesen sei, dass das Geld stimme und dass ihr Leben halt erst wirklich beginne, wenn die Schicht zu Ende sei.
Ich habe sie verstanden, alle. Mehr noch, ich habe sie gefühlt. Ihren Ekel, ihre Scham, ihre Machtlosigkeit; ihre Langweile, die Resignation und ihren verzweifelten Trotz. Diesen lähmenden Glauben, dass man die Dinge nicht verändern könne. Dass man sich fügen, sich mit einem Leben, das sich nicht richtig anfühlt, zufriedengeben müsse. Einem Leben, das nach Zuchtlachs stinkt.
Das ist es, was ich suche: die Leben anderer Menschen zu fühlen, zu spüren, wovon sie erzählen. Die Leben der Bedrängten, ungerecht Behandelten, Armen und Verfolgten. Dann fühle ich mich lebendig. Das ist der Stoff, aus dem meine Reportagen sind.
Flughafen also, Oslo. Warten am Gate. Ich bin unruhig, so wie immer, wenn ich nicht mehr mitten in einem Projekt stecke, nur ist es heute schlimmer. Mein Blick schweift über die Gesichter der anderen Wartenden: ein paar Backpacker, Outdoor-Freaks, Familien, Geschäftsleute.
Plötzlich saugt sich mein Blick fest. Dieses Gesicht mir gegenüber – es schlüpft direkt in mich hinein, nimmt mir den Atem, und meine Finger verkrallen sich in meinem Sitz.
Mein Blick verschwimmt, und ich stehe mitten in unserem Hotel. Rauch beißt in meine Lungen, die siedend heißen Dielen brennen in meine Fußsohlen. Meine verkohlten Eltern liegen auf dem versengten Teppich, ich starre in die leeren Augenhöhlen meiner Mutter, und dann sehe ich ihn, den Mann, der mir gegenübersitzt, er ist deutlich jünger und steht am Fluss und sieht Owen und mir beim Fischen zu, mit so einem Röntgenblick, als wären wir Verbrecher. Nein, so war es nicht, er steht im Moor und beobachtet mich mit hochgezogenen Brauen, wie ich zurückrenne. Warum läufst du nicht schneller, hm? Plötzlich steht er neben dem brennenden Hotel und starrt mich an! Als wäre ich an allem schuld!
Dieser Mann ist da gewesen.
Damals, bei dem Brand.
Mein Blick ist immer noch auf ihn gerichtet. Oslo, Flughafen, ich bin wieder da, zurück am Gate. Mein Herz klopft so laut, ich fürchte, dass er es hört, doch er liest ungerührt Zeitung. Obwohl mein Gesicht schweißnass ist, mein Puls rast und ich mich wie eine Bekloppte am Sitz festkralle, scheint niemand etwas gemerkt zu haben.
Ich atme tief durch. Und noch einmal. Rede mir ein, dass mein Puls langsamer wird. Löse eine zittrige Hand vom Sitz und wische mir mit dem Ärmel mein Gesicht trocken.
Was ich gerade gesehen habe, diesen Mann am Fluss und am Hotel, wie kann ich das vergessen haben? Wie kann man so etwas vergessen? Und stimmt es denn? Bilde ich mir das ein? Doch warum, einfach so? Woher kommen diese Bilder?
Da ploppt wieder etwas auf aus meinem Innern. Ich sehe es glasklar, Bilder aus lang verschlossenen Verliesen, in Zeitlupe spiele ich sie ab. Wieder dieser Mann, er trägt Jeans und eine grüne Wachsjacke. Das Haar ist noch voller, doch er hat denselben kühlen Gesichtsausdruck. Er steigt aus einem großen alten Kombi. Es muss ein Hotelgast sein, einer von den Stammgästen aus Belfast oder Derry, ein Angler auf dem Weg zum Fluss. Er fragt mich, ob ich was gefangen habe, aber er hat keine Angelrute dabei.
Meine Arme zittern wieder, ich brauche dringend eine Zigarette. Mir ist eiskalt, und trotzdem muss ich mir den Schweiß von der Stirn wischen.
Es hat nichts zu bedeuten, sage ich mir.
Erinnerungen, die nicht ohne Grund verloren gegangen sind.
Falsche Erinnerungen, gerade eben von mir selbst fabriziert, aus welchen Gründen auch immer.
Da blickt er von seiner Zeitung auf.
Schaut mir in die Augen, und mir verschlägt es den Atem.
Das Herz bleibt stehen, und für einen Augenblick sind wir miteinander verschweißt.
Fragend, verwundert sieht er mich an.
Senkt den Blick, peinlich berührt, liest weiter.
Nein, er kennt mich nicht. Und ich kenne ihn nicht. Er ist deutlich älter als ich, so Anfang, Mitte fünfzig, zurückgekämmte blonde Haare, eine zerfurchte Stirn und ein auf wild getrimmter Sechstagebart. Ein attraktiver Mann, so ein bisschen wie Iain Glen, der Jorah Mormont aus »Game of Thrones«. Kantige Züge, er will kühl wirken, aber nicht kalt. Vorausschauend und kontrolliert, wie jemand, der sich jederzeit im Griff hat. Er trägt einen teuren Anzug, maßgeschneidert, die Hände sind manikürt, und den Bart trägt er, um seine perfekte Erscheinung noch mit einem Schuss Verwegenheit aufzupeppen. Bestimmt Geschäftsmann oder Anwalt, jedenfalls einer, mit dem es das Leben zu gut gemeint hat und der glaubt, alles richtig gemacht zu haben und dies der Welt mitteilen zu müssen. Elegant, souverän, überlegen, so will er rüberkommen. Wie diese Models aus der Uhrenwerbung. Wahrscheinlich ist er genauso fake wie sie.
Und trotzdem macht er mir Angst.
Immer noch liest er Zeitung. Ob er nur so tut? Ich schaue ihn noch einmal an, und auf den zweiten Blick ist da noch etwas anderes, eine versteckte Traurigkeit, eine unter der Coolness verborgene Verletzlichkeit, wie sie Menschen in sich tragen, die Schlimmes überlebt haben.
Auf einmal ist er mir fast nah.
Nur mit Mühe gelingt es mir, mich von ihm abzuwenden. Unmöglich, dass er den Sog meiner Blicke nicht spürt. Ich schaue auf den Boden zwischen meinen Füßen, auf die Bildschirme mit den Uhren, stelle ihn mir als ein Model vor und suche nach einer Raucherlounge.
Da sehe ich aus den Augenwinkeln, dass er mich verstohlen mustert, als versuchte er, sich zu erinnern. Mir wird wieder kälter. Etwas Lauerndes, Gefährliches strahlt er aus.
Ich reiße mich los und gehe zu einer Bar. Tue so, als sähe ich ihn nicht. Zwinge mich, nah an ihm vorbeizugehen, während sich die feinen Haare auf meinen Armen sträuben. Ich brauche einen Kaffee, etwas Heißes zum Trinken gegen diese Eiseskälte in meinem Körper. Und mehr Distanz zwischen uns. Sein Aussehen habe ich mir eingeprägt, es hat sich eintätowiert in mein Gehirn. Ich muss ihn nicht ansehen, um mich zu erinnern. Ich trage sein Bild in mir, schon seit damals. Ich werde ihn nie mehr vergessen.
Der Kaffee kommt schnell, ich trinke einen Schluck und fühle mich besser. Noch ein Schluck, allmählich wird mir warm. Ich zittere nicht mehr, hole mein Smartphone hervor und tue so, als checkte ich Nachrichten. Aktiviere die Kamera, ziehe den Zoom weit heran. Lächle, als hätte ich etwas Nettes gelesen, halte die Luft an, hebe die Kamera und mache schnell drei Bilder von ihm. Als ich das Smartphone runternehme, ist er immer noch in die Zeitung vertieft.
Erleichtert atme ich aus, klicke auf die Bilder in der Galerie und betrachte das erste Foto, zoome sein Gesicht ganz nah heran, sodass ich die Barthaare zählen kann. Ich kenne ihn doch nicht, habe ihn noch nie gesehen, warum macht er mir nur solche Angst? Nein, er war kein Gast im Hotel meiner Eltern, keiner von den Nordiren.
Als ich zum zweiten Bild wische, zucke ich vor Schreck zurück.
Er schaut direkt in die Kamera, direkt in meine Augen! Ungläubig sehe ich ihn an, also sein Bild auf meinem Smartphone. Er weiß, dass ich ihn fotografiert habe. Oder er hat nur kurz aufgeschaut, weil er neugierig ist, wer ich bin, nachdem er mich so offensichtlich aus der Fassung gebracht hat. Vielleicht dachte er, ich schaue mir meine Nachrichten an.
Dann der Aufruf, der Flug nach Frankfurt am Main ist zum Einchecken bereit, begeben Sie sich bitte zum Gate. Er steht auf, dreht sich zum Schalter, hat seinen Boarding Pass in der Hand.
Ich schnappe meinen Rucksack, lasse den Rest vom Kaffee stehen und gehe zur Warteschlange.
Beeile mich, damit ich direkt hinter ihm stehe.
Mein Herz klopft wieder zu laut, wieder denke ich, er könnte es hören, und mein Instinkt ruft, dass ich verschwinden soll.
Er trägt Parfum, sehr dezent, leicht süßlich, riecht gut, besser als das von Ole. Er ist mindestens zwei Köpfe größer als ich und scheint mich nicht zu bemerken. Nervös schaue ich um seinen breiten Rücken herum, zu seinem Boarding Pass, doch ich kann seinen Namen nicht erkennen.
Plötzlich stockt er, als spürte er etwas. Beinah wäre ich auf ihn draufgelaufen. Er neigt den Kopf leicht nach rechts, und ich halte den Atem an. Hört er meinen Herzschlag? Kann er mich riechen? Sieht er aus den Augenwinkeln, dass ich hinter ihm bin?
Wie festgenagelt stehe ich da.
Halte weiter den Atem an.
Da macht er einen Schritt und steht vorn bei der Flugbegleiterin.
Reicht ihr den Boarding Pass.
Jetzt kann ich es erkennen, seinen Namen, er steht dort ganz klar in schwarzen Buchstaben: Colin McCoy.
Colin McCoy.
Da klingelt nichts.
Er geht durchs Gate.
Ich lasse anderen den Vortritt. Er hat sich nicht nach mir umgedreht, vielleicht hat er mich schon wieder vergessen, dieses seltsame Nervenbündel. Die Angst lässt nach, und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß jetzt, mit wem ich es zu tun habe.
Colin McCoy.
Der Name rattert durch mein Hirn: Colin, Colin, Colin … doch ich habe ihn noch nie gehört.
Colin McCoy.
McCoy, das ist ein durch und durch irischer Name.
Das kann kein Zufall sein. Es muss eine Verbindung geben.
Dieser Mann muss damals da gewesen sein, als es brannte. Er wäre in seinen Dreißigern gewesen, ungefähr so alt wie meine Mutter, das könnte sein.
Er hat mich gesehen und ich ihn.
Er steht in der Gangway, mit der gefalteten Zeitung und dem Boarding Pass in der Hand, sein Jackett überm Arm.
Und sieht mich an.
Kein Lächeln, stattdessen ein fragender, forschender, lauernder Blick.
Auch wenn ich wieder nicht atmen kann, auch wenn sein Blick mir den Hals zuschnürt, ich ihn im Moor stehen sehe und den Rauch im Hotel rieche, ich zittre und mich mit aller Kraft dazu zwingen muss, schaue ich ihm in die Augen, direkt in seine Augen, trotzig, verwegen, herausfordernd, vorwurfsvoll.
Du warst da, sagt mein Blick. Und du machst mir keine Angst. Ich kenne dich. Du weißt Dinge, von denen du mir erzählen musst. Ich will wissen, wer du bist.
Da wendet er sich ab, als wäre nichts gewesen, und schlendert durch die Gangway, ganz der Mann von Welt.
3
Entsetzt wache ich auf und kriege keine Luft. Colin sitzt auf mir und würgt meinen Hals. Seine Hände sind eiskalt, sein starrer Blick ist voller Wut, der Hass wie in Stein gemeißelt. Er würgt mich, und ich strample panisch mit den Beinen, kratze verzweifelt seinen Rücken, aber er lockert den eisernen Griff nicht. Seine Haut und sein Blut stecken unter meinen Fingernägeln, mein Blick verschwimmt, und ich weiß, dass ich sterben muss.
Jetzt.
Verkehrslärm dringt ins Zimmer. Ich brauche eine Weile, um zu realisieren, dass Colin McCoy doch nicht auf mir sitzt. Ich atme schnell, während die Todesangst und die Wut abebben. Ich schäle mich aus dem Bett, versuche, den Traum abzuschütteln, doch er hängt an mir wie eine klebrige Masse.
Leicht benommen trete ich ans Fenster. Kippe es auf und zünde mir eine Zigarette an. Vor dem Haus ist der mehrspurige Schaumainkai, jede Menge Autos sind unterwegs, dahinter fließt träge der Main. Halb leere Passagierschiffe fahren durch den Regen, und die Wolkenkratzer der Frankfurter Skyline ragen wie ernste Wächter aus dem grauen Dunst. Der Anblick beruhigt mich. Mir gefällt diese Stadt, ich spaziere gern durch ihre Straßen, in denen mich kaum jemand kennt. Sie ist groß genug, um sich darin zu verstecken, und hat genügend Bars und Clubs, in denen man sich verlieren kann.
Doch ein Zuhause ist Frankfurt nicht, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Die Stadt würde mir nicht fehlen, wenn ich meine Zelte woanders aufschlagen müsste. Ole hat schon recht, sie ist mein Base Camp, mehr nicht. Eigentlich ziemlich traurig, denn ich wohne hier seit über zwanzig Jahren.
Es ist ein verregneter Sommer, ein richtiger Scheißsommer. Ständig platscht es, weil Autos durch Pfützen fahren und das Wasser zur Seite spritzt. Es heißt, die Natur brauche das. Das mag schon sein, aber ich brauche Sonnenschein und dreißig Grad, damit sich diese klebrigen Träume von mir lösen und Colin McCoy verschwindet. Seit ich wieder in Frankfurt bin, und das sind schon vier Wochen, verfolgt er mich in meinen Träumen, folgt mir durchs Moor, ins Hotel, und auch bei Tag kriege ich ihn nicht aus dem Sinn.
Als wir in Frankfurt ankamen, sah ich ihn vor mir beim Aussteigen. Er drehte sich nicht um, schien nicht nach mir zu suchen. Er ging zum Transitbereich, hatte einen Anschlussflug. Ich blieb stehen und wartete, dachte, dass er sich bestimmt noch einmal umdrehen würde, was aber nicht geschah.
Ich drücke den Zigarettenstummel in den Aschenbecher, putze mir im Bad den Rauch und den faulen Geschmack der Nacht von den Zähnen, wasche mir mit kaltem Wasser das Gesicht, gehe in meine winzige Küche und setze Kaffee auf. Das Sprotzeln der Maschine hat etwas Vertrautes, als wäre ich nicht allein.
Ich schenke mir eine Tasse ein und setze mich in den Plastikstuhl. Schon wenn ich an meinen Laptop denke, kriege ich es mit der Angst zu tun. Ich weiß genau, was der Tag bringen wird, nämlich nichts. Ich werde vor dem Laptop sitzen, nicht einen guten Satz hinbekommen und nach zwei Stunden verzweifeln. Diese Menschen in dem norwegischen Schärendorf, denen ich so nah gekommen bin – auf einmal sind sie meilenweit von mir entfernt. Ich sehe sie nicht mehr, trotz der unzähligen Fotografien, die ich mir auf dem Rechner wieder und wieder anschaue, höre ihre Erzählungen nicht, obwohl ich alles aufgenommen habe. Fühle sie nicht.
Es geht vorbei, warte ab, versuchte ich mir in den letzten Tagen einzureden. Warum machst du keinen Spaziergang am Main? Also ging ich los, spazierte über den Eisernen Steg zum Römerberg, sah Tauben und Menschen und Häuser und betete im Dom, dass der liebe Gott meinen Kopf frei macht. So verzweifelt war ich, dass ich wirklich so tat, als ob ich beten würde, obwohl ich überhaupt nicht an Gott glaube.
Ich sage mir, es wäre wegen Ole, doch das stimmt nicht. Manchmal treffe ich Bekannte und tue so, als ob nichts wäre, gehe in Clubs, trinke und tanze bis zum Morgengrauen, um ein wenig Schlaf zu finden – und um den zu vergessen, um den es eigentlich geht: Colin McCoy. Doch es funktioniert nicht. Er ist immer da, spukt ständig in meinem Kopf herum, und je mehr ich trinke, um ihn zu vertreiben, desto schlimmer sucht er mich am nächsten Morgen heim.
Hier in Frankfurt werde ich ihn nicht los, so viel ist sicher. Mal steht er mit fragendem Blick am Ufer des River Owenduff, mal mitten im Moor oder beim Hotel. Manchmal fährt er mit diesem alten grauen Kombi vor, und Mum steigt zu ihm ins Auto und winkt mir zu. Oder er sitzt auf mir und bringt mich um, so wie gerade eben. Mal trägt er eine grüne Wachsjacke, mal einen hässlichen Wollpulli, dann einen Armeeoverall. Oder war der Mann von damals brünett? Trug er einen Bart? Hatte er nicht einen schmaleren Mund? War er nicht kleiner? War es wirklich Colin McCoy, und wo habe ich ihn noch gesehen?
Die Welt entgleitet mir, ich weiß nichts mehr, alles wankt. Kann es wirklich sein, dass ich das Hotel barfuß betreten habe, obwohl es drinnen noch brannte? Müssten die Dielen nicht siedend heiß gewesen sein? Oder ich hatte doch Gummistiefel an. Lag wirklich eine dicke Ascheschicht auf den Dielen? Und waren die Fensterscheiben wirklich geborsten? Manchmal, wenn ich mich zu erinnern versuche, sind sie unversehrt. Auch das Dach. Die Haustür ist geschlossen. Und schien wirklich die Sonne an jenem Tag? Es war Abend, der Fluss schimmerte kobaltblau, das hohe Ufergras glänzte wie Smaragde. Doch plötzlich ziehen Wolken am Himmel auf, das Gras wird grau und der Owenduff ölig und schwarz, wie flüssige Kohle.
Und auch das lässt mich schlecht schlafen: der Fluss, wie er sich durchs Moor schlängelt, diese endlosen Weiten aus Heidekraut und Torfgräsern, das Hotel, bevor es gebrannt hat – die Landschaft meiner Kindheit ist auf einmal wieder da. Diese Bilder habe ich fest in mir verschlossen, dachte, sie wären für immer verschwunden, doch Colin hat sie wieder heraufbeschworen. Erst als blasse Schemen, doch sie werden immer klarer und farbenfroher, ich kann das Heidekraut riechen und den Fluss, und plötzlich ist da ein Ziehen in meiner Brust, als müsste ich sterben, wenn ich nicht sofort zurückkehre. Eine brennende Sehnsucht und zugleich die Angst, was wohl passiert, wenn ich das tue, was Irland mit mir macht.
Weil ich Colin McCoy nicht aus meinen Gedanken vertreiben kann, habe ich vor einer Woche eine internationale Agentur für private Ermittlungen beauftragt, nach ihm zu suchen. Zuvor habe ich den Namen gegoogelt und die sozialen Medien nach ihm durchforstet. Es gibt einen ganzen Haufen Colin McCoys, in England und Irland, in den USA, in Australien. Viele konnte ich wegen der Fotos ausschließen, aber es gibt genügend, die ihr Angesicht nicht im Netz preisgeben. Ich nannte der Agentur den Namen und schickte ihnen die Fotos, die ich am Flughafen von ihm gemacht hatte.
So etwas kann dauern, meinte die Frau von der Agentur. Was kostet es, damit es schnell geht?, fragte ich. Ich akzeptierte den horrenden Preis und bat die Frau, die Suche zunächst auf Irland und England zu konzentrieren. Auch wenn das tief in meine Ersparnisse schneidet, muss ich wissen, wer dieser Colin McCoy wirklich ist.
Statt ins Wohnzimmer zu gehen, bleibe ich sitzen, weil ich Angst vor meinem Schreibtisch habe und doch nur verloren aus dem Fenster in den von Häuserfronten umstellten Hinterhof starre. Und an Irland und damals denke. Stattdessen zünde ich mir eine weitere Zigarette an. Es ist so still! Solange ich studiert habe, wohnte ich in einer WG, da war es nie still, und obwohl wir uns alle gut verstanden haben, wollte ich immer allein leben. Ich will mein Bad nicht teilen müssen, will nicht wach liegen, wenn andere Partys feiern, ins Klo kotzen oder nebenan Sex haben, und ich will auch nicht, dass andere mitkriegen, wenn ich jemanden mit nach Hause bringe. Es wäre gesünder für mich, nicht allein zu leben und einer guten Freundin von Colin McCoy und meiner verkorksten Kindheit zu erzählen, aber ich habe keine gute Freundin und fühle mich lieber einsam als entblößt. Mein Leben geht niemanden etwas an. Ich schaue auf meine brennende Kippe und denke: Du tust vieles, das dir nicht guttut.
Da reißt mich mein Smartphone aus meinen Gedanken.
»Maria Schubert«, sage ich. Ich mag meinen deutschen Namen nicht, an den Klang konnte ich mich nie gewöhnen.
»Anne Fleming«, sagt die Frau auf Englisch. »Ich bin private Ermittlerin. European Investigations hat mich beauftragt, nach einem Colin McCoy zu suchen.«
Vor Schreck fallen mir fast Smartphone und Zigarette aus der Hand. Die Frau am anderen Ende klingt kühl und geschäftsmäßig. Ich brauche eine Weile, bis ich antworten kann.
»Haben Sie ihn gefunden?«, frage ich aufgeregt.
»Sonst würde ich nicht anrufen. Er lebt in London.«
»Das ging aber schnell!«
»Die Agentur hat fünf Leute beauftragt. Wir sind verschiedenen Spuren nachgegangen.«
»Und Sie sind sicher, dass er es ist?«
»Ich habe Ihre Fotos. Ich habe ihn gesehen und bin mir sicher.«
»Was wissen Sie?«
»Er ist Immobilienmakler. Sehr erfolgreich, wie es aussieht. Ich schicke Ihnen den Link zu seiner Website per Mail. Er kommt ursprünglich aus Belfast, ist mit seinen Eltern früh nach England gegangen, war in Leeds in der Schule, hat in Birmingham studiert und lebt seit fünfzehn Jahren in Teddington, im Londoner Südwesten. Mitten im Speckgürtel. Mehr weiß ich noch nicht.«
»Wo sind Sie gerade?«
»Am Flughafen in Heathrow. Das ist die schlechte Nachricht. Er ist verreist. Ich habe ihn bis zur Sicherheitsschleuse verfolgt, weiter kam ich nicht. Ich weiß nicht, wohin er fliegt und wann er zurückkommt. Er hatte allerdings nur einen kleinen Koffer bei sich. Es sieht nicht so aus, als ob er sich zu einer Weltreise aufgemacht hat.«
»Wie lange beschatten Sie ihn schon?«
»Seit heute früh. Viel kann ich daher noch nicht sagen. Er hat eine ziemlich coole Villa direkt an der Themse. Für das Geld, das so ein Haus kostet, können Sie anderswo ein Dorf kaufen. Der Mann ist steinreich, sieht gut aus … Wenn Sie ihn heiraten wollen, würde ich zuraten. Und entscheiden Sie sich schnell, sonst nehme ich ihn mir vielleicht.«
Ich muss lachen. »Beschatten Sie das Haus weiter. Melden Sie sich, wenn er zurückkommt. In spätestens zwei Tagen bin ich bei Ihnen.«
»Rund um die Uhr beschatten? Können Sie das bezahlen?«, fragt Anne Fleming in ihrer furztrockenen Art. »Dazu brauche ich nämlich noch eine Kollegin aus meinem Team.«
»Tun Sie es. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich pleite bin. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Rufen Sie gleich an, egal, zu welcher Uhrzeit.«
Sie zögert. »Okay«, sagt sie dann.
»Bis hoffentlich bald«, sage ich, lege das Smartphone weg und stecke mir die nächste Zigarette an.
Im Netz finde ich schnell McCoys Website. Sandycove Estates heißt sein Unternehmen, der Webauftritt ist schlicht und elegant. Nirgendwo ist ein Foto von ihm zu entdecken, er mag es also sehr diskret, ist das nicht merkwürdig? Nur sein Name steht da und eine E-Mail-Adresse: [email protected]. Die wenigen Objekte, die er als Referenz zeigt, sind teure Villen und große Anwesen in Südengland, Frankreich und Italien. Der Mann hat offensichtlich Geld.
Als Nächstes google ich Anne Fleming. Fleming & Partners heißt ihre Ermittlungsagentur. Sie sitzt in London, in Kensington, eine teure Adresse. Auch ihr Webauftritt ist diskret, es finden sich keine Fotos von ihr oder ihren Partnern. Allerdings gibt es einige sehr gute Referenzen: effizient, ehrlich, kundenorientiert. Weder auf Insta noch auf X oder Facebook ist etwas zu meiner Anne Fleming zu entdecken. Als Detektivin will man sein Gesicht wohl nicht preisgeben. Jedenfalls hat sie Colin schnell gefunden.
Ich gehe auf ein Vergleichsportal.
Ich brauche einen Flug nach Irland, und zwar schnell.
Ich will, ich muss zurück.
Muss herausfinden, was damals geschehen ist.
Auch wenn das vielleicht eine Katastrophe wird.
4
Ich fühle nichts außer einer bleiernen Müdigkeit, als wären die schweren Regenwolken, die sich den ganzen Nachmittag über die Landschaft geschoben haben, in mich hineingezogen. Jetzt ist es Nacht, es gießt in Strömen. Wenigstens wissen die Scheibenwischer, wozu sie auf der Welt sind. Ich sehe nur das, was sie für kurze Momente freischieben und die Scheinwerfer erfassen, doch das ist nicht viel. Zum Glück. Hier im County Mayo, zwischen Bangor Erris und dem Dorf Mulranny, wo ich ein Zimmer gemietet habe, gibt es außer Meer und Moor fast nichts. Ich bin heilfroh, dass Nacht ist, denn ich habe eine Höllenangst vor dem, was ich bei Tag sehen würde, jetzt, wo ich wieder hier bin. In der Heimat, in die ich nie, nie, nie wieder zurückkehren wollte. Deshalb habe ich den Abendflug nach Dublin genommen, um heute nichts bei Tageslicht sehen zu müssen.
Solange es hell war, habe ich versucht, nur geradeaus auf die Straße zu schauen. Die Midlands zogen an mir vorbei, von Steinmauern und großen Laubbäumen umgebene Weiden mit träge herumstehenden, träge kauenden Kühen, schmucklose Straßendörfer mit schmierigen Pubs und Tankstellen, große Farmen mit Ställen, die wie Werkshallen aussahen, danach wieder Weiden …
Im County Roscommon, hinter dem Shannon, wo sich die Schönheit des Westens allmählich entfaltet, begann die Dämmerung, und ich hieß sie willkommen.