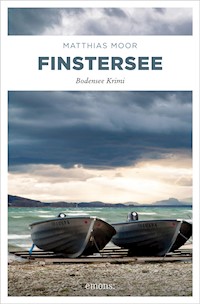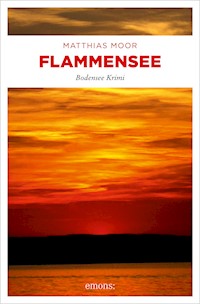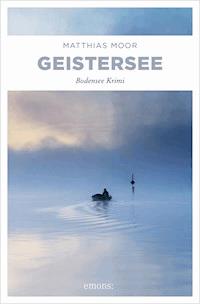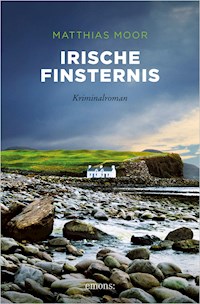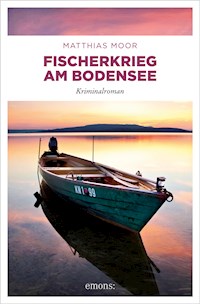
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bodensee Krimi
- Sprache: Deutsch
Intensiv recherchierter Öko-Krimi mit einer Prise Humor. Am Bodensee sinken die Fischbestände dramatisch, die Fischer fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Journalistin Alexandra Kaltenbacher soll über die Lage berichten. Als sie in der Zeitung das Foto eines ermordeten Mannes entdeckt, läuten bei ihr die Alarmglocken: Derselbe Mann hatte ihr kurz zuvor Hinweise über den Verbleib ihrer Mutter versprochen, die einst am See verschwand. Privatdetektiv Martin Schwarz soll Ermittlungen dazu anstellen. Was er herausfindet, wirft ein neues Licht auf den alten Fall. Das gefällt nicht jedem – und ein unerbittlicher Fischerkrieg beginnt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Matthias Moor, Jahrgang 1969, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Gymnasiallehrer und freier Journalist in Konstanz. Er liebt den See mit seinen vielgestaltigen Landschaften. Wenn mal nichts anliegt, fährt er am liebsten mit seinem Boot zum Angeln raus.
Besuchen Sie den Autor auf www.matthias-moor.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Stefan Arendt/imageBROKER
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-774-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Für all die Fischer*innen, Forscher*innen, Angler*innen und Naturschützer*innen, die den Bodensee lieben, für ihn streiten und kämpfen
Ein Streit zwischen wahren Freunden, wahren Liebenden bedeutet gar nichts. Gefährlich sind nur die Streitigkeiten zwischen Menschen, die einander nicht ganz verstehen.
Marie von Ebner-Eschenbach
Über Felchen, das Silber des Bodensees
Die Felchen – andernorts heißen sie Renken oder Maränen – gehören wie Forellen zu den lachsartigen Fischen. Im Bodensee und in vielen anderen Seen des Voralpenlandes sind sie die Brotfische der Berufsfischer. Ursprünglich lebten viele Felchen im Meer und zogen wie Lachse nur zum Laichen ins Süßwasser. Im Lauf der Jahrtausende wurden diese Wanderungen immer wieder unterbrochen, zum Beispiel durch die Eiszeiten. Als sich die Gletscher nach der letzten Eiszeit zurückzogen, machten einige Felchen den eisfrei werdenden Bodensee zu ihrer Heimat. Man könnte sagen: Mit den Felchen gelangte etwas Ozeanisches ins Schwäbische Meer.
Felchen fressen winzige Krebstierchen und Insektenlarven, weshalb ihre Mäuler klein und ihre Augen groß sind. Um satt zu werden, müssen sie ständig schwimmen. Sie haben schlanke Körper, und ihr Schuppenkleid sieht aus, als bestünde es aus silbernen Pailletten.
Die Felchen haben sich auf verschiedene Weisen ihrem Lebensraum angepasst. Die Blaufelchen – ihre Flanken haben einen metallisch blauen Schimmer – durchstreifen in Schwärmen die lichten Weiten des Obersees und des Überlinger Sees. Die Sandfelchen und Gangfische ziehen an der Halde entlang, wo die Wysse – das Weiße, so heißt am Bodensee die Flachwasserzone – steil in die opalblauen Tiefen abfällt. Sie kommen auch im Untersee vor. Dann gibt es noch den Kilch, eine Tiefseeform des Felchens, doch er gilt als verschollen.
Das zarte, weiße, nicht allzu magere Fleisch dieser Kaltwasserfische ist äußerst schmackhaft, egal ob geräuchert, gegrillt, gedünstet, gebraten oder nach Matjes-Art.
1
Gerade war ein heftiger Aprilschauer vorübergezogen. Der dunkle Wald roch nach feuchter Erde, Moos und moderndem Laub. Friedhofsgeruch, dachte Alexandra, und vielleicht lag hier wirklich irgendwo ihre Mutter verscharrt, wobei das unwahrscheinlich war. Denn im Konstanzer Lorettowald war zu viel los, um eine Leiche zu vergraben, zumindest tagsüber. Außerdem hatte die Polizei das Waldstück mehrfach durchkämmt. Jetzt, in der Nacht, war es still. Bedrohlich ragten die Schatten der Bäume in den schwarzen Himmel.
Aber vielleicht war ihre Mutter an diesem Ort ermordet worden. Zumindest hatte der Täter sie von hier entführt. Möglicherweise. Jedenfalls hatte ein Jogger ihre Mutter an jenem Tag im Lorettowald beim Laufen gesehen. Und ihr Auto wurde später auf einem Parkplatz in der Nähe entdeckt.
Es war ein nebliger Herbstnachmittag gewesen, man hatte kaum zwanzig Meter weit sehen können. Womöglich hatte der Täter sie betäubt, zu seinem Auto gezerrt und irgendwohin gefahren. Das vermutete zumindest die Polizei. Damals waren innerhalb von acht Wochen drei Frauen verschwunden, und keine war zurückgekehrt. Es gab keine Leichen und keinen Täter. Man wusste nicht einmal, ob die Frauen ermordet und ob sie überhaupt tot waren. Alle verschwanden beim Joggen in einem Waldstück, alle hatten die Orte regelmäßig aufgesucht, sodass die Polizei davon ausging, dass der Täter sie über einen gewissen Zeitraum beobachtet hatte. Dass er sie gezielt ausgewählt und auf eine günstige Gelegenheit gewartet hatte.
Alex fischte eine Zigarette aus der Packung. Ihre Hände zitterten vor Kälte und Wut. Die Zigarette war ziemlich feucht, brannte dann aber doch. Das Papier knisterte, und sie sog den Rauch ganz tief in sich hinein, dorthin, wo die große Traurigkeit saß. Tropfen fielen von den nassen Blättern, als würde es immer noch regnen, und ihre Kleider waren nass. Was hatte sie nur geritten, diesen verfluchten Auftrag anzunehmen? Warum wollte sie zurück in diese Scheißstadt? Warum stand sie mitten in der Nacht in diesem Scheißwald?
Damals war sie fünfzehn gewesen und hatte nicht glauben wollen, dass ihre Mutter tot war. Deshalb war sie Tag für Tag nach der Schule hierhergeradelt. Es war wie ein Zwang, immer und immer wieder lief sie die Pfade des Lorettowaldes ab und suchte nach Hinweisen, dem Haargummi ihrer Mutter, dem Hausschlüssel oder der Trinkflasche, die sie beim Laufen in der Hand gehalten hatte. Vielleicht, vielleicht hatte die Polizei ja etwas Entscheidendes übersehen. Und außerdem konnte es einfach nicht sein, dass ihre Mutter so mir nichts, dir nichts verschwand. Mit ihrem Lachen hatte sie die Schatten vertrieben, die sich auf ihr Haus legten, als ihr Vater mit den Jahren immer stiller und trübseliger wurde. Und auch wenn es manchmal Streit zwischen ihnen gab, Alex fühlte sich ihrer jungen Mutter so nah, als wären sie Schwestern, als schlügen ihre Herzen im selben Takt. Sie hatte gehofft, dass ihre Mutter plötzlich hier im Wald vor ihr stehen würde, mit ihrem fröhlichen Lächeln, als wäre nichts gewesen und als gäbe es eine simple Erklärung.
Diese schattigen Pfade verfolgten sie seitdem in ihren Träumen, und manchmal sah sie ihre Mutter, wie sie mit ihren langen hellbraunen Haaren zwischen den Bäumen stand. Sie blickte lächelnd zu ihr und breitete die Arme aus. Aber in diesen Träumen erklärte sie nie, warum sie seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren verschwunden war. Denn wenn Alex die Mutter umarmte, wachte sie plötzlich auf.
Vielleicht, vielleicht war Elisabeth wirklich nicht tot. Damals hatte Alex das fest geglaubt. Nach dem Studium hatte sie nach ihr gesucht, war sogar zu ihren Verwandten nach Russland gereist, hatte aber keine Spuren gefunden. Enttäuscht, niedergeschlagen war sie zurückgekehrt. Hör auf zu suchen, sagten ihre Freunde. Mit der Ungewissheit wirst du leben müssen, überwinde den Schmerz, lass dich nicht von einer trügerischen Hoffnung zerstören. Das war natürlich gut gemeint und leicht gesagt. Es gab Jahre, da war sie spindeldürr gewesen, da hatte sich ihre Gesichtshaut wie dünnes Pergament über ihre Knochen gelegt, und ihre Arme hatten wie vertrocknete Äste ausgesehen, sodass sie Angst bekam, wenn sie in den Spiegel blickte. Nein, sie war nicht magersüchtig gewesen, sie hatte sich furchtbar hässlich und alt gefunden, aber verdammt noch mal keinen Hunger gehabt, jedes Stückchen Apfel musste sie in sich hineinzwingen, und natürlich lag das nicht nur an Elisabeths Verschwinden. Aber doch vor allem, vor allem an den Folgen.
Inzwischen kam sie ganz gut klar. Meistens. Jedenfalls war sie nicht mehr so dürr und konnte essen, ohne sich zu quälen. Doch wenn ihr Handy klingelte und eine unbekannte Nummer anzeigte, dachte sie manchmal, es könnte ihre Mutter sein. Da klopfte ihr Herz dann wie verrückt.
Allmählich ließen die Tropfen nach. Der kleine Wald war wie eine Wildnis, zwischen den hohen Stämmen der alten Buchen und Eichen lag von nassem Moos überwachsenes Totholz, und junge, buschige Bäumchen drängten nach oben.
»Warum fährst du zum Joggen extra in den Lorettowald?«, hatte sie ihre Mutter einmal gefragt. Denn wo sie wohnten, auf der Insel Reichenau, gab es auch schöne Wege direkt am See.
»Ich muss ab und zu einfach was anderes sehen«, hatte sie geantwortet und dabei gelächelt. Und ihr zugezwinkert.
Genau wie an dem Tag, an dem sie für immer verschwand. An jenem Tag hatte Alex nicht nur die Mutter, sondern auch ihre Familie verloren. Ihren Vater, ihre Schwester, ihre Heimat. Oder schlimmer, die geliebte Heimat war zu einem kalten, tückischen Ort geworden. Zu einem zugefrorenen See mit brüchigem Eis, den man besser nicht betrat. Sie hatte sich nie wohlgefühlt, wenn sie während des Studiums nach Konstanz zurückgekehrt war. Wenn sie Schulfreunde traf, die voller Sehnsucht nach Hause kamen und in vertrauten Kneipen verklärte Erinnerungen austauschten, fühlte sie sich fremd und fehl am Platz. Wollte die Geschichten von früher nicht hören, und wie gut es den anderen jetzt ging. Da wurde ihr Herz vor Kälte wie taub, und sie hörte, wie das Eis unter ihr knackte.
Irgendwann war sie dann einfach nicht mehr heimgefahren. Und wenn sie im Fernsehen die Wetterkarte mit dem Bodensee sah, spürte sie manchmal einen Stich und zappte schnell weiter. Auch übers Auswandern hatte sie schon ernsthaft nachgedacht.
Und jetzt war sie doch wieder hergekommen.
Da knackte etwas. Nicht das Eis, sondern etwas im Unterholz. Vielleicht ein Fuchs? Nervös blickte sie sich um. Sofort raste ihr Puls. Es ist die Mutter, war ihr erster Gedanke.
Wieder knackte es. Das war kein Fuchs; was auch immer dort lauerte, war viel größer. Was, oder wer.
»Hallo?«, rief sie und schaffte es nicht, die Angst in ihrer Stimme zu verbergen.
Keine Antwort, nichts.
Nur das Fallen der Regentropfen von den Blättern.
Sie ging los, schnell. Der Pfad war schmal. Von beiden Seiten griffen nasse Äste wie kalte Hände nach ihr. Bald schimmerte zwischen den Bäumen das Licht von den Laternen, die einen breiten Waldweg beleuchteten. Niemand schien ihr zu folgen, aber sie rannte trotzdem, als würde der Mörder ihrer Mutter im Unterholz auf sie lauern.
Zehn Minuten später stand sie keuchend am Hörnle. Scheißzigaretten, dachte sie, aber immerhin, jetzt war ihr wieder warm. Das Strandbad lag auf einer breiten Landzunge zwischen Konstanzer Bucht und Überlinger See. Alles war still, und der Blick ging so weit. Das war besser als der dunkle Wald. An den gegenüberliegenden Ufern flimmerten die Lichter der Dörfer und Städte, dazwischen erstreckte sich die riesige Fläche des Obersees wie ein schwarzer Fjord, der ins Nichts führte.
Niemand zu sehen. Leichter Dunst schwebte über den nassen Wiesen, er schimmerte im Mondlicht. Sie ging runter zum Strand. Ihre Jeans war noch ganz klamm. Dennoch zog sie die Schuhe aus, krempelte ihre Hose hoch und lief ein paar Meter über den Kies ins Wasser. Es war so kühl und roch so frisch, wie es das nur im Frühling tat, als wäre es nach langem Schlaf wieder zum Leben erwacht. Als würde es blühen.
Hier pflegte ihre Mutter im Sommer nach dem Joggen zum Baden zu gehen. Sie war zu einem der Flöße geschwommen und hatte sich in die Sonne gelegt. Ließ sich von den Wellen schaukeln. Sie zeigte gern ihren Körper, das hatte Alex schon als Teenager gespürt. Ihre Mutter mochte die begehrlichen Blicke der Männer und die neidischen der Frauen, als Tochter hatte sie sich damals dafür geschämt. Heute ging es ihr wie ihrer Mutter.
Völlig verschwitzt trat Alex ein paar Stunden später aus dem Club. Ihre durchnässte Bluse klebte an ihrer Haut, und man konnte den schwarzen BH darunter sehen. Sollte man auch. Als sie vorhin vor dem Hotel gestanden war, hatte sie Angst vor dem leeren Zimmer bekommen. Schlafen würde sie eh nicht können, hatte sie gedacht, sie musste sich erst irgendwie verausgaben und ablenken, und so war sie im »KULT« gelandet, dem Club ihrer Schulzeit. Erfreulicherweise war das Publikum mit ihr gealtert, und mit ihren dreißig Jahren war sie längst nicht die Älteste. Zum Glück erkannte sie niemanden.
Sie brauchte frische Luft und eine Pause, aber das war es nicht allein. Da war dieser Mann gewesen, der die ganze Zeit zu ihr herübergestarrt und sie mit seinen Augen ausgezogen hatte. Älter als sie, so um die vierzig, irgendwie unheimlich, aber auch ziemlich attraktiv. Dunkler Typ, Dreitagebart, durchtrainierter Körper. Und dazu dieser Blick: verwegen, verloren, als wäre sie ein Magnet. Als hätten sie sich nicht zum ersten Mal getroffen. Nicht gut. Denn wenn sie so rastlos und durch den Wind und angetrunken war wie heute, war sie anfällig, Dinge zu tun, die sie plötzlich unbedingt brauchte und wollte, aber am nächsten Morgen bitter bereute. Und für die sie sich dann schämte.
Sie trank ihr Bier aus und stellte die Flasche auf den Boden. Die Haare, eine wilde Mischung aus Dreadlocks und Locken, fielen in ihr schweißbedecktes Gesicht. Sie zog ein Haargummi aus ihrer Jeans und bändigte die Löwenmähne zu einem Pferdeschwanz. Als Nächstes holte sie die Packung Gauloises hervor und steckte sich eine an. Sog den Rauch tief in sich hinein und drehte sich zum Eingang, um nachzusehen, ob der Typ ihr gefolgt war.
War er nicht. Erleichtert und auch ein bisschen enttäuscht blies sie den Rauch aus ihren Lungen. Ob sie wieder rein sollte? Aber sie war schon ziemlich erledigt und betrunken, und es fühlte sich so an, als würde sie zumindest für ein paar Stunden schlafen können.
Als sie aus der Dusche stieg, klopfte es. Sie band sich das Handtuch um den Körper und öffnete die Tür. Ihr Herz pochte wild. Bevor sie reagieren konnte, trat er ein. Sah in ihre Augen und fragte sie stumm, ob er wieder gehen sollte. Viel Zeit ließ er ihr nicht, da schlang er seine Arme um ihren Körper, zog sie zu sich und küsste sie. Sie schloss die Augen und öffnete ihren Mund. Er löste das Handtuch und ließ es zu Boden fallen. Während seine Hände ihren Rücken abwärtsglitten, war die Tür des Hotelzimmers noch immer geöffnet.
Sie rauchte und blickte hinaus auf die Reichenaustraße. Die Fenster waren schalldicht, und sie konnte den Lärm der vorbeifahrenden Autos nicht hören, so als wäre die Welt draußen auf stumm geschaltet worden. Die Fenster gingen bis zum Boden, und sie vermutete, dass man sie von der Straße aus sehen konnte. Deshalb hatte sie ihren Slip und ein Top angezogen.
Sie hatte kein Auge zugemacht, während der Fremde fest schlief. Jörg, so hieß er. Sie drehte sich zu ihm um. Sein nackter Körper wurde vom Licht der Straße angeleuchtet. Ein schöner Mann, aber auch unheimlich. Er strahlte etwas Rohes und Gefährliches aus, und beim Sex war er ihr fast zu grob gewesen. Aber nur fast. Irritierender war, dass er dabei immer wieder auf ihr Tattoo gestarrt hatte, so als würde es ihn besonders erregen. Sie trug es über ihrer linken Brust: einen Eisvogel in leuchtendem Blau und Orange, der sich kopfüber ins Wasser stürzte. Und jetzt erinnerte sie sich: Auch in dem Club hatte er vor allem dorthin geblickt. So als würde er es wiedererkennen. Als hätte er es schon einmal gesehen.
Alexandra bekam eine Gänsehaut. Wer zum Teufel lag da in ihrem Bett? Bald würde es dämmern, und dann würde sie ihn bitten zu gehen. Sie wollte ihn loswerden, so schnell wie möglich.
Da sah sie, dass er die Augen geöffnet hatte.
Und wieder auf das Tattoo an ihrer Brust starrte.
2
Konrad schwitzte und ächzte unter der Last der beiden Fünfundzwanzig-Liter-Kanister, aber der Zorn trieb ihn an. Am frühen Abend war er mit dem Boot hergekommen und hatte es im Schilf versteckt. Niemand hatte Notiz von ihm genommen. Für Stunden hatte er ruhig im Boot gelegen und seinen Zorn genährt.
Jetzt war es Nacht und nichts zu hören als das Schwappen des Benzins in den Kanistern. Es würde Krieg geben, wenn die Bäume brannten, das war klar, aber es musste sein. Sie mussten ein Zeichen setzen, sonst wären ihre Existenzen ruiniert. Alles hatten sie versucht, aber wen kümmerte das? Inzwischen fraßen die Kormorane mehr, als alle Berufsfischer am See zusammen fingen. Und während es immer weniger Fische gab, wurden die Vögel immer zahlreicher, jedes Jahr, über dreitausend lebten bereits am See, sechsmal so viel wie vor zehn Jahren. Und auch die Zahl der Brutpaare stieg immer weiter an. Doch heute Nacht würden alle Brutbäume am Untersee brennen, die hier und die drüben im Radolfzeller Aachried, dafür würden seine Kollegen sorgen. Und wenn sie anfingen, wer weiß, dann würden in ein paar Tagen vielleicht die Kolonien bei Fischbach und im Vorarlberg brennen. Und dann würde, dann musste die Politik reagieren!
Konrad sah auf die Uhr: eine Viertelstunde noch.
Keuchend setzte er die Kanister ab. Im schwachen Mondlicht konnte er die beiden Brutbäume erkennen. Vom Kot der Tiere waren sie weiß gefärbt und sahen aus wie Skelette von Urzeitwesen. Über sich erkannte er die Schemen der Vögel in ihren Nestern. Dreiundvierzig Brutpaare hatte er gezählt, bisher hatten hier im Wollmatinger Ried höchstens zwei oder drei Paare gebrütet. Vor dreißig Jahren hatte er sich noch gefreut, wenn er einen Kormoran gesehen hatte, so selten waren sie gewesen. Sie waren ja Fischer wie er auch. Schlanke, anmutige Räuber, aber es waren einfach zu viele.
Einmal hatte er einen toten Kormoran aus zwanzig Metern Tiefe geholt, er hatte sich in seinem Netz verfangen, als er Fische herausreißen wollte. Und im Obersee hatte ein Kollege einen Vogel aus vierzig Metern Tiefe geholt. Vierzig Meter! Zwei Minuten konnten sie unter Wasser bleiben, er hatte die Zeit selbst gestoppt, kaum ein Seefisch war vor diesen Raubtieren sicher. Und manchmal fielen morgens mehrere hundert Tiere in die Ermatinger Bucht ein, jagten gemeinsam und scheuchten alles auf, was Flossen hatte. Oder sie holten sich die Fische aus den Netzen, zerrissen das Nylon, ruinierten das teure Material. Mit der Zeit hatten sie gelernt, wie man Fische aus den Netzen holte, ohne darin hängen zu bleiben. Schon lange hatte er keinen toten Kormoran mehr aus der Tiefe gezogen. Schlaue Jäger waren sie. Und ein halbes Kilo Fisch fraß ein Kormoran am Tag. Einer! Am Tag!
Konrad stand am Fuß des Stamms. Hörte das nervöse Bellen der Vögel. Manche schlugen aufgeregt mit den Flügeln. Sie hörten ihn, vielleicht rochen sie das Benzin. Alles war knochentrocken, der Schauer vor ein paar Tagen hatte nicht viel gebracht, und die Äste der Bäume waren schon abgestorben vom Kot der Tiere. Lichterloh würden sie brennen, lichterloh!
Er öffnete den Kanister und goss das Benzin an den ersten Stamm. Dabei traten ihm Tränen in die Augen. Tränen des Zorns und der Scham. Doch den Vögeln würde nichts passieren, nur den Eiern in ihren Nestern. Die Kormorane würden panisch davonfliegen und nicht wiederkehren, solange die Flammen loderten, sie würden durch die Nacht irren und die Eier würden entweder verbrennen oder später auskühlen. Aber was machte das schon?
Jedes Jahr, er hatte das nachgelesen, verputzte jeder Deutsche im Schnitt zweihundert Hühnereier. Dagegen waren die paar von den Kormoranen lächerlich, zumal die Tiere ja längst nicht mehr bedroht waren. Und außerdem: Allein die Konstanzer Hauskatzen dürften an einem Tag mehr Vögel töten und Nester ruinieren. Es ging um ein Zeichen, ein mächtiges Zeichen, das sie setzen wollten, das war bitter nötig. Was hatten sie geredet, Petitionen verfasst, mit Journalisten diskutiert, beim Landrat gebettelt und gefleht! Vertröstet wurden sie, abgespeist mit kleinstmöglichen Zugeständnissen. Verlogene, mitleidige Blicke und leere Versprechungen bekamen sie: Diese Kormorane, klar müsse man mehr tun, aber die Naturschutzlobby! Das Empfinden der Leute! Niemand will Tiere leiden sehen! Und das Leiden der Fische? Dass manche Fischarten durch den Vogel bedroht waren? Das sah man nicht. An der Wasseroberfläche hörte die Welt für die meisten Menschen auf.
Er ging weiter und schüttete Benzin an den zweiten Baum. Vom beißenden Geruch wurde ihm übel. Und die Vögel wurden noch unruhiger, spürten, dass da etwas nicht stimmte. Dass ihren Gelegen Gefahr drohte.
Dann sah er auf die Uhr. Fünf Minuten noch.
Um Punkt zwei Uhr würden sie die Bäume anzünden, so war es abgemacht.
Ein letztes Mal ließ Konrad den Blick durchs Ried schweifen. Das Schilf raschelte leise im Nachtwind. Er liebte das Geräusch, wie alles hier, es war seine Heimat, er gehörte hierher, sonst hatte er nichts.
Zwei Uhr.
Sowie er das Zündholz ins Benzin geworfen hatte, schossen die Flammen in die Höhe. Die Vögel bellten, schlugen Alarm, flatterten auf, während die Flammen Stamm und Äste hinaufleckten. Wie schnell das ging! Wie mächtig diese Feuersbrunst war! Und so heiß, dass er rasch zurücktreten musste, damit seine Haut nicht versengte. Oben sah er die Schatten der davonfliegenden Vögel, hörte das geisterhafte Bellen und Meckern, das verzweifelte Rufen.
Schnell ging er zum nächsten Baum. Warf das Zündholz, und sofort eilten die hungrigen Flammen hoch zu den Nestern. Das gleiche Inferno: wildes Geflacker, die Schatten der flatternden Vögel, ihre panischen Rufe.
Es war vollbracht.
Fast.
In einem Kanister hatte er noch ein paar Liter Benzin übrig gelassen. Die goss er ins Schilf, eine Linie quer zum Wind. Zündete ein Streichholz an. Spürte den Nachtwind in seinem Rücken, als er es zwischen die Halme warf. Sofort ging es in Flammen auf. Seine Augen weiteten sich, so schnell breiteten sie sich aus, fraßen in Sekunden eine lodernde Schneise ins Ried.
Niemand würde das hier übersehen.
Er musste weg, in Sicherheit, warf die Kanister ins Feuer und lief zum Boot. Hastig schob er es ins Wasser. Es würde nicht lange dauern, bis Wasserschutzpolizei und Feuerwehr hier wären. Er drehte den Motor auf und fuhr rasch über den Seerhein auf die Schweizer Seite. Auch wenn ihn jemand sah, niemand würde ihn erkennen. Dann lenkte er das Boot hart am Ufer und im Schutz des Schilfs in Richtung Ermatingen.
Keine drei Minuten war er unterwegs, da hörte er schon die Sirenen. An der verabredeten Stelle fuhr er ins Schilf. Zog das Boot hinein, keiner würde es hier finden. Auf einem Feldweg wartete Reto, sein Schweizer Fischerfreund. Schon von Weitem sah er das Glimmen seiner Zigarette.
Konrad blickte nach Westen. Ganz in der Ferne, am anderen Ende des Untersees, sah er es ganz deutlich: drei rote, wild flackernde Feuerbälle, auch die Brutkolonien im Radolfzeller Aachried standen also in Flammen. Dann sah er noch einmal hinüber zu den Bäumen, die er in Brand gesteckt hatte.
Ihm stockte der Atem. Aus der brennenden Schneise war ein Flammenmeer geworden; eine einzige, gewaltige Feuersbrunst, die sich, vom Südwestwind angefacht, unaufhaltsam Richtung Konstanz fraß.
3
Nachdem der zweite Feuerwehrwagen mit heulender Sirene an ihrem Hotelfenster vorbeigerauscht war und Alexandra trotz der schallisolierten Fenster erneut senkrecht im Bett stand, schaltete sie ihr Smartphone an. Das Netz wusste schon Bescheid: Es gab zwei Großbrände, die sich rasch ausbreiteten, einen im Radolfzeller Aachried und einen im Wollmatinger Ried. Auch die Täter standen bereits fest. »Die Drecksfischer haben die Kormoranbäume abgefackelt«, meinte ein wütender Chatter namens »Vogelfreund« auf SÜDZEITUNG online, »aber wir wissen ja, wo sie wohnen!«
Wenn das Gerücht stimmte, hatte der Brand etwas mit ihrem Auftrag zu tun. Alex sprang aus dem Bett, schlüpfte in Jeans und Bluse, zog die Lederjacke an und steckte die Kamera in den Rucksack. Jagdfieber packte sie, endlich, wie eigentlich immer, wenn sie an einer neuen Story dran war. Sie liebte es, sich in die Arbeit zu stürzen, mit Betroffenen zu sprechen, sich einzulesen, Witterung aufzunehmen, Zusammenhänge zu erkennen, sich ein Urteil zu bilden. Es war jedes Mal ein Abenteuer, als würde sie in eine neue Welt eintauchen. Da vergaß sie, dass sie jenseits der Arbeit nur ein klägliches Leben hatte, keine echten Freunde, keine Hobbys. Dass sie ohne Arbeit ziemlich aufgeschmissen war, zwischen zwei Projekten morgens mit einem mulmigen, schalen Gefühl aufwachte und Angst vor dem neuen Tag hatte. Nicht wusste, wie sie ihn rumkriegen, was sie mit sich anfangen sollte und wozu sie überhaupt auf der Welt war.
Dann legte sich die Einsamkeit wie eine schwere Rüstung um ihren Körper. Und besonders schlimm spürte sie die nach einem One-Night-Stand, wenn sie am Morgen aufwachte und der Geruch des Mannes noch im Schlafzimmer lag. Sie wollte nie, dass ihre Eroberungen blieben. Sie wollte Sex mit ihnen, ein bisschen plaudern, kurz die Einsamkeit vergessen, sich begehrt und vielleicht sogar gemocht fühlen, dann sollten sie verschwinden. Es gab selten einen, bei dem sie am Morgen bereute, dass er nicht neben ihr aufgewacht war. Genauso war es vorgestern mit diesem Jörg gewesen, er wäre gern länger geblieben und hätte noch ein paar Nümmerchen geschoben, doch sie war heilfroh, als sie ihn endlich vertrieben hatte. Der Typ war ihr einfach unheimlich.
Trotzdem musste sie seitdem ständig an ihn denken und wartete auf seinen Anruf. Nicht weil sie ihn vermisste, sondern weil er ihr etwas Unglaubliches erzählt hatte. Vielleicht schmollte er, weil sie ihn sozusagen aus dem Bett gekickt hatte, doch er hatte hoch und heilig versprochen, sich bei ihr zu melden. Diese Geschichte könnte alles verändern, ihr ganzes Leben. Wenn sie stimmte. Vertrauenswürdig hatte sie diesen Jörg von Anfang an nicht gefunden. Er war so ein Spielertyp, ein Lebemann, vergnügungssüchtig und verantwortungslos. Charmant, gut im Bett, wirklich gut im Bett, aber sonst zu nichts zu gebrauchen. Dass er nicht anrief und ihr außerdem eine falsche Telefonnummer gegeben hatte, bestätigte nur ihre Einschätzung.
Alexandra verließ das Zimmer und nahm die Treppen ins Untergeschoss, immer drei Stufen auf einmal. Kurz darauf schoss sie mit ihrem Mountainbike aus dem Parkhaus des Hotels, als wäre sie auf einer Etappe der Tour de France. Die frische Nachtluft tat gut. Sie fühlte sich leicht, stark und frei. Endlich ging es richtig los, dachte sie. Die letzten beiden Tage hatte sie vor allem in der Unibibliothek gesessen und recherchiert, aber doch meistens an Jörgs Geschichte gedacht, die er vielleicht nur erfunden hatte, um sie noch mal rumzukriegen. Doch dafür hatte er zu viel gewusst.
Sie fuhr an der Konstanzer Moschee entlang, deren weißes Minarett wie eine Rakete aussah, rechts folgten Einkaufzentren, und links flog die Stadt am Seerhein an ihr vorbei, ein neues Viertel mit einer schicken Promenade am Fluss, die Wohnblöcke sahen wie bunte Bauklötze aus. In ihrer Kindheit hatte es das noch nicht gegeben, da hatten sich Industrieanlagen am Seerhein entlanggezogen. Bis zum Wollmatinger Ried waren es keine zwei Kilometer, und sie trat so schnell sie konnte in die Pedale, als wäre sie auf der Flucht. Zurück in die Wirklichkeit, hinein ins Abenteuer. Ein weiterer Feuerwehrwagen bretterte mit heulender Sirene und Blaulicht an ihr vorbei.
»Ich will wissen, wie die Situation am See wirklich ist«, hatte der Redakteur des SPIEGEL zu ihr am Telefon gesagt. Sie hatte sich über den Anruf gefreut und war richtig aufgeregt gewesen. Meistens schrieb sie für die taz und einige linke Online-Magazine, das war ihre politische Heimat, aber leben konnte sie von den kargen Honoraren, die sie für ihre Artikel bekam, kaum. Wenn sie den Rechercheaufwand mit dem Geld verglich, war das Sklavenarbeit. Selbstausbeutung. Etwas, wogegen sie eigentlich anschrieb. Aber es machte einfach verdammt viel Spaß, und sie hatte den Eindruck, mit ihren Reportagen etwas zu bewegen. Beim SPIEGEL war finanziell deutlich mehr drin. Und auch wenn sie das Blatt viel zu liberal fand, war es trotzdem cool, für so ein fett etabliertes Nachrichtenmagazin zu schreiben.
Der Redakteur kam wie sie vom Bodensee. Er wusste, dass sie von der Reichenau stammte und sich auf ökologische Themen spezialisiert hatte. Ob er auch wusste, dass ihr Vater Berufsfischer war? In den letzten Jahren waren die Bodenseewellen hochgeschlagen: Der Nährstoffgehalt des Sees war durch die immer besseren Kläranlagen rapide zurückgegangen und in der Folge der Fangertrag der Berufsfischer dramatisch eingebrochen, wohingegen die Zahl der Kormorane seit Jahrzehnten stark zunahm. Dann war nach langem Rechtsstreit eine Aquakulturanlage im See genehmigt worden, welche die Region mit gezüchteten Bodenseefelchen versorgen sollte. Doch die meisten Berufsfischer wollten die Anlage nicht, sie forderten stattdessen eine Erhöhung des Nährstoffgehalts im See, was wiederum Politik, Gewässerschutz und Naturschutzverbände strikt ablehnten. Es hatte zahlreiche Protestaktionen der Fischer gegeben, Podiumsdiskussionen und Gespräche mit Politikern, doch im letzten Jahr war es still geworden. Hatten die Fischer aufgegeben? Resigniert? Wie es aussah, eher nicht.
Schon von Weitem sah sie die riesige Rauchwalze am Nachthimmel. Wie eine gewaltige Unwetterfront wirkte sie, zugleich anziehend und furchteinflößend. Vor den städtischen Entsorgungsbetrieben parkten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen kreuz und quer. Blaulichter flackerten, Menschen in Uniformen liefen aufgeregt hin und her, es war eine Atmosphäre wie bei einer Großrazzia.
Die B 33, die wichtigste Verkehrsachse der Stadt, die Konstanz mit der A 81 verband und am Ried entlangführte, war gesperrt, ebenso die Zufahrten zu den Entsorgungsbetrieben und dem Klärwerk. Ein paar Dutzend Schaulustige drängten sich vor dem Absperrband. Auch die Presse war schon da, der SWR hatte einen Wagen geschickt. Ein Polizist, wahrscheinlich der Pressesprecher, gab einem Journalisten vor laufender Kamera ein Interview.
»Wir wissen noch nichts«, sagte er. »Ob die beiden Brände zusammenhängen und wer verantwortlich ist, kann ich Ihnen nicht sagen.« Ob Gefahr bestehe, dass der Brand aufs Industriegebiet übergehe? »Wir haben eine sehr gute Feuerwehr in Konstanz. Ich glaube, wir kriegen das in den Griff.« Es klang weniger optimistisch, als es sollte.
Bei den Schaulustigen war man schon weiter. »Die saget, in ä paar Minude isch des Feuer im Induschdriegebiet«, meinte ein Mann mit wichtigem Blick. »Do gibt des hier ä Kadaschdroph. Un drübe uf d’Höri brennet scho die erschde Häusle in Moos! Die müsset alles evakuiere, grad hab i ä WhatsApp kriegt.«
»Aber Moos liegt südlich vum Ried, vu do kummt doch de Wind«, meinte eine Skeptikerin. »Dann müsst sich des Feuer ja gege d’Windrichtung ausbreite.«
»Mei Quelle isch verlässlich!«, beharrte der Mann und sah die Schlaubergerin pikiert an. »In Moos brennt’s, sag i Ihne!«
»Ha, des waret hundertpro die Fischer«, sagte ein anderer. »Un wenn des stimmt, hond die’s bei mir verschisse! Grad hot mer einer verzällt, dass sechshundert Kormoran lebendig verbrennt sind. Sechshundert!«
Hier würde sie nicht schlauer werden, dachte Alex, außerdem wollte sie das Feuer sehen, und von hier würde sie nicht herankommen. Überall standen Polizisten und hatten die Schaulustigen im Blick. Alexandra hatte noch nie einen Großbrand gesehen, doch sie trieb mehr als Neugierde und Sensationslust. Eine Reportage hatte genauso viel mit Emotionen, Stimmungen und Atmosphäre zu tun wie mit Fakten und Zusammenhängen. Sie musste die Orte, die Menschen und ihre Gefühle spüren, um zu verstehen. Und dieser Brand hatte wohl mit sehr starken Gefühlen zu tun.
Sie schwang sich wieder aufs Rad und fuhr die Fritz-Arnold-Straße entlang. Als Kinder hatten sie immer im Ried gespielt, sie kannte alle geheimen Wege dorthin. Und tatsächlich: Fünfhundert Meter weiter war nur wenig los. Eine Polizeistreife überholte sie, nahm von ihr aber keine Notiz.
Sie schloss ihr Rad ab und zwängte sich durch Brombeerhecken. Die Stacheln pikten durch ihre Jeans, zerkratzten ihre Lederjacke und hielten ihren Rucksack fest. Alex knipste die Taschenlampe ihres Handys an und versuchte, sich an den Ranken vorbeizudrücken oder hinüberzusteigen. Als sie sich durchs Dickicht hindurchgezwängt hatte, lag ein Entwässerungsgraben vor ihr. Sie sprang hinüber, schaffte es aber nicht ganz und blieb mit beiden Füßen im Morast stecken.
»Scheiße«, rief sie und lachte. Ihre Sneaker waren ruiniert und von einer kackbraunen Schicht überdeckt, die Hände und Knöchel blutig, Socken und Füße klatschnass. Sie schmatzten beim Gehen. Klasse, dachte Alex, so fühlte sich das Leben an!
Kurz darauf befand sie sich auf einem freien Feld, und der Anblick verschlug ihr den Atem. Vor ihr stand diese mächtige Walze aus Feuer und Rauch, es sah aus wie der Weltuntergang, unten loderten die Flammen, darüber standen die vom zuckenden orangefarbenen Licht angestrahlten Wolken, darüber der schwarze Nachthimmel, davor die dunklen Silhouetten der Bäume. Endzeitstimmung. Götterdämmerung.
Sie wollte noch näher ran. Da sah sie einen Mann, keine fünfzig Meter entfernt. Er schien mit irgendwas beschäftigt zu sein und hatte sie noch nicht bemerkt. Kurz darauf stieg eine Drohne in den Nachthimmel, der Mann steuerte sie direkt über das Inferno. Alex grinste. Bestimmt ein Kollege, wahrscheinlich ein Lokaljournalist, der sich hier auskannte. Die Aufnahmen würde er für gutes Geld verkaufen können.
Sie ging weiter. Bald konnte sie das Feuer hören, das Knistern, Fauchen und Rauschen. Der ganze Schilfgürtel brannte, es war eine kilometerlange Feuerwand, die wie eine geschlossene Armee vorrückte und sich in die Felder fraß, Richtung Stadt. Alex holte ihre Kamera heraus und machte Aufnahmen. Sie würde sie nicht verkaufen, von Sensationsjournalismus hielt sie nichts, die Fotos waren für sie, um die Stimmung dieser Nacht später beim Schreiben nachempfinden zu können.
Jetzt sah sie in einiger Entfernung Feuerwehrleute, die noch Abstand zum Feuer hielten. Wie es schien, waren sie noch nicht einsatzbereit. Wahrscheinlich hofften sie, dass das Feuer auf den Wiesen nicht genug Nahrung finden würde. Das Gras brannte sicher nicht so stark wie das furztrockene Schilf. Ihr Hauptaugenmerk galt dem Industriegebiet, dem Klärwerk und den Entsorgungsbetrieben, die wollten sie schützen. Würde sich das Feuer bis dorthin ausbreiten, gäbe es wirklich eine Kadaschdroph, das hatte der Schaulustige richtig erkannt.
Alexandra hörte ein lautes Knattern im Himmel, ein Polizeihubschrauber näherte sich rasch. Instinktiv ging sie in die Hocke. Er flog über sie, sein Scheinwerfer zielte auf die Feuerwand, er folgte ihr nach Osten.
Kurz darauf stand Alex so nah an den Flammen, dass sie die Hitze spürte. Die Luft war wie verschwommen, Funken sprühten, verkohlte Schilfreste wirbelten durch die Luft, es knisterte, knackte und flackerte und roch nach verbranntem Stroh. Wie berauscht von der Naturgewalt starrte sie auf die Flammen. Ihre Wangen glühten, und ihr Herz pochte wild. Sie musste an die großen Funkenfeuer denken, die überall am See am Sonntag nach Aschermittwoch entzündet wurden, schon als Kind hatte sie den Anblick gefürchtet und geliebt. Die Phantasie, sich ins Feuer zu stürzen und von den Flammen, vom Schmerz verschlungen zu werden, hatte Schauer des Entsetzens durch sie rieseln lassen und sie elektrisiert. Sie war dann ganz nah an die Flammen getreten, viel näher, als sie es sich eigentlich traute, hatte die Hitze ertragen, bis es wirklich schmerzte, blieb noch einen Moment stehen, um dann schnell davonzulaufen.
Auf einmal wurde es auch hier glühend heiß, und Alex merkte, wie schnell das Feuer gewandert war und sich ihr genähert hatte. Noch einmal holte sie die Kamera heraus und fotografierte, direkt in die Flammen. Ertrug wie als Kind beim Funkenfeuer die Hitze, obwohl sie schon schmerzte. Wartete noch einen Moment, obwohl die Funken bis zu ihr sprühten. Sie ging erst rückwärts, als sich ihre Haut anfühlte, als würde sie brennen.
Da sah sie ein Tier neben sich, einen Schwan. »Oh mein Gott«, flüsterte sie erschrocken. Der Vogel war zu Tode erschöpft, die Flügelfedern zur Hälfte verbrannt, ebenso der Hinterleib. Er würde nicht überleben, trotzdem stemmte er die Flügel auf den Boden und versuchte, vom Feuer wegzurobben. Doch der Schwan war zu schwach. Alex glaubte, den höllischen Schmerz in seinen Augen zu erkennen. Sie packte die Kamera in den Rucksack, ging zu dem Tier und versuchte, es hochzuheben. Obwohl sie dem Schwan helfen wollte, fauchte er, doch er hatte kaum mehr Kraft. Noch einmal wollte sie ihn auf den Arm nehmen, aber er war zu schwer. Also zog sie ihn vorsichtig weg von den Flammen. Warum war er nicht rechtzeitig geflohen?, fragte sie sich. Vielleicht war es ein Weibchen und schon beim Brüten gewesen und wollte das Nest nicht verlassen. Dann hatte das Feuer das Tier eingeschlossen und erfasst, als es im letzten Moment versuchte davonzufliegen.
Als sie den Schwan ablegte, rührte er sich nicht mehr. Die Flügel waren halb ausgestreckt, der lange Hals lag schlaff im Gras. Das Tier war tot. Wie viele Schwäne waren wohl in dieser Nacht gestorben? Was der Brand für die Tiere bedeutete, darüber hatte sie sich keine Gedanken gemacht. Ob denen, die das Feuer gelegt hatten, bewusst war, was sie anrichteten? Sie holte die Kamera heraus, auch diese grausame Episode wollte sie festhalten.
»Verschwinden Sie!«, rief plötzlich jemand hinter ihr. Vor Schreck wäre Alex fast die Kamera aus der Hand gefallen. Wie aus dem Nichts war der Mann aufgetaucht, sie hatte ihn überhaupt nicht bemerkt. Er trug eine Feuerwehruniform. »Haben Sie den Arsch offen oder was? Wissen Sie, wie gefährlich das hier ist?«
»Tut mir leid, ich bin von der Presse. Ich wollte dem Schwan hier helfen.«
Er schüttelte den Kopf und blickte erst auf das tote Tier, dann auf ihre Kamera. Ungläubig sah er sie an. »Ihr Aasgeier habt sie doch nicht alle. Hauptsache, ihr kriegt eure Story. Grad hab ich einen Kollegen von Ihnen vertrieben. Der hat eine Drohne übers Feuer fliegen lassen. Schade, wir hätten sie mit unseren Schläuchen abschießen sollen.« Er seufzte und schluckte seinen Ärger herunter. »Es geht gleich los mit dem Löschen, und Sie stehen sozusagen direkt in der Schusslinie. Also weg jetzt!«
»Ist ja schon gut, danke«, sagte sie und machte sich auf den Rückweg. Der Rausch, die Abenteuerlust waren verflogen. Natürlich hatte der Mann recht. Auch wenn es nicht nur Sensationslust gewesen war, was sie zu dem Feuer getrieben hatte, war es ihr doch um den Kick gegangen. Den Kick, etwas Neues, Gefährliches zu erleben.
Sie war schon fast bei der Hecke, da sah sie aus den Augenwinkeln einen Schatten neben einem Busch. Die Umrisse eines Mannes, der sie zu beobachten schien. Wahrscheinlich noch ein Feuerwehrmann, der sich vergewissern wollte, dass sie sich wirklich vom Acker machte. Doch irgendwas kam ihr komisch vor. Ihre Nackenhaare sträubten sich, als drohte eine Gefahr. Alex lief weiter und tat so, als hätte sie den Mann nicht gesehen.
Als sie an einer Baumgruppe vorbeikam, trat sie dahinter und spähte zurück. Für einen Moment hörte ihr Herz auf zu schlagen. Der Mann folgte ihr, er war keine dreißig Meter entfernt, doch das Gesicht konnte sie nicht erkennen. Sofort dachte sie an diesen Jörg, er hatte ungefähr seine Statur. Sollte er es wirklich sein, musste er sie länger verfolgt haben, wahrscheinlich schon von ihrem Hotel aus. War er ein Stalker, so ein erbärmlicher Freak, der Macht über Frauen brauchte, um sich nicht allzu jämmerlich zu fühlen? Aber der Freak hatte Muskeln, die hatte sie neulich gespürt. Bekäme er sie zu fassen, hätte sie kaum eine Chance. Doch was zum Teufel wollte er von ihr? Warum ließ sie sich nur mit solchen Scheißtypen ein? Oder war das doch ein Feuerwehrmann?
In dem Moment holte der Fremde eine Maske aus seiner Tasche und streifte sie über seinen Kopf. Instinktiv begann sie zu rennen, zu dem Brombeerdickicht, hinter dem ihr Fahrrad stand. Diesmal schaffte sie den Sprung über den Graben. Sie schlüpfte ins Dickicht, wollte sich beeilen, doch sie kam kaum voran, die Brombeerranken zerrten an ihr, als wollten sie sie aufhalten, als machten sie mit diesem Arschloch gemeinsame Sache. Sie versuchte sich loszureißen, sich mit Gewalt durchs Gestrüpp zu schieben, ihre Jacke war schon völlig verkratzt, genau wie ihre Hände, aber sie hing im Dickicht wie eine Fliege im Spinnennetz!
Panik erfasste sie. Alex blieb stehen, spürte, wie der Puls in ihren Schläfen hämmerte. Sie dachte an die Nacht vor ein paar Tagen im Lorettowald, da hatte es im Unterholz geknackt und sie das Gefühl gehabt, dass dort jemand lauerte. Hatte er sie da schon verfolgt? Hatte der Sprint ans Hörnle ihr das Leben gerettet? War ihre Begegnung im »KULT« gar kein Zufall gewesen?
Plötzlich hörte sie ihn hinter sich, wie auch er mit den Brombeeren kämpfte, hörte sein Keuchen, er schien ganz nah, dann war es still. Jetzt verharrte auch er. Lauschte. Sah sie vielleicht. Bewegte seine Hand vorsichtig durchs Gestrüpp, um nach ihr zu greifen …
Panisch drängte sie weiter, statt stehen zu bleiben und sich vorsichtig zwischen den Ranken hindurchzuwinden. Sie riss sich los, lief ein Stück, aber schon krallten sich die nächsten Ranken in ihren Körper, hielten sie fest wie eine fleischfressende Pflanze.
Im nächsten Augenblick packte sie jemand von hinten an den Schultern. Alex blieb vor Schreck das Herz stehen. Jemand zog sie mit Macht an sich heran. Kurz darauf spürte sie ein Messer an ihrer Kehle, und für einen Moment wurde ihr schwarz vor Augen. Sie hörte seinen Atem, er roch nach Schnaps und Bier.
Sie schloss die Lider, spürte die Klinge auf ihrer Haut.
Tränen schossen ihr in die Augen, kurz sah sie ihre Mutter vor sich, wie sie mit einem unbestimmten Lächeln auf einem der Pfade im Lorettowald stand.
Sollte das, dachte Alexandra, schon alles gewesen sein?
4
»Dürfen wir eintreten?«, fragte der Mann und hielt ihm einen Polizeiausweis hin. Der Mann hieß Steck und war Kommissar, ein Bürohengst mit dürren Armen und schlaff überm Gürtel hängender Wampe. Eine Frau war noch dabei, eine Kommissarin Henke. Sie war ungefähr so alt, wie Elisabeth es heute wäre, wenn sie noch leben würde. Aber diese Henke war nicht so hübsch wie sie.
»Was wollen Sie?«, fragte Konrad Kaltenbacher. Sein Herz klopfte, obwohl er die Polizei eigentlich schon erwartet hatte.
»Es geht um den Brand im Ried.«
Die Farbe wich aus seinem Gesicht, er konnte das nicht verhindern. Hatte ihn gestern jemand erkannt? Er blickte zur Straße. Dort stand Martha Brandstätter, ausgerechnet! Was suchte die hier? Hatte sie ihn vorige Nacht gesehen? Hatte sie die Polizei gerufen? Auch ihr Fischerhaus befand sich direkt am See, nur zwei Grundstücke weiter. Wie missgünstig und schadenfroh sie zu ihm herüberspähte! War da nicht auch ein höhnisches Lächeln?
Früher hatte sie nicht dieses Boshafte gehabt, Konrad hatte sie gemocht. Sie war eine von den wenigen gewesen, die sich nicht das Maul über Elisabeth verrissen. Russenschlampe, so hatte seine Nachbarin, die alte Kracht, seine Liz einmal beim Metzger genannt. Zufällig hatte er das aufgeschnappt.
Jetzt würde er Martha solch böses Gerede auch zutrauen. Und wie alt sie aussah! Sie war fünfzehn Jahre jünger als er und Johannes, wirkte aber älter als ihr Mann. Doch wenn man mit jemandem wie Johannes Brandstätter verheiratet war, alterte man wohl schneller. Weil die Seele Schaden nahm.
Mit dem Johannes hatte er sich schon im Kindergarten geprügelt. Die Kaltenbachers und die Brandstätters, das hatte noch nie zusammengepasst, schon ihre Großväter waren sich aus dem Weg gegangen. Und nachdem er eine zehn Jahre jüngere Frau geheiratet hatte, dachte er manchmal, musste Johannes eine noch jüngere nehmen. Wobei er sich nicht nur deshalb für Martha entschieden hatte.
Sie löste ihren Blick und kehrte ihm den Rücken zu. Konrad merkte, wie die beiden Kommissare ihn aufmerksam beobachteten.
»Kommen Sie«, sagte er mürrisch und ging zum Haus. Ob sie schon seine Freunde vernommen hatten? War einer schwach geworden? Vielleicht der Paul. Wenn, dann er. Mit Druck konnte er nicht umgehen, deshalb war er auch so fett. Seit gut zehn Jahren, seit immer weniger Felchen in den Überlinger See zogen, soff und fraß er zu viel. Er hatte eh nur mitgemacht, weil er nicht Nein sagen konnte. Besser, sie hätten ihn in Ruhe gelassen. Aber sie hatten sich geschworen zu schweigen, egal, was passieren würde. Und dem Paul lag viel an ihrer Freundschaft.
Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Neugierig blickten sich die Kommissare um. Jeder wollte gern wissen, wie Fischer lebten. Die Leute stellten sich vor, sie hausten in einer Art Heimatmuseum, mit Reusen und einem Berg von zu flickenden Netzen in jeder Ecke. Wobei sein uraltes Fachwerkhaus der Phantasie wohl recht nahekam. Die Möbel waren seit Generationen in Familienbesitz, der Eichentisch und der Biedermeierschrank hatten schon seinem Ururgroßvater gehört, sein Großvater hatte den Ofen mit den hellblauen Kacheln gebaut, und an den Wänden hingen eine Tiefenkarte und Aquarelle vom Untersee.
Konrads Herz schlug wie verrückt. Jetzt würde es wieder losgehen, so wie damals. Da hatte auch ein Kommissar vor seiner Gartentür gestanden. Erst glaubten sie noch an den Serienmörder, aber dann … Weil sie den nicht fanden, nahmen sie ihn aufs Korn. Der eifersüchtige Ehemann, der seine Frau erdrosselt und die Leiche im See versenkt hat. Wo waren Sie an dem Nachmittag, Herr Kaltenbacher? Haben Sie Zeugen? Nur Felchen, hatte er geantwortet, und die habe er alle getötet. Das fand dieser Kommissar Mayer mit den traurigen Augen gar nicht lustig. Doch beweisen konnte er ihm nichts.
Etwas zu trinken bot Konrad seinen Gästen nicht an. Warum auch? Er wollte sie schnell wieder loshaben, und das sollten sie ruhig merken. Angst vor der Polizei zu zeigen machte die Sache nur schlimmer, das hatte er damals gelernt. Mit seiner Angst hatte er sich überhaupt erst verdächtig gemacht.
»Das Feuer hat einigen Schaden angerichtet«, meinte Steck.
»Hab ich gehört«, sagte Konrad. »Haben da ein paar Kinder im Ried gezündelt?«
»Es war Brandstiftung. Wir haben zwei Benzinkanister gefunden. Das Feuer wurde in einer Kormorankolonie gelegt.«
»Um die ist es nicht schade. Von denen gibt es viel zu viele.«
Steck schüttelte den Kopf und hob die Stimme. »Das halbe Ried ist abgebrannt, Herr Kaltenbacher. Die B 33 war die ganze Nacht gesperrt. Hätte die Feuerwehr nicht so schnell reagiert, wären wahrscheinlich auch die Entsorgungsbetriebe und das Klärwerk betroffen gewesen. Durch den Wind sprang das Feuer über die Kanäle.«
»Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert.«
»Ach ja?«
Steck sah ihn an wie einen Verbrecher. Wie damals dieser Kommissar Mayer, als er ihn nach seinem Alibi für den Nachmittag fragte, an dem seine Frau verschwunden war.
»Was wollen Sie von mir?«
»Haben Sie das Feuer gelegt, Herr Kaltenbacher?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
Steck zuckte mit den Achseln. »Fragt man in Fischerkreisen herum, fällt schnell Ihr Name. Und Sie haben auch eine passende Vorstrafe.«
»Wen genau haben Sie denn alles befragt? Und was genau hat wer gesagt?«
Darauf blieb ihm Steck die Antwort schuldig. Das hatte er sich schon gedacht: Der Kommissar stocherte im Nebel. Wollte ihm Angst einjagen. Konrad lachte abschätzig. »So einfach macht ihr euch das? Brutbäume brennen, und weil der Kaltenbacher schon mal ein paar Kormorane abgeknallt hat, muss er es gewesen sein.«
»Sie haben zwölf Vögel im Naturschutzgebiet geschossen.«
»Sonst kriegt man sie halt nicht.«
Steck und Henke tauschten verständnislose Blicke. Klar, die hatten keine Ahnung, was es heißt, wenn einem die Existenz weggefressen wird. Als Beamte trugen sie ja einen weichen Rettungsring auf den Hüften, mit dem sie auch die Sintflut überleben würden.
»Wo waren Sie gestern Nacht?«, fragte die Henke.
»Bei meinem Freund, dem Franz Hart. Ein Fischer aus Allmannsdorf. Wir waren bei ihm zu Hause, haben Karten gespielt und zusammen etwas getrunken. Deshalb bin ich auch mit dem Fahrrad gefahren. Und noch zwei Freunde waren da, der Reto Burri aus Ermatingen und der Paul Lemprecht aus Litzelstetten.«
Kommissarin Henke lächelte, als wüsste sie was. »Bei Franz Hart waren wir schon. Ist ja gut für Sie, dass es gleich so viele Zeugen gibt. Und gut für die anderen ist es auch.«
Konrad missfiel ihr spöttischer, abfälliger Ton, so als nähme sie ihn nicht für voll. »Was wollen Sie damit sagen? Was unterstellen Sie mir da?« Seine Stimme war plötzlich so laut und scharf, dass die zwei zusammenzuckten. Erschrocken starrten sie ihn an, den großen, dunklen, breitschultrigen Mann, als würde er gleich Kleinholz aus ihnen machen. Auch wenn er viel älter war, gegen ihn hätten sie nicht den Hauch einer Chance.
»Tut mir leid«, sagte Konrad und lächelte entschuldigend. Doch eigentlich freute es ihn, sie erschreckt zu haben. »Aber Sie wissen ja sicher schon, dass ich mit der Polizei nicht die besten Erfahrungen gemacht habe.«
Die beiden blieben still und sahen ihn an, als wollten sie ihn am liebsten gleich festnehmen. Konrad trommelte mit den Fingern auf den alten Tisch. Mittlerweile war sein Gesicht genauso zerfurcht, dachte er. Lange schon hatte er morgens nicht mehr in den Spiegel geblickt.
»Haben Sie sonst noch was?«, fragte er. »Ich muss nämlich wieder auf den See. Wir sind grad beim Laichfischfang auf Hecht, und ich verdien mein Geld nicht mit Rumsitzen.«
»Ich glaube, Sie unterschätzen, worum es hier geht«, sagte Steck pikiert.
»Ach ja?«
»Wir ermitteln nicht nur wegen Brandstiftung, sondern auch wegen eines Tötungsdelikts.«
Entgeistert sah er Steck an. »Was?«
Der machte eine Pause, nur um ihn zu quälen. Um zu sehen, ob er sich verraten würde.
»Was ist passiert? Wieso ›Tötungsdelikt‹?«
»Wir haben eine verkohlte Leiche im Ried entdeckt«, sagte die Henke trocken.
Konrad schluckte. Er konnte nichts sagen. Natürlich wussten sie jetzt, dass er es war, so verstört wie er dreinblickte. Vielleicht sollte er es zugeben, alles erklären. Jemanden töten, das hatten sie doch nicht gewollt! Käme es raus, müssten sie ins Gefängnis. Was bekam man für Brandstiftung, wenn dabei einer starb? Sie wären ruiniert. Seine Freunde durfte er nicht verraten. Er hatte sie überzeugt, ihm zu folgen.
Schweiß stand auf seiner Stirn, so wie damals. Immer wenn er ins Polizeipräsidium musste, hatte Schweiß auf seiner Stirn gestanden, auch wenn er fror. Und wie damals schlug sein Herz so wild wie ein Hammerwerk. »Wer ist denn gestorben?«
»Ein Mann, mehr wissen wir noch nicht. Die Leiche wird gerade von der Rechtsmedizin untersucht.«
»Warum war er im Ried, mitten in der Nacht?«
»Das werden wir hoffentlich bald herausfinden.«
Konrad starrte vor sich auf den Tisch. Er spürte, wie Steck ihn beobachtete, wie ein Hecht ein krankes, müdes Fischchen, kurz vor dem Zupacken.
»Wenn Sie jetzt den Mund aufmachen, kann Ihnen das helfen«, sagte Steck. Es klang sehr mitfühlend. »Wahrscheinlich wollten Sie mit Ihren Freunden nur die Kormoranbäume abfackeln und niemanden töten. Aber dann müssen Sie mit uns reden. Schnell.«
Konrad zögerte, überlegte noch einmal. »Ich habe mit der Sache nichts zu tun, und meine Freunde auch nicht, das können Sie mir glauben«, sagte er dann. Er klang viel entschiedener, als er es in Wirklichkeit war.
Steck sah ihn finster an. Der Kommissar ahnte, dass er hinter dem Brand steckte, und spürte, was in ihm vorging. Er wartete, lauerte, ob das Fischchen nicht noch ein Stück näher zu ihm schwimmen würde.
Konrad Kaltenbachers Kehle war staubtrocken. Würde er noch einmal die Kraft aufbringen, all das auszuhalten? Die Befragungen, die Verhöre, das Gerede der Leute. Sein Name würde wieder in der Zeitung stehen und durch den Schmutz gezogen werden. Alle würden sie ihn wieder so schräg ansehen wie vorhin Martha Brandstätter.
Doch er schwieg. »Ich muss auf den See«, sagte er barsch.
»Also gut«, seufzte Steck und stand auf. »Wir werden überall herumfragen. Irgendjemand hat Sie gesehen, wenn Sie es waren. Und womöglich ist nicht jeder Ihrer Freunde so stark wie Sie. Oder soll ich sagen: stur? Sie sollten miteinander reden.«
»Verschwinden Sie!«, rief Konrad. So laut und bissig, dass der Steck einen kleinen Satz zur Tür machte.
5
Martin Schwarz seufzte tief. Schweiß stand auf seiner Stirn, obwohl er sich überhaupt nicht bewegte. Seit ein paar Tagen war es richtig heiß, zu heiß für Mitte April. Vor ihm lag der weitläufige Kinderspielplatz der Insel Mainau. »Blumis Uferwelt« hatten die Marketing-Fritzen diesen Teil getauft. Bescheuerter Name, dachte er, aber seine Tochter Kim und ihre Freundin Lotta liebten den Ort. Mit ihren brandneuen Feenflügeln wirbelten die beiden Fünfjährigen durch das Gewirr des Kunstwaldes, balancierten auf Stämmen, hingen kichernd an Seilen, versteckten sich in einem Haufen aus riesigem Treibholz. Auf ihren Köpfen trugen sie ihre Prinzessinnenkrönchen. Die Zauberstäbe, die auf Knopfdruck rot blinkten, steckten im Gürtel ihrer Kleidchen. Kims war rosa, Lottas blau. Gestern hatte er mit ihnen »Tinker Bell« geschaut, und Martin konnte sich ungefähr ausmalen, was in ihren Köpfchen vor sich ging: Die Stämme waren Schilfhalme, Kim eine Blumen- und Lotta eine Wasserfee, und irgendwo lauerte ein böser Pirat, der das Feenreich bedrohte und den es auszuschalten galt. Vorhin hatte Kim gefragt, ob er der Pirat sein könnte. Eigentlich jagte er gern Feen, aber heute fehlte ihm die Lust. Sein Kopf war einfach zu voll.
Martin seufzte noch einmal und trank einen großen Schluck Hefeweizen, das er sich im Biergarten nebenan geholt hatte. Ahhh, der erste Schluck, wie er kühl und schäumend durch den Hals rann, das war kaum zu toppen. Er saß am Rand des Spielplatzes und stellte das Glas neben sich. Noch zwei Schlucke, und die Welt würde beginnen, ein weniger feindlicher Ort zu sein.
Eine Bank weiter saß ein Ehepaar und beäugte ihn skeptisch.
Irgendwie lief es gerade nicht rund. Seine Arbeit als Privatdetektiv ödete ihn seit einiger Zeit an. Der letzte richtig große Fall mit dem Archäologen Alexander Stetten lag fünf Jahre zurück. Seitdem Routine: Ehepartner beschatten oder heimlich Leute filmen, die ihren Müll in die Tonnen der Nachbarn stopften. Ziemlich oft waren seine Auftraggeber grauenhafte Arschlöcher, Zwangscharaktere und Narzissten, getrieben von Eifersucht, Missgunst, Geltungsdrang oder Gier. Nein, er hatte momentan nicht das Gefühl, mit seiner Arbeit zur Besserung der Welt beizutragen. Gestern Abend hatte ein Mann angerufen, der ernsthaft von ihm verlangt hatte, den Bernhardiner seines Nachbarn zu observieren, um herauszufinden, ob dieser nachts heimlich in seinen Garten kackte. Ein Beweisvideo wollte der Mann auch. Den Auftrag hatte er abgelehnt.
In der Konstanzer SÜDZEITUNG hatte er vor Kurzem einen Bericht über berufliche Krisen gelesen. Der war ihm unter die Haut gegangen. Von »Kompetenzsaturierung« und »Erstarren in der Routine« war da die Rede gewesen, dem man mit Job-Wechsel, »Job-Enrichment« oder »veränderter individueller Sinnkonstruktion« begegnen müsse. So ein Mist, hatte er gedacht. Letzteres hieß so viel wie sich die Sache schönzureden. In so was war er aber nicht gut. Und was gab es bei ihm schon zu »enrichen«, wenn es keine gescheiten Fälle gab? Okay, er könnte sich in all den technischen Schnickschnack wie Abhörtechnik, Videoaufzeichnung und Ortungssysteme hineinknien, aber dafür hatte er seinen Mitarbeiter Thomas Korn. Dem würde er da nie das Wasser reichen können. Und er hatte auch überhaupt keine Lust dazu.