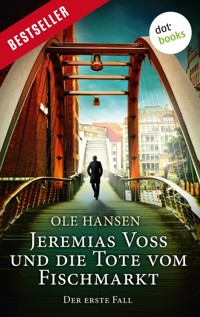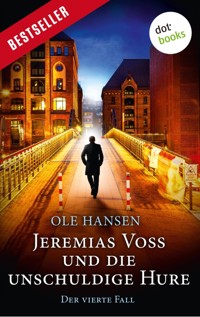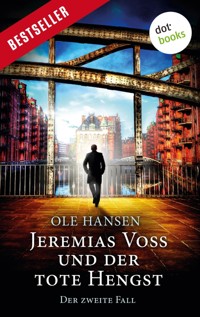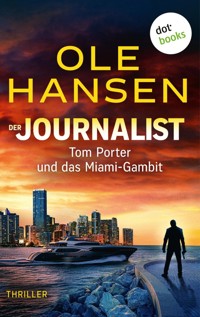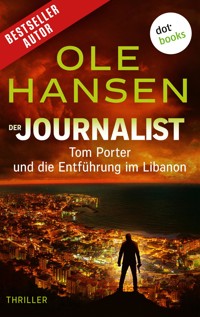Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Jagd um die Welt … TOM PORTER UND DIE KANADISCHE INTRIGE: Eigentlich freut sich Journalist Tom Porter auf zwei Wochen Erholung in Vancouver, doch schon kurz nach seiner Ankunft stößt er auf rätselhafte Todesfälle von Umweltschützern und Indigenen. Seine Spur führt ihn schließlich bis zu dem skrupellosen Holzkonzern »Canadian Timber Company«. Porter weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, bis weitere Leben der Profitgier zum Opfer fallen … TOM PORTER UND DIE ENTFÜHRUNG IM LIBANON: In Kairo wird Dennis Albright, Chef eines amerikanischen Technologiekonzerns, von einer Terrorgruppe gefangen genommen und in den Libanon verschleppt. Jegliche Verhandlungsversuche mit den Entführern scheitern. Gemeinsam mit dem Ex-Marine Mark Foreman nimmt Tom Porter die Jagd nach den Entführern auf. Die beiden haben nur einen Versuch, Albright zu befreien und lebendig nach Hause zurückzukehren … TOM PORTER UND DAS MOSKAU-KOMPLOTT: Bei einer Auslandsmission explodiert das Flugzeug des amerikanischen Innenministers. Kurze Zeit später stößt Tom Porter auf ein Armband, das er schon am Tag des Absturzes gesehen hat – doch diesmal liegt es neben der Leiche eines Unbekannten. Hat der Täter einen Fehler gemacht? Porter nimmt die Fährte auf – und kommt so einem Komplott auf die Spur, dass weit über die Landesgrenzen hinausgeht … Die ersten drei packenden Fälle des Investigativjournalisten Tom Porter – actiongeladene Thriller-Spannung von Bestsellerautor Ole Hansen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
TOM PORTER UND DIE KANADISCHE INTRIGE: Eigentlich freut sich Journalist Tom Porter auf zwei Wochen Erholung in Vancouver, doch schon kurz nach seiner Ankunft stößt er auf rätselhafte Todesfälle von Umweltschützern und Indigenen. Seine Spur führt ihn schließlich bis zu dem skrupellosen Holzkonzern »Canadian Timber Company«. Porter weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, bis weitere Leben der Profitgier zum Opfer fallen …
TOM PORTER UND DIE ENTFÜHRUNG IM LIBANON: In Kairo wird Dennis Albright, Chef eines amerikanischen Technologiekonzerns, von einer Terrorgruppe gefangen genommen und in den Libanon verschleppt. Jegliche Verhandlungsversuche mit den Entführern scheitern. Gemeinsam mit dem Ex-Marine Mark Foreman nimmt Tom Porter die Jagd nach den Entführern auf. Die beiden haben nur einen Versuch, Albright zu befreien und lebendig nach Hause zurückzukehren …
TOM PORTER UND DAS MOSKAU-KOMPLOTT: Bei einer Auslandsmission explodiert das Flugzeug des amerikanischen Innenministers. Kurze Zeit später stößt Tom Porter auf ein Armband, das er schon am Tag des Absturzes gesehen hat – doch diesmal liegt es neben der Leiche eines Unbekannten. Hat der Täter einen Fehler gemacht? Porter nimmt die Fährte auf – und kommt so einem Komplott auf die Spur, dass weit über die Landesgrenzen hinausgeht …
Sammelband-Originalausgabe Dezember 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
»Tom Porter und die kanadische Intrige« erschien bereits 1992 unter dem Titel »Umweltkiller« bei der Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Rastatt. Copyright © der Originalausgabe 1992 by Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Rastatt. Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
»Tom Porter und die Entführung im Libanon« erschien bereits 1989 unter dem Titel »Unternehmen Blitzschlag« bei Moewig, Raststatt. Copyright © der Originalausgabe 1989 by Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Raststatt. Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
»Tom Porter und das Moskau-Komplott« erschien 1989 unter dem Titel »Das Moskau-Komplott« bei Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig, Raststatt. Copyright © der Originalausgabe 1989 by Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Raststatt. Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Alexa Kim
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (cdr)
ISBN 978-3-69076-858-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ole Hansen
Der Journalist
Drei Thriller in einem eBook: »Tom Porter und die kanadische Intrige«, »Tom Porter und die Entführung im Libanon« & »Tom Porter und das Moskau-Komplott«
Tom Porter und die kanadische Intrige
Thriller
Er bringt die größten Intrigen der Welt ans Licht – und die skrupellosesten Verbrecher hinter Gitter … Als der Journalist Tom Porter in Vancouver ankommt, freut er sich eigentlich auf zwei Wochen Erholung – doch schon kurz nach seiner Ankunft stößt er auf mehrere rätselhafte Todesfälle von Umweltschützern und Indigenen. Seine Spur führt ihn schließlich bis zu dem skrupellosen Holzkonzern »Canadian Timber Company«, der seit einiger Zeit immer weiter in die kanadischen Wälder vordringt, ohne Rücksicht auf Mensch und Natur. Aber würden sie auch über Leichen gehen, um ihrer Ziele durchzusetzen? Porter weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, bis weitere Leben der Profitgier zum Opfer fallen …
Kapitel 1
»Verdammte Scheiße«, fluchte Tumbler Hakwitt und massierte sein schmerzendes Brustbein. Ein plötzlicher Ruck hatte ihn aufs Lenkrad geschleudert. Behutsam tastete er seinen Brustkorb ab. Außer einer schmerzhaften Prellung schien alles in Ordnung zu sein. Zum Glück hatte er kaum mehr als Schritttempo fahren können, denn die ohnehin schlechte Schotterstraße von Tachie nach Fort St. James war nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage mit Geröll und Schlamm überspült. Deshalb hatte er die Querrinne in der Fahrbahn nicht gesehen und war mit dem linken Vorderrad hineingesackt.
Hakwitt setzte sich wieder zurecht und gab vorsichtig Gas. Dreck spritzte nach allen Seiten, doch der alte Armee-Jeep rührte sich nicht. Hakwitt legte den Rückwärtsgang ein und versuchte es in die andere Richtung – ohne Erfolg. Das linke Vorderrad saß so fest, dass selbst der Vierradantrieb des Geländewagens nicht half.
Hakwitt stieß erneut einen Fluch aus und kletterte aus dem Jeep. Sofort sackte er mit dem linken Fuß so weit in den weichen Lehm, dass ihm die dunkle Brühe in den Stiefel lief. Unbeherrscht trat er gegen den Wagen. Doch seine eigentliche Wut richtete sich gegen seine Frau. Hätte er sich nur nicht von ihr beschwatzen lassen. Aber sie hatte ihm so lange mit ihren Vorhaltungen in den Ohren gelegen, bis er losgefahren war. Er durfte gar nicht daran denken, dass er jetzt gemütlich zu Hause sitzen und einen guten Schluck Whisky genießen könnte. Stattdessen steckte er hier im Schlamm fest, nur weil er diesen verdammten Whisky zurückbringen sollte. Kein Wunder, dass die Geister so viel Dummheit bestraften.
Vor drei Tagen hatte er noch geglaubt, das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben. In Vanderhoof, der Distrikthauptstadt unten im Süden am Yellowhead Highway, hatte er Logger Joe vor dem Alkoholladen getroffen. Ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit hatte ihm der Holzfäller jovial auf die Schulter geklopft und ihn zu einem Drink eingeladen. Zusammen waren sie zu Sunny’s Bar gefahren. Nachdem sie etliche Schnäpse gehoben hatten, war Logger Joe darauf zu sprechen gekommen, dass seine Firma irgendwann in ferner Zukunft in den Wäldern nördlich des Stuart Lake Holz schlagen wollte. Nach weiteren Schnäpsen hatte er angedeutet, dass er zwei Kartons Whisky springen lassen würde, wenn ihm jemand versichern würde, dass es in der Gegend keine indianischen Kultstätten gab. Trotz seines umnebelten Gehirns erkannte Hakwitt die Chance, billig an den begehrten Schnaps heranzukommen. Ohne zu überlegen, gab er Logger Joe die gewünschte Bestätigung. Doch der hatte ihm, dem Häuptling der Yokatchie, nicht glauben wollen. Zwei Schnäpse lang hatten sie sich gestritten, dann hatte Logger Joe gesagt, er wette um einen weiteren Karton Whisky, dass Hakwitt ihm diese Bestätigung nicht schriftlich geben würde. Hakwitts Verstand hatte längst aufgehört, klar zu denken, doch er war noch in der Lage gewesen, den Text, den Logger Joe ihm diktierte, auf einen Zettel zu kritzeln und zu unterschreiben.
Betrunken wie er war, hatte er sich in seinen alten Armee-Jeep gesetzt und war Logger Joe nach Fort St. James gefolgt. Hier hatte er die drei Kartons Whisky bekommen.
In Yokatchie hatte er den Wagen hinter seinem Haus geparkt und gewartet, bis es stockdunkel geworden war. Erst dann hatte er sich getraut, die Kartons aus dem Jeep zu holen. Voller Stolz hatte er sie seiner Frau gezeigt und ihr mit schillernden Worten berichtet, wie er Logger Joe übers Ohr gehauen hatte.
Zu seiner Verblüffung hatte Mary völlig anders reagiert, als er erwartet hatte. Anstatt sich über den Handel zu freuen, hatte sie ihm heftige Vorhaltungen gemacht. Als Vorstand des Dorfes, hatte sie gezetert, hätte er so etwas nie tun dürfen. Wenn die Leute im Dorf davon erführen, wäre er die längste Zeit Häuptling gewesen. Zum Teufel würden sie ihn jagen. Und diese Schande könnte sie nicht ertragen. Scheiden lassen würde sie sich. In diesem Stil ging es den ganzen Abend weiter. Zuerst hatte er nur gelacht und sich damit verteidigt, dass es ja nur ein Stück Papier sei und dass Logger Joe damit sowieso nichts anfangen könne. Außerdem wäre das Holzfällen erst in ferner Zukunft geplant, und wer weiß, was bis dahin noch alles passieren würde. Aber Mary hatte das nicht gelten lassen.
Drei Tage hatte er ihrem Gezeter standgehalten, dann hatte er voller Wut den Whisky wieder aufgeladen und war losgefahren. Und die Strafe hatte nicht lange auf sich warten lassen.
Hakwitt sah sich die Bescherung an. Das linke Vorderrad war bis zur Achse in einer mit Schlamm gefüllten Rinne eingeklemmt. Nicht einen Millimeter ließ es sich durch Rütteln bewegen. Er krempelte die Ärmel hoch und griff in den Morast. Der Reifen hing gut zehn Zentimeter über dem festen Boden. Er zog seine Hand wieder heraus und wischte sie notdürftig ab. Dann ging er in den Wald, um Holz zu sammeln. Mit einem Arm voller Äste kam er zurück und presste so viele davon unters Rad, bis der Reifen fest aufsaß. Da er außer einem Wagenheber kein Werkzeug dabei hatte, begann er, mit seinem Messer die Erde vor dem Reifen wegzubrechen. Es war eine mühselige Arbeit, und schon nach kurzer Zeit war er über und über mit Lehm bespritzt.
Nach einer halben Stunde hatte er es geschafft. Das Rad war frei und lag jetzt auf den Ästen, und nach vorne hatte es genügend Luft. Hakwitt kletterte in den Jeep und ließ ihn an. Vorsichtig gab er Gas, der Wagen ruckte, sackte etwas tiefer, aber er bewegte sich und kam aus der Rinne frei. Hakwitt fuhr weiter, bis auch die Hinterräder die gefährliche Stelle passiert hatten, und hielt dann an. Der Jeep hing links vorne verdächtig nach unten. Fluchend kletterte er aus dem Wagen und betrachtete die Ursache. Der Reifen war platt.
Zum Glück hatte er einen Reservereifen dabei. Der sah zwar wenig vertrauenerweckend aus, denn an mehreren Stellen schimmerte bereits das Gewebe unter dem Gummi hervor, doch für Hakwitt war das kein Grund, beunruhigt zu sein. Er schraubte ihn vom Heck des Jeeps ab und wechselte ihn gegen den platten Reifen aus.
Doch heute war nicht sein Tag. Noch nicht einmal sechs Kilometer war er gefahren, als es einen Knall gab: Der gerade erst aufgezogene Reifen war geplatzt. Hakwitt schäumte vor Wut. Er verfluchte seine Frau und sich selbst, weil er auf das verdammte Weib gehört hatte.
Aber sein Zorn verrauchte genauso schnell, wie er gekommen war, und Hakwitt überlegte, was am sinnvollsten war. Hilfe zu holen war unsinnig. Die nächste Menschenseele würde er erst in Fort St. James treffen, und das lag noch zwanzig Kilometer weiter im Süden. Und hier an der Straße auf einen vorbeikommenden Wagen zu warten, war reine Zeitverschwendung. Ihm blieb also nichts anderes übrig, als zu Fuß nach Fort St. James zu marschieren.
Er versteckte die drei Kartons Whisky im Wald und verwischte die Spuren. Dann hängte er sich die Decke, die über dem Whisky gelegen hatte, um die Schultern und brach auf.
Sein persönlicher Schutzgeist schien zu der Auffassung gekommen zu sein, dass er für heute genug gestraft worden war, denn von Norden her rollte ein Auto heran. Zu Hakwitts Freude war es Jim Owl, ein junger Bursche aus seinem Dorf.
»Hallo, Tumbler«, rief Jim, während er neben ihm anhielt, »ich habe deinen Jeep gesehen. Was ist passiert?«
Hakwitt kletterte in das Führerhaus des alten Pick-up. »Scheiß Straße! Gleich zwei platte Reifen. Du musst mir helfen.«
»Klar. Ich hab mir schon gedacht, dass ich dich hier irgendwo treffen wurde. Die Spuren waren noch frisch. Ich hab einen der kaputten Reifen gleich mitgebracht.«
»Wunderbar, Jim, das hast du gut gemacht.« Hakwitt bemühte sich, seiner Stimme einen erfreuten Klang zu geben. Natürlich war er froh, dass Jim gekommen war. Aber er hatte Angst, er könnte seine Spuren im Wald entdeckt und das Whisky-Versteck gefunden haben. Wie beiläufig warf er einen Blick durch das Rückfenster. Erleichtert atmete er auf. Auf der Ladefläche lag nur der defekte Reifen.
Die Schotterstraße war so schlecht, dass sie fast eine Stunde benötigten, um Fort St. James zu erreichen. Bei der ersten Tankstelle hielt Jim an. Sie hatten Glück. Der Tankwart hatte gerade nichts zu tun und war bereit, den Reifen zu flicken. Da nur das Ventil beim Einbrechen in die Rinne beschädigt worden war, konnte er den Schaden schnell beheben. Schon eine halbe Stunde später waren sie wieder auf dem Weg zum Jeep.
Hakwitts Fahrzeug stand noch so da, wie er es verlassen hatte. Mit Jims Hilfe war der Reifen im Nu gewechselt, und sie konnten aufbrechen. Jim fuhr voraus, Hakwitt, der den jungen Indianer nicht misstrauisch machen wollte, folgte ihm. Den Whisky ließ er, wenn auch schweren Herzens, in seinem Versteck.
In Fort St. James trennten sie sich. Jim wollte auf dem Parkplatz des originalgetreu aufgebauten Forts der Hudson Bay Company ein paar geangelte Lachse an Touristen verkaufen. Das war zwar verboten und wurde empfindlich bestraft, doch das störte ihn wenig. Sollten sie ihm ruhig eine Geldstrafe aufbrummen, bei ihm war nichts zu holen. Er hatte kein Geld. Das Einzige, was ihm passieren konnte, war, dass man ihn ins Gefängnis stecken würde. Und die paar Tage würde er auf einer Backe absitzen. Für die Touristen, die ihm die Fische abgekauft oder gegen ein paar Dosen Bier eingetauscht hatten, sah es viel unangenehmer aus. Sie mussten mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Jim hielt das Gesetz für eine reine Schikane, die gezielt gegen die Indianer gerichtet war. Durch das Gesetz, vor allem aber durch die drastischen Strafen, wurden viele Touristen davon abgehalten, bei den Indianern Fisch oder Fleisch zu kaufen. Jim übersah allerdings, dass die Regierung den Indianern das unbeschränkte Fischerei- und Jagdrecht nur unter der Bedingung eingeräumt hatte, dass die Fänge ausschließlich für den privaten Verbrauch genutzt wurden.
Während Jim für seine Lachse Käufer zu finden versuchte, fuhr Hakwitt weiter nach Vanderhoof. Da er wegen der Panne viel Zeit verloren hatte, traf er dort erst kurz nach fünf Uhr abends ein.
Er stellte seinen Jeep auf einen freien Parkplatz an der Hauptstraße und ging zu Fuß zum Büro der American/Canadian Timber Company, ACT, zurück. Durch die Fensterscheibe sah er, dass das Büro noch besetzt war. Erleichtert trat er ein. Ein muskulöser Mann, dessen Gesicht man ansah, dass er gewöhnlich im Freien arbeitete, saß hinter einem Schreibtisch. Seinen linken Arm trug er in einer Armbinde.
»’n Abend«, begrüßte er den vor Dreck starrenden Hakwitt. Sein prüfender Blick nahm am Äußeren des Indianers keinen Anstoß, er schien sich nur für seine Konstitution zu interessieren. Mit dem Ergebnis zufrieden, fuhr er in seiner schleppenden Sprechweise fort: »Willst ’nen Job? Wir zahlen fünfzehn Bucks pro Stunde.«
»Kein Interesse. Ich suche Logger Joe – privat.«
Der Mann schob sein Kaugummi von einer Seite auf die andere, während er Hakwitt jetzt abfällig musterte. »Logger Joe ist nicht hier.«
Hakwitt spürte, wie Zorn in ihm hochstieg, doch er unterdrückte eine gereizte Antwort und sagte so ruhig wie möglich: »Bitte, Sir, wo kann ich ihn finden? Es ist wichtig.«
Der Holzfäller überlegte, ob er dem Indianer die gewünschte Auskunft geben sollte, sagte dann jedoch: »In Sunny’s Bar.«
»Danke.« Hakwitt drehte sich um und verließ das Büro.
Sunny’s Bar war eine typische Country-Kneipe. In einem handtuchförmigen Raum befand sich auf der einen Seite ein langer Tresen mit Barhockern, und auf der anderen Seite, getrennt durch einen Gang, standen mehrere Tische in einer Reihe. Im rückwärtigen Teil gab es die üblichen Poolbillards.
Als Hakwitt eintrat, war die Bar mäßig besetzt, drei Männer, darunter Logger Joe, standen am Tresen, und zwei weitere Gäste spielten im Hintergrund Billard. Bei den drei Männern an der Bar schien Logger Joe das Wort zu führen. Sein sonorer Bass übertönte alle anderen. Er war ein wahrer Kleiderschrank. Einen Meter neunzig groß, breite Brust, einen Nacken, den man mit zwei Händen nicht umspannen konnte, und Oberarme, so stark wie bei einem normalen Mann die Oberschenkel. Sein Kopf passte ganz zu dem muskulösen Körper. Wenn er sich zu voller Größe aufrichtete, wirkte er wie ein Baumstamm, den man in zwei Metern Höhe gekappt hatte. Das war wohl auch der Grund gewesen, warum man ihm den Spitznamen Logger, Baumstamm, gegeben hatte.
Einer der Männer am Tresen hatte sich bei Hakwitts Eintritt umgedreht. Mit einem spöttischen Blick auf seine Kleidung rief er: »Du brauchst doch nicht zu baden, wenn du ’ne Kneipe besuchen willst.«
Seine Kumpel stimmten in sein Lachen ein.
»Ja, wen haben wir denn da?« Logger Joes Bass dröhnte durch die ganze Bar. »Ist das nicht mein Freund, der Chief von Yokatchie? Was hat man denn mit dir gemacht? Veranstaltet ihr jetzt Schlammschlachten, oder bist du über einen Abfallhaufen in eurem Dorf gestolpert?«
Die Männer grölten vor Vergnügen.
Hakwitts Kopf wurde rot. Nicht vor Scham, sondern vor Wut. Er ballte die Hände zu Fäusten. Einen Augenblick sah es so aus, als wolle er sich auf die Männer stürzen, doch dann öffneten sich seine Fäuste wieder. Er war weiß Gott kein Feigling, aber die mächtige Gestalt und der gemeine Zug um Logger Joes Mund flößten ihm Respekt ein. Außerdem zeigten die geröteten Gesichter der Männer, dass sie schon eine Menge Alkohol getrunken hatten. In diesem Zustand war es besser, sie nicht zu provozieren. Deshalb sagte er ruhig: »Ich muss mit dir sprechen, Joe. Es ist wichtig.«
»So, so, du musst mit mir sprechen.« Logger Joe sah seine Kameraden grinsend an. »Ja, wenn eine so hohe Persönlichkeit wie der Chief von Yokatchie das fordert, dann muss ich wohl gehorchen.« Er machte eine unterwürfige Verbeugung. Seine Kumpel schlugen sich vor Lachen auf die Schultern.
»Schieß los, Chief, weswegen musst du mich sprechen?«
»Das ist privat. Könnte ich dich allein sprechen?«
»Nun hört euch das an. Er muss mit mir allein sprechen. Wohl eine Privataudienz. Vielleicht ein Staatsgeheimnis? Aber wenn ein Chief das möchte, dann ist das wohl ein Befehl.«
Die Männer begleiteten jedes seiner Worte mit Gelächter.
»Lass ihn hier …«
»Wir wollen hören, was er …«
»Kann ich nicht machen«, schnitt Logger Joe ihre Worte ab. »Wir müssen den Wunsch eines Chiefs respektieren.« Logger Joe machte einen Schritt auf den Häuptling zu und legte ihm kameradschaftlich den Arm um die Schultern. »Komm, Chief, die beiden sind nicht reif genug für Staatsgeheimnisse.« Er führte Hakwitt zu einem der Tische an der Wand und ließ sich auf den Stuhl fallen. »So, spuck’s aus. Was willst du?«
»Ich will den Zettel zurückhaben.«
»Du willst was?« Aus Logger Joes Stimme war jede Spur von Freundlichkeit verschwunden.
»Ich brauche den Zettel.«
»Warum?«
»Ich hätte es nicht tun dürfen. Bitte gib ihn mir zurück.«
»Spinnst du?«
»Nein, es ist mein völliger Ernst.«
Logger Joes Augen funkelten böse, als er sagte: »Nun hör mir mal gut zu, Chief. Du kannst doch nicht meinen Whisky saufen und hinterher sagen: April, April, das Geschäft gilt nicht.«
»Ich geb dir den Whisky zurück.«
»Was?«
»Ich geb den Whisky zurück.«
»Du hast wohl ’n Arsch offen. Geschäft ist Geschäft.« In Logger Joes Stimme schwang ein gefährlicher Unterton mit.
Hakwitt wurde unruhig. Er kannte den Jähzorn dieses Riesen. Trotzdem sagte er: »Was nützt er dir überhaupt? Was willst du damit anfangen?«
»Das geht dich einen Scheißdreck an. Ich hab den Zettel, du hast den Whisky, und dabei bleibt’s. Verstanden?« Logger Joe erhob sich.
»Wenn ich ihn nicht zurückbekomme, werde ich überall erzählen, dass du mich gezwungen hast, ihn zu schreiben.«
Logger Joes Faust fuhr vor, packte Hakwitts Jacke und zog ihn wie ein Spielzeug über den Tisch. »Du Scheißkerl, was willst du? Sag das noch mal!« Logger Joe hatte die andere Hand gehoben, und es sah aus, als wollte er sie dem Indianer ins Gesicht schmettern. Doch plötzlich hielt er mitten in der Bewegung inne. Ein verschlagener Zug lag in seinen Augen, als er Hakwitt zurück auf seinen Stuhl stieß und sagte: »Ich kann dir den Zettel nicht geben. Ich hab ihn nicht hier.«
Hakwitt schob schnell seinen Stuhl zurück, um aus Logger Joes Reichweite zu kommen.
»Vielleicht könntest du ihn holen. Nicht heute, vielleicht morgen«, fügte er schnell hinzu.
Logger Joes Stimme wurde freundlicher. »Ich hab ihn in meinem Trailer in Fort St. James.«
»Das passt gut«, beeilte sich Hakwitt zu versichern, »ich hab den Whisky dort in der Nähe versteckt. Könnten wir nicht heute Abend noch hinfahren und die Sache erledigen?«
Logger Joes Stimmung hatte sich völlig verändert. Jovial sagte er: »Also, wenn dir so an dem Fetzen gelegen ist, dann will ich mal nicht so sein. War ja sowieso ein Jux. Wenn du willst, treffen wir uns heute Abend.« Joe sah auf die Uhr über der Theke. »Sagen wir, neun Uhr bei meinem Trailer in Fort St. James. Wo er steht, weißt du, oder?«
»Ja.« Hakwitt stand auf. Man sah ihm an, wie erleichtert er war, als er die Bar verließ.
Auch Logger Joe erhob sich und ging zu seinen Saufkumpanen zurück.
»Na, Joe, was wollte der Kerl?«, empfing ihn einer der beiden.
»Nichts Besonderes, war was Persönliches.«
»Noch ’n Bier?« Logger Joe stand einige Augenblicke wie geistesabwesend am Tresen. Es schien, als hätte er die Frage nicht gehört. Doch dann sagte er: »Nein, sauft ohne mich weiter. Ich muss noch was erledigen.« Er zog ein Bündel Dollarnoten aus der Hosentasche, warf einige davon auf den Tresen und stampfte aus dem Raum. Die Männer starrten ihm nach. Ihre erstaunten Blicke trafen sich, sie schüttelten verständnislos die Köpfe und bestellten eine neue Runde.
Logger Joe ging über die Straße und stieg in seinen Geländewagen. Auf dem Weg nach Fort St. James hielt er bei einem Supermarkt, um etwas in der Pharmazie-Abteilung einzukaufen.
Hakwitt befand sich in bester Stimmung. Zwar störte es ihn erheblich, dass er den schönen Whisky zurückgeben sollte, doch vielleicht hatte seine Frau recht, und es war wirklich eine Dummheit gewesen, Logger Joe so ein Papier zu geben. Schließlich lagen nicht nur die sakralen Stätten von Yokatchie in diesem Bereich, sondern auch die der anderen Indianerdörfer entlang des Tachie River und des Trembleur Lake. Doch jetzt war dieses Problem überstanden. Alles war besser verlaufen, als er gehofft hatte. Und über die beiden Flaschen, die in einem der Kartons fehlten, würde er schon mit Logger Joe einig werden.
Die Abenddämmerung begann heraufzuziehen, als Hakwitt die Stelle erreichte, an der er den Whisky versteckt hatte. Mit bangem Herzen zwängte er sich durchs Unterholz zu der Felsspalte und riss mit hastigen Bewegungen die Zweige, die den Eingang verdeckten, fort. Die Kartons lagen noch so da, wie er sie abgestellt hatte. Erleichtert trug er einen nach dem anderen zu seinem Jeep, legte sie auf den Rücksitz und tarnte sie sorgfältig mit einer Decke. Dann brach er wieder auf.
Als er in Fort St. James ankam, war es bereits dunkel geworden. Er bog zum See ab und fuhr wenig später auf den Campingplatz. Logger Joes Trailer stand als letzter in der ersten Reihe am See. Er schien zu Hause zu sein. Sein Geländewagen stand neben dem Wohnwagen, und im Inneren brannte Licht. Jetzt verschwanden bei Hakwitt auch die letzten Zweifel, dass Logger Joe es nicht ehrlich gemeint haben könnte.
Er parkte seinen Jeep neben dem Geländewagen, stieg aus und klopfte.
»Komm rein«, hörte er Logger Joes Bass von drinnen.
Hakwitt öffnete die Tür und trat ein. Der Wohnraum war nur schwach beleuchtet. Joe saß im Halbdunkel und trank Whisky. Eine angebrochene Flasche Canadian Club stand auf dem Tisch.
»Setz dich und trink einen mit.« Logger Joe griff nach einem Glas, schenkte es halbvoll ein und reichte es Hakwitt. »Cheers, alter Knabe.«
»Ich hole nur schnell die Kartons.«
»Lass nur, das können wir nachher machen. Jetzt saufen wir erst einen.« Er hob sein Glas und prostete Hakwitt zu.
Hakwitt ließ sich nicht lange nötigen und nahm einen langen Schluck.
»Setz dich«, forderte Joe ihn auf, und Hakwitt ließ sich auf der Couch nieder. »Du könntest mir einen Gefallen tun, Chief«, sagte Logger Joe, während er sich vorbeugte und Hakwitts Glas großzügig nachfüllte.
»Gerne, wenn ich kann.«
»Ich brauch noch Holzfäller und Hilfskräfte. Du könntest dich in deinem Dorf umhören, ob sich nicht einige von deinen Jungs ein paar Dollar verdienen wollen. Wir zahlen gut.«
»Mach ich. Wie viele brauchst du?«
»Soviel du auftreiben kannst.«
Hakwitt trank sein Glas leer und erhob sich. »Okay, ich werde mich umhören. Jetzt muss ich aber gehen, ist verdammt spät geworden. Kannst du mir den Zettel geben?«
»Trink noch einen.« Logger Joe füllte nach.
»Ich muss wirklich los.«
»Schade.« Joe griff in die Brusttasche seiner Jeansjacke und zog einen zusammengefalteten Zettel heraus. »Hier, und jetzt lass uns die Gläser austrinken.«
Hakwitt faltete das Papier auseinander. Seine Augen leuchteten befriedigt auf. Es war der Zettel, den er in Sunny’s Bar geschrieben hatte. »Vielen Dank, Joe. Tut mir leid, dass ich dir Ärger gemacht habe.«
»Schon vergessen – Prost.«
Hakwitt nahm sein Glas und kippte es in einem Zug hinunter. Jetzt, wo er den Zettel hatte, wollte er so schnell wie möglich verschwinden. Bei Logger Joe konnte man nie wissen, ob er es sich nicht anders überlegte.
Er drehte sich um und ging zur Tür.
»Warte, ich komm mit.«
Obwohl Hakwitt für seine Verhältnisse wenig getrunken hatte, waren seine Beine seltsam schwer.
Logger Joe, der merkte, wie er torkelte, grinste und sagte noch dröhnender als gewöhnlich: »Kannst wohl nichts mehr ab, Chief, was?«
Hakwitt antwortete nicht. Er versuchte, die Decke von den Kartons zu ziehen.
»Lass nur, ich mach das schon.« Joe schob den sich am Jeep festhaltenden Hakwitt zur Seite und hob die Whisky-Kartons mit einer Leichtigkeit vom Rücksitz, als wenn sie leer wären.
Hakwitt versuchte inzwischen, auf den Fahrersitz zu klettern. Nach drei vergeblichen Versuchen gelang es ihm endlich.
»Fahr vorsichtig, oder willst du hierbleiben? Kannst bei mir schlafen.« Logger Joes Stimme dröhnte, als wollte er den ganzen Platz unterhalten.
»Dan-ke, ge-ht sch-schon«, lallte Hakwitt und startete den Motor. Mit durchdrehenden Rädern schoss er auf die Straße.
Logger Joe sah ihm grinsend nach, wie er in Schlangenlinien versuchte, die Straße zum Ausgang hinunterzufahren. Er trug die Whisky-Kartons in seinen Trailer und eilte dann zum See. Wenig später heulte ein Bootsmotor auf, und Logger Joe raste nach Norden.
Hakwitt hielt das Lenkrad mit beiden Fäusten eng umklammert. Den Oberkörper nach vorne gebeugt, stierte er auf die Schotterpiste vor sich. Die Lichtkegel seiner Scheinwerfer fraßen sich in die Nacht. Noch war der Mond nicht aufgegangen, um zusätzliches Licht zu spenden.
Er kämpfte gegen die Müdigkeit, die ihn zu überfallen drohte. Die Augen unnatürlich weit aufgerissen, starrte er in das schwarze Loch vor sich. Mit eckigen Bewegungen versuchte er, Hindernissen in letzter Sekunde auszuweichen. Die Koordinierung von Kupplung, Schaltung und Gas wurde immer schwieriger, zeitweise fuhr er mit dreißig Stundenkilometern im ersten Gang. Der Motor heulte so, dass man Angst haben musste, er würde jeden Augenblick auseinanderbrechen. Hakwitt hörte es nicht. Er fuhr stur weiter, und das Erstaunliche war, er kam Kilometer um Kilometer voran. Dass er dafür die gesamte Fahrbahn benötigte, störte niemanden. Er war der einzige Autofahrer, der um diese Zeit die Straße benutzte.
Die Fahrbahn wurde enger und kurvenreicher. Der Wald trat zurück, und Felsen ragten an einer Seite auf. Auf der anderen Seite fiel das Gelände steil ab. Plötzlich griffen die Lichtkegel ins Leere. Die Straße war verschwunden. Hakwitt starrte entsetzt nach vorne. Dann dämmerte es ihm – eine Kurve. Er riss das Lenkrad nach rechts und fuhr fast rechtwinklig um die Felsnase. Kaum hatte er die Kurve passiert, als es vor ihm donnerte und prasselte. Doch er hörte es nicht und nahm den Steinschlag erst wahr, als die ersten Brocken auf die Fahrbahn schlugen. Hakwitt riss am Steuer und trat auf die Bremse. Er erwischte das Gaspedal. Der Motor heulte auf, und plötzlich lösten sich seine Hände vom Lenkrad. Er fühlte sich frei, glaubte zu fliegen.
Der Jeep war über den Steilhang gerast, und Hakwitt wurde herausgeschleudert. Mit dem Kopf nach unten schlug er zwanzig Meter tiefer zwischen den Felsbrocken auf.
Kapitel 2
Der Strom der Passagiere, die mit der American Airlines aus Washington, D.C., nach Vancouver gekommen waren, bildete schnell eine Schlange vor der Zoll- und Passabfertigung. Doch die kanadischen Beamten arbeiteten zügig, so dass der mittelgroße, untersetzte Herr, der als einer der letzten ausgestiegen war, die Einreiseformalitäten nach zehn Minuten überstanden hatte. Die Reisetasche über die rechte Schulter gehängt, blieb er einige Meter neben der Passkontrolle stehen und sah sich suchend um.
Der Mann mochte etwa Mitte bis Ende vierzig sein, hatte eine hohe Stirn und ausgesprochen intelligente Gesichtszüge. Am auffälligsten waren jedoch seine kleinen, verschmitzt blickenden Augen. Sie erweckten den Eindruck, dass er ein Mensch war, der sich nur durch wenige Dinge seine gute Laune verderben ließ.
Nachdem er einige Zeit offensichtlich vergeblich gewartet hatte, schlenderte er in Richtung Flughafenhalle davon. Hier studierte er die Reklameschilder der verschiedenen Fluggesellschaften. Er hatte gerade den Schalter der Canada Air entdeckt, als ihn eine Lautsprecherdurchsage aufhorchen ließ.
»Mister Tom Porter, Passagier der American Airlines, Flug 675 von Washington, D.C., nach Vancouver, bitte beim Informationsschalter der Canada Air in der Eingangshalle melden. Mister Tom Porter, bitte melden Sie sich beim Informationsschalter der Canada Air in der Eingangshalle.«
Der untersetzte Herr blickte sich ein wenig verwundert um. Als er nicht sofort fand, was er suchte, ging er zum Ticket Counter der Canada Air.
»Wo habt ihr euren Info-Schalter versteckt?«, fragte er eine der Hostessen, die gerade keinen Kunden bediente.
»Letzter Schalter links, Sir.«
»Besten Dank.« Der Herr führte, wie bei einem militärischen Gruß, die rechte Hand an die Stirn und ging zu dem angegebenen Schalter.
Noch bevor er etwas sagen konnte, wurde er von einer professionell lächelnden Dame in der Uniform der Airline angesprochen: »Willkommen bei der Canada Air, können wir Ihnen helfen?«
»Das, meine Dame, vermag ich noch nicht zu sagen«, antwortete er mit einem Lächeln. »Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen melden. Mein Name ist Tom Porter. Sie haben mich ausrufen lassen.«
»Tom Porter aus Washington?«
»So ist es.«
»Wir haben eine Nachricht für Sie, Mr. Porter.« Die Hostess blätterte einen Ordner mit Notizen durch und zog einen Zettel hervor. »Ein Mr. Frank Barns hat angerufen. Er bittet uns, Ihnen mitzuteilen, dass er Sie nicht abholen kann.« Die Angestellte reichte ihm einen Zettel.
»Sonst noch was?«
»Nein, Sir, das war alles.«
»Vielen Dank.« Wieder deutete der Mann mit der rechten Hand einen Gruß an. Er ging ein paar Schritte zur Seite und überflog die Nachricht.
Bitte informieren Sie Tom Porter, AA Flug 675, von Washington, D.C., Ankunft 12.6., 11.20 Uhr, dass er nicht abgeholt werden kann. Frank Barns hatte einen Unfall. Er liegt im St.-John-Hospital in Vanderhoof.
»Mist, verdammter«, knurrte Tom Porter.
»Gilt das mir?«
Tom fuhr herum und starrte überrascht in die Augen einer jungen Frau.
»Auf dieses Gesicht, mein lieber Tom, habe ich lange gewartet. Hast du nicht einmal gesagt, den Meisterjournalisten könne nichts aus der Fassung bringen?«
»Das soll ich gesagt haben? Unmöglich! Du siehst mich völlig sprachlos.« Er zog Viola Martínez in seine Arme und küsste sie freundschaftlich auf beide Wangen. »Mein Gott, Mädchen, wie lange ist es her, dass wir uns gesehen haben?«
»Zwei Jahre.« Viola befreite sich sanft aus seinen Armen. »Hast du das etwa vergessen? Ich nicht! Wie ein Dieb hast du dich damals aus dem Staub gemacht. Wenn ich dir nicht so verdammt dankbar gewesen wäre, hätte ich dich ermorden können. Du hast ja keine Ahnung, was für Sorgen ich mir um dich gemacht hatte.«
Tom lächelte schuldbewusst. Er erinnerte sich noch glasklar an Viola und seine plötzliche Flucht. Er war damals in Mexiko gewesen und hatte eine Rauschgiftsache recherchiert. Dabei war er Viola begegnet. Sie war Stewardess bei der Mexican Airlines gewesen und war ohne ihr Wissen von einer Rauschgiftorganisation als Kurier benutzt worden. Irgendjemand, wahrscheinlich ein abgewiesener Liebhaber, hatte sie verraten, und die Polizei hatte sie mit zwei Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt. Sie wäre unweigerlich im Gefängnis gelandet, wenn er ihr nicht aus dem Schlamassel geholfen hätte. Dank seiner Ermittlungen mussten zwei Drogenbosse hinter Gitter. Die Rauschgiftmafia hatte sich dafür gerächt. Nur durch großes Glück war er bei einem Anschlag mit dem Leben davongekommen, hatte aber etliche Wochen in einem Krankenhaus in Mexiko City verbringen müssen. Viola hatte ihn dort gepflegt und sich darum gekümmert, dass er die beste ärztliche Versorgung bekam. Sie waren Freunde geworden, aus Violas Sicht durchaus mehr. Auch ihm erging es nicht anders. Eines Abends, kurz nachdem sie gegangen war, war ihm bewusst geworden, wie sehr er schon von ihrer Jugend, ihrem Charme und ihren körperlichen Reizen gefangengenommen war. Ihr Verhältnis würde unweigerlich vor dem Traualtar enden, wenn er auch nur einen Tag länger bleiben würde. Da er aber sein unabhängiges Leben liebte, war er noch in der gleichen Nacht aus dem Krankenhaus geflohen.
»Heißt das, du hast mich die ganze Zeit über gesucht?« Das amüsierte Funkeln in seinen Augen stand im krassen Gegensatz zu dem Ernst, mit dem er die Frage stellte.
»Bild dir bloß keine Schwachheiten ein, Tom Porter«, antwortete Viola empört. »Ich habe nur die Lautsprecherdurchsage gehört und bin hierhergekommen, um zu sehen, ob man wohl meinen untreuen Tom gemeint haben könnte.«
Tom lächelte. »Und? Welche Gefühle durchpulsten deine Brust, als du deinen Märchenprinzen in voller Lebensgröße vor dir sahst?«
»Mordgedanken, mein Lieber, ich kann mich nur nicht entscheiden, wie ich dich umbringen soll.«
»Welch entzückender Gedanke, von so zarten Händen ins Jenseits befördert zu werden. Welcher Mann kann da schon widerstehen? Bis du dich für eine angemessene Methode entschieden hast, könntest du mir erklären, was du hier treibst und was diese hübsche Uniform zu bedeuten hat. Soweit ich mich erinnern kann, stattet die Mexican Airlines ihre Stewardessen nicht so dekorativ aus. Bist du in die Dienste eines anderen lateinamerikanischen Landes getreten? Hat man dich gar zum General befördert?« Tom ließ seinen Blick amüsiert über ihr schmuckes Kostüm mit den goldenen Tressen und Schulterklappen schweifen.
»Ich sage es dir, wenn du mich zu einem Kaffee einlädst.«
»Nichts könnte mir den Tag mehr verschönern.«
»Du bist und bleibst der größte Lügner, den ich kenne.« Viola hängte sich bei Tom ein, und gemeinsam steuerten sie auf einen Coffee Shop zu. Während die Mexikanerin den Kaffee vom Tresen holte, belegte Tom einen Platz, von dem aus sie die Halle übersehen konnten. Als Viola den dampfenden Becher vor Tom hinschob, musterte sie ihn unauffällig.
»Du siehst gut aus, Tom. Du scheinst die Verletzungen bestens überstanden zu haben. Das freut mich.«
»Längst vergessen. Mir geht es wunderbar. Muss mein Junggesellenleben sein. Keiner nörgelt an mir herum.«
Viola lächelte. »Bist du etwa deswegen so Hals über Kopf aus dem Krankenhaus verschwunden? Hattest du Angst, ich könnte mich zu einer Xanthippe entwickeln?«
»Das natürlich nicht«, wehrte Tom ab. »Mich plagten nur so schreckliche Albträume. Auf meinem Schoß sah ich zwei plärrende Kinder sitzen, und an meinem Hosenbein zerrte ein drittes. Dazu eine Frau mit aufgelösten Haaren …«
»Tom Porter, du bist ein Widerling! Du würdest es verdienen, dass dich überhaupt keine Frau mehr ansieht. Übrigens scheinst du ein paar Pfunde angesetzt zu haben.« Viola sah auf die Stelle, wo sich das Hemd über dem Bauch wölbte.
»Siehst du, wie recht meine Albträume hatten? Keine fünf Minuten sitzen wir zusammen, und schon wird meine schwächste Stelle angegriffen.«
Viola stieß mit ihrem Schuh gegen sein Schienbein. »Das ist die Strafe für deine Worte«, sagte sie streng und fuhr lächelnd fort: »Wie findest du meine Uniform? Mein Chef hat sie sich ausgedacht. Er meinte, ich sehe so repräsentativer aus.«
»Bist du nicht mehr bei der Mexican Airlines?«
»Wie du siehst, nein. Kurz nachdem du so plötzlich verschwunden warst, hat mich die Gesellschaft gefeuert. Ich glaube, die Drogenbosse steckten dahinter. Ich war stocksauer. Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, es war mein Glück. Ich habe dadurch meinen Job bei der ACT gefunden.«
»ACT? Meinst du die American Canadian Timber Company?«
»Genau die. Die suchten damals eine Stewardess für ihren Privatjet. Ich habe mich beworben und den Job bekommen. Inzwischen bin ich bei Mr. Loggart zum Mädchen für alles avanciert: Stewardess, wenn er den Firmenjet benutzt, sonst Fahrerin, Sekretärin und rechte Hand. Ein toller Job. Nie langweilig, und ich verdiene doppelt so viel wie früher. Ich hätte es gar nicht besser treffen können. Mein Chef ist ein klasse Typ.«
»Loggart?« Tom zog nachdenklich die Stirn in Falten. »Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört.«
»Kein Wunder, Humphrey Loggart ist einer der Vizepräsidenten von ACT. Er ist zuständig für Kanada. Unsere Company ist der drittgrößte Holzlieferant der Welt. In Kanada sind wir marktführend, und mein Chef leitet die mit Abstand größte Abteilung.« Der Stolz in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
»Und du bist seine rechte Hand – gratuliere. Gut, dass ich damals geflohen bin, sonst hättest du jetzt vier bis sechs Kinder und wärst zwanzig Pfund schwerer. Du solltest mir auf Knien danken.«
»Du bist unmöglich, Tom Porter – aber so unrecht hast du nicht. Ich habe es wirklich gut getroffen und habe Chancen, noch weiter zu kommen. Mein Chef hat nämlich Aussichten, im März nächsten Jahres zum Präsidenten der ACT aufzusteigen. Wenn es ihm gelingt, unseren Marktanteil in Kanada zu vergrößern, kann ihm keiner seiner Konkurrenten das Wasser reichen. Wenn er Präsident wird, will er mich mitnehmen.«
Tom sah Viola anerkennend an. »Gratuliere. Und was treibst du hier in Vancouver?«
»Ich warte auf Mr. Loggart. Er hat eine Besprechung in der Stadt. Und du? Bist du wieder einer Story auf der Spur?«
»Leider nein. Ich habe Urlaub.« Über Toms Gesicht huschte bei den Worten ein so bekümmerter Ausdruck, dass Viola lachen musste.
»Du tust ja gerade so, als wenn Urlaub eine Strafe wäre.«
Tom lächelte kläglich, als er antwortete. »Das nicht gerade, aber ich habe mich beschwatzen lassen, vierzehn Tage in der Wildnis zu verbringen. Meilenweit kein Haus, kein Wein und nichts Vernünftiges zu essen. Nur Wald, Wasser und zur Gesellschaft einen Umweltapostel und einen Haufen blutgieriger Mücken.«
»Du Ärmster«, sagte Viola mit gespieltem Bedauern. »Aber wenn du auf ein Leben in Gottes freier Natur keine Lust hast, warum fährst du dann hin?«
»Weil ich schwach war. Weil ich mich dazu habe überreden lassen.«
»Du? Ich denke, du bist immer Herr der Lage.«
»Natürlich kann man mich nicht überreden«, behauptete Tom sofort. »Als ich diesem Unternehmen zustimmte, war ich im Zustand völliger Trunkenheit, also quasi nicht zurechnungsfähig.«
»Wer war denn dieses Genie, das dich aus deiner Junggesellenhöhle in Washington herausgelockt hat? Sicher eine Frau.«
Tom verzog das Gesicht zu einer noch kläglicheren Miene. »Wenn es das wenigstens gewesen wäre, dann gäbe es ja noch einen Silberstreifen am Horizont. Aber es war leider keine Frau. Es war ein Mann. Ein angeblicher Freund! Einer von diesen fanatischen Umweltschützern, die nur ’ne Mohrrübe essen, wenn der Kuhmist noch dranhängt, damit sie ja sicher sind, dass das Ding auch aus ökologischem Anbau stammt.«
»Kannst du dich etwas allgemeinverständlicher ausdrücken?«
»Nun ja, dieser angebliche Freund ist wie ich Reporter und arbeitet für ein Umweltmagazin in Vancouver. Er hat irgendwo in the middle of nowhere eine Jagdhütte, in der er seine Urlaube zu verbringen pflegt.«
»Und wo liegt diese Hütte?«
»Weiß der Himmel. Irgendwo in der Mitte von British Columbia bei einem historischen Fort am Stuart Lake.«
»Fort St. James?«
Tom sah Viola überrascht an. »Genau. Woher kennst du denn das?«
»Erstaunt dich, was? Aber schließlich hast du nicht das ganze Wissen gepachtet. Übrigens, es ist wunderschön dort.«
»Kennst du meinen Freund?«
»Nein, wieso?«
»Du redest wie er.«
»Im Ernst, Tom, es ist wildromantisch dort oben. Im Fort St. James hast du das Gefühl, die Zeit ist stehengeblieben. In dem Fort – es hat einmal der Hudson Bay Company gehört – laufen die Menschen noch in der Kleidung herum, wie sie vor gut hundert Jahren getragen wurde. Du wirst dich dort wohl fühlen. Vielleicht ein bisschen einsam, aber sonst …«
»Wollen wir tauschen?«
»Wenn dein Freund charmanter ist als du.«
»Du verlangst Unmögliches. Aber es sieht so aus, als wenn der Kelch noch einmal an mir vorübergehen würde. Ich habe nämlich eine Nachricht erhalten, dass er im Krankenhaus in Vanderhoof liegt. Um mir diese freudige Botschaft mitzuteilen, wurde ich nämlich zum Informationsschalter gerufen.«
»Du bist unmöglich, Tom! Übrigens, wir wollen ganz in die Nähe.«
»In die Nähe?«
»Ja, nach Prince George. Sobald mein Chef eintrifft, fliegen wir.«
»Die Welt ist ein Dorf. Da steht man mutterseelenallein in einem fremden Land …«
»Ah, mein Chef kommt. Ich muss gehen.« Viola öffnete ihre Handtasche und zog eine Visitenkarte heraus. »Tom, es hat mich wirklich gefreut, dich getroffen zu haben. Wenn du einmal in Denver bist, melde dich bitte.«
»Mach ich.« Tom gab Viola die Hand. »Ich versprech’s. Mach’s gut.«
»Du auch.« Viola warf Tom eine Kusshand zu und eilte davon. Tom sah ihrer schlanken Gestalt nach, bis sie zwischen den Menschen verschwunden war. Dann ging er zum Tresen und holte sich einen zweiten Becher Kaffee. Seine Gedanken waren noch ganz von der überraschenden Begegnung gefangengenommen. Bilder von den Tagen in Mexiko tauchten auf, und im Geiste genoss er noch einmal die schönen Stunden, die er dort mit Viola verlebt hatte.
»Gut, dass ich dich noch treffe.« Tom fuhr auf. Violas Stimme hatte ihn aus seinen Erinnerungen gerissen. »Falls du nach Vanderhoof willst, könnten wir dich bis Prince George mitnehmen. Mr. Loggart lässt dir seine Einladung überbringen.«
Tom zögerte nur einen Moment, dann sagte er: »Eine gute Idee. Damit sind die Würfel gefallen.« Er sprang auf. »Also, auf in den Norden.«
Er nahm seine Reisetasche und stieg im Überschwang gleich über die Barriere, die den Coffee Shop zur Halle hin begrenzte. Zusammen gingen sie durch das Terminal. Am Ende des Gangs, von dem die Abfluggates abgingen, öffnete Viola eine Tür. Eine ganz in Grün und Weiß gestrichene Boeing 737 stand auf dem Rollfeld. Auf dem Seitenleitwerk prangte ein Redwood-Baum, und an der Seitenwand stand mit großen Buchstaben ACT. Die vordere Bordtür war offen und die Treppe ausgefahren. Im Cockpit saßen bereits die Piloten. Sie schienen darauf zu warten, starten zu können, denn sie gaben Viola durch Handzeichen zu verstehen, sich zu beeilen.
Viola nickte und beschleunigte ihre Schritte. Sobald sie an Bord waren, fuhr Viola die Treppe ein und verriegelte die Eingangstür. Dann griff sie zum Bordmikrofon. »Alles fertig, Bob.«
Tom hatte sich inzwischen interessiert umgesehen. Es war das erste Mal, dass er in einer Privatmaschine dieser Größe mitflog. Sie befanden sich in einem Vorraum, in dem an der einen Längsseite Kleiderschränke und an der gegenüberliegenden Seite eine geräumige Pantry aus hellem Holz eingebaut waren.
»Gib mir deine Tasche und Jacke, wir lassen sie hier vorne«, forderte Viola ihn auf. Nachdem sie die Sachen verstaut hatte, öffnete sie die Mitteltür. Tom trat in einen geräumigen Salon, dessen Möbel und Wände aus dem gleichen Holz wie im Vorraum bestanden. Die Stoffe der Polstermöbel und Vorhänge waren darauf abgestimmt.
Tom nickte anerkennend. »So lasse ich mir das Fliegen gefallen.«
»Schön, nicht?« Viola schien erfreut zu sein, dass Tom beeindruckt war. Sie zeigte auf die Tür, die in den rückwärtigen Teil führte. »Dort hinter der Tür befindet sich ein mit allen Schikanen ausgerüstetes Büro und ein komplett eingerichtetes Schlafzimmer mit eingebautem Bad.«
Die Triebwerke heulten auf und übertönten Toms Antwort.
»Bitte nimm Platz und schnall dich an.«
»Wo? Hat der hohe Herr einen Lieblingsplatz?«
»Nein, setz dich hin, wo du willst. Ich bin gleich wieder da.« Viola öffnete die Tür und verschwand im Büro.
Tom setzte sich in einen der Drehsessel am Fenster. Kurz bevor die Boeing die Startposition erreicht hatte, betrat ein schlanker Mann den Salon. Obwohl seine Haare bereits eisgrau waren, schätzte Tom, dass er kaum älter sein mochte als er selbst. Tom löste seinen Sicherheitsgurt, um sich höflich zu erheben, doch der Mann winkte mit einer lässigen Handbewegung ab.
»Bitte, Tom – ich darf Sie doch so nennen? – behalten Sie Platz. Ich bin Humphrey Loggart.« Er reichte Tom die Hand und sah ihn mit freundlichem, aber durchdringendem Blick an.
Tom spürte einen kräftigen Händedruck und war angetan.
»Mr. Loggart …«
»Humphrey, bitte.«
»Vielen Dank. Humphrey, ich bin Ihnen sehr verbunden, dass Sie so freundlich sind, mich nach Prince George mitzunehmen. Sie ersparen mir dadurch viel Mühe, und es ist natürlich wesentlich angenehmer, einmal so zu fliegen.« Er wies mit einem vielsagenden Blick auf die elegante Einrichtung.
Loggart quittierte die Worte mit einem Lächeln. »Aber ich bitte Sie, Tom. Als mir Viola erzählte, wen sie getroffen hat und dass Sie in unsere Gegend wollen, da habe ich sie sofort gebeten, Sie einzuladen. Es ist für mich eine Ehre, einen so prominenten Gast an Bord zu haben. Ich habe Ihr Buch über den internationalen Terrorismus gelesen. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich wünschte, die Regierungen würden Ihren Empfehlungen folgen. Wirklich ein beachtenswertes Buch.«
Tom fand den Vizepräsidenten immer sympathischer. »Vielen Dank. Ich fasse Ihre Worte als großes Kompliment auf.«
Loggart winkte ab. »Nur keine falsche Bescheidenheit, Tom. Doch wir müssen unsere Unterhaltung einen Augenblick unterbrechen. Ich muss meinen Sessel drehen. Mit dem Rücken zur Flugrichtung sitzt es sich so unbequem beim Start.« Loggart schwenkte den Sessel herum und verriegelte ihn mit einem Knopfdruck.
Die Maschine war inzwischen auf die Runway getollt. Die beiden Pratt & Whitney-Triebwerke dröhnten auf, und die Boeing donnerte über die Startbahn. Tom sah, wie sie abhob, dann wurde er in seinen Sessel gedrückt. Der Jet stieg steil empor und legte sich nach einigen Augenblicken über Steuerbord in eine sanfte Rechtskurve. Tom sah die Straße von Georgia mit dem lebhaften Schiffsverkehr unter sich kleiner und kleiner werden. Dann tauchten die nördlichen Bezirke von Vancouver auf. Vorbei am Mount Garibaldi zog die Maschine nach Norden.
Die Tür ging auf, und Viola trat in die Kabine, in der Hand zwei Schreibmaschinenseiten. Wie Tom erkannte, handelte es sich um Telefaxmitteilungen. Loggart hatte die Verriegelung an seinem Sessel gelöst und sich wieder zu Tom umgedreht. Viola reichte ihm die Blätter. Loggart überflog sie, faltete sie zusammen und steckte sie in seine Jackentasche. Tom, neugierig auf alles Geheimnisvolle, begann zu rätseln, was die Nachricht wohl beinhalten mochte. Unauffällig musterte er Loggarts Gesicht, doch er konnte in den scharf geschnittenen Zügen seines Gegenübers keine Reaktion erkennen. Nicht einmal das kleinste Flackern in den kühl blickenden grauen Augen ließ erkennen, ob es eine gute oder schlechte Nachricht gewesen war.
»Was halten Sie von einem Cocktail und einem kleinen Imbiss? Ich glaube, wir haben alles an Bord, um Ihre Wünsche erfüllen zu können, oder habe ich meinen Mund zu voll genommen, Viola?«
»Natürlich nicht, Mr. Loggart.«
Mit einem höflichen Lächeln wandte er sich Tom zu. »Bitte, Tom, sagen Sie Viola Ihre Wünsche.«
Bevor Tom antworten konnte, warf Viola ein: »Lass nur, ich glaube, ich weiß noch, womit man dich verwöhnen kann.« Sie drehte sich um und ging. Nach einigen Augenblicken kam sie zurück und servierte ihm ein Glas Jack Daniels und ihrem Chef einen Dry Martini.
»Den trinkst du doch noch immer?«, fragte sie lächelnd.
Tom erwiderte ihr Lächeln. »Du hast ein gutes Gedächtnis. Kein Wasser, kein Eis und dann auch noch meine Lieblingsmarke – Humphrey, mit Ihnen fliege ich öfter.«
»Cheers, Tom. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen.«
Während die Boeing 737 mit achthundert Stundenkilometern in zehntausend Metern Höhe über die menschenleere Wildnis nach Norden zog, sprachen die beiden Männer über die üblichen Belanglosigkeiten, mit denen sich Fremde bei solchen Gelegenheiten zu unterhalten pflegen. Nach einiger Zeit wurden sie von Viola unterbrochen, die mit einem Tablett herantrat.
Tom sah auf die braune Masse in einer Schüssel und sog das verführerische Aroma ein. »Chili con carne«, rief er erfreut, »mein Leibgericht. Du bist ein Schatz, Viola.«
»Leider nicht hausgemacht, sondern aus der Dose.«
»Macht nichts, Hauptsache Chili.«
»Tom ist nämlich Spezialist für Chili«, erklärte Viola ihrem Chef, der die Schüssel skeptisch musterte. »Er sammelt alle Rezepte, derer er habhaft werden kann. Über zwanzig verschiedene hat er schon …«
»Fünfunddreißig«, verbesserte Tom.
»Wusste gar nicht, dass man daran so viel variieren kann.« Loggart lächelte amüsiert. »Das Ganze besteht doch nur aus Bohnen, Chili und Fleisch.«
»Richtig, aber auf die Mischung und das Würzen kommt es an.« Während der nächsten zehn Minuten gab Tom eine Einweisung in die komplizierte Zubereitung dieses alten Westerngerichts. Loggart und Viola hörten belustigt zu. Als Tom geendet hatte, sagte Loggart: »Sie haben mich neugierig gemacht, Tom. Wenn ich das nächste Mal in Washington bin, melde ich mich bei Ihnen, um eines dieser Zauberwerke zu probieren.«
»Ich würde mich sehr freuen. Ich werde Ihnen das beste home made Chili kochen, das Sie jemals gegessen haben.«
Loggart quittierte Toms Worte mit einem höflichen Kopfnicken. Dann wechselte er das Thema. »Tom, was halten Sie davon, einmal einen Artikel über die Holzindustrie zu schreiben?«
Tom musterte Loggart verwundert. Der plötzliche Themenwechsel hatte ihn überrascht, und da er nicht erkennen konnte, ob der Vizepräsident der ACT seine Worte ernst meinte, antwortete er ausweichend: »Über dieses Thema ist schon so viel geschrieben worden, dass man damit kaum noch einen Hund hinter dem Ofen hervorlocken kann.«
Loggart beugte sich vor und sah Tom fest in die Augen. »Stimmt! Aber wer hat es geschrieben? Zumeist Leute, die von der Materie nicht die leiseste Ahnung haben, oder können Sie mir auch nur einen Artikel nennen, der versucht, die Probleme objektiv darzustellen?« Als er Toms skeptischen Blick sah, fuhr er fort: »Versuchen Sie gar nicht erst zu überlegen, Sie würden keinen Artikel finden. Glauben Sie mir, die sind von Leuten geschrieben, die unfähig zu einer objektiven Darstellung sind. Sie sehen nur ihr eigenes kleines Interessengebiet, und das stellen sie in fast schon krimineller Weise heraus. Und wenn Sie diese Umweltschützer unter die Lupe nehmen, dann sind es Menschen, die in irgendwelchen administrativen Bereichen arbeiten. Lehrer, Beamte, Wissenschaftler, die in staatlichen Institutionen beschäftigt sind und aus sicherer Quelle ihre Gehälter beziehen, oder es sind Künstler und Journalisten, die auf dieser Schiene versuchen, Geld zu verdienen. Denen ist es doch im Prinzip völlig egal, über was sie schreiben oder reden, Hauptsache, es bringt Geld. Das ist ja auch völlig legitim, jeder will Geld verdienen, auch wir. Was nur so kriminell ist, das ist die reißerische Darstellung vom angeblichen Raubbau an der Umwelt. Das Aufhetzen der Öffentlichkeit. Sie säen schlichtweg Hass, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Sie polemisieren nur und entziehen sich jeder sachlichen Diskussion. Im gleichen Atemzug gehen sie aber in den nächsten Supermarkt und kaufen alles, was sie zu ihrem Wohlbefinden brauchen. Sie fahren wie selbstverständlich Autos, gehen angeln und jagen, besitzen Motorboote und Flugzeuge. Wenn sie Schnupfen haben, gehen sie zum Arzt, und ihre Kinder müssen natürlich auf die besten Schulen. Und was ich besonders verwerflich finde, ist, dass sie die Ersten sind, die auf die Straße gehen und protestieren, wenn keine Kindergartenplätze da sind, nicht genügend Lehrer vom Staat eingestellt und die Schulklassen zu groß werden. Dass dieses alles, einschließlich ihrer Gehälter, bezahlt werden muss, vergessen diese Leute zumeist. Sehen Sie, deshalb meine ich, sollten Sie einen Artikel über die Holzindustrie und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Wohlstand schreiben. Einen objektiven Bericht, einen Bericht, in dem alle Fakten berücksichtigt und ausgewogen dargestellt werden. Ich bin überzeugt, dass so ein Artikel ankommen wird. Zumindest wird er für ausreichend Zündstoff sorgen und die Diskussion anfachen.«
»Damit dürften Sie recht haben. Aber wer sagt Ihnen, dass ich der richtige Mann bin, um über so ein komplexes Thema objektiv zu berichten?«
Loggart griff in die Tasche und zog die Zettel, die ihm Viola gegeben hatte, hervor. »Während wir starteten, hat Viola unseren Computer in Denver angezapft. Die Informationen, die er über Sie gespeichert hat, sagen, dass es keinen besseren Mann gibt, um diese Problematik darzustellen. Sie haben wirklich einen ausgezeichneten Ruf, Tom.«
»Und Sie scheinen bestens informiert zu sein.«
»In meinem Job muss ich das sein. Ich will Ihnen ein paar Zahlen nennen, die Sie in den Artikeln der Umweltschützer nicht finden werden und die das unterstreichen, was ich eben gesagt habe.
Wir beide, Sie und ich, sind Amerikaner. Und wir beide stöhnen schon heute unter der Last der Steuern, die wir bezahlen müssen.«
»Das können Sie laut sagen.«
»Richtig. Aber nehmen wir einmal Kanada, zum Beispiel British Columbia. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten ist das ein Wohlfahrtsstaat. Die Versorgung für Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter ist dort bestens geregelt. Diese Leistungen müssen natürlich finanziert werden, und das geht nur über Steuern. Die Folge ist, dass die Kanadier erheblich mehr Steuern zahlen als wir. Obwohl natürlich auch der Einzelne stark belastet wird, muss die Masse der Steuern die Industrie aufbringen. In British Columbia sind etwa zweihundertachtundfünfzigtausend Jobs mit der Forstwirtschaft und dem Forstmanagement verbunden, und das bei nur drei Millionen Einwohnern. Gut siebenundachtzigtausend Jobs entfallen dabei auf die direkte Forstindustrie. Produkte im Wert von dreizehn Milliarden kanadischen Dollar wurden allein im letzten Jahr für den einheimischen und internationalen Markt geliefert. Oder anders ausgedrückt: Rund fünf Milliarden Meter Bau- und Nutzholz wurden in den Sägemühlen hergestellt. Das ist genug, um 1,6 Millionen Häuser zu bauen. Hinzu kommen noch 1,6 Millionen Kubikmeter Sperr- und Furnierholz, vier Komma zwei Millionen Tonnen Zellulose und eins Komma sechs Millionen Tonnen Papier. Und das alles nur in British Columbia. Eine beachtliche Leistung für die Holzindustrie in einem Land mit nur drei Millionen Einwohnern.«
»Bedeutet aber auch, dass Unmengen an Bäumen gefällt werden müssen.«
»Richtig, ich komme gleich darauf zurück. Zuvor möchte ich noch etwas anderes sagen, und nur deshalb habe ich diese Zahlen erwähnt. All diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass die Industrie 1,1 Milliarden Dollar an Abgaben und Steuern zahlen konnte. Steuern, die es, wie gesagt, ermöglichen, dass die Menschen in B.C. so abgesichert leben können. Oder wo, glauben Sie, kommen zum Beispiel die siebzig Millionen her, die jährlich für die Bekämpfung von Waldbränden ausgegeben werden müssen, oder die dreißig Millionen, die für Aufforstung und Schädlingsbekämpfung bereitgestellt werden? Doch zurück zu Ihrem Einwand. Sie haben völlig recht. Es werden viele Bäume gefallt. Aber was bedeutet das? Etwa die Hälfte von B.C., circa fünfundneunzig Millionen Hektar, ist mit Wald bedeckt. Die, über den Daumen gepeilt, achtzig Millionen Kubikmeter Holz, die jährlich geschlagen werden, entsprechen in etwa einem Prozent der Fläche. Sie sehen, wenn man sich einmal die Fakten nüchtern vor Augen hält und nicht auf Panikmache hinarbeitet, dann sieht alles anders aus.«
Tom nickte. Schweigend sah er einige Augenblicke aus dem Fenster. Dann wandte er sich wieder an Loggart. »Könnte ich die Zahlen schriftlich bekommen?«
»Natürlich.« Loggart gab ihm einen der beiden Zettel. Es war eine Aufstellung mit Daten über die Holzwirtschaft in der kanadischen Provinz British Columbia, wie Tom mit einem flüchtigen Blick erkannte. Ein anerkennendes Lächeln huschte über seine Lippen. »Sie scheinen gut vorbereitet zu sein.«
»Wie ich schon sagte, in meinem Job muss man das. Was halten Sie von meinem Vorschlag?«
»Klingt interessant. Ich werde ihn mir überlegen«, antwortete Tom ausweichend.
»Tun Sie das. Wir planen übrigens, ein neues Gebiet für unseren Abbau zu erschließen. Außerdem wollen wir ein neues Sägewerk und eine Zellulosefabrik am Stuart Lake errichten. Sie sind herzlich eingeladen, sich unsere Arbeiten anzusehen, wenn Sie in der Gegend sind.« Loggart zog eine Visitenkarte aus einem Etui, schrieb einige Worte auf die Rückseite und gab sie Tom. »Wenn Sie diese Karte den leitenden Ingenieuren zeigen, wird man Ihnen alles zeigen und erklären. Besonders unsere Fabriken könnten interessant sein. Es werden die größten in ganz B.C. sein.«
Für den Rest des Fluges unterhielten sie sich über Vor- und Nachteile einer intensiven Forstwirtschaft. Tom war von der Offenheit, mit der Loggart diskutierte, angetan. Er wich keinem Problem aus und fühlte sich durch provozierende Fragen nicht gekränkt.
Sie beendeten ihre Unterhaltung erst, als sie im Anflug auf den Flughafen von Prince George waren und Loggart seinen Sessel wieder in Flugrichtung drehte.
Als sie vor dem Flughafengebäude ausgestiegen waren, erkundigte sich Loggart, ob er Tom in der Stadt absetzen könne. Tom lehnte ab. Er bedankte sich für die Mitnahme und verabschiedete sich.
»Vergiss nicht, mich in Denver zu besuchen«, erinnerte ihn Viola an sein Versprechen.
»Keine Sorge.« Tom tippte sich zum Gruß an die Stirn und ging.
Kapitel 3
Jim Owl schmetterte die Eingangstür mit solcher Gewalt zu, dass die gesamte Vorderfront des Holzhauses erzitterte. Mit unsicheren Schritten stampfte er zu einem verrosteten, von Ranken und Gestrüpp überwucherten Pick-up-Truck. Neben diesem Veteran aus den frühen fünfziger Jahren rosteten noch drei andere Autos, zwei Kühlschränke und ein Küchenherd neben dem Haus vor sich hin. Jim nahm einen Schluck aus der Bierdose, stellte sie vorsichtig auf die Ladefläche des Trucks und schwang sich dann selbst hinauf. Den Rücken gegen die durchgerostete Fahrerkabine lehnend, ließ er sich auf seinem Lieblingsplatz nieder.
Er trank die Bierdose leer und warf sie achtlos zur Seite. Mit leisem Geschepper landete sie zwischen den anderen, die schon den gleichen Weg gegangen waren. Da niemand sich die Mühe machte, die Dosen wegzuräumen, waren sie inzwischen zu einem beachtlichen Haufen angewachsen.
Die Haustür öffnete sich, und Jims Eltern traten heraus. Sie trugen die alte Tracht ihres Volkes. Sein Vater hatte sich zusätzlich mit dem Stirnreif und der Kette aus Zedernborke, die schon sein Großvater getragen hatte, geschmückt.
Ohne seinen Sohn zu beachten, schritt er die mit Schlaglöchern übersäte Dorfstraße entlang. Nur seine Mutter warf ihm einen bittenden Blick zu. Obwohl ihn der flehentliche Ausdruck ihrer Augen traf, blieb er trotzig sitzen.
Nach und nach verließen auch die anderen Familien das Dorf, alle festlich gekleidet in ihre historischen Gewänder. Eine beklemmende Stille breitete sich über Yokatchie aus. Das Rauschen des Trout River dräng plötzlich überdeutlich an Jims Ohren. In seinem vom Alkohol umnebelten Gemüt kam es ihm vor, als würde der Fluss zu ihm sprechen. Jim erschauerte. In seiner Phantasie glaubte er, die Geister würden ihm zürnen, weil er sich geweigert hatte, an dem Zeremoniell teilzunehmen. Sollte er falsch gehandelt haben? Irrten die katholischen Priester, die diesen Brauch als heidnisch verteufelten? Sollte er nicht doch gehen? Schließlich handelte es sich um die Bestattung des Häuptlings. Vorgestern war er mit seinem Auto auf der Heimfahrt von Vanderhoof verunglückt, heute sollte er nach Art der Väter bestattet werden. Nicht so, wie es üblich geworden war, nachdem die katholischen Priester ihre alten Riten christianisiert hatten. Nein, Tumbler Hakwitt sollte wie seine Vorfahren, als es noch keine Weißen im Land der Carrier gegeben hatte, zu seinen Vätern ziehen. So jedenfalls hatte er es schon lange vor seinem Tod bestimmt.
Jim war unschlüssig. Er war kein großer Denker, sein Handeln wurde mehr von Gefühlen bestimmt. Deshalb wusste er auch nicht, was er tun sollte. Auf der einen Seite war er Katholik, war getauft und glaubte an die Geschichten, die ihm die Priester in der Schule von Gott, Jesus, der Gottesmutter und den Heiligen erzählt hatten. Das war auch der Grund, warum es heute Morgen zu dem Streit mit seinem Vater gekommen war. Er hatte, wie es ihn die Priester gelehrt hatten, die Bestattung mit der ganzen Intoleranz seiner einundzwanzig Jahre als ein Werk des Teufels abgelehnt. Doch jetzt, ganz allein – selbst die Hunde hatten das Dorf verlassen und waren ihren Herren nachgelaufen –, jetzt sah plötzlich alles anders aus. Jetzt war ihm, als würde sein Schutzgeist durch das Rauschen des Wassers zu ihm sprechen. Eine Weile lehnte er unentschlossen an der Ladefläche. Dann stand er abrupt auf und ging mit schwankenden Schritten ins Haus. Der Indianer in ihm hatte gesiegt.
Als Jim wieder vor die Tür trat, trug auch er die historische Tracht seines Volkes. Die Jacke aus weich gegerbtem Hirschleder war reich bestickt, und an seinem ledernen Wickelrock hingen Klauen und Zähne erlegter Tiere.
Er eilte an den Häusern vorbei und bog am Ortsausgang auf einen schmalen Trampelpfad ein. Der Weg folgte dem Lauf eines Bachs, der sich oberhalb von Yokatchie in den Trout River ergoss. Im feuchten Untergrund waren die Spuren der Dorfbewohner deutlich auszumachen.