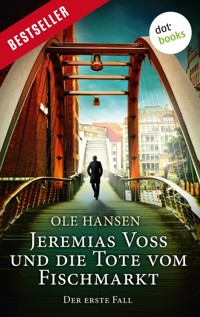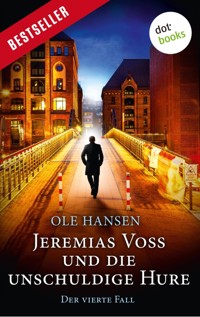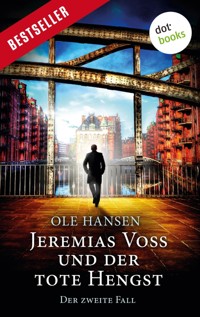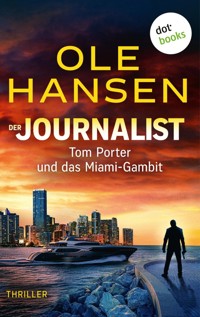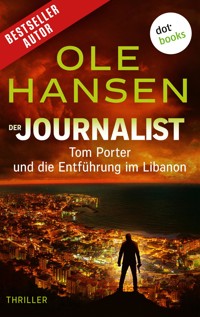Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein tödlicher Anschlag – ein fatales Komplott Als US-Journalist Bob Sounders nach Panama reist, um den hiesigen Präsidenten zu interviewen, ahnt er noch nichts von dem politischen Beben, dass dieses Gespräch nach sich ziehen wird: Wenn Gomez' Forderung nach mehr Souveränität nicht Folge geleistet wird, droht er mit der Veröffentlichung von Dokumenten, die für die USA einen zerstörerischen Skandal bedeuten würden. Doch dazu soll es nie kommen, denn nur kurze Zeit später wird Gomez' Flugzeug in die Luft gesprengt. Wer steckt hinter dem Anschlag und welche schmutzigen Geheimnisse sollten hier um jeden Preis vertuscht werden? Bob Sounders beginnt zu ermitteln – und stößt schon bald auf ein Netz aus Gewalt und illegalen Geschäften, das sich bis in die höchsten Kreise der Vereinigten Staaten erstreckt … Der furiose und brandaktuelle Thriller von Ole Hansen, jetzt endlich im eBook – für alle Fans von John le Carré und Clive Cussler!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als US-Journalist Bob Sounders nach Panama reist, um den hiesigen Präsidenten zu interviewen, ahnt er noch nichts von dem politischen Beben, dass dieses Gespräch nach sich ziehen wird: Wenn Gomez‘ Forderung nach mehr Souveränität nicht Folge geleistet wird, droht er mit der Veröffentlichung von Dokumenten, die für die USA einen zerstörerischen Skandal bedeuten würden. Doch dazu soll es nie kommen, denn nur kurze Zeit später wird Gomez‘ Flugzeug in die Luft gesprengt. Wer steckt hinter dem Anschlag und welche schmutzigen Geheimnisse sollten hier um jeden Preis vertuscht werden? Bob Sounders beginnt zu ermitteln – und stößt schon bald auf ein Netz aus Gewalt und illegalen Geschäften, das sich bis in die höchsten Kreise der Vereinigten Staaten erstreckt …
Über den Autor:
Ole Hansen, geboren in Wedel, ist das Pseudonym des Autors Dr. Dr. (COU) Herbert W. Rhein. Er trat nach einer Ausbildung zum Feinmechaniker in die Bundeswehr ein. Dort diente er 30 Jahre als Luftwaffenoffizier und arbeitete unter anderem als Lehrer und Vertreter des Verteidigungsministers in den USA. Neben seiner Tätigkeit als Soldat studierte er Chinesisch, Arabisch und das Schreiben, sowie Umweltwissenschaften und Geschichte, wobei er seine beiden Doktortitel erlangte. Nachdem er aus dem aktiven Dienst als Oberstleutnant ausschied, widmete er sich ganz seiner Tätigkeit als Autor. Dabei faszinierte ihn vor allem die Forensik – ein Themengebiet, in dem er durch intensive Studien zum ausgewiesenen Experten wurde. Heute wohnt der Autor an der Ostsee.
Von Ole Hansen sind bei dotbooks bereits die folgenden eBooks erschienen:
Die Jeremias-Voss-Reihe:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und die Spur ins Nichts. Der dritte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und die unschuldige Hure. Der vierte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der Wettlauf mit dem Tod. Der fünfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der Tote in der Wand. Der sechste Fall«
»Jeremias Voss und der Mörder im Schatten. Der siebte Fall«
»Jeremias Voss und die schwarze Spur. Der achte Fall«
»Jeremias Voss und die Leichen im Eiskeller. Der neunte Fall«
»Jeremias Voss und der Tote im Fleet. Der zehnte Fall«
»Jeremias Voss und die Toten im Watt. Der elfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
Die Marten-Hendriksen-Reihe:
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der falsche Mönch. Der dritte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der Tote auf hoher See. Der vierte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der falsche Erbe. Der fünfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
Die Arne Claasen-Reihe:
»Arne Claasen und die vergessenen Toten. Der erste Fall«
»Arne Claasen und die tödliche Fracht. Der zweite Fall«
»Arne Claasen und die Tote am Elbufer. Der dritte Fall«
Die Claasen&Hendriksen-Reihe:
»Die Tote von Pier 17 – Der erste Fall für Claasen & Hendriksen«
»Mord im Trockendock – Der zweite Fall für Claasen & Hendriksen«
»Die tote Kapitänin« – Der dritte Fall für Claasen & Hendriksen
Einige seiner Kriminalromane sind auch in Sammelbänden erschienen:
»Die dunklen Tage von Hamburg«
»Das kalte Licht von Hamburg«
»Die Schatten von Hamburg«
»Die Morde von Hamburg«
»Die Toten von Hamburg«
Außerdem veröffentlichte Ole Hansen seine packenden Agenten-Thriller:
»Der Journalist: Tom Porter und die kanadische Intrige«
»Der Journalist: Tom Porter und die Entführung im Libanon«
»Der Journalist: Tom Porter und das Moskau-Komplott«
»Der Journalist: Tom Porter und das Miami-Gambit«
»Die Libyen-Verschwörung«
»Die Akte Panama«
Unter seinem Klarnamen Herbert Rhein veröffentlichte der Autor bei dotbooks auch die folgenden eBooks:
»Todesart: Nicht natürlich. Gerichtsmediziner im Kampf gegen das Verbrechen.«
»Todesart: Nicht natürlich. Mit Mikroskop und Skalpell auf Verbrecherjagd.«
Folgende Bücher von Ole Hansen sind auch als PoD erhältlich:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall«
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall«
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall«
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall«
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe April 2025
Copyright © der Originalausgabe 1991 by Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Raststatt
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion (Überarbeitung): Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Ysbrand Cosijn, Bogdan Skaskiv
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-679-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ole Hansen
Die Akte Panama
Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
»Würden Sie sich bitte anschnallen, Sir?«
Eine Stewardess beugte sich zu dem großen, schlanken Mann in Sitz 14A, der zu schlafen schien. Sein Kopf mit der hohen Stirn und den kurzgeschnittenen blonden Haaren ruhte mit geschlossenen Augen auf der Kopfstütze des Sitzes.
Die Flugbegleiterin tippte ihm sanft auf die Schulter.
Bob öffnete die Augen und blickte geistesabwesend auf.
»Würden Sie sich bitte anschnallen, Sir?«, wiederholte sie. »Wir haben unsere Reiseflughöhe verlassen und befinden uns im Anflug auf Panama City.«
»Oh – ja, selbstverständlich«, murmelte er und ließ den Sicherheitsgurt einrasten.
Die Stewardess ging weiter, um die anderen Passagiere zu überprüfen.
Bob lehnte sich zurück, und erneut tauchten die beiden Namen Kaktusblüte und Springer in seinen Gedanken auf. Vor einer Woche hatte er sie zum ersten Mal gehört, und seitdem ließen sie ihn nicht mehr los.
Am letzten Montag hatte er wie gewöhnlich mit einem Freund in einem gemütlichen Lokal in Georgetown zu Abend gegessen. Der Freund, der bei der US-Drogenbekämpfungsbehörde als Operationsleiter für Mittelamerika arbeitete, war an diesem Abend sichtlich aufgebracht gewesen und hatte ihn als Blitzableiter benutzt.
»Bob«, hatte er geflucht, »ich hab die Schnauze voll von diesem Scheißladen! Ich such mir einen anderen Job. Ich geh in die Industrie oder mach sonst was.«
Bob hatte versucht, ihn zu beschwichtigen, aber der Freund hatte sich nicht beruhigen lassen.
»Es ist zum Verrücktwerden«, schimpfte er weiter, »die Abteilung für die Rauschgiftbekämpfung in Mittelamerika ist von höchster Stelle angewiesen worden, mit den Chaoten von der CIA zusammenzuarbeiten. Die offizielle Begründung ist: Die CIA hat in diesem Gebiet verstärkt Kräfte im Einsatz und es bestehe die Gefahr, dass wir gegeneinander arbeiten. Kräfte bündeln, Schaden von unserem Land abwenden, nicht aus Versehen Operationen der CIA aufdecken, solche und ähnliche Parolen höre ich den ganzen Tag. Im Grunde ist das ja vernünftig, aber mit diesen Scheißkerlen von der CIA kannst du nicht zusammenarbeiten. Die machen selbst aus Scheißhauspapier noch ein Geheimdokument. Zusammenarbeit sieht bei diesen Arschlöchern so aus, dass wir ihnen die Informationen über unsere Aktionen geben und sie uns sagen, ob wir sie so durchführen können oder nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir diese Kerle zuwider sind.« Sein Freund stürzte seinen Drink mit einem Schluck hinunter und sprach wütend weiter. »Gerade vorgestern ist uns wieder ein dicker Fisch durch die Lappen gegangen. Unser Vertrauensmann in Panama City hatte uns informiert, dass ein Transport von Kokain von Boca del Guasimo – das ist so ein Kuhkaff westlich der Kanalzone – per Flugzeug in die Staaten abgehen sollte. Wir hatten alles arrangiert, um den Transport abzufangen, und dann die CIA wie befohlen über unsere Pläne informiert. Seit Tagen lagen unsere Männer auf der Lauer. Das Flugzeug kam. Es wurde beladen. Wir stürmten vor. Und was fanden wir? Nichts als Reis. Jeder verfluchte Sack war von oben bis unten mit Reis gefüllt. Wie die Deppen standen wir da. Wir haben natürlich sofort nachgeforscht und herausgefunden, dass Kaktusblüte und Springer den Transport kurzfristig umdirigiert hatten.«
»Kaktusblüte und Springer?«, fragte Bob.
»Zwei Oberbonzen in der Drogenszene da unten. Bei nahezu allen Operationen haben sie ihre Finger im Spiel.«
»Habt ihr ’ne Ahnung, wer sie sind?«
»Keinen Schimmer. Aber so, wie die informiert sind, glaube ich, dass sie in hohen Regierungskreisen sitzen. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht.«
»Und die CIA, hat die keine Ahnung?«
Sein Freund machte eine verächtliche Handbewegung. »Natürlich nicht. Aber was wissen diese Kerle schon?«
Der Lautsprecher über Bobs Kopf knackte, und die Stimme der Stewardess riss ihn aus seinen Gedanken.
»Meine Damen und Herren, würden Sie jetzt bitte das Rauchen einstellen und Ihre Sitze aufrecht stellen, wir befinden uns im Anflug auf den General Omar Torrijos Airport und werden in wenigen Minuten landen. Das Wetter ...«
Bob verscheuchte seine Gedanken, klappte den Tisch hoch und stellte die Rückenlehne senkrecht. Nach wenigen Minuten rumpelte das Fahrwerk: Die Maschine war gelandet. Als der Pan-Am-Clipper seine Parkposition erreicht hatte, stand Bob auf, hängte sich seine Reisetasche über die Schulter und ließ sich vom Strom der Passagiere zum Ausgang treiben.
Jeder, der den großen, schlanken Mann mit der hohen Stirn, den sympathischen, intelligenten Gesichtszügen und den fröhlich blickenden blauen Augen ansah, hätte ihn für einen Wissenschaftler gehalten. Doch dieser Eindruck trog. Bob Sounders war Journalist – mit Leib und Seele. Zwar hätte er nach seinem Studium an der altehrwürdigen Yale-Universität und der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften eine Hochschulkarriere einschlagen können, doch diese Laufbahn erschien ihm zu eintönig. Er hatte deshalb noch einige Semester Zeitungswissenschaften drangehängt und sich dann bei der größten amerikanischen Wochenzeitschrift, dem New York Mirror, beworben. Bis jetzt hatte er diesen Entschluss nicht bereut. Die Arbeit war aufregend und abwechslungsreich, ganz so, wie er es erhofft hatte. Mit Begeisterung, Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit hatte er jede Aufgabe angepackt, und da seine Arbeiten gründlich recherchiert und präzise geschrieben waren, erregten sie schon bald die Aufmerksamkeit des Chefredakteurs. Die Folge war, dass er mit immer höherwertigen Aufträgen betraut wurde und jetzt, mit fünfunddreißig Jahren, zum harten Kern der Mannschaft gehörte.
Aber Bob verfügte noch über zwei weitere Merkmale, die für seinen Job von unschätzbarem Vorteil waren. Er besaß geschliffene Umgangsformen und konnte sich auf jedem gesellschaftlichen Parkett bewegen, außerdem sprach er fließend Spanisch und zufriedenstellend Französisch. Durch Glück, aber vor allem wegen dieser Eigenschaften und Fähigkeiten, hatte er Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen gefunden. Von der Skepsis, die gewöhnlich Reportern entgegengebracht wurde, hatte er nie etwas zu spüren bekommen. Im Gegenteil, er war überall ein gern gesehener Gast. Das lag auch daran, dass er sich in seinen Artikeln trotz aller Schärfe bemühte, die Betroffenen fair zu behandeln.
So hilfreich es für ihn war, in höchsten Kreisen zu verkehren, so nachteilig wirkte es sich gelegentlich auf seine Arbeit in der Redaktion aus. Zwar hatten sich seine Kollegen inzwischen daran gewöhnt, dass er in Kreisen verkehrte, die ihnen in der Regel verschlossen blieben, aber ein gewisser Neid war geblieben und machte eine Teamarbeit nicht immer leicht. Was sich aber noch negativer auswirkte, war, dass viele Prominente sich nur interviewen lassen wollten, wenn er diese Aufgabe übernahm. Entweder Bob Sounders oder keiner, war meistens die lakonische Forderung. Seine eigentliche journalistische Tätigkeit war dadurch erheblich beeinträchtigt, was Bob aufs Äußerste missfiel.
Auch dass er jetzt im Internationalen Flughafen von Panama City stand, hatte er diesem Umstand zu verdanken. Gestern Abend kurz nach neun war er vom Chef vom Dienst angerufen worden, der ihm kurz und bündig mitgeteilt hatte, dass er am nächsten Tag mit der Neun-Uhr-Maschine nach Panama City zu fliegen hatte, um den Präsidenten der Republik Panama zu interviewen. Eigentlich wäre dies die Aufgabe des Mittelamerika-Korrespondenten gewesen, denn der arbeitete an einem Artikel über die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Panama und den USA. Aber das Präsidialamt in Panama hatte bestimmt, dass nur Bob Sounders ein Gespräch gewährt werden würde.
Zuerst hatte er sich weigern wollen, die Aufgabe zu übernehmen – der Termin passte überhaupt nicht in seine Arbeitsplanung –, doch dann war ihm der Gedanke gekommen, dass diese Reise eine gute Gelegenheit bot, Nachforschungen über die mysteriösen Figuren namens Kaktusblüte und Springer anzustellen.
Bereits eine halbe Stunde später hatte er den Mittelamerika-Korrespondenten in seiner Wohnung in Mexiko City angerufen, um den Inhalt des Interviews mit ihm durchzusprechen. Anschließend hatte er seine Sekretärin aus dem Bett geklingelt und sie beauftragt, alle Termine für die nächsten Tage abzusagen.
Da er seinen Arbeitsplatz im Washingtoner Büro des Mirror hatte, musste er schon um fünf Uhr morgens von zu Hause aufbrechen, um den ersten Shuttle-Flug nach New York zu erreichen. Hier konnten sie wegen einer Störung auf dem Flugplatz La Guardia nicht landen und mussten nach Newark ausweichen. Von dort hätte er mit dem Auto mindestens zwei Stunden bis zum Kennedy Airport benötigt und damit die Pan-Am-Maschine nach Panama City verpasst. Also war er zum Hubschrauberterminal gestürmt und mit einem Lufttaxi zum Kennedy Airport geflogen. Ein teurer Spaß, aber er hatte seinen Flug erreicht.
Jetzt hatte er nur noch ein Ziel: Er wollte so schnell wie möglich ins Hotel und erst einmal ausgiebig duschen. Vor dem Terminal schlug ihm die feuchtheiße Luft entgegen und machte das Atmen schwer.
»Taxi, Señor! Taxi nach Ciudas Panama!«, empfingen ihn die sich an Lautstärke und Gesten überbietenden Taxifahrer.
Abschätzend musterte Bob die Autos und ging dann auf das am besten aussehende zu. Eilfertig kam ihm der Fahrer entgegen, ergriff sein Gepäck und verstaute es im Kofferraum.
»Wohin, Señor?«, fragte der Fahrer und ließ den Motor an.
»Zum Holiday Inn. Was kostet es?«
Der Taxifahrer nannte einen Preis, der Bob viel zu hoch erschien. Offensichtlich glaubte er, den müde aussehenden Gringo leicht übers Ohr hauen zu können. Doch Bob lachte nur und sagte kurz: »Vergessen Sie’s. Ich zahle die Hälfte.«
Der Fahrer warf in einer verzweifelten Geste die Hände hoch und jammerte: »Unmöglich, Señor, dabei setze ich zu. Was glauben Sie, was ich ...«
»Dreiviertel«, unterbrach Bob den Redestrom. Er hatte wenig Lust auf Feilschen, sondern wollte nur so schnell wie möglich ins Hotel.
»Aber, Señor, denken Sie an die Benzinkosten, das kann ich unmöglich …«
»Gut, vergessen Sie’s, ich steige aus«, unterbrach Bob den Fahrer.
»Señor …«
Bob öffnete die Tür.
»Okay, Señor, abgemacht«, gab der Fahrer grinsend nach.
Bob hatte sich das am besten aussehende Taxis ausgesucht, weil er gehofft hatte, es verfüge über eine funktionierende Klimaanlage. Er wurde enttäuscht. Sie war ausgefallen. Dafür hatte der Fahrer die Fenster heruntergedreht, damit der Fahrtwind die stickige Luft aus dem Auto blasen konnte. Es wurde im Wagen etwas kühler, aber eine Erfrischung war es bei der hohen Luftfeuchtigkeit gewiss nicht. Schon nach wenigen Minuten fühlte Bob, wie ihm der Schweiß am Körper herunterrann. Als sie endlich vor dem Hotel hielten, klebten ihm Hemd und Hose am Leib.
Das Holiday Inn lag am Pazifik inmitten einer üppigen tropischen Vegetation. Zu jeder anderen Zeit hätte Bob den malerischen Anblick genossen, doch so durchgeschwitzt und müde hatte er keinen Blick dafür. Er bezahlte den Taxifahrer und eilte ins Hotel. Der Boy mit seinem Gepäck musste sich beeilen, ihm zu folgen.
Als er durch die Luftschleuse ins Foyer trat, kam er sich vor, als befinde er sich in einer anderen Welt: Wohltuende Kühle umfing ihn. Er sog die trockene Luft tief ein und ging zum Empfang.
»Für mich wurde ein Zimmer reserviert. Bob Sounders ist mein Name«, wandte er sich an einen der Angestellten hinter dem Schalter.
Der junge Mann fuhr mit dem Finger die Namen in der Reservierungsliste entlang. Er tat es zweimal, dann sagte er mit Bedauern in der Stimme: »Es tut mir leid, Señor, aber für einen Bob Sounders haben wir keine Reservierung.«
Ein ungutes Gefühl überfiel ihn. Von seinen früheren Besuchen in Panama City wusste er, dass es hier fast unmöglich war, eine Unterkunft zu bekommen, wenn man kein Zimmer reserviert hatte.
Gewöhnlich wimmelte die Stadt von Geschäftsleuten, denn Panama war mit seinen günstigen Steuerbestimmungen nicht nur ein beliebter Sitz für Reedereien, sondern auch ein Eldorado für Banken aus aller Welt.
»Dann geben Sie mir ein anderes Zimmer.«
»Tut mir leid, Señor, wir sind ausgebucht.«
Bob wurde ärgerlich. Gereizt fuhr er den Angestellten an: »Bei Ihnen muss ein Fehler passiert sein. Gestern wurde von meiner Zeitung, dem New York Mirror, ein Zimmer für mich bestellt. Die Reservierung wurde von Ihrem Haus bestätigt. Ich gehe nicht eher hier weg, bevor ich ein Zimmer habe.« Zwar wusste Bob nicht, ob sie eine Bestätigung erhalten hatten, aber es war nie verkehrt, das erst einmal zu behaupten.
»Sagten Sie New York Mirror?«
»So ist es.«
»Einen Augenblick.« Der Angestellte fuhr erneut mit dem Finger die Liste entlang. Kurz vor dem Ende hielt er inne. »Ja, hier habe ich die Reservierung eines Einzelzimmers für den New York Mirror«, sagte der Angestellte.
»Diese Idioten«, entfuhr es Bob erleichtert. »Das Zimmer ist für mich.«
Wenig später riss er sich die Kleider vom Leib, stieg unter die Dusche und ließ lange das kühle Nass über seinen Körper rinnen, bevor er erfrischt das Wasser abdrehte. Er schlüpfte in einen leichten Tropenanzug und fuhr in den 19. Stock. Hier lag das Belvedere, ein Restaurant, von dem aus man einen berauschenden Blick über die Stadt und die Bucht von Panama hatte. Beim Chefkellner bestellte er einen Tisch an einem der großen
Panoramafenster. Alle Tische waren noch besetzt, und er musste in der Bar warten.
Bei einem ausgezeichneten Dinner entspannte er sich. Allerdings nur bis nach dem Essen. Sobald der Kellner abgeräumt hatte und eine Tasse Kaffee vor ihm stand, begann er, das Interview mit General Julio Gomez, dem Präsidenten der Republik Panama, vorzubereiten. Als er schließlich aufstand, war er der einzige Gast im großen Speisesaal. Die Kellner lächelten ihm freundlich und erleichtert zu, als er ging.
Von seinem Zimmer rief er den Empfang an und bat, um acht Uhr geweckt zu werden und für halb zehn ein Taxi mit funktionierender Air Condition zu bestellen. Dann ging er zu Bett. Minuten später war er eingeschlafen.
Er wachte erst wieder auf, als er von der Hotelvermittlung geweckt wurde. Ein paar Minuten blieb er träge liegen, dann trieb er sich mit seiner täglichen Morgengymnastik den Schlaf aus dem Körper, schlenderte nach einer ausgiebigen Morgentoilette zum Restaurant und ging bei einem leichten Frühstück noch mal das Konzept für das Gespräch mit dem Präsidenten durch. Kurz vor halb zehn fuhr er mit dem Fahrstuhl nach unten. Das Taxi wartete bereits mit laufendem Motor und funktionierender Klimaanlage vor dem Portal.
Die Fahrt war kurz. Der Palacio de las Garzas, der offizielle Wohn- und Amtssitz des Präsidenten, lag keine zwei Kilometer vom Holiday Inn entfernt.
Bob nannte dem Torposten seinen Namen und den Grund des Besuchs. Der Posten wies ihn in das Wachgebäude. Der diensthabende Sergeant überprüfte seinen Ausweis und verglich ihn mit einer Besucherliste. Anschließend wurde er mit einem Metalldetektor nach Waffen durchsucht, während ein anderer Soldat seinen Aktenkoffer überprüfte. Alles, was an dem Kassettenrecorder zu öffnen war, wurde aufgeschraubt. Selbst die Batterien wurden ausgetauscht.
»Sie bekommen sie zurück, wenn Sie das Gebäude verlassen«, teilte ihm der Soldat höflich, aber bestimmt mit.
Nach der Prozedur bekam Bob einen Sicherheitsausweis, den er sichtbar tragen musste. Erst jetzt durfte er in Begleitung eines Postens die Zufahrt zum Palast betreten.
Als sie etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, forderte der Posten Bob auf zu laufen. Gemeinsam spurteten sie ganz unseriös und unmilitärisch zum Eingangsportal und erreichten es gerade rechtzeitig, bevor einer jener kurzen, aber heftigen Tropenschauer niederprasselte. Der Posten grinste Bob an und führte ihn zur Palastwache. Hier wurde er von einer neuen Eskorte übernommen. Sie traten durch eine Stahltür, die vom Wachzimmer aus gesteuert wurde.
Der neue Posten führte ihn durch mehrere mit Marmor und riesigen Wandmalereien verzierte Gänge und blieb vor einer wuchtigen, doppelflügeligen Holztür stehen; zwei Posten mit Maschinenpistolen bewachten den Eingang. Einer der Soldaten überprüfte seinen Sicherheitsausweis. Sie durften passieren. Der Saal, in den sie traten, war ein großes Rechteck, Wände und Decke waren reich verziert. Ein breiter, kostbarer Teppich, der von einer Längsseite bis zur anderen reichte, teilte den Raum in zwei Hälften. Auf der einen Seite standen mehrere Ledersessel zu einer Sitzgruppe arrangiert, und auf der anderen befand sich als einziges Stück Möbel ein Schreibtisch. Ein Offizier im Range eines Oberstleutnants saß in Paradeuniform dahinter. Als sie das Zimmer betraten, erhob er sich und kam auf sie zu.
Der Begleitposten nahm Haltung an und meldete: »Bob Sounders vom New York Mirror.«
Der Oberstleutnant beachtete den Soldaten nicht. Er reichte Bob die Hand und sagte mit freundlicher Reserviertheit: »Willkommen in der Republik Panama. Seine Exzellenz der Präsident wird Sie um zehn Uhr empfangen. Er hat eine halbe Stunde für Sie reserviert.«
Bob bedankte sich gemessen. Der Oberstleutnant sah auf die Uhr über der Tür zu seiner Rechten. Es waren noch fünf Minuten bis zehn. Er tauschte mit Bob ein paar belanglose Höflichkeiten aus, und als der Zeiger auf zehn Uhr sprang, ging er zur Tür, öffnete die beiden Flügel und kündigte den Besucher mit lauter Stimme an. Dann trat er zur Seite und gab den Weg frei.
Bob schritt an ihm vorbei und ging selbstbewusst auf den Schreibtisch zu. Mit keinem Blick nahm er die kostbare Ausstattung des riesigen Amtszimmers des Präsidenten wahr. Sein Blick war fest auf den Mann, der ihn kritisch musterte, gerichtet. Aus Erfahrung wusste er, dass der erste Eindruck über Erfolg oder Misserfolg einer Mission entschied. Ein paar Schritte vor dem Schreibtisch blieb Bob stehen und verneigte sich leicht.
»Guten Morgen, Herr Präsident. Ich habe den Auftrag und die Ehre, Ihnen den Gruß Mr. Falkenhams, des Herausgebers des New York Mirror, zu übermitteln und Ihnen in seinem Namen für die Freundlichkeit, unserem Blatt ein Interview zu gewähren, zu danken.«
Der mittelgroße, untersetzte Mann in der Uniform eines Generals erhob sich und kam hinter seinem Schreibtisch hervor. Mit einem jovialen Lächeln, mit dem man Personen zu bedenken pflegt, die gesellschaftlich unter einem stehen, sagte er: »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Sounders. Ich hoffe, Sie hatten bislang einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Bitte übermitteln Sie Mr. Falkenham ebenfalls meinen Gruß.« Der Präsident schüttelte Bobs Hand. »Kommen Sie, wir setzen uns dort drüben hin.« General Gomez führte seinen Gast zu einer Sitzgruppe aus Louis-Quatorze-Möbeln.
Bob wartete, bis der Präsident Platz genommen hatte, und setzte sich dann ebenfalls.
»Herr Präsident, habe ich Ihre Erlaubnis, das Interview auf Tonband aufzunehmen?«
»Selbstverständlich, ich bitte sogar darum, denn dadurch habe ich eine gewisse Sicherheit, dass meine Worte nicht falsch verstanden werden.« Der Anflug eines ironischen Lächelns umspielte seine Lippen.
Bob holte den Kassettenrecorder aus seiner Tasche und wollte mit dem Interview beginnen. Doch der Präsident winkte ab.
»Lassen wir das Frage-und-Antwort-Spiel, Mr. Sounders. Ich habe Ihrer Zeitung das Interview gewährt, damit die amerikanische Bevölkerung aus berufenem Munde erfährt, in welcher entwürdigenden Weise Ihre Regierung mein Land behandelt. Seit ich zum Wohle meines Volkes das Amt des Präsidenten der Republik Panama übernommen habe, versucht Ihre Regierung, Druck auf unser kleines Land auszuüben. Die Amerikaner, die gemäß Vertrag nur die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Panamakanals gewährleisten sollen, gebärden sich, als wären sie die Herren des Landes. Und wenn wir sie daran erinnern, dass sie hier nur Gäste sind, dann droht uns Ihre Administration mit Wirtschaftsrepressalien. Das ist eine für uns völlig inakzeptable Situation. Es ist an der Zeit, dass die amerikanische Regierung und das amerikanische Volk verstehen lernen, dass wir kein Kolonialstaat der USA, sondern eine freie Nation sind.«
»Herr Präsident.« Bob nützte die erste Atempause des Generals, um zu Wort zu kommen. »Wir wissen, dass Sie die sofortige, uneingeschränkte Übergabe des Kanals fordern. Aber diese Übergabe wurde doch bereits 1977 zwischen Präsident Carter und Ihrem damaligen Präsidenten, General Torrijos Herrera, unterzeichnet. Damit ...«
General Gomez unterbrach ihn ungehalten. »Nach diesem Vertrag erhalten wir die volle Souveränität erst im Jahr 2000. Das ist unzumutbar! Wir fordern die Übergabe des Kanals und den Abzug der Amerikaner sofort! Seit der Kanal 1914 fertiggestellt wurde, beuten die Amerikaner ihn aus. Jetzt ist es höchste Zeit, dass mein Land in den Genuss seiner wirtschaftlichen Vorteile kommt. Vergessen Sie nicht, das hier ist unser Land und nicht die Vereinigten Staaten. Was würde das amerikanische Volk sagen, wenn wir plötzlich auf den Gedanken kämen, den Hudson River als unser Eigentum zu erklären, dort eine eigene Verwaltung aufbauen, Militär stationieren würden und uns einen Dreck um die Amerikaner, die dort leben, kümmern würden? Für schwachsinnig würde man uns erklären und uns in hohem Bogen hinauswerfen! Und das mit vollem Recht. Aber nur weil wir ein kleines Land sind, haben wir nicht weniger Rechte als Ihre Nation.«
Bob wollte eine Frage stellen, doch der Präsident wischte sie mit einer herrischen Handbewegung vom Tisch.
»Wir dulden diese Bevormundung nicht mehr, und wir werden uns Gehör zu verschaffen wissen. Wir werden verbieten, dass in unserem Land Terrorkommandos ausgebildet werden und gegen unsere Nachbarn, mit denen wir friedlich zusammenleben wollen, eingesetzt werden.« Der Präsident richtete seinen Zeigefinger so auf Bob, als wollte er ihn damit durchbohren. »Und noch etwas – und schreiben Sie es wörtlich –, wir werden der CIA verbieten, sich in unserem Land zu tummeln, als gehöre es ihr. Ich werde nicht länger dulden, dass diese verbrecherische Organisation in unserem Land Rauschgiftoperationen in großem Stil durchführt, um damit ihre schmutzigen Geschäfte zu bezahlen. Sollte Ihre Regierung meinen Forderungen nach voller Souveränität nicht nachkommen, werde ich einen Skandal entfesseln, an den Ihr Präsident und seine Regierung noch Jahre denken werden. Und glauben Sie mir, es wird ein Skandal sein, der die Weltöffentlichkeit aufhorchen lässt.«
Bob versuchte noch ein paarmal, den Redestrom des Präsidenten zu unterbrechen, doch es war vergeblich. General Julio Gomez schien sich vorgenommen zu haben, dafür zu sorgen, dass seine schweren Anschuldigungen von einem amerikanischen Journalisten auf Band aufgenommen wurden. An einem Interview schien er von vornherein überhaupt nicht interessiert gewesen zu sein.
Während Bob scheinbar aufmerksam zuhörte, fragte er sich, was General Gomez mit diesen Schimpftiraden bezweckte. Er musste sich doch im Klaren darüber sein, dass er damit das ohnehin schon gespannte Klima zwischen den USA und Panama noch weiter verschlechterte.
Nach einer halben Stunde ging die Tür auf, und der Oberstleutnant trat ein. Sofort unterbrach der Präsident seinen Redefluss und erhob sich. Bob blieb nichts anderes übrig, als seinem Beispiel zu folgen. Völlig verändert reichte General Gomez ihm die Hand, während er freundlich sagte: »Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich habe einen anderen Termin. Aber ich gebe heute Abend einen Empfang. Sie sind herzlich eingeladen. Mein Adjutant wird Ihnen eine Einladungskarte geben und Sie am Abend den anderen Regierungsmitgliedern vorstellen. Dort können Sie dann all die Fragen stellen, zu denen Sie heute Morgen nicht gekommen sind.«
General Gomez drehte sich um und ging zu seinem Schreibtisch. Bob packte seine Sachen zusammen und folgte dem Adjutanten ins Vorzimmer, wo er eine Einladungskarte sowie einige Informationen zu dem Empfang erhielt. Dann übernahm ihn wieder der Wachtposten, der ihn hergebracht hatte.
Um Viertel vor elf stand Bob wieder auf der Straße. Er war verblüfft und verwirrt. Das war anders gelaufen, als er geplant hatte.
Kapitel 2
Während Bob über das eigenartige Interview nachdachte, saß nicht weit entfernt ein Mann in seinem Büro und starrte auf eine handgeschriebene Notiz, die ein Bote vor ein paar Minuten in einem verschlossenen Umschlag gebracht hatte. Tiefe Falten standen auf seiner Stirn. Normalerweise hielt er sich für gut informiert, aber diese Nachricht hatte ihn vollkommen überrascht. Er stand auf und ging, den Kopf nachdenklich nach vorn gebeugt, im Zimmer auf und ab. Nach einiger Zeit blieb er stehen. Er musste versuchen herauszufinden, was hinter dieser Meldung steckte. Sollte es mehr als ein Bluff sein, dann konnte sie verdammt gefährlich werden. Nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Organisation.
Er schlüpfte in sein Jackett und verließ das Büro. Mit dem Fahrstuhl fuhr er in die Tiefgarage und stieg in eines der dort parkenden Autos. Eine Weile fuhr er scheinbar ziellos durch die Innenstadt von Panama City, dann bog er in die Ausfallstraße zum General Omar Torrijos Airport. Aufmerksam beobachtete er den hinter ihm fahrenden Verkehr. Als er sicher war, dass ihm niemand folgte, drehte er um, fuhr in die Innenstadt zurück und hielt bei einem der großen internationalen Hotels. Hier, im Marriot, herrschte um diese Zeit reger Publikumsverkehr. Geschäftsleute kamen von ihren Konferenzen zurück, und neue Gäste trafen ein. Die Angestellten am Empfang hatten so viel zu tun, dass sie den sportlich durchtrainierten Besucher, der zielstrebig auf die Telefonzellen zuging, nicht beachteten. Der Mann steckte eine Münze in den Apparat und wählte. Als er das Klingeln hörte, drückte er den Kontakt herunter. Das Freizeichen ertönte. Der Mann sah auf seine Uhr. Nach zwei Minuten wiederholte er den Vorgang. Wieder unterbrach er das Gespräch, bevor jemand am anderen Ende den Hörer abnehmen konnte. Nach einer weiteren Minute wählte er zum dritten Mal und unterbrach, nachdem das Rufzeichen ertönte, erneut die Verbindung. Nun lehnte er sich gegen die Wand der Telefonzelle und wartete. Nach ein paar Augenblicken klingelte es.
»Hallo«, meldete er sich.
Eine ihm wohlvertraute Stimme fragte: »Was gibt’s?«
»Blühen deine Kakteen?«
»O ja, sie sind voll aufgeblüht und haben herrliche gelbe Blüten.«
Der Mann war zufrieden. Obwohl er die Stimme erkannt hatte, war er erst jetzt sicher, mit der richtigen Person verbunden zu sein und gefahrlos sprechen zu können. Wäre sie nicht oder nur teilweise auf seine Frage eingegangen, dann hätte er gewusst, dass es Probleme gab. Um jede Möglichkeit auszuschließen, dass ein Fremder mithörte, war die Frage nach der Blütenfarbe als zusätzlicher Sicherheitsfaktor eingebaut. Gelb bedeutete, dass sie sich im ersten Drittel eines Monats befanden, Rot benutzten sie für das zweite und Lila für das letzte Drittel. Hätte der Gesprächspartner aus irgendeinem Grund nicht frei sprechen können, dann hätte er geantwortet »Nein, sie blühen noch nicht« oder hätte eine falsche Farbe genannt.
Da alles sicher war, sagte er: »Ich muss dich unbedingt sprechen. Wann kannst du es einrichten?«
»Ich muss heute Abend zum Empfang des Präsidenten. Wir könnten uns danach treffen«, antwortete Kaktusblüte nach kurzem Überlegen.
»Zu spät, es muss vorher sein.«
Wieder vergingen einige Sekunden, bevor sie antwortete. »Wann kannst du hier sein?«
»In einer Stunde.«
»Gut, ich habe aber nur wenige Minuten Zeit.«
»Das dürfte reichen. Wo treffen wir uns?«
»Im Orchideen-Pavillon. Komm durch die Seitenpforte. Ich werde dafür sorgen, dass die Hundestreife dort nicht patrouilliert.«
Der Mann hängte ein und verließ die Telefonzelle. Er musste sich beeilen, wenn er den Termin einhalten wollte. So schnell es der Verkehr zuließ, fuhr er in eines der ärmeren Wohnviertel, wo schmucklose Hochhäuser die Straße säumten. Er parkte seinen Wagen in der Tiefgarage eines der Häuser und fuhr mit dem Fahrstuhl in den zehnten Stock. Mit einem Sicherheitsschlüssel öffnete er eine der Apartmenttüren und trat in die Wohnung, die einen kaum benutzten Eindruck machte. Er ging auf die Bücherwand zu, die die ganze Breite des Zimmers einnahm, öffnete das Barfach und schaltete die Beleuchtung ein. Dann zog er ein Buch aus dem Regal über der Bar und drückte auf einen Knopf, der als Astauge getarnt war. Mit einem leisen Summen schwang das Mittelteil der Bücherwand auf. Der Mann trat in den schmalen Raum, der dahinter lag. Dort hingen an einer Stange verschiedene Kleidungsstücke, und auf einem Bord lagen, sorgfältig ausgerichtet, Perücken, Bärte, Augenbrauen und sonstige Utensilien, die für eine professionelle Verkleidung benötigt wurden. Er wählte einige Sachen aus, ging ins Bad und begann mit geübten Handgriffen zu arbeiten. Nach zwanzig Minuten war er fertig und warf einen letzten, kritischen Blick in den Spiegel. Ein hispanisch aussehender Geschäftsmann mit dichten dunklen Augenbrauen, Schnurrbart und halblangen schwarzen Haaren sah ihn an. Zufrieden räumte er alles wieder in den Geheimraum, schloss die Tür und schaltete die Barbeleuchtung aus. Damit war der elektrische Strom für den Öffnungsmechanismus der Geheimtür unterbrochen. Zum Schluss brach er sich von den auf der Fensterbank stehenden Kakteen eine gelbe Blüte ab und steckte sie ins Revers.
Er fuhr in die Tiefgarage zurück und verließ mit einem anderen Auto den Parkplatz. Sein Ziel lag an der Peripherie von Panama City, wo in weitläufigen Parks versteckt die Villen der Reichen lagen. Hohe Metallgitterzäune, stachelige Hecken und Wachtposten mit Hunden sorgten dafür, dass die Bewohner ihren Reichtum ungestört genießen konnten.
Der Mann kannte die Gegend wie seine Westentasche, denn er war schon oft hier gewesen, teils offiziell, teils heimlich. Bei der fünften Querstraße bog er von der Landstraße in Richtung Pazifik ab, und nach einiger Zeit führte ein schmaler Schotterweg nach links – der Weg, der von der Müllabfuhr und von Lieferanten benutzt wurde.
Der Mann sah auf die Uhr. Es waren nur noch wenige Minuten bis zum verabredeten Zeitpunkt. Er bog in die Servicegasse, parkte seinen Wagen hinter der ersten Kurve, stieg aus und blickte sich um. Als er sicher war, nicht beobachtet zu werden, eilte er den Weg entlang. Nach etwa hundert Metern erreichte er eine kleine, hinter Rankgewächsen verborgene Tür. Was die Pforte an dieser Stelle sollte, war unklar. Irgendein Besitzer musste sie aus einer Marotte heraus angelegt haben. Vielleicht, um sich unbeobachtet zu einem heimlichen Rendezvous absetzen zu können. Was immer auch der Grund gewesen sein mochte, er war längst in Vergessenheit geraten. Niemand außer Kaktusblüte kannte die Pforte. Aber für sie und den Mann, der sie jetzt aufsuchen wollte, war sie ideal. bot sie doch eine gute Möglichkeit, sich in Panama City ungesehen treffen zu können.
Der Mann blieb stehen und lauschte. Als er nichts hörte, zog er einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete die Tür. Lautlos schwang sie auf. Die Scharniere waren frisch geölt. Vorsichtig zog der Mann die Pforte hinter sich zu und lauschte erneut. Sehen konnte er kaum noch etwas. Die Abenddämmerung war hereingebrochen und hatte den Park in Dunkel gehüllt. Aber er brauchte kein Licht, um sich zu orientieren. Er kannte sich hier aus. Geschmeidig huschte er zwischen den Palmen und Oleandersträuchern hindurch. Bis auf das leise Streichen der Blätter an seiner Kleidung war nichts zu hören.
Die Tür zum Pavillon stand offen. Der Mann huschte hinein und blieb einen Augenblick an der Tür stehen, um seine Augen an die Dunkelheit im Inneren zu gewöhnen.
»Kaktus«, flüsterte eine weibliche Stimme.
»Blüte«, antwortete der Mann mit dem vereinbarten Code.
Eine Frau trat hinter einem Ständer voll Orchideen hervor. Der Mann ging auf sie zu, zog die gelbe Kaktusblüte aus dem Knopfloch seines Revers und reichte sie der Frau. Der Schein einer halb abgedunkelten Taschenlampe blitzte auf und erlosch sofort wieder. Kaktusblüte hatte genug gesehen. Die gelbe Blüte in ihrer Hand gab ihr Gewissheit, dass der verkleidete Mann vor ihr tatsächlich derjenige war, mit dem sie sich verabredet hatte.
»Was gibt’s so Wichtiges, dass du mich sprechen willst? Du kannst dir doch denken, dass ich vor so einem Empfang keine Minute Zeit habe.«
»Es ging nicht anders. Ich habe eine Nachricht abgefangen. Danach hat der Präsident gedroht, die amerikanische Regierung in einen Skandal zu verwickeln. Weißt du, worum es sich handelt? Er hat die CIA öffentlich des Rauschgiftschmuggels bezichtigt. Was kann der Präsident in der Hand haben, dass er so etwas sagt?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
»Könnte er etwas von unseren Geschäften erfahren haben?«
»Das halte ich für ausgeschlossen. Wenn das der Fall wäre, hätte ich bestimmt etwas gehört«, antwortete Kaktusblüte selbstbewusst.
»Sei dir nicht zu sicher. Versuche herauszufinden, ob er nur blufft oder tatsächlich etwas in der Hand hat. Es könnte für uns lebenswichtig sein.«
»Du siehst Gespenster. Was der Präsident weiß, das weiß auch ich, aber ich werde der Sache nachgehen. Bis wann brauchst du die Information?«
»So schnell wie möglich. Kannst du versuchen, es beim heutigen Empfang herauszubekommen?«
Kaktusblüte überlegte einige Augenblicke. »Möglich, der Präsident ist bei solchen Anlässen meist sehr aufgeschlossen und redselig. Vielleicht kann ich etwas erfahren. Woher hast du die Nachricht?«
»Reiner Zufall«, antwortete der Mann ausweichend. Mit mahnender Stimme fügte er hinzu: »Versuch herauszufinden, was der Präsident im Schilde führt, und denk daran, auch dein Hals hängt mit in der Schlinge.«
Wäre es heller gewesen, hätte Springer sehen können, dass Kaktusblüte verächtlich lächelte, als sie antwortete: »Unsinn! Ich glaube, du siehst wirklich Gespenster. Wenn der Präsident etwas im Schilde führen würde, wüsste ich es längst. Vor mir hat er keine Geheimnisse.«
Springer unterdrückte einen Fluch. Er hasste die überhebliche Art der Frau. Aber er konnte wenig tun. Obwohl sie auf seiner Gehaltsliste stand und üppige Summen verschlang, ließ sie sich von ihm doch nur in begrenztem Maße leiten. Auch wenn sie ihn durch ihr Verhalten schon manches Mal zur Raserei gebracht hatte, vermied er alles, was sie verärgern könnte. Sie war nicht nur seine beste Informantin, sondern auch eine gute Geschäftspartnerin. Mit ihr und ihren Verbindungen war er groß ins Rauschgiftgeschäft eingestiegen und hatte so die nötigen Mittel für seine anderen Operationen beschaffen können. »Wann wollen wir uns treffen?«, fragte die Frau.
»Nach dem Empfang. Kannst du zu unserem Treffpunkt Nummer zwei in die Stadt kommen?«
»Unmöglich! Ich bleibe heute Nacht im Palast. Ich kann nicht fort. Wenn du etwas wissen willst, musst du zu mir kommen. Mein Fahrer wird dich abholen. Wann und wo soll er dich treffen?«
Springer knirschte mit den Zähnen. Er hasste diesen Treffpunkt. Erstens war er für seinen Geschmack zu gefährlich und zweitens zu anstrengend. Aber aus Erfahrung wusste er, dass sie sich davon nicht abbringen lassen würde. Trotzdem versuchte er es.
»Wenn dich nun der Präsident noch einmal sprechen will, dann …«
»Unsinn! Unser guter Julio wird sich nicht mehr melden. Er wird den Anlass wie gewöhnlich nutzen und sich, sobald die Gäste gegangen sind, mit seinen Saufkumpanen zu einer Pokerpartie zurückziehen. Vor ihm sind wir bis zum Morgengrauen sicher. Also, wann soll der Fahrer dich abholen?«
»Um ein Uhr am Hafen. Du weißt schon, wo.«
»Sagen wir Mitternacht, dann haben wir mehr Zeit füreinander.«
»Gut, um Mitternacht«, stimmte Springer widerstrebend zu.
»Dann bis heute Nacht.«
Kaktusblüte huschte an ihm vorbei und verschwand im Dunkeln.
Er wartete ein paar Minuten und verließ dann ebenfalls den Pavillon.
Auf direktem Weg kehrte er in sein Apartment zurück, demaskierte sich und suchte danach noch einmal sein Büro auf. Hier verschlüsselte er die Nachricht, die er am Nachmittag erhalten hatte, und setzte sie über eine normale Telefonleitung ab. Danach vernichtete er alle beschriebenen Papierbögen, einschließlich der Blätter, die er als Unterlage beim Schreiben benutzt hatte, in einem Reißwolf. Die Papierfetzen vermischte er noch einmal mit der Hand. Als Letztes verschloss er den Zettel mit der Meldung im Panzerschrank.
Eine halbe Stunde später war er zu Hause. Seine Frau empfing ihn schon ungeduldig.
»Mein Gott, Liebling, wo kommst du denn her? Du weißt doch, dass wir heute Abend noch weg müssen.«
Springer nahm seine Frau zärtlich in die Arme und küsste sie. »Ging nicht anders, Darling. Ich hatte noch einen späten Besucher. Wo sind die Kinder?«
»Oben, mit dem Babysitter. Willst du noch was essen? Es ist noch warm. Ich kann es dir schnell herrichten.«
»Das wäre lieb. Ich lauf nur eben zu den Kindern und sag ihnen gute Nacht.«
Zwei Stufen auf einmal nehmend, sprang er die Treppe zum ersten Stock hoch. Seine drei Söhne saßen vor dem Fernseher und sahen sich einen Western an. Ralph, der Fünfjährige, sprang, als er seinen Vater sah, auf und begrüßte ihn stürmisch.
Springer nahm ihn auf den Arm und fuhr seinen beiden anderen Söhnen liebevoll durch die Haare. Für einige Augenblicke unterhielt er sich mit ihnen, dann wünschte er ihnen eine gute Nacht und ging zur Küche hinunter.
Kapitel 3
Die gleichen Gedanken, die sich Springer über die Äußerungen des Präsidenten gemacht hatte, beschäftigten auch Bob Sounders. Auch er fragte sich, was Gomez dazu veranlasst haben könnte, die CIA so öffentlich des Rauschgiftschmuggels zu bezichtigen. Er musste irgendetwas in der Hand haben, was er gegen die Amerikaner verwenden konnte, etwas, womit er glaubte, sie erpressen zu können. Nur so ergaben seine Drohungen und Beschuldigungen einen Sinn. Die Frage war nur, was für ein Druckmittel besaß der Präsident? So sehr Bob auch nachgrübelte, er fand keine Antwort. Eigentlich hätte er es dabei bewenden lassen können, denn er hatte das Interview ja nur stellvertretend für den Mittelamerika-Korrespondenten aufgenommen. Doch er war zu sehr Journalist, um seine Neugier bezwingen zu können. Aber es kam noch etwas hinzu, was seinen Wunsch nach weiteren Nachforschungen verstärkte. Die Worte Rauschgift und CIA hatten ihm schlagartig das Gespräch mit seinem Freund von der Drogenfahndungsbehörde ins Gedächtnis zurückgerufen.
Nach einer Weile hatte er sich entschieden: Er würde bleiben und versuchen herauszubekommen, was hinter der ganzen Sache steckte.
Er holte sein Notizbuch aus dem Aktenkoffer und suchte nach der Telefonnummer seines Kollegen in Mexico City. Fairerweise wollte er ihn über seine Pläne informieren. Leider erreichte er Fred Marlin telefonisch nicht. Er teilte deshalb Freds Sekretärin seine Absichten mit und bat sie, ihren Chef sofort darüber zu unterrichten. Anschließend wählte er die Nummer des Mirror in New York und ließ sich mit dem Chefredakteur verbinden. Herb, der Chef, hörte sich Bobs Bericht an, ohne ihn zu unterbrechen. Als Bob geendet hatte, entschied er: »Selbstverständlich bleibst du unten und versuchst herauszufinden, was Gomez im Schilde führt. Das mit Fred regle ich. Er wird zwar fuchsteufelswild sein, aber das braucht dich nicht zu stören. Sieh du zu, dass du fündig wirst.«
Damit war sein Auftrag offiziell bestätigt, und er brauchte sich keinen Kopf zu machen, dass er einen Kollegen aus einer guten Story drängte. Denn sollte die CIA tatsächlich ins Drogengeschäft verwickelt sein, wäre das ein Riesenskandal. Doch bevor er mit den Nachforschungen beginnen konnte, war noch einiges zu erledigen.
Er bestellte sich ein Taxi und fuhr dann mit dem Fahrstuhl ins Foyer. Am Empfang war wenig Betrieb, er ging hinüber und wandte sich an einen der älteren Angestellten.
»Ich muss heute Abend zu einem Empfang und brauche dazu einen Gesellschaftsanzug. Wo kann ich so etwas auf die Schnelle bekommen?«
Für den Angestellten schien die Frage nicht ungewöhnlich zu sein. Ohne zu zögern, antwortete er: »Wir haben hier etliche gute Kaufhäuser. Sie können aber auch zu einem Schneider gehen, der fertigt Ihnen einen tadellosen Smoking in wenigen Stunden an. Ich …«
»Eigentlich wollte ich mir nichts kaufen, sondern leihen.«
»Das ist natürlich auch möglich.« Der Angestellte griff unter die Theke und holte einen abgewetzten Kasten voller Visitenkarten hervor. Nach einigem Suchen zog er eine heraus.
»Hier, gehen Sie zu Enrico Bolivar in die Avenida Belisario Porras. Wissen Sie, wo die Straße liegt?«
»Nein, aber ich nehme ein Taxi. Vielen Dank.« Er steckte die Visitenkarte ein und ging nach draußen. Sein Taxi wartete bereits unter dem Vordach des Hotels. Das war auch gut so, denn im Augenblick prasselte gerade wieder einer dieser Tropenschauer hernieder.
»Zum Hauptpostamt.«
Der Fahrer brauste los, als handle es sich um einen Notfall. Der Regen peitschte gegen die Windschutzscheibe, und die Scheibenwischer führten einen vergeblichen Kampf gegen die Wassermassen. Den Fahrer schien das nicht zu stören. Er raste mit unverminderter Geschwindigkeit durch die Straßen.
Als sie vor dem Hauptpostamt hielten, hatte sich der Regenschauer verzogen. Es fielen nur noch vereinzelte Tropfen, und die Sonnenstrahlen brachen wieder durch die Wolkendecke. In ein paar Minuten würden sie die Straßen in ein Dampfbad verwandeln.
Bob ließ das Taxi warten, während er das Tonband mit dem Interview nach Mexico City aufgab. Als er ein paar Minuten später wieder einstieg, zeigte er dem Fahrer die Visitenkarte.
»Kennen Sie diese Adresse?«
»Sì, Señor.«
»Dann los.«
Der Taxifahrer machte ein bedenkliches Gesicht und zeigte auf seine Armbanduhr. »Da werden Sie nicht viel Glück haben. Es ist gleich Siesta.«
»Wie lange geht die?«
Der Fahrer zuckte mit den Schultern. »Bis zwei oder drei Uhr, wer weiß?«
»Dann muss ich vor der Siesta dort sein. Fünf Dollar extra, wenn Sie es schaffen. Treten Sie aufs Gaspedal.«
Der Taxifahrer führte die Anweisung wörtlich aus. Mit quietschenden Reifen nahm er die Kurven. Bob, ganz im Gegensatz zu den meisten Amerikanern, genoss die Raserei.
Als sie die angegebene Adresse erreichten, war gerade ein junger Bursche dabei, den Laden abzusperren. Noch bevor das Taxi hielt, sprang Bob aus dem Auto und eilte auf den Mann zu. »Halt, ich brauche noch dringend etwas!«
Der Mann drehte sich langsam um und sagte abweisend: »Jetzt ist Siesta. Kommen Sie um drei Uhr wieder.«
»Das ist zu spät. Ich brauche einen Smoking. Es ist dringend.«
Der Mann zuckte gleichgültig mit den Schultern und ließ das Gitter herunter.
Der Taxifahrer war ebenfalls ausgestiegen und unterstützte Bob lautstark. Aber auch seine Bemühungen zeigten keinen Erfolg. Die Siesta schien dem jungen Burschen heilig zu sein. Erst als Bob seine Geldbörse hervorzog, keimte in seinen Augen Interesse auf. Und als Bob ihm einen Zehn-Dollar-Schein vor die Nase hielt, schloss er den Laden eilfertig wieder auf. Mit einem zuvorkommenden Lächeln bat er Bob einzutreten.
»Sind Sie Señor Bolívar?«, fragte Bob.
»Nein, ich heiße Manfredo. Ich arbeite hier. Señor Bolívar ist meistens in seinem Geschäft in der Altstadt.«
»Das erklärt alles.«
»Bitte?« Manfredo sah Bob verständnislos an.
»Vergessen Sie’s. Also, ich benötige einen Smoking, dazu Hemd, Schuhe, Krawatte, Manschettenknöpfe, halt alles, was dazugehört.«
»Für wie lange brauchen Sie es?«
»Einen Tag.«
Während Bob sprach, hatte Manfredo ihn aufmerksam gemustert. Jetzt drehte er ihn ein paarmal hin und her und sagte dann: »Ich glaube, ich müsste etwas in Ihrer Größe haben. Bevorzugen Sie etwas Klassisches, oder wollen Sie etwas Modernes?«
»Bringen Sie mir etwas Klassisches«, entschied sich Bob. »Meine Konfektionsgröße …«
»Die brauche ich nicht, Señor. Bitte warten Sie hier, ich bin gleich zurück.«
Manfredo verschwand hinter einer Tür an der Rückwand und tauchte nach fünf Minuten wieder auf. Über seinen Armen hingen die gewünschten Sachen.
»Sie können sie dort anprobieren«, sagte er und trug die Kleidungsstücke zu einer Ecke, die mit einem zerschlissenen Vorhang abgeteilt war.
Bob musterte die Sachen skeptisch, doch zu seinem Erstaunen schienen sie nahezu neu zu sein. Stück für Stück probierte er sie an. Manfredo hatte ein gutes Augenmaß, denn die Stücke passten ausgezeichnet. Selbst die Schuhe drückten nicht.
»In Ordnung, ich nehme alles«, sagte er zu dem jungen Mann. »Wie teuer ist die Leihgebühr für einen Tag?«
Manfredo nannte einen Preis, der Bob viel zu hoch erschien. Doch da alles auf Spesen ging, akzeptierte er die Summe.
Zufrieden, dieses Problem so schnell gelöst zu haben, ließ er sich zum Hotel zurückfahren. Bevor er ausstieg, beauftragte er den Taxifahrer, ihn Punkt acht Uhr abends abzuholen.