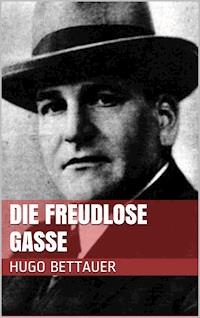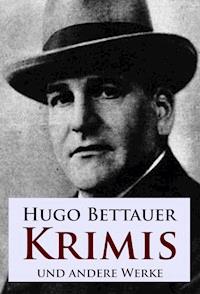Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses eBook: "Der Kampf um Wien" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Maximilian Hugo Bettauer (1872-1925), war ein österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Bettauer spezialisierte sich auf Kriminalromane mit sozialem Engagement. Populär wurden seine Romane auch dadurch, dass ihre Schauplätze nicht allein Wien, sondern auch New York und Berlin waren. Er gehörte damit nicht nur zu den umstrittensten, sondern auch erfolgreichsten Schriftstellern seiner Zeit. In der Verfilmung Die freudlose Gasse feierte Greta Garbo ihr internationales Leinwanddebüt. Aus dem Buch: "An einem Morgen des frühen Dezember stieg ein junger, großer, muskulöser Mann aus dem Schlafwagen des Paris - Bukarest Expreßzuges, der eben in die Halle des Westbahnhofes eingerollt war. Hinter ihm stand ein baumlanger Neger mit allerlei Handkoffern beladen, und beide, der Herr wie der Diener, wunderten sich. Der Neger, weil keinerlei Träger nahten, um ihm zu helfen, der Herr, weil er ein ähnliches Ungeheuer von Bahnhof, ein solch Konglomerat von Schmutz, Enge und Unzweckmäßigkeit noch nie erblickt hatte..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Kampf um Wien
Ein Roman von Tage: Die Entwicklung Österreichs von den 1920ern bis zum Anschluss an das Dritte Reich im Jahr 1938
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel. Flanagan kommt nach Wien und wundert sich.
Inhaltsverzeichnis
An einem Morgen des frühen Dezember stieg ein junger, großer, muskulöser Mann aus dem Schlafwagen des Paris – Bukarest Expreßzuges, der eben in die Halle des Westbahnhofes eingerollt war. Hinter ihm stand ein baumlanger Neger mit allerlei Handkoffern beladen, und beide, der Herr wie der Diener, wunderten sich. Der Neger, weil keinerlei Träger nahten, um ihm zu helfen, der Herr, weil er ein ähnliches Ungeheuer von Bahnhof, ein solch Konglomerat von Schmutz, Enge und Unzweckmäßigkeit noch nie erblickt hatte. Schließlich kam doch ein Träger, und der Herr wies auf das Gepäck des Negers und sagte in reinem, fließendem und doch fremd klingendem Deutsch:
»Hier mein Gepäckschein, beheben Sie die zwei Koffer, nehmen Sie das Handgepäck und besorgen Sie ein Auto.« Was der Träger darauf erwiderte, erschien dem jungen Mann ein absolut unverständliches Kauderwelsch, und erst als sich ein Bahnhofbeamter in die Unterhaltung mengte, erfuhr er, daß der Träger wohl die Koffer beheben, aber ein Auto nicht besorgen könne, weil er nicht das Recht habe, irgendwelchen Dienst außerhalb des Bahnhofes zu versehen. Worauf sich der Herr wieder wunderte und kopfschüttelnd nach einer Halle ging, die ihm eine Mischung von Schweinestall und Obdachlosenheim zu sein schien. Dort wartete er geduldig, bis die zwei großen Lederkoffer zum Vorschein kamen, dann gings ins Freie, wo ihn sofort Männer umringten und in einem Deutsch, von dem er wieder kaum hie und da ein Wort verstand, auf ihn einsprachen. Mittlerweile wurde das Gepäck herangerollt, und die kleinen und großen Koffer konnten endlich auf ein Mietauto verstaut werden, worauf der Neger sich neben den Chauffeur setzte, während der Herr im Kupee Platz nahm und als Ziel das Hotel Imperial angab.
In flotter Fahrt ging es die Mariahilferstraße abwärts, und der junge Mann im Wagen flog auf und nieder und lachte vergnügt vor sich hin, weil es ihm ein ganz Neues war, in einem Auto mit zersprungenen Federn über ein Pflaster, das aus Hügeln und Gruben zu bestehen schien, zu fahren. Er wollte ein Fenster herablassen, aber das ging nicht, weil der Griff abgebrochen war, und so begnügte er sich damit, mit dem Lederhandschuh die Feuchtigkeit von der Glasscheibe, die einen Sprung hatte, zu wischen und so einen Ausblick auf die Straße zu gewinnen. Es war neun Uhr und viele Leute gingen die Straße entlang, aber der junge Mann vermißte das Großstadttempo, es schien ihm, als ob alle diese Männer und Frauen einen schleppenden Gang hätten, als ob niemand in Eile wäre. Hie und da gingen Menschen langsam statt auf dem Bürgersteig auf dem Fahrdamm, und dann dröhnte warnend und mißtönig die Autohupe, und die Bedrohten fluchten und sprangen in komischem Zickzack hin und her, bis sie in Sicherheit waren. Der junge Mann lächelte vergnügt und dachte: Dies gehört wohl zur Gemütlichkeit, die ja in Wien ihre Heimat haben soll! Ich werde mich an vieles gewöhnen, vieles verstehen lernen müssen.
Nun kam ein kurzes Stückchen Ring und dann der freie, große Schwarzenbergplatz, aber vorher schon querte das Auto die Ringstraße und hielt vor dem Hotel Imperial. Männer mit grüner Schürze kamen heran, halfen beim Aussteigen und belehrten den Fremden, daß er den neuntausendfachen Betrag von fünf Kronen vierzig Heller zu bezahlen habe plus einem Trinkgeld, dessen Höhe in seinem Belieben stehe. Der junge Herr lachte hell auf, weigerte sich aber, auf der Straße bei eben einsetzendem leichten Regen die schwierige Multiplikation vorzunehmen, sondern überließ die Ordnung der Angelegenheit dem inzwischen herbeigekommenen Portier, einem älteren Mann von respektablem Exterieur mit goldbetreßter Mütze. Aber er wunderte sich abermals, denn das Wort Trinkgeld, dessen Bedeutung ihm trotz gründlicher Beherrschung der deutschen Sprache fremd war, beschäftigte ihn und er beschloß, recht bald in Erfahrung zu bringen, warum Leute in Wien Geld bekommen müssen, wenn sie Durst haben. Und dunkel erinnerte er sich, gehört zu haben, daß Wien ein ganz besonders gutes Quellwasser habe. Arme Stadt, dachte er, die ihren Bewohnern das Trinkwasser verkaufen muß.
Im Hotelbureau verlangte der Fremde, nach seinen Zimmern geführt zu werden.
»Ja, welche Zimmer wünschen der Herr?« fragte mit einem Blick auf den Neger, der einen sicheren Schluß auf den Reichtum des Passagiers ziehen ließ, sehr höflich ein Herr im schwarzen Gehrock, der Direktor genannt wurde.
»Nun«, erwiderte ein wenig gereizt der Fremde, »ich habe doch gestern nachts von Salzburg aus mich telegraphisch angemeldet.«
»Haben der Herr die Depesche dringend oder gewöhnlich aufgeben lassen?«
»Dringend oder gewöhnlich? Das verstehe ich nicht! Ich denke, daß jede Depesche dringend ist.«
Der Direktor lächelte diskret.
»Jawohl, mein Herr, aber bei uns in Österreich werden gewöhnliche Depeschen sehr oft per Post befördert und dann kommt es vor, daß sie ebenso lange, wenn nicht länger, unterwegs sind als ein Brief.«
Der Fremde riß den Mund vor Erstaunen auf.
»Wissen Sie, was das nach unserem primitiven amerikanischen Menschenverstand ist? Ein ganz gemeiner Betrug, eine infame Gaunerei! Und wenn so etwas die Western Union täte, so ließe ich ihren Manager glatt wegen Betrug und Herauslockung von Geld unter falschen Vorspiegelungen verhaften.«
Der Direktor war froh, endlich erfahren zu haben, daß der Herr ein Amerikaner sei und sein Lächeln wurde noch verbindlicher.
»Sir, bei uns ist das Telegraphenwesen verstaatlicht und der Staat –«
»Kann seine Bürger wie er will betrügen«, ergänzte der Amerikaner. »Aber nun sagen Sie, kann ich bei Ihnen Zimmer bekommen oder nicht?«
»Bitte sehr, mein Herr, natürlich, Zimmer, wie viele Sie wollen. Es kommen ja fast keine Fremden, alles stagniert – ja, früher, vor einem Jahr, da hätte der Herr von Hotel zu Hotel fahren müssen. Wünschen ein Zimmer allein oder eines mit Bad?«
»Für meinen Diener eines mit Bad, und für mich ein Appartement, Schlafzimmer und Parlor und selbstverständlich auch ein Badezimmer. Muß nicht groß sein, aber einigermaßen behaglich.«
Das Wort Parlor – die amerikanische Bezeichnung für Salon – erfüllte den Direktor mit Genugtuung und er führte den Amerikaner und dessen schwarzen Diener mit dem Lift in das zweite Stockwerk. Dort überlegte er einen Augenblick, dann öffnete er zögernd eine Tür.
»Dies wäre unser schönstes Appartement. Hier ein kleiner Vorraum mit separater Garderobe, dann dieser Salon, ein Schlafzimmer und anstoßend das Badezimmer.«
Der Amerikaner war von der distinguierten Eleganz, mit der die Räume möbliert waren, angenehm berührt.
»Nehme ich! Und nun bringen Sie in meiner nächsten Nähe meinen Diener Sam unter!«
Um allen späteren Weiterungen vorzubeugen, beschloß der Direktor, gleich jetzt den Preis zu nennen. »Das Appartement ist eigentlich für zwei Personen berechnet und ein wenig kostspielig. Mit dem Dienerzimmer zusammen würde ich bei längerem Aufenthalt zwei Millionen pro Tag in Anrechnung bringen.«
Der Gast erschrak zuerst, als er diese ungeheuerlich klingende Summe hörte. Dann lachte er hell auf.
»Beinahe dreißig Dollars! Na, ungefähr der New Yorker Preis. Mit der Wiener Billigkeit, von der mir drüben so viel erzählt wurde, scheint es ja vorbei zu sein.«
»Jawohl mein Herr, wir haben die Weltparität erreicht, vielfach sogar überschritten und daher eben die Stagnation, die Wien noch ganz zugrunderichten wird. Ich werde nun die Koffer heraufschicken.«
Ein paar Minuten später war Sam in voller Tätigkeit. Das Handgepäck wurde aufgeschnürt, der Liegekoffer geöffnet, der Schrankkoffer aufgestellt, zischend floß das heiße Wasser in die Badewanne und Sam goß über den schlanken, von der Hitze des Wassers geröteten und dampfenden Körper seines Herrn flüssige Seife, Bayrum und reinen Alkohol und begann zu kneten und zu reiben, daß ihm der Schweiß über die schwarze Stirne floß und sein Herr stöhnte. Während er ihm dann den Seifenschaum über das Kinn pinselte, sagte er vergnügt grinsend im breiten Negerenglisch:
»Master Ralph, Wien gute Stadt sein tut.«
»Warum das, Sam?«
»Draußen war hübsches weißes Mädchen mit blondem Haar, auf dem komische Haube saß. Immer, wenn ich vorbeiging, hat sie mich angelacht, so daß ich Mut bekam und sie in Arm zwickte. O Master, Arm war weich und fein! Und das Mädchen hat nicht mit dem Fuß nach mir gestoßen, sondern mir nur Schlag mit kleinen Patschhändchen gegeben und gelacht. Master, glauben Sie, daß Wiener Mädchen mich lieben werden?«
Der Herr platzte belustigt heraus:
»Sam, paß auf, mach’ mir keine Unannehmlichkeiten hier im Hotel! Aber du hast recht, wenigstens hat man mir schon auf dem Schiff erzählt, daß sich deine farbigen Brüder bei den deutschen Mädchen durchaus keiner Unbeliebtheit erfreuen.«
»Werde ich also probieren, Master«, sagte Sam und verdrehte in Erwartung kommender Freuden die Augen und grinste, daß die schneeweißen Zähne zwischen den wulstigen brennroten Lippen hervorleuchteten.
Sam durfte sich mit seinem Herrn schon einige Frechheiten erlauben, denn er war sein Milchbruder, das heißt, Sams Mutter war die Amme des jungen Amerikaners gewesen.
Der Amerikaner war nun angezogen, besah im Spiegel seine schlanke, in einen dunkelblauen Cheviotanzug gekleidete Gestalt und das glattrasierte Gesicht, aus dem die braunen Augen klug und freundlich blickten. Er strich nochmals die hellbraunen seidenweichen Haare mit der Bürste zurück, dann ließ er sich von Sam in einen hellgrauen mit Biber gefütterten Tuchpelz helfen, setzte den grauen Seidenplüschhut auf und ging voll Erwartung hinunter, um die ihm neue Stadt zu betreten, das ihm neue, fremde Leben kennen zu lernen und in einer Welt unterzutauchen, von der er sich das große Erlebnis, die hohe Mission und die Ergründung des Menschentums versprach.
In der Halle hielt ihn der Portier mit der Bitte auf, den Meldeschein auszufüllen. Wieder wunderte der Amerikaner sich. Was geht andere Menschen meine Religion, mein Alter an? Warum nicht gleich mich nach meiner Gesinnung, meinen politischen Anschauungen und Neigungen fragen? Doch er füllte mit großen, steilen, festen Buchstaben den Schein aus.
Patrick Ralph O’Flanagan, geboren 1892 zu St. Paul in Minnesota, Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika, katholisch.
Nun war noch die Rubrik »Beruf« frei. Der Amerikaner zögerte einige Sekunden und überlegte. Wie sollte er diese Frage beantworten? Mit »Vergnügungsreisender« etwa oder »Privatier?«
Beides würde der Wahrheit entsprechen, aber doch nicht ganz, denn eigentlich war er ja, bevor er nach Europa fuhr, Präsident der »American Wood-und Forest Trust Company« geworden. Und da Patrick Ralph O’Flanagan sich, soweit es ging, gerne an die volle Wahrheit zu halten pflegte, schrieb er diesen Titel hin. Ohne zu ahnen, welch verhängnisvolle Tat er damit beging und wie sehr er sein ganzes Leben beeinflußte.
2. Kapitel. Wie Ralphs Mutter einen Amerikaner geheiratet hatte.
Inhaltsverzeichnis
Es hatte aufgehört zu regnen, der Himmel war blau geworden, und fahle kühle Sonnenstrahlen beleuchteten den Dezembertag.
Ralph O’Flanagan stand vor dem Hotel, ließ den Blick nach links und rechts schweifen, und das Bild, das sich ihm bot, war von so eigenartiger Lieblichkeit, wie er es nach der Fahrt im schäbigen Autotaxi wirklich nicht vermutet hatte. Er querte den Ring, ging bis zur Oper und betrachtete mit hellem Entzücken und unverdorbenem primitiven, aber um so echteren Verständnis den harmonischen Bau und freute sich auf die Kunstgenüsse, die er ihm bieten würde. Oft genug hatte ihm ja seine Mutter von der Wiener Oper, von der Bild und der Schläger, dem Winkelmann und Reichmann erzählt. Und immer hatten ihre Augen vor Stolz dabei geleuchtet, so daß einmal sein Vater mit schneidendem Hohn ausgerufen hatte:
»Machst ja gerade, als hätte die Oper dir gehört!«
Ralph O’Flanagan bog, nachdem er einen Taschenplan zu Hilfe gezogen, in die Kärntnerstraße, und nun erst empfand er es, in einer Großstadt zu sein. Die Straße fast so belebt wie das New Yorker Tenderloin, elegante Herren, schöne Frauen in kostbaren Pelzen, nach der neuesten Mode gekleidet, geschmackvolle Auslagen, gefüllt mit den besten und schönsten Erzeugnissen Wiener Schneider-und Modekunst.
Ralph lächelte und zog einen Vergleich. Die New Yorker Damen traten mit mehr Selbstbewußtsein auf, diese Wienerinnen aber da mit entschieden mehr Grazie. Und wie sie mit ihren großen, schelmischen Augen zu flirten verstanden! Ralph errötete unter dem Kreuzfeuer von Blicken, die mit Wohlgefallen an ihm hängen blieben, und wieder mußte er seiner Mutter gedenken.
»Kokett sind ja die Wiener Mädeln«, hatte sie einmal gesagt, »auch leichtsinnig, aber dabei gut und lieb.«
Schon fühlte sich Ralph vom Tempo des Wiener Lebens erfaßt, langsam wie noch nie in seinem Leben schlenderte er bis zum Stephansplatz, blieb mit weit aufgerissenen Augen vor dem Dom stehen und schloß sich dann dem Mittagsbummel auf dem Graben an. Aber seine Gedanken waren nicht mehr in der neuen Stadt, flogen weit zurück übers Meer und den halben amerikanischen Kontinent, zur toten Mutter, zum freudlosen, nüchternen Elternhaus, zu seinem früheren Leben, aus dem er mit einem jähen Ruck gerissen worden war.
Patrick Ralph O’Flanagan war als das einzige Kind des Sägewerksbesitzers John Patrick O’Flanagan und dessen Gattin Lola, geborene Holub, in St. Paul, der größten Stadt des nordwestlichen Staates Minnesota, aufgewachsen. Sein Vater ein Hüne, Typus des Irländers mit Stiernacken, breiten Schultern, mächtigen Fäusten, trockenem Witz und eisernem Schädel. Die Mutter klein, zierlich, mädchenhaft auch noch mit vierzig Jahren. Und wenn der Vater einen Jähzornanfall bekam und zu brüllen begann, dann wurden ihre großen blauen Augen ganz dunkel und feucht, sie erzitterte am ganzen Leib wie ein junges Reh, und später, als Ralph zwölf und mehr Jahre alt geworden, geschah es oft, daß Frau Lola wie hilfesuchend den Arm ihres Sohnes ergriff, wenn der Vater harte Worte sagte.
Mutter hatte aber neben tausend lieben, guten Eigenschaften auch eine sehr drollige, über die Ralph jetzt, mitten am Wiener Graben, bei der Erinnerung laut auflachen mußte. Mutter hatte nämlich nie ordentlich die englische Sprache erlernen können! Wohl konnte sie sich mit jedermann vollständig und leicht verständigen, jedes englische Buch glatt lesen, aber ihrem Englisch haftete ein entschiedenes Wienerisch-Deutsch an, und wenn sie in Aufregung geriet oder vor ihrem großen, mächtigen Mann Angst hatte, vergaß sie die englische Sprache ganz und produzierte ein Kauderwelsch, über das sich der kleine Ralph krank lachen konnte, der Vater aber erst recht in Tobsucht geriet. Mama sagte ihrem Jungen, wenn sie mit ihm allein war, immer wieder auf deutsch:
»Ralpherl, weißt, ich hab’ ja schon so gut englisch sprechen können, aber später, wie ich mit O’Flanagan ein paar Wochen verheiratet war, hab’ ich alles wieder vergessen.« Wobei zu bemerken ist, daß seine Mutter von ihrem Gatten nie anders als »der O’Flanagan« sprach.
Mamas Geschichte hatte sich folgendermaßen abgespielt:
Der in Fachkreisen sehr bekannte Wiener Architekt Rudolf Holub hatte im Jahre 1889 von einer großen amerikanischen Gesellschaft den ehrenvollen Auftrag erhalten, herüber zu kommen, um sich am Bau einer mächtigen Brücke über den Delaware zu beteiligen. Und da Rudolf Holub ein armer Teufel trotz seines Ruhmes war und das amerikanische Angebot materiell sehr verlockend, so nahm er an und fuhr mit seiner Frau und dem kaum siebzehnjährigen Töchterchen Lola nach Amerika. Frau und Tochter blieben in New York in einer netten deutschen Pension, Architekt Holub aber fuhr mit den übrigen Architekten, Zeichnern und Ingenieuren dorthin, wo die Brücke gebaut wurde.
Einen einzigen Brief bekam seine Frau von ihm: In diesem Brief hieß es:
»Mir ist bange nach Euch, so bange, wie ich es gar nicht sagen kann. Alles erscheint mir hier wild, so roh und brutal. Der Wind wird zum Orkan, der Regen zum Wolkenbruch, Sonnenwärme zur Höllenqual. Es ist, als wollte sich die amerikanische Erde gegen den weißen Eindringling zur Wehr setzen. Mir ist gar nicht wohl zu Mute, dumme, haltlose Träume und Ahnungen bedrücken mich.«
An einem Montag hatte Frau Holub diesen Brief bekommen und am folgenden Dienstag erschien einer der Manager der Gesellschaft bei ihr und teilte ihr mit, daß ihr Gatte am Samstag von einem gestürzten Eisenpfeiler erschlagen worden sei. Er kondolierte herzlich und außerdem gab er der Witwe noch einen ganzen Wochengehalt, wobei er versicherte, daß Amerikaner nobel seien.
Und Frau Holub stand, der englischen Sprache nicht mächtig, mit ihrem zarten, bildschönen Töchterchen, das hübsch singen und etwas klavierspielen, aber sonst auch gar nichts konnte, mittellos im fremden Lande da.
Die kleine Lola entwickelte ungeahnte Energien. Nachdem sie sich ausgeweint hatte, begab sie sich eines Tages im Oktober nach der vierzehnten Straße, bog auf den Irving Place ein und blieb mit hochklopfendem Herzen vor einem recht schäbigen Theatergebäude stehen, dessen bunte Reklamezettel besagten, daß hier die Direktoren Gustav Amberg und Heinrich Conried Theater spielen. Lola hatte nämlich am Tag vorher in der Staatszeitung gelesen, daß das deutsche Theater durch die Erkrankung zweier weiblicher Mitglieder in arge Verlegenheit geraten sei und besonders das Operettenrepertoire sehr würde leiden müssen. Worauf Lola sich im Spiegel besah, feststellte, daß sie auch im schwarzen Fähnchen sehr reizvoll aussehe, sich im Parlor der Pension an das Klavier setzte, ein paar Töne anschlug und abermals befriedigt konstatierte, daß ihre Stimme gut und hell klinge.
Und nun stand Lola vor dem Theater, hatte Herzklopfen und traute sich nicht hinein. Bis ein freundlicher Mann mit mächtigem Schnurrbart vor ihr stand und nach ihrem Begehr fragte. Es war dies der sehr einflußreiche und wichtige Theaterdiener Herr Steinberg, ehemaliger k. k. Sicherheitswachmann in Wien! Da Steinberg das Mädchen nicht in der verhaßten englischen Sprache anredete, sondern »Freil’n« sagte, wurde sie zutraulich und erklärte, ein Engagement zu suchen. Worauf Steinberg sie ohneweiters beim Arm packte und in die Direktionskanzlei führte, in der eben Herr Amberg und Herr Conried einander die furchtbarsten Grobheiten an den Kopf warfen.
Fünf Minuten später stand Lola auf der Bühne, um, von dem Wiener Kapellmeister Lehner begleitet, das Liedchen zu singen:
»Weißt du Mutterl, was mir träumt hat…«
Abermals fünf Minuten später war Lola mit der schandbaren Gage von zwanzig Dollar wöchentlich als Soubrette an das Irving-Place-Theater engagiert.
Den Wert oder Unwert dieser Summe durchaus nicht erkennend, lief Lola beglückt nach Hause und fiel ihrer vergrämten und abgehärmten Mutter jubelnd um den Hals. Die Witwe lauschte der Botschaft, rote Flecken traten in ihre mageren Wangen, sie griff sich mit den wachsgelben Händen ans Herz und sagte: »Kind, du mußt aber brav bleiben, auch wenn ich nicht mehr bin.«
Einige Wochen später, zwei Tage nachdem Frau Holub einem Herzleiden erlegen war, stand Lola auf den Brettern, die ihr die Rettung bedeuteten, und sang in der Fledermaus den Prinzen Orlowsky. Davon, daß sie in den Pausen schluchzte und von den mitleidigen Kollegen mit Whisky gelabt werden mußte, hatte das Publikum, dem die kleine Soubrette sehr gut gefiel, keine Ahnung.
3. Kapitel. Der Mann aus dem Westen.
Inhaltsverzeichnis
So vergingen zwei, drei Monate mit ewigen Geldnöten und harten Versuchungen, sich eines neuen Hutes halber zu verkaufen, bis eines Sonntags abends ein sonderbarer Zufall in Gestalt des wohlhabenden Sägemüllers John Patrick O’Flanagan dem Leben der kleinen Lola eine merkwürdige Wendung gab.
John Patrick O’Flanagan war ein Irländer, der als junger Bursch nach Amerika ausgewandert war, sich zuerst jahrelang als Holzfäller im Westen herumgetrieben hatte, bis er durch zähen Fleiß, Schlauheit und eine tüchtige Portion Skrupellosigkeit zu eigenen Waldungen, erheblichem Wohlstand und einem schönen Haus in St. Paul gekommen war. Er war unbeweibt geblieben, einerseits weil er keine Zeit gehabt hatte, sich um Frauen zu kümmern, anderseits aber weil er eine instinktive Furcht hatte, sich unter das Joch einer amerikanischen Frau zu begeben, die, wie er überzeugt war, der Teufel erfunden hatte, um die Männer zu kujonieren.
Und nun war John Patrick nach vielen Jahren zum erstenmal nach dem Osten gekommen, hatte in Philadelphia große Verträge abgeschlossen und war dann nach New York gefahren, um mit den Direktoren der Erie-Eisenbahn wegen Lieferung von Eisenbahnschwellen für zehntausend Kilometer Strecke abzuschließen.
Eines Sonntags unmittelbar nach dem Neujahrstag schlenderte der Mann aus Minnesota durch die Straßen und langweilte sich, wie sich ein Fremder nur im amerikanischen Osten langweilen kann. Die Kneipen geschlossen, die Theater und Variétes desgleichen, die Straßen wie ausgestorben, da der biedere New Yorker der Ansicht ist, ein anständiger Mensch habe am Sonntag zu Hause zu sitzen und zu beten.
Es war neun Uhr abends und John Patrick beschloß eben, innerlich einen derben irisch-wildwestlichen Fluch ausstoßend, das Hotel Netherland aufzusuchen, in dem er wohnte, als ihm an der Ecke der vierzehnten Straße und des Irving Place so etwas wie Musik in die Ohren tönte. Neugierig folgte er diesem Klang und kam so vor das deutsche Theater, vor dem Plakate in Englisch und Deutsch ankündigten, daß als »Sacred-Concert« mit Gesangseinlagen der »Rabenvater« gegeben werde. Es war damals nämlich ein Privilegium des deutschen Theaters, mit Rücksicht auf die Lebensgewohnheiten der Deutschen auch am Sonntag zu spielen, nur mußte ein frommes Mäntelchen umgenommen werden und jede Vorstellung den Charakter eines »Kirchenkonzertes« haben. Das heißt, es durften keine Kostümstücke gegeben werden und zwischen den Akten wurden allerlei höchst unheilige Lieder und Couplets gesungen, so daß die Polizei, wenn sie die Augen zudrückte und die Hände dafür offen hielt, wirklich an ein Kirchenkonzert glauben konnte.
John Patrick O’Flanagan sprach zwar außer »Sauerkraut« und »Frankfurter« kein Wort deutsch, aber dachte, deutscher Gesang sei immerhin besser als keiner, ging zur Kassa und verlangte den besten Sitz, worauf der Kassier, ein ehemaliger österreichischer Generalstabsoffizier, ihm mit großer Ehrfurcht den Platz in der Orchesterloge, ganz dicht neben der Bühne, verkaufte.
Der erste Akt war eben zu Ende und ein Herr in einem schlechtsitzenden Frack sang mit schmalziger Stimme eine endlose Arie, die den Mann aus dem Westen zu heftigem Gähnen veranlaßte. Nach dieser Nummer wurde er aber ganz lebendig. Die Bühne betrat in einem blaßblauen, nur wenig ausgeschnittenen Kleidchen bescheidenster Art ein junges, blondes Mädchen, das wie eine kleine Puppe aussah und mit unwahrscheinlich veilchenblauen Augen schüchtern in das Publikum sah. Flanagan hatte, wie die meisten großen und robusten Männer, eine besondere Vorliebe für das Zarte und Kindhafte und außerdem war er sofort überzeugt, noch nie in seinem Leben ein so liebliches Ding und so blaue Augen gesehen zu haben. Das Mädchen sang mit zarter, aber wohlklingender Stimme ein paar Wiener Lieder, das unvermeidliche »Weißt du Mutterl, was mir träumt hat« und »Muß ja net alles von Gold sein was glänzt«, und Flanagan, der natürlich nicht ein Wort verstand, setzte seine mächtigen Hände in Bewegung, klatschte wie toll, pfiff und trampelte dazu mit den Füßen, was in Amerika besonderen Enthusiasmus bedeutet, so daß die Sängerin einen erschreckten, großen Kinderblick auf ihn richtete und sich vor ihm nochmals besonders verbeugte.
Worauf O’Flanagan über und über rot wurde und ein so heftiges Herzklopfen verspürte, wie bisher nur einmal in seinem Leben, als er sich vor Jahren irgendwo in Wisconsin plötzlich allein zehn Rothäuten gegenübersah, die stürmisch nach seinem Skalp begehrten.
Die kleine Sängerin trat ab, O’Flanagan stellte mit Mühe und Not aus dem Programm fest, daß sie Lola Holub hieß, und als nach ihr eine imposante Germanin aus Berlin erschien, die sich während des Singens abwechselnd auf den vollen Busen und die mächtigen Schenkel schlug, ergriff er die Flucht.
Nach einer sehr unruhigen Nacht, in der ihm im Traume mehrfach die kleine deutsche Sängerin erschien, wickelte O’Flanagan seine Geschäfte erfolgreich ab, wobei er so zerstreut war, daß er die Direktoren noch mehr um die Ohren haute, als er eigentlich beabsichtigt hatte. Die übrigen Tagesstunden verbrachte er in nervöser Unruhe und abends war er eine viertel Stunde vor Beginn in der Orchesterloge des deutschen Theaters, wo irgend ein Lustspielschmarrn gegeben wurde. Er hatte Glück. Lola Holub war in dem Stück beschäftigt, sie gab einen der üblichen Backfische, die sich einbilden, daß der Leutnant die Kinder bringt, und hatte zwar nicht viel zu sprechen, war aber fast in jeder Szene auf der Bühne. Und unwillkürlich flog der Blick ihrer blauen Augen immer wieder zu dem großen Herrn in der Loge hin, der am Abend vorher seinem Beifall so laut Ausdruck gegeben.
O’Flanagan schwitzte vor Aufregung. Er wußte, daß er unbedingt noch heute diese Lola Holub kennen lernen mußte. Unbedingt und um jeden Preis. Und wenn John Patrick etwas wollte, so hatte er es noch immer durchgesetzt. Aber dieser Fall erschien ihm schwieriger als jeder bisherige. Wie lernt man eine Künstlerin kennen? Dieses Problem war ihm vollständig unbekannt. Plötzlich aber erinnerte er sich, einmal in einem Fünfcentroman gelesen zu haben, wie ein Graf einer Tänzerin seine Visitkarte mit einer Einladung zum Souper hinter die Bühne schickte. Also, er war kein Graf, aber dafür ein freier Amerikaner, der Geld hatte.
Sofort nach Schluß der Vorstellung begab er sich ins Foyer und erwischte einen langen, mageren Billeteur, den er ansprach. Dieser Theaterdiener war nun ein aus Wien durchgebrannter Hof-und Gerichtsadvokat namens Mansch und sofort im Bilde, als der Amerikaner ihm eine Fünfdollarnote in die Hand drückte und dabei etwas von Souper und Miß Lola Holub sprach. Er versicherte Flanagan in einem unmöglichen Englisch, daß die junge Dame höchst ehrbar sei, worüber Flanagan sehr erfreut war, er aber trotzdem sein Äußerstes tun werde.
Und Flanagan war wieder vom Glück begünstigt. Lola Holub hatte nämlich Hunger, den ausgewachsenen, gesunden Hunger eines jungen Mädchens, das um sieben Uhr in der Pension einen Schlangenfraß mit Unwillen verzehrt hatte und jetzt kein Geld besaß. Nicht einmal elende fünf Cents, für die es sich irgendwo eine Tasse Kaffee hätte kaufen können. Als ihr nun der ehrenwerte Doktor Mansch die Einladung zum Souper überbrachte, lief ihr das Wasser in ihrem kleinen Mäulchen zusammen, und vage Vorstellungen von einem Beefsteak oder gar Hummer benebelten ihre Sinne. Da zudem Frau Pietsch, die komische Alte, ihr in tiefem Baß zuredete: »Kleine, sein Sie nicht dumm, von einem Souper hat noch niemand ein Kind bekommen«, gab Lola sich einen Ruck, sagte sich: »Ach was, es ist wirklich nichts dabei, er sieht doch recht gutmütig aus« und nahm an.
Der Abend verlief sehr merkwürdig. Die beiden saßen in einer behaglichen Ecke des deutschen Restaurants Lüchow, Lola aß Hummer und Steak und eine beinahe echte Sachertorte, und Flanagan wischte sich ununterbrochen den Schweiß von der Stirne und schüttelte ein Krügel Pschorr nach dem anderen in sich hinein. Darin bestand aber auch die ganze Unterhaltung, da sie nicht englisch und er nicht deutsch sprach. Erst gegen Mitternacht trat als belebendes Moment die Tatsache hinzu, daß O’Flanagan ein Händchen Lolas streichelte, wobei ihm seltsam rührselig zu Mute wurde und ihr ein Tränchen in die Augen trat, weil seit Mutters Tod niemand so sanft und zart ihre Hand gestreichelt hatte. Die Kollegen – na ja, die griffen anders zu, gemein, brutal und gierig, um sie, wenn sie abwehrte, eine dumme, zimperliche Gans zu nennen.
Schließlich geleitete der Riese die kleine Lola bis zu ihrem Haus und verabschiedete sich von ihr, indem er zehnmal mit gepreßter Stimme »Au revoir« sagte.
Am nächsten Tag aber da geschah etwas, was Lola als echt amerikanisch empfand. Sie bekam in aller Herrgottsfrüh einen riesigen Korb mit roten Rosen und einen Brief, in dem ein Scheck auf 1000 Dollar lag. Der Brief lautete nach der Übersetzung durch die Pensionsinhaberin, die von Lola zu Hilfe gerufen werden mußte, folgendermaßen:
»Mein liebes Fräulein Holub! Ich bin gesund, fünfunddreißig Jahre alt, habe ein schönes Heim in St. Paul und eine Menge Geld. Sie gefallen mir sehr gut, und ich möchte Sie heiraten. Wenn Sie auch wollen, so bitte ich Sie, von der Bühne fortzugehen und Englisch zu lernen. In drei Monaten, zu Ostern, werde ich wieder in New York sein und Sie fragen. Heute muß ich zurück nach St. Paul. Also auf Wiedersehen im April.
Ihr Sie sehr verehrender John Patrick O’Flanagan.
P.S. Ich werde versuchen, auch Deutsch zu lernen. Aber ich glaube, es wird nicht gehen.«
Lola, voll Angst vor der Zukunft, im Bewußtsein, durchaus kein großes Bühnentalent zu sein, mit Schrecken an das Ende der Theatersaison denkend, überlegte nicht lange. Ging von der Bühne ab, nahm eine Lehrerin und verbrachte die ganzen Tage damit, sich mit Vokabeln und einer Aussprache vertraut zu machen, die ihr überaus unsympathisch waren.
Am Ostersonntag erschien tatsächlich John O’Flanagan in New York, machte ihr seinen Besuch im Salonrock, fand ihr Englisch drollig und entzückend, durfte sie küssen und am Dienstag im Rathaus heiraten.
So war aus einem Wiener Kind plötzlich Mrs. Lola O’Flanagan geworden.
4. Kapitel. Der reichste Mann der Welt.
Inhaltsverzeichnis
Die Ehe verlief nicht so, wie es Lola gehofft, ihr Gatte erwartet hatte. Die beiden kamen einander nicht näher. Die Verschiedenartigkeit der Charaktere, der Vergangenheit, der Bildung, der Sprache und Abstammung waren zu groß, ließen sich nur solange überbrücken, als der erste Rausch der Sinne, den sie nie ganz teilen konnte, anhielt. Dann wußte Flanagan mit seiner kleinen Frau, die gerne Bücher las und Klavier spielte, nichts anzufangen. Irgendwie war er voll Mitleid mit diesem kleinen exotischen Vögelchen, irgendwie empfand er es auch mit seinen robusten Nerven, daß Lola nicht zu ihm, nicht nach Minnesota, nicht nach Amerika gehörte. Und wie es oft zu geschehen pflegte, wandelte sich das Mitleid in Groll, und wenn er grollte, wurde er laut, und wenn er dann sah, wie seine junge Frau erschrak und zu zittern begann, wurd er erst recht heftig.
Eine große Rolle spielte naturgemäß die Tatsache, daß Lola nicht Englisch genug konnte, um sich ihm gegenüber restlos verständlich zu machen, ihm zu sagen, was die Sprache nur in ganz umschriebener Weise ausdrücken kann. Als eines Tages Flanagan in einem häßlichen Wutanfall von ihr als einem »Dutch woman« sprach und es als Schande bezeichnete, daß sie Englisch noch immer nicht perfekt konnte, da begann Lola ganz verwirrt zu werden und, so sonderbar es klingen mag, keine Fortschritte im Englischen zu machen, sondern Rückschritte.
Als nach zweijähriger Ehe der kleine Patrick Ralph geboren wurde, besserte sich vorübergehend das Verhältnis der Gatten, aber sowie das Kind groß genug war, um durch ein Ausstrecken der Ärmchen zur Mutter oder zum Vater seine größere Sympathie zu bezeugen, wurde die Entfremdung noch stärker. Lola überströmte mit ihrer ganzen Zärtlichkeit das Kind, sie sang ihm deutsche Lieder vor, lehrte ihm die ersten deutschen Worte, sprach nie englisch mit ihm, entzog ihn so bald als möglich der schwarzen Amme, ja sie brachte es dazu, daß sein kleiner Milchbruder Sam ebenfalls Deutsch erlernte.
O’Flanagan tobte und wetterte dagegen, aber vergebens, in diesem Punkt blieb die kleine ängstliche Frau stark, und wenn Flanagan schrie, daß die Wände zitterten, sah sie ihn nur groß und erstaunt an, ohne zu tun, wie ihr Gatte wollte.
Ralph hing denn auch mit viel größerer Zärtlichkeit an seiner Mutter, als es amerikanische Jungens sonst tun, und noch als er die Mittelschule besuchte, las er am liebsten gute deutsche Bücher, die ihm die Mutter heimlich kommen ließ. Als er sechzehn war, machte allerdings Flanagan dem ein Ende, indem er den Jungen zuerst nach San Franzisko, dann nach Chikago in die Lehre zu Geschäftsfreunden schickte, so daß die ewige Wienerin allein und einsam in dem kalten großen Haus zu St. Paul zurückblieb.
Sechs Jahre hindurch mußte Ralph in der Fremde bleiben, sich allein sein Brot verdienen, bis ihn der Vater zurückrief.
Er trat nun in den väterlichen Betrieb ein, ohne zu ahnen, wie groß dieser eigentlich war. Es gab da eine sehr komplizierte Korrespondenz mit einem Dutzend Aktiengesellschaften, zahllosen Sägewerken und Forsten, niemand aber bekam einen vollen Einblick in die Geschäfte, da O’Flanagan alle Fäden in der Hand behielt und schwerwiegende Dinge nie mit seinem Sohn, sondern nur mit dem alten Prokuristen Herbert Walker beriet.
So innig das Verhältnis Ralphs zu seiner Mutter war, so wenig gut stand er mit dem Vater. Dieser sah in ihm einen durchaus unamerikanischen Schwärmer, einen halben Deutschen, einen müßigen Menschen, den die dummen deutschen Bücher viel mehr interessierten als die Geschäfte, der überhaupt keinen merkantilen Sinn hatte, ja es nicht einmal verstand, ordentlich energisch gegen die Arbeiter und Büroangestellten aufzutreten. Und einmal, zwei Jahre vor dem Beginn dieser Geschichte, kam es, als Ralph sich eines entlassenen Arbeiters annehmen wollte, zu einer heftigen Szene, die seitens des alten Flanagan mit den Worten beschlossen wurde:
»Wahrhaftig, am liebsten würde ich die Millionen, die ich erworben, in den See werfen! Du wirst es nie verstehen, ein solches Vermögen zu halten oder gar zu vermehren.«
Damals erfuhr Ralph zum erstenmal, daß sein Vater Millionär sei.
Der große Weltkrieg kam, Ralph wurde rasch zum Offizier befördert, bevor er aber dazu kam, an die französische Front abzugehen, waren die Mittelmächte niedergebrochen, Deutschland gedemütigt und Österreich bei lebendigem Leib zerstückelt. Bitterlich weinte die noch immer zart und mädchenhaft aussehende Frau Lola, wenn sie von dem Elend Wiens, dem Hunger der Wiener Kinder, dem Jammer der alten Rentner las, und was sie an Geld, mit dem sie recht knapp gehalten wurde, erübrigen konnte, wanderte über den Ozean nach Wien. Lebendiger als je zuvor wurde ihr die Erinnerung an die geliebte Vaterstadt, stundenlang erzählte sie abends, wenn Ralph verdrossen und mit seinem Leben unzufrieden bei ihr saß und ihr Gatte noch bis in die Nacht hinein im Kontor arbeitete, von Wien, von der einzigartigen Schönheit dieser Stadt, ihren milden Sitten, die überall in Musik ausklängen, von Wiener Herzlichkeit und Gemütlichkeit.
Am 2. Dezember 1921 brachten die amerikanischen Zeitungen übertriebene Berichte von den Plünderungen, die in Wien vor sich gegangen seien, von Bränden, die die halbe Stadt verwüstet hätten, von tausenden Toten und offener Anarchie. Frau Lola, die sich nicht hatte abgewöhnen können, amerikanischen Zeitungen zu glauben, weinte in ihrem Bett stundenlang, am Morgen fühlte sie sich schwach und elend, der Arzt stellte ein schweres Herzleiden, Erbschaft ihrer Mutter, fest, und als der alte, weiß gewordene O’Flanagan alle Anordnungen traf, um seine Frau nach dem milden Süden der Floridanischen Küste zu schicken, war es zu spät. Die kleine Wienerin starb in den Armen des Sohnes und ihre letzten Worte waren:
»Wenn du einmal nach Wien kommst…«
Ein halbes Jahr später verlor Ralph auch den Vater. Es war die Nachricht eingelangt, daß ein mächtiges Sägewerk, fünfhundert Kilometer von St. Paul entfernt, in Brand geraten sei und O’Flanagan ließ es sich nicht nehmen, in der Nacht die Fahrt per Auto dorthin anzutreten. Ungeduldig feuerte er den Chauffeur zu immer größerer Geschwindigkeit an, bis der mächtige Wagen gegen einen Prellstein fuhr, sich überschlug und unter seinen Trümmern O’Flanagan begrub.
Unmittelbar nach dem Leichenbegängnis, an dem ganz St. Paul teilnahm, wurde das Testament eröffnet, und Ralph erfuhr zu seinem maßlosen Erstaunen, daß er Alleinherr eines Vermögens war, das alle Begriffe übertraf. Die Zeitungen übertrieben nicht wesentlich, als sie verkündeten, daß der kaum dreißigjährige Ralph O’Flanagan einer der reichsten Männer, wenn nicht gar der reichste der Welt sei, und die Erbschaftsbehörden waren wochenlang beschäftigt, bevor sie vollen Einblick in den Umfang der O’Flanaganschen Betriebe gewannen. In eingeweihten Kreisen sprach man davon, daß O’Flanagan der Herr eines Großteils der amerikanischen Wälder und der Besitzer von drei Viertel Aktien der größten Holzindustrien des Landes gewesen sei. Man munkelte von einem Totalvermögen von mehr als tausend Millionen Dollar, womit Rockefeller auf die zweite Stelle verdrängt worden sei.
Ralph stand all dem fassungslos gegenüber. Er hatte das Leben eines beliebigen Durchschnittsamerikaners geführt, als erwachsener Mensch von seinem Vater einen Gehalt bezogen, der knapp für seine kleinen Auslagen reichte, die ersehnte Europareise war ihm nicht gestattet worden, wenn eine Rechnung vom Buchhändler kam, schimpfte sein Vater über unsinnige Verschwendung, karg und hart war seine ganze Jugend gewesen und nun stand er plötzlich als moderner Krösus, als unabhängiger Herr und Gebieter, dem die ganze Welt gehörte, da.
Daß er nicht das Zeug in sich hatte, weiterhin den Industriekönig zu spielen und Millionen zu erraffen, wußte Ralph ganz genau, und er war beglückt, als wenige Wochen nach Vaters Tod der alte Walker ihm vorschlug, aus allen den vielen Unternehmungen eine einzige große Aktiengesellschaft zu bilden, an deren Spitze er nur nominell stehen würde. Einige Wochen vergingen mit den Vorbereitungen, dann konnte der junge O’Flanagan in Begleitung seines Dieners und Milchbruders Sam nach New York fahren, wo die Verhandlungen zum Abschluß kamen. Die ganz Nordamerika, Kanada und Mexiko umspannende American Wood-and Forest Trust Company war gebildet, Ralph O’Flanagan ihr nomineller Präsident, ohne eigentlichen Beruf, aber mit dem vollen Bewußtsein der Verantwortung, die ihm sein unschätzbares Vermögen auferlegte, stand er der Zukunft gegenüber.
Wie sich diese Zukunft vorläufig gestalten würde, stand für ihn vollständig fest. Die letzten Worte seiner geliebten Mutter waren schicksalsbestimmend. Er wollte in seine Urheimat, in die Stadt, aus der er durch das Herz seiner Mutter die Liebe zu allem Höheren geerbt hatte. Er wollte dieses Wien, das er liebte, ohne es zu kennen, erfassen, wollte sehen, ob sich der Niedergang eines Kulturzentrums durch werktätige Arbeit, der fast unversiegbare Mittel zur Seite standen, aufhalten ließe.
Und so kam Ralph O’Flanagan im Dezember des Jahres 1922 nach Wien und machte seinen ersten Spaziergang durch die Straßen einer Stadt, die ihm fremd war und doch mit jedem Schritt ein wärmeres und behaglicheres Empfinden gab.
5. Kapitel. Das Mädchen in der Elektrischen.
Inhaltsverzeichnis
Ralph verließ den Graben, ging aufs Geratewohl durch die Bognergasse über Hof und Freyung und zollte den Bankpalästen seine Bewunderung. Diese stieg, als ihm ein Passant auf seine Frage mitteilte, daß das Neugebäude der Kreditanstalt erst vor einem Jahr fertig geworden sei. Also hatte man in Not und Verarmung, trotz Teuerung und rasender Geldentwertung doch Mittel und Wege gefunden, um einen stolzen, kostbaren Bau zu errichten, einen Bau, der jenem Kapitalismus dient, dessen Ende nach dem Umsturz bevorzustehen schien.
Am Schottentor stand der Amerikaner fast hilflos einem Durcheinander von Wagen gegenüber. Er, der eben aus New York kam, wagte kaum, den Platz zu queren. Von links und rechts, von vorne und rückwärts kamen Straßenbahnwagen, Autos und Schwerfuhrwerke, und vergebens sah sich Ralph nach dem amerikanischen Policeman um, der drüben bei tausendfach dichtem Verkehr durch einen Wink mit der Hand Ordnung zu machen versteht.
Immerhin, es scheint auch so zu gehen, dachte O’Flanagan, aber schon ging es nicht mehr. Zwischen zwei Straßenbahnzüge kam ein Pferdewagen, und die drei bildeten einen Knäuel, einen Wirrwarr, der von Tobsuchtsanfällen begleitet wurde, an denen sich vier Schaffner, zwei Motormänner, ein Kutscher und etwa dreißig Passagiere und Passanten beteiligten.
Belustigt sah Ralph dem erheiternden Schauspiel zu. Plötzlich kreuzte sich sein Blick mit dem eines Mädchens, das in einem der Straßenbahnwagen saß. Ralph zuckte zusammen, fühlte, wie ihm das Blut in die Wangen schoß. Lieblicheres hatte er noch nie gesehen. Ein schlankes Ding mit dunkelblonden Haaren, deren Fülle der kleine Lederhut kaum bergen konnte. Große, schiefergraue Augen, von fast schwarzen Wimpern umrandet, sahen ihn, der fasziniert hinstarrte, fragend an, wandten sich rauh wieder ab und ein rosiger Hauch überzog das ovale, feine Gesicht.
In diesem Augenblick löste sich der Knäuel, der Kutscher hieb fluchend auf seine Pferde ein, die Motormänner kurbelten an und fuhren weiter.
Ralph zögerte, kam zu spät zum Entschluß, den Wagen, in dem das Mädchen saß, zu besteigen. Schon hatte ein Postelektromobil ihm den Weg versperrt, und in voller Fahrt sauste die Elektrische die Währingerstraße entlang.
Ralph war es aber, als würde durch die Scheiben hindurch ihn noch ein Blick aus den traumhaft schönen Augen treffen. Rasch wandte er sich an einen Schutzmann mit der Frage, wohin der eben entschwundene Wagen fahre. Und schrieb die Antwort »Nach Währing in die Kreuzgasse« in sein Notizbuch.
In der Zwischenzeit hatte man sich im Hotel Imperial mit der Person des neuangekommenen Amerikaners befaßt und es war ein seltsames Interview zustandegekommen.
Der kleine Doktor Züngel, Spezialreferent der »Presse« für englische und amerikanische Angelegenheiten, hatte wieder einmal seine Runde durch die Ringhotels gemacht, um nach interessanten Persönlichkeiten zu fahnden. Erst im Hotel Imperial kam Doktor Züngel auf seine Rechnung. »Ralph O’Flanagan, mit Diener«, das klang schon nach etwas. Nun ist der irische Name O’Flanagan drüben nicht selten und der Journalist ließ sich zur genaueren Information das Original des Meldescheines geben. Als er das Wort »Präsident der American Wood and Forest Trust Company« las, blitzten seine Äuglein und eine graue Strähne hob sich vom sonst kahlen Schädel, ein Zeichen höchster Erregung. »Himmel!« schrie er, »das ist ja der Millionär O’Flanagan, was sag ich, der Milliardär, der neueste Dollarkrösus!« Und er erinnerte sich, vor Monaten, nachdem der alte O’Flanagan gestorben war, seitenlange Artikel mit Bildern in den amerikanischen Zeitungen gesehen zu haben, ja, er hatte aus ihnen sogar einen kleinen Artikel für die »Presse« unter der Überschrift »Der reichste Mann der Welt« exzerpiert, worauf neunhundert Wohlfahrtsaktionen und zehntausend private Schnorrer von der »Presse« die genaue Adresse des Krösus verlangt hatten.
»Wo ist er? Kann ich ihn sprechen?« schrie Dr. Züngel dem Portier zu.
»Ist weggegangen, aber da draußen steht sein Diener, vielleicht kann der Ihnen sagen, wann Mister O’Flanagan zurückkommt.«
6. Kapitel. Sam wird interviewt.
Inhaltsverzeichnis
Und nun entwickelte sich ein eigenartiger Dialog zwischen Sam und dem Wiener Journalisten. Dieser sprach englisch, Sam aber, stolz auf seine, wenn auch mangelhaften Kenntnisse der deutschen Sprache, erwiderte deutsch. Sam war auch durchaus bereit, Rede und Antwort zu stehen, erstens weil es ihm sein Herr nicht nachdrücklich untersagt hatte, anderseits, weil er auf seinen Herrn maßlos stolz war und sich nicht das Vergnügen versagen wollte, so viel Rühmliches als nur möglich über ihn zu erzählen. So erfuhr denn Doktor Züngel, daß dieser junge O’Flanagan eine Mutter gehabt hatte, die Wienerin war. (Ha! Welch Sensation!) Und daß sie mit dem Mädchennamen Holub geheißen und ihr Vater ein Brückenmacher gewesen, den ein böses Eisenstück totgeschlagen. Und er erfuhr, daß Mister Ralph ein guter Herr sei und sehr gescheit und ungeheuer viel Bücher gelesen habe, und bei jeder derartigen lobenden Erwähnung stupste der Neger den Journalisten und sagte grinsend:
»Schreib genau auf, daß kein Dummheit in dein Paper erzählst.«
Nun wollte aber Dr. Züngel noch etwas wissen, und zwar das Allerwichtigste. Zu welchem Zweck nämlich der reichste Mann der Welt nach Wien gekommen sei.
Sam kratzte sich das wollige Haupt.
»Well ich nicht wissen genau, aber meinen, weil Mutter hier geboren.«
»Aha, er will sich Wien ansehen und dann wieder wegreisen?«
»Nein, paß auf, daß kein Dummheit in dein Paper schreibst. Master will lange hier bleiben, sehr lange, Jahr vielleicht oder mehr. Paß auf, Mann von die Zeitung, ich gehört haben, wie Master auf Schiff, Dame, die ihn gefragt hat, sagte: Ich zusammengehören mit Wien und vielleicht versuchen, arme Stadt vor Niedergang zu retten. Well, paß auf, Master hat so viel Geld, daß er kann kaufen mit ein einziges Scheck ganze Stadt mit alle Häuser.«
In diesem erhebenden Moment, da Dr. Züngel sich vornahm, kategorisch für seine Sensation die erste Seite der »Presse« zu verlangen, erschien Ralph O’Flanagan, sah den Mann mit Notizbuch und Bleifeder zu Sam fragend aufblicken, erfaßte sofort die Situation und bekam einen maßlosen Schrecken.
»Sie wünschen, mein Herr?« fragte er so schroff, daß Dr. Züngel noch kleiner wurde und sein grauer Haarsträhn eine Volte schlug.
»Gestatte mich vorzustellen, Dr. Züngel von der »Presse«. Da Mister O’Flanagan nicht anwesend waren, habe ich mir gestattet, von Ihrem Diener einige Informationen –«
»Herr«, unterbrach Ralph erbost, »ich bin durchaus keine interessante Persönlichkeit, über die es Informationen einzuholen gibt. Ich bin hier ein Privatmann, wie jeder andere, und möchte dringend bitten, sich um mich nicht zu kümmern.«
Sprach’s, ging und machte Sam einen solchen Krach, daß dieser von nun an Zeitlungsleute ärger als die Pest scheute.
Doktor Züngel aber kam noch gerade rechtzeitig zum Abendblatt ins Bureau und einige Stunden später wußte ganz Wien, daß der reichste Mann der Welt, Mister Patrick O’Flanagan, in Wien mit der ausgesprochenen Absicht weile, Österreich zu sanieren. Und daß dieser O’Flanagan hiezu eine Art moralische Verpflichtung fühle, da seine Mutter eine Wienerin, Tochter des Architekten Rudolf Holub, gewesen sei, und der Krösus zweifellos unverzüglich mit dem Bundeskanzler Dr. Seipel sowie dem Finanzminister Dr. Kienböck in Fühlung treten werde. Daran schloß sich ein Leitartikel, der genau dasselbe nochmals mit Leidenschaft sagte, und dann im Finanzteil eine längere Betrachtung von einem »hervorragenden Finanzmann«, der der Bevölkerung die erschütternde Mitteilung machte, daß ein Dollar erheblich mehr sei als eine Krone, ja eine Million Dollar sogar mehr als siebzig Milliarden wären.
Ralph O’Flanagan bekam einen Wutanfall, Sam eine, allerdings recht gelinde, Ohrfeige und der Hoteldirektor mußte zwei kräftige Hausdiener mit der Spezialaufgabe betrauen, alle lästigen Besucher hinauszukomplimentieren.
7. Kapitel. Man interessiert sich für Ralph.
Inhaltsverzeichnis
Der Generaldirektor der »Bankgesellschaft«, Herr Klopfer-Hart, saß in seinem in gediegenster englischer Art ausgestatteten Bureau und dachte angestrengt nach, daß sich eine Falte inmitten der hohen energischen Stirne bildete. Der kleine, gedrungene Herr mit dem weißen, fast viereckigen Bart und den noch immer nicht ganz weißen, bürstenartig aufrecht stehenden Haaren, zu denen die buschigen, bis vor kurzem noch pechschwarzen, jetzt auch schon gebleichten Augenbrauen vortrefflich harmonierten, galt als der bedeutendste, willenstärkste Kopf unter den führenden Bankleuten, deren Zahl nach dem Umsturz Legion geworden war. Und trotzdem er ein hoher Sechziger war, verstand er seine Zeit, ging mit ihr, wußte genau, wie weit und wie wenig weit ein modernes Bankinstitut gehen mußte und durfte, um einerseits nicht zurückzubleiben, anderseits nicht auf eine Stufe mit schwindelhaften Konjunkturbanken zu sinken.
Direktor Klopfer-Hart, den der Umsturz um den Geldadel, nicht aber um das Geld gebracht hatte, ließ die Finger durch den Bart gleiten und las nochmals den rotumränderten Zeitungsausschnitt, den ihm mit hundert anderen der Leiter des Preßbureaus hatte vorlegen lassen.
Nun ein Druck auf den Taster, und sein Privatsekretär kam herein.
»Doktor, dieser Ralph O’Flanagan interessiert mich. Vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit an der Sache, die da in der Presse steht. Vielleicht auch nur ein neuer Duim, jedenfalls hat der Name bisher unter den Amerikanern nicht gezählt. Bitte, kabeln Sie sofort an Seligmann nach New York um genaue Auskunft.«
Der Auftrag war kaum erteilt, das Kabelgramm noch nicht abgegangen, als einer der zahllosen Prokuristen, der, der den amerikanischen Kreditverkehr unter sich hatte, um Vortritt bitten ließ.
»Herr Generaldirektor, ich glaube, die Depesche kann unterbleiben, denn eben ist mit der amerikanischen Post ein Schreiben der New Yorker Generaldirektion der Guarantee Trust Company angekommen, das sich auf diesen Ralph O’Flanagan bezieht.«
Klopfer-Hart, der englisch so gut wie deutsch sprach, nahm dem Prokuristen das Schreiben aus der Hand und las:
»Wir ersuchen Sie, Mister Ralph O’Flanagan aus St. Paul, Minnesota, der sich soeben nach Wien zu längerem Aufenthalt begeben hat, Kredit in jeder Höhe, der von ihm beansprucht wird, einzuräumen und mit den jeweiligen Beträgen unser Konto zu belasten. Abhebungen, die eine Million Dollar übersteigen, bitten wir, uns jedesmal per Kabel bekanntzugeben. Wir bitten, Mister O’Flanagan in jeder Beziehung, falls er es wünscht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.«
Generaldirektor Klopfer-Hart zog die buschigen Brauen hoch.
»Sehr angenehm! Nun haben wir auch den prächtigsten Vorwand, direkt mit ihm in Fühlung zu treten. Keinesfalls darf er uns aus den Händen kommen.«
Nach kurzem Überlegen: