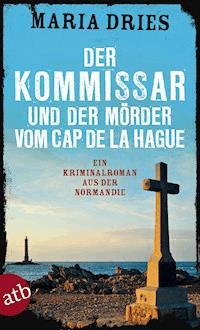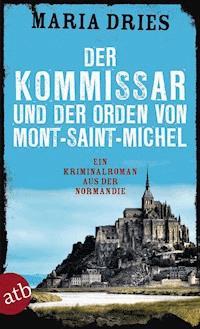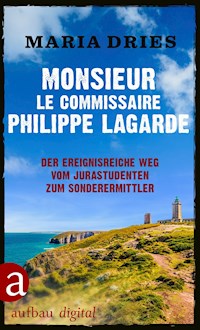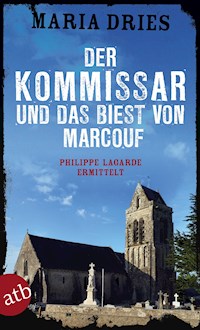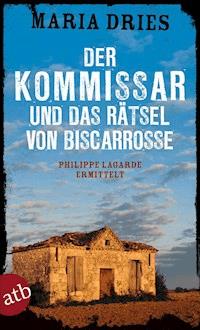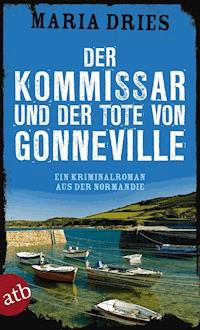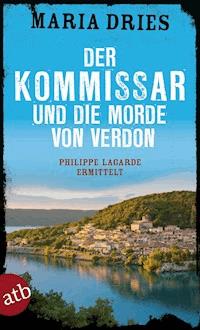
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Philippe Lagarde
- Sprache: Deutsch
Commissaire Lagarde in Südfrankreich.
Der geplante Urlaub von Philippe Lagarde und seiner Lebensgefährtin Odette fällt ins Wasser. Nachdem der Ehemann von Odettes Freundin in der Schlucht von Verdon verunglückt ist, reisen sie zur Beerdigung. Obwohl die Polizei von einem Selbstmord ausgeht, ist die Witwe sicher, dass ihr Mann ermordet wurde. Als sich Ungereimtheiten häufen, kommen auch Lagarde Zweifel an der Geschichte. Warum jedoch sollte die Polizei einen Mord vertuschen? Und dann gibt es einen weiteren Toten: Auch der Bürgermeister des Ortes verunglückt in der Schlucht von Verdon ...
Spannende Ermittlungen vor der Kulisse des Lac de Sainte-Croix.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Maria Dries
Maria Dries wurde in Erlangen geboren und hat dort Sozialpädagogik und Betriebswirtschaftslehre studiert. Heute lebt sie mit ihrer Familie in einem Bauernhaus in der Fränkischen Schweiz. Schon seit vielen Jahren verbringt sie die Sommer in der Normandie.
Im Aufbau Taschenbuch sind bisher ihre erfolgreichen Krimis »Der Kommissar von Barfleur«, »Die schöne Tote von Barfleur«, »Der Kommissar und der Orden von Mont-Saint-Michel« und zuletzt »Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague« erschienen.
Informationen zum Buch
Commissaire Lagarde in Südfrankreich
Der geplante Urlaub von Philippe Lagarde und seiner Lebensgefährtin Odette fällt ins Wasser. Nachdem der Ehemann von Odettes Freundin in der Schlucht von Verdon verunglückt ist, reisen sie zur Beerdigung. Obwohl die Polizei von einem Selbstmord ausgeht, ist die Witwe sicher, dass ihr Mann ermordet wurde. Als sich Ungereimtheiten häufen, kommen auch Lagarde Zweifel an der Geschichte. Warum sollte die Polizei einen Mord vertuschen? Und dann gibt es einen weiteren Toten: Auch der Bürgermeister des Ortes verunglückt in der Schlucht von Verdon …
Spannende Ermittlungen vor der Kulisse des Lac de Sainte-Croix
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Maria Dries
Der Kommissar und die Morde von Verdon
Philippe Lagarde Ermittelt
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Maria Dries
Informationen zum Buch
Newsletter
Karte
Die Zersprungene Glocke
Lac de Sainte-Croix, Alpes-de-Haute-Provence
Acht Tage später
Barfleur, Normandie, eine Woche später
Der fliegende Fisch
Schwarzes Gold
Der Felsbalkon von Mescla
Der Schrotthändler von Riez
Kastanienfest
Die Schlucht von Verdon
Pétanque-Spiel in Tourtour
Mariette
Die Glocken von Les Salles
Das Haus mit den vier Türmen
Barbecue
Was danach geschah
Impressum
Für Johanna
Die Zersprungene Glocke
Wie bittersüß ist mitternächt’ges Lauschen
Im Winter, nah der Glut, die steigt und sinkt,
Wenn ferne Zeiten leise Reden tauschen,
Und Glockenläuten durch den Nebel dringt.
Beglückt die Glocke, die mit starker Kehle
Durch viele Jahre freudig und mit Macht
Gebete singt, so wie aus frommer Seele
Ein tapfrer Krieger, der das Zelt bewacht.
Ach, meine Seele sprang, – und will ich singen,
In kalter Nacht die Einsamkeit zu zwingen,
Dann hör’ ich meine eigne Stimme tönen
Wie eines wunden Kriegers dumpfes Stöhnen,
Den man vergaß in seiner letzten Not,
Der zwischen Leichen stirbt den bittren Tod.
Charles Baudelaire
»Die Blumen des Bösen«
(»Les Fleurs du Mal«)
Lac de Sainte-Croix, Alpes-de-Haute-Provence
Der türkisfarbene Verdon fließt an manchen Stellen ruhig wie ein Bach, an anderen wird er zum gewaltigen Strom, überschwemmt das Land und macht es fruchtbar. Seit tausenden von Jahren folgt er seinem Lauf. Er entspringt in den Alpen der Haute-Provence und stürzt sich dramatisch schön in eine Schlucht aus Kalkfelsen, die einen der größten Canyons Europas bildet. Sie ist etwa einundzwanzig Kilometer lang und bis zu siebenhundert Meter tief. Oberhalb der steil nach unten fallenden Felswände kleben Aussichtsplattformen wie Adlerhorste. Der Blick nach unten ist zugleich faszinierend wie schwindelerregend.
Der intensive Duft von blühenden Lavendelfeldern liegt in der Luft. Über dem Canyon schwebt ein Gänsegeier mit gewaltiger Flügelspanne. Tief in der Schlucht lässt sich ein vierzehn Kilometer langer Wanderweg erahnen. Mit seinen Steilstufen, Hängepassagen und langen dunklen Felstunneln birgt er viele Tücken. Auf dem blaugrün sprudelnden Wasser wirken die Kajaks wie Spielzeugboote.
Bei der Brücke von Galetas fließt der Verdon in den Stausee Sainte-Croix. Für den wohl schönsten See der Provence mussten große Opfer gebracht werden. Fruchtbares Land wurde überschwemmt und ein ganzes Dorf zerstört. Seit diesen dramatischen Ereignissen hört man den See hin und wieder murmeln, hauptsächlich bei Neumond. Manchmal tönt nachts die Glocke der einst überfluteten Kirche mit einem tiefen vollen Klang weit über den See hinaus. Der Volksmund erzählt, dass dort nach solchen besonderen Nächten Unheil drohe.
Das Haus der Familie Laurent lag etwas abseits vom Dorf Les Salles-sur-Verdon auf einem Hügel über dem See. Der Ausblick war überwältigend. Die glatte türkise Wasseroberfläche glitzerte in der Sonne. Inmitten des Sees erhob sich eine kleine bewaldete Insel, die unbewohnt war. Schroffe weißgraue Kalkfelsen, lichte Pinienhaine, blühende Ginsterbüsche und helle Kieselstrände prägten das Landschaftsbild.
Die sandfarbene Villa der Laurents glich eher einem kleinen Schloss. Der Grundriss war quadratisch, jede der vier Ecken wurde von einem schlanken Turm flankiert. Das flache Ziegeldach war rot, ebenso die Hauben der Türme. Eine hohe Mauer umgrenzte den weitläufigen Park, in dem sich Zypressen, Schirmpinien und Zedern erhoben.
Mélanie Laurent saß auf der Terrasse unter einer Markise. Vor ihr, auf einer großen Sperrholzplatte, stand das Modell, an dem sie gerade arbeitete. Das Dorf, das entstehen sollte, verfügte bereits über einige Häuser, einen Brunnen und einen Friedhof. Die einzelnen Elemente waren aus kleinen flachen Korkteilen detailgetreu gefertigt. An den Fenstern flatterten schneeweiße Gardinen, am Brunnenaufbau hing ein winziger Blecheimer, und zwei Gräber waren mit rosa Miniaturrosen geschmückt. Sie war gerade dabei, einen Dachziegel aus rot lackiertem Kork aufzukleben, als ihre Pflegerin auf die Terrasse kam.
»Cédric ist da, Méla. Soll ich euch Kaffee und Kuchen bringen? Die Köchin hat Schokoladentarte gebacken.«
»Gerne, Bernadette, und Wasser bitte. Es ist so heiß heute.«
Cédric, ein großer, kräftiger, gutaussehender Mann, trat auf die Terrasse. Er begrüßte Mélanie mit einem liebevollen Kuss auf die Wange.
»Wie geht es dir, Schwesterherz?«, erkundigte er sich.
»Gut, danke.« Sie griff nach einem weiteren Korkteilchen. Cédric betrachtete stirnrunzelnd das unfertige Dorf auf der Platte, die fast den gesamten Tisch einnahm, und setzte sich. Die Pflegerin kam mit einem beladenen Tablett und stellte es auf der Sitzfläche eines Stuhles ab.
»Danke schön, Bernadette. Wir bedienen uns selbst.«
Mélanie lächelte sie an. Dann schenkte sie für Cédric und sich Kaffee ein und legte Kuchenstücke auf die Teller. »Ich freue mich, dass du da bist und mir ein wenig Gesellschaft leistest«, sagte sie. »Lass es dir schmecken.«
Nachdenklich betrachtete sie ihr Werk aus Kork. Kuchen und Kaffee hatte sie vergessen. »Was meinst du, Cédric? Soll ich die Schindeln für das Kirchendach ockerfarben lackieren oder lieber sandfarben? Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht eine winzige Glocke gießen lasse. Ganz originalgetreu. Bei den Glocken, die man im Laden für Kunsthandwerk kaufen kann, handelt es sich um Kinderspielzeug aus Blech. Das finde ich unangemessen.«
Sie erwartete keine Antwort und zupfte gedankenverloren eine Gardine zurecht. »Mit dem Brunnen bin ich nicht zufrieden. Ich denke, ich werde dafür silbern glitzernde Kieselsteine am Seeufer sammeln.« Kurz war sie wieder bei ihm und sah ihn mit ihren ernsten blauen Augen an. »Keine Sorge, Bernadette wird mich natürlich begleiten.« Mélanie griff nach einem feinen Pinsel und tauchte die Spitze in ein Lackdöschen. Die Zungenspitze erschien zwischen ihren Lippen, so konzentriert arbeitete sie. Cédric kam sich völlig überflüssig und unbeachtet vor und verlor die Geduld. »Méla, rede mit mir!« Seine Stimme klang eine Nuance zu scharf und zu laut. Sie fuhr zusammen und starrte ihn erschrocken an.
Ungehalten deutete er auf das Miniaturdorf. »Hör doch endlich auf damit. Das macht doch keinen Sinn. Wie viele Modelle verstauben bereits auf dem Dachboden? Dreißig? Vierzig? Du baust sie aus Legosteinen, Knetmasse, Streichhölzern, Ton, Pappmaché, Spielmais, Plastilin und was weiß ich alles noch. Das muss ein Ende haben. Es tut dir nicht gut.«
Sie hörte nicht zu und lackierte den Pfosten eines Gartenzaunes flaschengrün.
»Wir könnten eine kleine Reise unternehmen. Was meinst du? Das würde dir bestimmt guttun.«
Mélanie summte leise vor sich hin. Als sie einen winzigen gelben Vogel auf einer Dachrinne befestigte, platzte ihm der Kragen. »Jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn!«, brüllte er. »So wirst du nie gesund!« Wütend sprang er auf, packte die Sperrholzplatte und schleuderte sie über die Brüstung. Kurz schwebte das Modell horizontal in der Luft, dann kippte es und verschwand aus ihrem Blickfeld. Cédric stürmte davon und ließ Mélanie alleine auf der Terrasse zurück. In Panik sprang sie auf, lief zum Geländer und starrte nach unten. Dort loderte ein Feuer, das der Gärtner entzündet hatte, um Reisig und dürre Äste zu verbrennen. Sie musste hilflos mit ansehen, wie ihr geliebtes Dorf in Flammen aufging. Das Feuer fraß es unerbittlich auf, und es war nicht mehr zu retten. Dieser Gedanke war unerträglich. Ihr Gesicht verlor jede Farbe. Sie war unfähig sich zu bewegen.
Cédric hatte inzwischen den Vorhof erreicht und blieb abrupt stehen. Seine Wut war so schnell verflogen, wie sie gekommen war. Sein Ausbruch tat ihm entsetzlich leid. Er hätte Méla nicht so erschrecken dürfen. Kurz überlegte er, ob er zu ihr zurückgehen sollte. Er entschied sich jedoch dagegen. Es war klüger zu warten, bis sie sich beruhigt hatte. Später würde er wiederkommen und sie zu einem Segeltörn auf dem See überreden. Manchmal begleitete sie ihn tatsächlich. Sie liebte das türkis schimmernde Gewässer. Abends würden sie gemeinsam essen und anschließend das Modell reparieren.
Dicke Tränen liefen über Mélanies Wangen. Sie konnte es nicht fassen, dass ihr Dorf verbrannt und nur hässliche graue Asche übriggeblieben war. Als das Feuer niederbrannte, lag der beißende Geruch von Rauch in der Luft. Wie ferngesteuert verließ sie die Terrasse, durchquerte den Salon und gelangte in den Korridor. Sie lauschte und schlich auf leisen Sohlen bis zum Hinterausgang. Bernadette war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich hielt sie sich in der Küche auf, die im Untergeschoss lag, und plauderte mit der Köchin. Mélanie huschte aus dem Haus und zog die Tür leise hinter sich zu. Rasch lief sie zur Gartenpforte und schlüpfte hindurch. Über eine Wiese gelangte sie zu einem Pfad, der zu den Kalkfelsen führte. Jetzt konnte sie vom Haus aus niemand mehr sehen. Langsam, mit gleichmäßigen Schritten, folgte sie dem Weg, den Blick geradeaus gerichtet. Die Nachmittagshitze hatte sich auf die Hochebene gelegt. Wilder tiefroter Oleander, sonnengelbes Ginstergebüsch und herb duftender Wacholder spendeten nur wenig Schatten. Der Anblick von zwei Wildeseln zauberte für einen Moment ein Lächeln auf Mélanies Gesicht. Gleich darauf verschwand es wieder, und ihr Gesichtsausdruck versteinerte. Sie nahm sich nicht die Zeit, so wie sonst Blumen zu pflücken und einen bunten Kranz für ihre Haare zu binden. Als sie den Felsabbruch erreicht hatte, setzte sie sich auf einen flachen Stein. Sie betrachtete den See, über den weiße Segel zogen. An einem Anleger schaukelten Fischerboote. Angler saßen auf einem Steg auf Klappstühlen.
Cédric hatte einige wichtige Schreibarbeiten im Büro erledigt und sich dann umgezogen. Er trug jetzt eine bequeme Leinenhose, ein weißes Baumwollhemd und Segelschuhe. Gegen siebzehn Uhr kehrte er in die Villa zurück und suchte nach seiner Schwester. Er fand sie weder auf der Terrasse noch im Salon. Zwei Stufen auf einmal nehmend, lief er in den zweiten Stock und klopfte an ihre Schlafzimmertür. Es folgte keine Reaktion. Er klopfte erneut, öffnete die Tür und rief ihren Namen. Der Raum war leer, das Bad ebenso. Cédric wurde nervös. Vom Balkon aus ließ er seine Blicke über den Park schweifen. Er sah nur den Gärtner, der ein Blumenbeet harkte. Die Nachmittagssonne spiegelte sich im See und tauchte ihn in ein sanftes, blaugelbes Licht. Cédric eilte in das Untergeschoss und ging in die Küche. Dort traf er auf die Köchin und Mélanies Pflegerin Bernadette, die am Tisch saßen, Kaffee tranken und einträchtig einen Plausch hielten.
»Wo ist Mélanie?«, fragte er mit barscher Stimme. Die beiden Frauen sahen ihn erschrocken an. Bernadette fing sich als Erste wieder. »Auf der Terrasse. Sie arbeitet bereits seit heute Morgen an ihrem neuen Modell.«
»Da ist sie nicht.«
»Dann hat sie sich wahrscheinlich hingelegt. Sie hält nachmittags gerne einen Mittagsschlaf.«
»In ihrem Zimmer ist sie auch nicht.«
Jetzt war der Pflegerin ihre Nervosität deutlich anzusehen. Auch die Köchin, die sonst nichts aus der Ruhe bringen konnte, wirkte plötzlich angespannt.
»Waren Sie schon an ihrem Lieblingsplatz im Garten?«, fragte sie und wusste die Antwort bereits. Natürlich hatte Monsieur Cédric dort schon gesucht.
Unwirsch schüttelte er den Kopf. »Da ist sie nicht.« Vom Balkon aus hatte er die Bank am Goldfischteich inmitten des Rosenlabyrinths sehen können. Da war niemand gewesen. Er fühlte eine eiskalte Hand nach seinem Herzen greifen. Wo war seine Schwester?
»Sie werden dafür bezahlt, dass Sie auf sie aufpassen!«, brüllte er. Dann rannte er in den Park und suchte nach Méla, hinter jedem Busch, jedem Mäuerchen, jeder größeren Pflanze und schließlich am Brunnen. Er überprüfte hastig das Gitter auf dem schwarzen klaffenden Loch. Es war nach wie vor fest verschraubt und mit einem stabilen Eisenschloss gesichert. In wachsender Panik suchte er im Gemüsegarten, hinter den Feuerbohnen und den Brombeersträuchern. Manchmal saß sie dort verträumt im Gras und naschte süße Früchte. Nichts.
Als er unterhalb der Terrasse die Feuerstelle entdeckte, war die Glut erloschen. Aus dem Aschehaufen und den verkohlten Holzstücken spitzte ein winziges rotes Dach aus Korkeiche. Cédric erstarrte. Mélanies Modell. Es war verbrannt. Sein Herz pochte heftig gegen die Rippen. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Dennoch rannte er, so schnell er konnte, zu der alten Windmühle aus dunkelgrauem Feldstein. Ihre altersschwachen Flügel zitterten im Wind. Sie erhob sich neben dem ummauerten Waldfriedhof, der einsam inmitten kargen Felsgesteins lag.
Seine Schwester konnte stundenlang auf den staubigen Dielen des Dachbodens hocken und tief in Gedanken versunken die Gräber betrachten. Über eine wacklige Leiter hastete er auf die oberste Plattform des Gemäuers. Als er den Kopf durch die Luke steckte, scheuchte er einige schwarze Vögel auf. Seine Augen wanderten hoffnungsvoll durch das düstere Turmzimmer. Es war leer.
Zurück in der Villa alarmierte er die Polizei.
Mélanie erhob sich entschlossen und trat an die Abbruchkante. Das graue Gestein fiel beinahe senkrecht in die Tiefe. Die Wasseroberfläche befand sich etwa achtzig Meter unterhalb von ihr und lockte sie. Mélanie warf noch einen letzten Blick auf das neue Dorf, flüsterte »Adieu, Cédric« und breitete die Arme aus. Schließlich stieß sie sich ab und sprang. Ihr weißes Kleid flatterte im Wind, ihre Haare umwehten golden glänzend ihren Kopf. Sie flog, frei wie die Möwen. Ein seliges Lächeln verzauberte ihr Gesicht. Sie flog dorthin, wo sie einst glücklich gewesen war.
Bis sich blauschwarze Nacht über den See senkte, suchten Dutzende von Polizisten auf der weiten Hochebene nach Mélanie. Auch Spürhunde wurden eingesetzt. Freiwillige Helfer durchkämmten das Hinterland und Feuerwehrleute nahmen sich das Seeufer vor.
Es war unmöglich gewesen, Cédric daran zu hindern, sich einer Suchmannschaft anzuschließen. Letztendlich hatte man ihn gewähren lassen.
Eine Hündin mit dunkelbraun glänzendem Fell namens Mimi nahm auf einem Klippenpfad Witterung auf. Ungeduldig zog sie ihren Führer an die Abbruchkante eines Felsmassivs. Sie ließ sich auf einem Teppich von gelben Wildblumen nieder und heulte den Mond an. Das Jaulen, das über den See hallte, ließ einem das Blut in den Adern gefrieren. Der Polizist deutete mit zitternder Hand auf die senkrechte Steinwand und sah Cédric voller Mitgefühl an.
»Ich fürchte, Ihre Schwester ist dort hinuntergestürzt. Mimi hat sich noch nie geirrt. Was für ein tragischer Unfall. Es tut mir so leid.«
Cédric stand wie fest verwurzelt am Rand des Bergmassivs und starrte in die Tiefe, die dunkel und feindselig zurückblickte. Der Impuls zu springen, war übermächtig.
Am nächsten Morgen begannen Wasserwacht und Feuerwehr den See abzusuchen. Sie gingen systematisch vor und arbeiteten Planquadrat für Planquadrat ab. Als die Kirchturmuhr des neuen Dorfes Les Salles-sur-Verdon zwölf Uhr schlug, hatten sie noch nichts gefunden. Sie legten eine kurze Pause ein und stärkten sich mit Kaffee und belegten Baguettes. Dabei diskutierten sie die Einflüsse, die Strömungen, Saugwirkungen an den Staumauern und lebensgefährliche Strudel auf den Fundort eines Opfers hatten.
Ungefähr einen Dreiviertelkilometer weiter in westlicher Richtung tauchte Bernard Dumont im türkisblauen Lac de Sainte-Croix. Der durchtrainierte ehemalige Rettungsschwimmer hatte im Ruhestand seine Leidenschaft für das Sporttauchen entdeckt. Bei einem Urlaub in Ägypten hatte er erfolgreich an einem Kurs teilgenommen. Er wusste natürlich, dass Tauchgänge aus Sicherheitsgründen immer mindestens zu zweit begangen werden sollten. Doch meistens hielt er sich nicht an diese eiserne Regel. Er war Individualist und lieber alleine unterwegs. Außerdem war er fest davon überzeugt, dass er ein exzellenter Taucher war und ihm nichts, aber auch rein gar nichts zustoßen konnte. Immerhin hatte er eine Boje gesetzt.
Er befand sich in etwa dreißig Meter Tiefe, paddelte leicht mit den Flossen und schwebte über schwarzen, unergründlichen Felsspalten. Im Hintergrund konnte man die historische Brücke aus dem sechsten Jahrhundert erkennen, die den Verdon mit neun Bögen überspannt hatte und bei der Flutung versunken war. Die Stirnlampe von Dumont beleuchtete schilfgrüne Algen, die in der Strömung des Verdon wankten. Ein Schwarm silberner Fische flitzte vorbei und verschwand unter einer Steinplatte.
Zwischen dunklem Geröll und verwesendem Geäst entdeckte Dumont einen hellen Fleck und näherte sich neugierig. Als in seinem Lichtkegel ein Gesicht auftauchte, das von goldenem Lichtschein umkränzt zu sein schien, bekam er Atemprobleme. Als er begriff, dass die eine Hälfte des Kopfes offenbar von Raubfischen gefressen worden war und nur ein verbliebenes blaues Auge ihn fixierte, setzte sein Herzschlag aus.
Am späten Nachmittag, als die Sonne von einem Wolkengebirge verdeckt wurde und Sturm aufkam, fanden Mitglieder der Wasserwacht die Leichen.
Im Dorfbistro orakelte der alte Fischer Jacques einige Stunden später, nach dem dritten Glas Rotwein, dass die Flussgöttin Styx die beiden geholt habe. Nun, da ihr die Beute entrissen worden sei, werde das verheerende Folgen haben.
Der Begriff Styx stammte aus der griechischen Mythologie und hatte zwei Bedeutungen. Neben der Flussgöttin bezeichnete er außerdem den Fluss, der in die Unterwelt führte. Martel, ein französischer Höhlenforscher, der erstmals im Sommer 1905 in die Tiefen der wilden Schlucht von Verdon hinuntergestiegen war, hatte den Begriff für diese Gegend geprägt, indem er den Verdon als Höllenfluss bezeichnet hatte.
Acht Tage später
Georges Lebeau saß fröhlich pfeifend am Steuer seines Wagens. Er folgte der schmalen, von Korkeichen und Pinien gesäumten Serpentinenstraße, die oberhalb der Schlucht von Verdon verlief. Es war früh am Morgen. Nebelschwaden stiegen aus der zerklüfteten Spalte auf, die an das Werk einer riesigen Säge erinnerte. Hinter einem Felsmassiv erhob sich die Sonne als gelborange glühender Feuerball. Eine Gruppe Motorradfahrer in schwarzer Lederkleidung preschte auf schweren Maschinen dröhnend an ihm vorbei und verschwand bald wieder im Dunst. Die wunderschöne Strecke war bei Bikern aus aller Welt sehr beliebt, da sie höchste Anforderungen an das fahrerische Können stellte und als gefährlich galt.
Er lenkte sein Auto auf einen Parkplatz neben einer Aussichtsplattform, die auf einem Felsvorsprung über der Schlucht erbaut war, und schaltete den Motor aus. Es war sein Lieblingsplatz, und er legte dort immer einen Stopp ein, bevor er zu seiner Firma fuhr. Er war Inhaber eines Hoch-Tiefbau-Betriebes, der auf Sprengungen spezialisiert war, und ein vielbeschäftigter Mann. In der morgendlichen Stille genoss er die spektakuläre Aussicht und rauchte in Ruhe eine Zigarette, bevor er sich in den Trubel seines florierenden Geschäftsbetriebes stürzte. Dabei ging er gedanklich die Aufgaben durch, die zu erledigen waren. Automatisch griff er nach seinen Zigaretten, die normalerweise auf der Mittelkonsole ihren Platz hatten. Dort waren sie jedoch nicht. Stirnrunzelnd beugte er sich vor, öffnete das Handschuhfach und spähte hinein. Die Schachtel war nirgends zu entdecken. Er durchsuchte das Fach und bemerkte zunächst nicht, wie sich sein Wagen in Bewegung setzte und auf die hölzerne Brüstung der Plattform zurollte. Erst, als er das Bersten der Holzbretter vernahm, fuhr er hoch und realisierte mit Entsetzen, was sich gerade abspielte.
Die Motorhaube schob sich durch die Absperrung und schwebte über dem Abgrund. Lebeau erstarrte vor Schreck, dann kam Leben in ihn. Er riss die Fahrertür auf und wollte aus dem Auto springen. Doch inzwischen waren wertvolle Sekunden verstrichen. Unter ihm war kein Boden mehr, auf den er hätte gelangen können. Nur noch steile Felsen, Buschwerk und tief unten der grüne Fluss.
Der Wagen kippte nach vorne und stürzte in die Schlucht. Mit schierer Panik in den Augen starrte der Mann auf den Grund der Spalte, der mit rasender Geschwindigkeit immer näher kam. Sein Herz raste. Ein gellender Schrei brach aus seiner Brust.
Der Aufprall war fürchterlich. Das Fahrzeug zerschellte mit einem infernalischen Knall auf einer steinigen Sandbank. Georges Lebeau war auf der Stelle tot.
Barfleur, Normandie, eine Woche später
Der Ort mit dem malerischen Fischerhafen lag an der Nordostspitze der Halbinsel Cotentin. Häuser aus grauem Granitstein mit weißen Fensterläden und roten Kaminen säumten die Promenade. Am Hafenausgang erhob sich die imposante Kirche Saint-Nicolas. Aufgrund des enormen Gezeitenunterschiedes lagen die festgemachten Schiffe bei Niedrigwasser auf Grund. Endlos erscheinende Muschelbänke erstreckten sich entlang der Küste, wo an der Pointe de Barfleur der Leuchtturm von Gatteville wie ein ausgestreckter Finger emporragte.
Philippe Lagarde stand auf dem Deck seines Bootes, das in der Bucht von Barfleur ankerte, und angelte. In dem Eimer, der neben ihm stand, zappelten bereits zwei Goldbrassen und eine Makrele. Der ehemalige Elitepolizist genoss sein Leben im Ruhestand in vollen Zügen. Manchmal kam es jedoch noch immer vor, dass er bei einem komplizierten Kapitalverbrechen von Kollegen um Unterstützung gebeten wurde. So wie Anfang Juni, als im Wald von Gonneville zwei Menschen auf einem Hochsitz regelrecht hingerichtet worden waren. Die Aufklärung des Falles hatte das ganze Können ihres Teams erfordert. Außerdem war er als Dozent an der Polizeiakademie von Rennes tätig.
Ein Fisch biss an, und Lagarde rollte vorsichtig die Schnur auf. Er hatte einen im Sonnenlicht schillernden Hering gefangen. Seine Ausbeute würde für das Abendessen ausreichen. Er hatte vor, mit seiner Lebensgefährtin Odette zu grillen, und freute sich schon darauf. Bei dem Gedanken an sie lächelte er.
Der Kommissar war mit seinem ebenmäßigen markanten Gesicht, den saphirblau leuchtenden Augen und den kurzgeschnittenen dunklen Haaren ein attraktiver Mann. Er war von mittelgroßer Statur, kräftig gebaut und durchtrainiert. Im Privatleben galt er als charmant, humorvoll, herzlich und sanftmütig. Bei dienstlichen Belangen jedoch konnte er knallhart und unnachgiebig sein. Lagarde gab niemals auf.
Er nahm die Angeln aus den Halterungen und verstaute sie unter der Sitzbank. Dann holte er den Anker ein, betrat die Steuerkabine und startete den Motor. Das Boot pflügte durch die Wellen, und er steuerte den Hafen von Barfleur an. Der Ort lag schemenhaft im gleißenden Sonnenlicht. Schafswolken zogen gemächlich über den azurblauen Himmel. Es roch nach Tang und Fisch. Auf seinen Lippen schmeckte er Salz.
Nachdem er sein Schiff im Hafenbecken an einer Boje festgebunden hatte, ruderte er mit dem zweisitzigen, korallenroten Kunststoffboot zur Kaimauer und vertäute es an einem Eisenring. Von dort aus gelangte er auf eine steinerne Treppe, die hinauf zur Mole führte. Nachdem er den Eimer mit seinem Fang auf die Ladefläche seines himmelblauen Renault Express gestellt hatte, der direkt vor der Hafenmauer stand, schlenderte er über die Promenade zu seinem Lieblingsbistro »Im Wind der Inseln«. Dort fand er unter der rot-weiß gestreiften Markise einen freien Tisch, setzte sich und streckte die Beine aus. Gaston, der Wirt, begrüßte ihn mit einem Lächeln. »Salut, Philippe.«
»Salut, Gaston.«
»Warst du angeln?«
»Ja. Odette und ich wollen heute Abend grillen. Ich hoffe, sie ist mit meinem Fang zufrieden.«
»Das ist sie bestimmt. Was darf ich dir bringen?«
»Einen Pastis, bitte.«
»Kommt sofort.«
Gaston servierte ihm den Anisschnaps in einem hohen, schlanken Glas und stellte eine Karaffe mit Wasser und Eiswürfeln daneben. Zum Knabbern gab es eine Schale mit gesalzenen Pistazien. Lagarde bedankte sich und goss Eiswasser in den Schnaps. Die Flüssigkeit färbte sich milchig gelb. Er nahm einen erfrischenden Schluck und beobachtete das lebhafte Treiben auf der Promenade.
Die Ebbe hatte eingesetzt und das Wasser im Hafenbecken sank Millimeter um Millimeter. In einigen Stunden würden die Boote im Schlick festsitzen und die Einkieler auf die Seite kippen.
Nachdem er ausgetrunken hatte, legte er Kleingeld auf den Tisch, winkte Gaston zum Abschied zu und ging zu seinem Auto. Auf der Küstenstraße, die von einer sanften Dünenlandschaft gesäumt wurde, fuhr er in Richtung Norden zu seinem Haus. Es war ein älteres, einstöckiges Granitsteingebäude und lag oberhalb einer kleinen henkelförmigen Bucht. Vom Garten aus hatte man einen phantastischen Blick über den Ozean.
Lagarde ging in sein Schlafzimmer im ersten Stock und packte eine kleine Reisetasche. Morgen früh wollten Odette und er für einige Tage nach Burgund fahren. Sie hatten geplant, Sehenswürdigkeiten wie das Zisterzienserkloster Cluny zu besichtigen, durch den bezaubernden Ort Dijon zu bummeln, entlang der Saône mit dem Fahrrad zu fahren und durch Weinberge zu wandern. Am Abend würden sie die dortige Gastronomie erforschen, schlemmen und einen guten Burgunder genießen.
Seine Lebensgefährtin war Eigentümerin eines Feinschmeckerrestaurants, das weit über Barfleur hinaus bei Gourmets sehr beliebt war und über einen hervorragenden Ruf verfügte. Normalerweise war sie dort unabkömmlich. Doch jetzt wurden die Küche und der Kühlraum renoviert und ein hochmoderner Kochherd eingebaut. Deshalb war das »Mirabelle« für eine Woche geschlossen. Weil Odette die Handwerker kannte und ihnen vertraute, war es Lagarde gelungen, sie zu der Reise zu überreden. Jacques, ihr genialer, mimosenhafter, eitler Chefkoch, hatte sich bereit erklärt, die Renovierungsarbeiten zu überwachen. Sie freuten sich sehr auf die Reise.
Er trug seine Tasche nach unten und stellte sie in den Flur. Aus dem Arbeitszimmer holte er zwei Reiseführer, eine Landkarte und seine Spiegelreflexkamera. Er hatte vor, viele schöne Bilder zu machen und nach ihrer Rückkehr ein Fotobuch zu gestalten, als Überraschung für Odette.
Jetzt musste er nur noch Alexandre versorgen. Der große, scheue Wildkater war ihm vor einiger Zeit zugelaufen und erwartete jeden Tag zwei Mahlzeiten, die aus Katzenmilch und Ragout, am liebsten Kaninchen oder Lachs, bestehen mussten. Lagarde trat auf die Terrasse und sah sich um. Alexandre saß neben seinen beiden leeren Futternäpfen und fauchte empört. Die gelben Augen funkelten. Sein buschiger, gestreifter Schwanz schlug auf den Boden. Als Lagarde sich den Schalen näherte, machte der Kater einen Satz nach hinten. Er mochte keine Nähe und ließ sich niemals streicheln. Nachdem der Kommissar die Näpfe gefüllt hatte, trat er zwei Schritte zurück. Alexandre trank die Milch und ließ ihn dabei nicht aus den Augen. Während Lagardes Abwesenheit würde sich Albertine, seine Putzfrau, um den Kater kümmern und den Garten gießen.
Lagarde lud sein Gepäck ins Auto und machte sich auf den Weg zum Mirabelle. Er schob eine CD mit französischen Chansons in die Musikanlage und sang mit Edith Piaf La Vieen rose. Für zehn Minuten folgte er der Landstraße, die durch einen Buchenwald führte. Um die hohen Stämme rankte sich Efeu, und Sonnenstrahlen bildeten tanzende Lichtpunkte im Blätterdach. Der Wald ging in weites Ackerland über, und in der Ferne erhob sich ein Weiler mit geduckten Granitsteinhäusern und einer umfriedeten Wehrkirche.
Odettes Restaurant lag etwa einen Kilometer landeinwärts in einem weitläufigen Apfelgarten. Er parkte sein Auto neben Odettes und ging den Weg entlang, der zum Restaurant führte. In steinernen Rosetten blühten Dahlien und Gladiolen in vielfältiger Farbenpracht und verbreiteten einen süßen Duft. Das graue, kegelförmige Dach des Restaurants, das aus groben Schieferplatten bestand, lugte hinter einer Zeder hervor. Lagarde vermutete Odette in der Küche, wo sie sicherlich die Renovierungsarbeiten überwachen und sich in alles einmischen würde. Deshalb war er erstaunt, als er sie an einem Tisch auf der Terrasse entdeckte, die von Kastanienbäumen beschattet wurde. Sie trank eine Tasse Kaffee und las eine Karte. Eine Strähne hatte sich aus dem Knoten gelöst, zu dem sie ihre dunklen Haare hochgesteckt hatte, und fiel weich auf ihre Schulter. Als sie seine Schritte auf dem Kies hörte, sah sie auf.
»Salut, mein Schatz«, begrüßte er sie.
»Salut, Philippe.« Ihre großen braunen Mandelaugen wirkten traurig und feucht. Er gab ihr einen Kuss und sah sie forschend an. »Was ist denn los? Ist etwas passiert?«
Sie nickte betrübt. »Ja, Georges ist tot.«
»Welcher Georges?«
»Georges Lebeau. Du kennst ihn nicht. Der Mann von Hélène.«
Hélène Lebeau war ihm ein Begriff. Sie hatte Odette im vorigen Frühjahr für einige Tage besucht. Die beiden kannten sich aus der Zeit, als sie Commis de Cuisine in einem Fünf-Sterne-Restaurant in Reims gewesen waren. Die Tyrannei des Directeur de Cuisine hatte die beiden jungen Frauen zusammengeschweißt. Als sie an einem freien Abend ein Konzert in der Fußgängerzone besucht hatten, hatte Hélène Georges kennengelernt. Sie hatte sich in ihn verliebt und war ihm in seine Heimat in der Haute-Provence am Lac de Sainte-Croix gefolgt.
»War er krank?«, fragte Lagarde.
»Nein. Er hatte einen Unfall. Sein Wagen ist in die Schlucht von Verdon gestürzt, was für ein entsetzliches Unglück.«
»Mon Dieu. Das tut mir sehr leid. Auch für Hélène und ihre Familie.«
Odette nickte. »Mir auch. Wie schlimm muss es sein, wenn jemand, den man liebt, so plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Was für ein Schock für die Hinterbliebenen. Die Beerdigung findet am Donnerstag statt, um sechzehn Uhr.«
Zögernd sah sie ihn an. Er wusste genau, was sie beschäftigte. »Du möchtest an der Beerdigung teilnehmen und deine Freundin trösten.«
Sie nickte stumm. Lagarde lächelte sie aufmunternd an. »Wir verschieben den Urlaub, mein Liebling. Das ist doch nicht schlimm. Deine Freundin ist wichtiger.«
»Ich glaube, ich fahre mit dem Zug. So eine lange Strecke möchte ich nicht im Auto fahren.«
»Ich habe eine bessere Idee. Warum fahren wir nicht zu zweit? Ich habe Hélène kennengelernt, und ich mag sie.«
Odette freute sich. Sie war nicht gern allein unterwegs. »Das ist eine sehr gute Idee. Ich rufe Hélène an und sage ihr, dass wir kommen.«
»Ich habe eine noch bessere Idee. Wenn wir morgen früh, wie geplant, starten, könnten wir für zwei Tage in dem gebuchten Hotel in Dijon übernachten, das liegt ungefähr in der Mitte der Route. So wäre es möglich, zumindest ein paar Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und einen Bummel durch die Altstadt zu machen. Vielleicht würde die Zeit sogar noch für eine Weinbergwanderung reichen, auf die hast du dich doch so gefreut. Am Donnerstag fahren wir zum Lac de Sainte-Croix und treffen rechtzeitig zur Beerdigung ein.«
Odette schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln. »Guter Plan, das machen wir! Magst du auch eine Tasse Kaffee?«
»Lieber einen doppelten Mokka.«
»Ich bin gleich wieder da.« Sie verschwand im Eingang des Restaurants.
Kurz darauf kam sie mit einem kleinen Tablett zurück. Darauf standen der Mokka, ein Glas Wasser und ein Porzellanteller mit winzigen, von Sahneschnecken gekrönten Kirschtörtchen.
»Danke schön.« Er griff nach einem süßen Teil.
Als sie gemeinsam ihren Kaffee tranken, machten die Handwerker Feierabend. Es war schon nach achtzehn Uhr. Die Männer in den verstaubten blauen Arbeitsoveralls verabschiedeten sich freundlich und wünschten einen schönen Abend. Ein junges Mädchen, den Werkzeuggürtel lässig um die schmalen Hüften geschlungen, eine Baseballkappe auf dem blonden Schopf, schien sich im Kreis ihrer Kollegen wohl zu fühlen. Odette winkte ihnen nach.
»Die Handwerker haben bisher gute Arbeit geleistet. Sie sind wirklich tüchtig. Ich denke, die Renovierungsarbeiten werden Ende der Woche fertig sein. Morgen wird der High-Tech-Herd installiert. Darauf zu kochen wird ein Traum.«
Lagarde grinste. »Davon bin ich fest überzeugt.« Er trank seinen Mokka aus und erhob sich. »Ich werde jetzt den Grill anzünden und die Fische vorbereiten. Schließlich wollen wir morgen früh zeitig los. Ich möchte dich in Dijon zum Dîner in ein feines Restaurant einladen.«
»Gut. Dann kümmere ich mich um die Beilagen. Rosmarinkartoffeln, Artischockensalat, Koriandersauce?«
»Perfekt, mein Liebling.«
»Dazu ein Muscadet, Sèvre et Maine sur Lie. Eine hervorragende Wahl zu Fischgerichten, Muscheln und Austern.«
Sie verschwand über die Treppe und die Galerie in ihrer Wohnung, die im ersten Stock des Haupthauses lag. Lagarde war erleichtert, dass sie nicht mehr so traurig war. Beim Essen würde er ihr erzählen, dass er schon einmal in der Haute-Provence gewesen war.
Lagarde hatte Odette nicht verraten, in welchem Hotel in Dijon er ein Zimmer gebucht hatte. Es sollte eine Überraschung werden.
Das »Grand Hotel La Cloche«, die Glocke, war ein Fünf-Sterne-Hotel und lag an der Place Darcy. Es galt als das schönste Hotel in Dijon. Dort hatten, wie das Gästebuch belegte, viele Prominente gewohnt, unter anderem Gracia Patricia von Monaco und Louis de Funès. Er hatte ein Superior-Zimmer mit einem großen Bad und einem Kingsize-Bett reserviert.
Am Abend nach ihrer Ankunft lud er seine Freundin in das Gourmetrestaurant des Hotels, »Die Gärten der Glocke«, ein, das sich in einem Wintergarten befand, der sich zum Garten hin öffnete. Es war nicht leicht gewesen, einen Tisch zu bekommen. Die Überraschung gelang. Odette strahlte und sah in ihrem schwarzen Cocktailkleid hinreißend aus. Während des Dîners trat der Koch an ihren Tisch und fragte, ob sie zufrieden seien. Als er Odette erblickte, stutzte er für einen Moment. Dann erkannte er sie und erklärte ihr, wie stolz er sei, eine Köchin, die mit einer Haube von Gault Millau ausgezeichnet war, in seinem Restaurant begrüßen zu dürfen. Gemeinsam tranken sie ein Glas Champagner, und Odette lud ihn in das Mirabelle ein. Der Koch liebte die raue Normandie und wollte im Herbst für einige Tage dort Urlaub machen und hochseefischen.
Der fliegende Fisch
Der kleine malerische Ort Moustiers-Sainte-Marie lag einige Kilometer nördlich des Stausees Lac de Sainte-Croix am Fuß eines rauen Bergmassivs. Er war eingebettet in eine Landschaft aus bizarren Felsen, grünen Hügeln, silbrig glänzenden Olivenhainen und leuchtenden Lavendelfeldern. Das größte und ertragreichste Gebiet in den Flussauen des Verdon war bei der Flutung überschwemmt worden. Die Kapelle Notre-Dame-De-Beauvoir, die über eine Felsentreppe erreicht werden konnte, thronte auf einer Tempelruine über der Schlucht von Verdon. In den Gassen von Moustiers befanden sich, wie in allen typischen Ortschaften der Provence, Trinkwasserbrunnen. Die Touristen liebten es, durch die pittoresken Sträßchen zu bummeln und den Kunsthandwerkern über die Schulter zu schauen. Berühmt war der Ort für seine jahrhundertealte Fayence-Tradition.
Die Pfarrkirche erhob sich stolz über dem Dorf. Der Friedhof war begrenzt von einer hohen, verwitterten Steinmauer. Im Hintergrund wuchsen auf einem Kalksteinkegel Macchie und Korkeichen. Der Ausblick auf den türkisfarbenen See und die sich bis zum Horizont erstreckende Gebirgslandschaft war überwältigend.
Die sandfarbene Aussegnungshalle mit dem roten Ziegeldach und dem alten Glockenturm lag im hinteren Bereich des Friedhofs. Dorthin führte ein schmaler Kiesweg, der von blühenden Oleanderbäumen gesäumt wurde. Über den Gottesacker wehte eine leichte Brise, die die Hitze ein wenig milderte. Es duftete nach Jasmin und Pinienzapfen.
Vor dem Holzportal, dessen Flügel weit geöffnet waren, stand Hélène Lebeau. Die schmale Gestalt wirkte verloren. Sie trug ein schwarzes, streng geschnittenes Kostüm und einen eleganten Hut mit einem Netz, das ihr Gesicht halb verdeckte. Neben ihr stand ein junger Mann, groß, korpulent, mit einem wilden schwarzen Bart, ebenfalls in Trauerkleidung. Er wirkte unbeholfen und am Boden zerstört. Man sah, dass er geweint hatte. Mit eiserner Disziplin, das bleiche Gesicht versteinert, begrüßte Hélène Lebeau jeden Trauergast persönlich und reichte ihm die Hand. Mit leiser Stimme bedankte sie sich höflich für die Kondolenz. Es bildeten sich Grüppchen, die schweigend zusammen standen.
Als Odette ihre Freundin erblickte, schnürte Mitgefühl ihr Herz zusammen. Sie umarmte Hélène. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie. Als sie das Gesicht ihrer Freundin sorgenvoll musterte, stellte sie fest, dass deren Augen vom Weinen geschwollen und rotgeädert waren. Die Wangen waren eingefallen. Hélène versuchte ein Lächeln, das misslang. »Ich freue mich, dass du gekommen bist, Odette.«
Lagarde drückte sie kurz und sprach ihr sein Beileid aus. Die Witwe bedankte sich bei ihm. Nach und nach begaben sich die Trauergäste in die Aussegnungshalle und suchten sich einen Platz auf den Holzbänken. Hélène Lebeau, ihr Sohn Xavier und Verwandte der Familie setzten sich in die erste Reihe.
Als der Abbé feierlich gekleidet an die Kanzel trat, erhob sich die Trauergemeinde. Nach einem Gebet und einem gemeinsam gesungenen Kirchenlied schilderte er wichtige Stationen im Leben von Georges Lebeau. Hélènes Schultern bebten. Schließlich wurde der helle Eichensarg mit dem Orchideengesteck von vier schwarzgekleideten Männern zum Grab getragen und in die Grube hinabgelassen. Der Weg dorthin wurde vom Gesang einer Frau begleitet, die Georges Lebeaus Lieblingsarie zum Besten gab. Es waren berührende Momente. Jeder Trauergast trat an das Grab, verabschiedete sich und warf eine weiße Rose hinein. Nachdem die Zeremonie beendet worden war, verkündete der Abbé, dass die Trauergesellschaft von der Familie Lebeau zu einem Imbiss im Restaurant gegenüber der Kirche eingeladen war.
Odette und Lagarde liefen Hand in Hand, langsam und gedankenversunken, über den Kiesweg zum Friedhofsausgang. Sie folgten anderen Trauernden über eine Treppe und quer über die Straße zum Gasthaus. Dort war die Terrasse für die Gäste reserviert. Große stabile Schirme spendeten Schatten.
Hélène bat sie an ihren Tisch. Sie schien sich ein wenig gefasst zu haben. Ihr Teint war jedoch noch immer kalkweiß. Ihre vergissmeinnichtblauen Augen, die sonst immer fröhlich und unternehmungslustig geleuchtet hatten, waren trüb und dunkel vor Schmerz. Odette vermutete, dass sie ein Beruhigungsmittel genommen hatte. Wie sollte sie sonst diese Tortur durchstehen?
Kellner servierten Getränke, Kuchen und Platten mit Kanapees, und die Gäste griffen zu. Die Witwe rührte keinen Bissen an und nippte an einer Tasse Kaffee. Sie schien mit ihren Gedanken ganz weit weg zu sein. Ihr Sohn saß dicht neben ihr und zerkrümelte mit der Gabel ein Stück Napfkuchen, das er kaum angerührt hatte. Einige Mitglieder der Trauergemeinde begannen über Georges zu sprechen und Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Xavier blieb stumm. Er sah seinem Vater sehr ähnlich. Seine Mutter lächelte Odette und ihren Lebensgefährten an.
»Ich freue mich so, dass ihr gekommen seid. Ihr bleibt doch sicher ein paar Tage? Ich werde ein Gästezimmer für euch herrichten. Wie ihr wisst, wohne ich in Bauduen, am Südufer des Sees. Es wird euch gefallen.«
Odette streichelte liebevoll ihre Hand. »Wir haben in Bauduen ein Hotelzimmer gemietet, weil wir dir nicht zur Last fallen wollen. Du brauchst jetzt sicherlich viel Ruhe. Aber wir können bis Samstag bleiben, wenn du möchtest.«
»Das wäre schön. Nach der Trauerfeier möchte ich nach Hause und mich hinlegen. Ich bin völlig am Ende. Georges’ Tod ist ein Schock für mich. Was für ein entsetzliches Unglück.« Sie schluchzte auf. »Xavier wird mich begleiten und sich um mich kümmern. Er ist für ein paar Tage in sein altes Kinderzimmer gezogen.« Sie lächelte ihren Sohn liebevoll an. »Er ist mir eine große Stütze.«
Der junge Mann legte den Arm um sie und küsste sie auf die Wange. »Ich passe auf dich auf, Maman. Versprochen.«
Hélène hatte eine Idee. »Kommt doch morgen zum Mittagessen zu mir. Dann können wir reden. Ich koche etwas Schönes für euch.«
»Das machen wir gerne, Hélène«, versprach Odette. »Hoffentlich geht es dir dann ein wenig besser.«
Lagarde hatte das Gefühl, dass die beiden Frauen reden wollten und entschuldigte sich. Die Hände in den Hosentaschen, schlenderte er zur Balustrade der Terrasse und betrachtete die schöne, ungezähmte Landschaft, die sich vor ihm erstreckte. Unterhalb des Aussichtspunktes lag still der smaragdgrüne See. Von seinem Standpunkt aus konnte er den Stern erkennen, der an einer langen Kette das Tal überspannte und, nach einer Überlieferung, den Ort und seine Umgebung schützen sollte. Er war mit Blattgold überzogen, das in der Sonne glänzte.
Als er sich abwandte und eine Runde durch den Garten des Restaurants drehen wollte, hörte er eine kräftige, tiefe Männerstimme, die ihm bekannt vorkam. Sehr bekannt sogar. Erstaunt sah er sich um und traute zuerst seinen Augen nicht. Am hintersten Tisch, vor einer Pergola, über die eine weinrote Bougainvillea kletterte, entdeckte er drei Männer, mit denen er vor vielen Jahren sehr gut befreundet gewesen war. Grinsend trat er an den Tisch und klopfte mit der Faust auf das Holz. »Bonjour, Messieurs.«
Pascal erkannte ihn zuerst. Ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Inzwischen hatte er eine Glatze, er schien noch hagerer geworden zu sein, und seine große Nase glänzte rötlich. Früher hatten sie ihn »das Superhirn« genannt.
»Philippe!« Er sprang auf und umarmte ihn. »Unser Chefstratege. Was machst du denn hier?« Lagarde kam nicht dazu, eine Antwort zu geben. Samy schlug ihm mit seiner Pranke auf die Schulter. Sein Kumpel war noch immer durchtrainiert und trug das weizenblonde Haar, so wie früher, streichholzkurz geschnitten. Sein smartes Zahnpastalächeln hatte sich kein bisschen verändert. Aufgrund seiner praktischen Veranlagung und weil er der Skrupelloseste unter ihnen war, war er immer der Mann für das Grobe gewesen. »So eine Überraschung!«