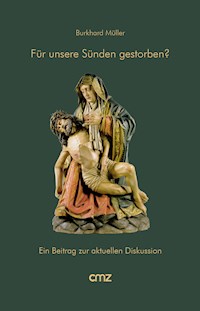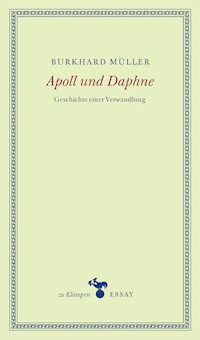Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schillers Todestag jährt sich im Mai 2005 zum 200. Mal. Burkhard Müller will den Untiefen der Jubiläumsliteratur entgehen. Weder läßt er Schiller ein weiteres biographisches Begräbnis erster Klasse zuteil werden. Noch tut er ihn als 'Idealisten' ab, also als sympathischen Spinner. Stattdessen geht er von dem aus, was Schillers Größe ausmacht: der leidenschaftlichen Sprache des Dichters, in der er seine Bühnenfiguren erschafft und sie zu ihren Taten vorantreibt. Wie in seinem dramatischen Werk läßt Schiller sich auch in seinen philosophischen und historischen Schriften vom szenischen Sprachdenken fortreißen, halsbrecherisch kommen seine Thesen daher; sie gleichen Verschwörungen des Geistes, wobei der ausgefuchste Plan immerfort durch die kühne Improvisation überholt wird. In unserem Zeitalter, dessen Theater schwach und dessen Theorieunlust ausgeprägt ist, ist Burkhard Müllers schwungvoller Essay eine Provokation – und wird damit dem Vermächtnis Schillers gerecht.'Wie oft habe ich den Regisseur verflucht, der die Schauspieler, die ersichtlich ihr Handwerk könnten, wenn man sie nur ließe, für seine Mätzchen verbrät wie ein stümperhafter Koch, der aus lauter erstklassigen Zutaten einen Fraß anrichtet und dafür gar noch gelobt werden will! Das Theater wird nur dann eine Zukunft haben, wenn es wieder zum Theater der Schauspieler wird und dem Regisseur den Platz anweist, der ihm zukommt, irgendwo zwischen Garderobenfrau und Beleuchter.' Burkhard Müller
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Müller
Der König hat geweint
Schiller und das Drama der Weltgeschichte
Erste Auflage 2005
© zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe
e-mail: [email protected]
www.zuklampen.de
Satz: thielen VERLAGSBÜRO, Hannover
Umschlag: Matthias Vogel (paramikron), Hannover
ISBN 9783866743984
1. digitale Auflage 2014: Zeilenwert GmbH
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Schrecken der Unsterblichkeit
Mäntel, schwarz und scharlachrot
Der Fiesco und Schillers theatralisches Sprachdenken
Der König hat geweint
Don Carlos und die Staatsaktion
Der auswendige Schiller
Gedächtnis, erpresst und unwillkürlich: Ballade und geflügeltes Wort
Goldene Wellen im dunklen Strom
Die Idee der Universalgeschichte
Kehrichtfass und Rumpelkammer
Von der Schwierigkeit, einer Sache auf den Grund zu gehen: Die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges
Die Gewalt dem Begriff nach vernichten
Zwang und Freiheit in Schillers späteren Schriften
Schluss
Auch das Schöne muss sterben · Die Nänie
Über den Autor
Fußnoten
Einleitung SCHRECKEN DER UNSTERBLICHKEIT
Kurz vor Weihnachten des Jahres 2004, am Vorabend des Schillerjahrs. Im Theater einer großen deutschen Provinzstadt werden die Räuber von Friedrich Schiller gegeben. Das Haus ist gefüllt bis auf den letzten Platz, und zwar ganz überwiegend mit Schulklassen, die an der Hand ihres Deutschlehrers hierher gekommen sind. In der zweiten Halbzeit macht sich die bislang mühsam zurückgedämmte Langeweile des Publikums geltend, es wird unruhig, es fängt an, Gummibärchen aus Tüten zu essen, deren Knistern die Lautstärke kleiner Explosionen erreicht. Die Handlung nähert sich dem Finale furioso, drei Leichen bedecken bereits den Boden der Bühne. Da ruft jemand aus dem hinteren Drittel »Zugabe!«, ein erlöstes Lachen bricht sich Bahn, alle Wirkung des Stücks ist verpufft. Die Schauspieler haben sichtlich Mühe, zu Ende zu spielen.
Wem nutzt diese Veranstaltung? Nicht dem Publikum, das sich nicht aus eigenem Antrieb, sondern unter dem Druck eines kulturellen Kanons hier versammelt hat; nicht den Lehrern, die, freiwillig oder unfreiwillig, auf das Geheiß ihres Lehrplans hin tätig geworden sind; nicht den Akteuren, für die es eine Qual sein muss, vor einem solchen Publikum aufzutreten. Und mit alledem wird auch dem Autor des Stücks wenig gedient sein. Wozu also das Ganze?
Wir sind wahrlich nicht das erste Geschlecht, das antritt, um Friedrich Schillers zu gedenken. Keine der sieben verschiedenen Staatsgewalten, die Deutschland in den letzten hundert Jahren erlebt hat, ließ es sich nehmen, Schiller die Reverenz zu erweisen. Das Kaiserreich ehrte in ihm den Patrioten, die Weimarer Republik den Republikaner. Hitler unterband– spät– die Aufführung des Don Carlos und des Wilhelm Tell; aber er reiste nach Weimar, um neben Goethe auch Schiller seine Aufwartung zu machen. Die französische Besatzungszone erweiterte das Zwillingspaar zu einer Troika und setzte, aus leicht durchschaubaren politischen Gründen, Schiller, Goethe und Heine auf die hohen Werte ihrer Briefmarkenserie. Als dann die zwei deutschen Staaten in West und Ost zur Welt kamen, richtete es ein gerechtes Schicksal so ein, dass dem Osten die Wirkungs- und Todes-, dem Westen aber die Geburts- und Jugendstätten Schillers zufielen. So blühte das Marbacher Schillerhaus zum zentralen Literaturarchiv der jungen oder, wie man heute besser sagen sollte, der alten Bundesrepublik empor. Und auch deren Todfeind, die Deutsche Demokratische Republik, wusste Schiller als Teil ihres Erbes zu schätzen. Nun ist also die Berliner Republik an der Reihe.
Als 1909 der hundertfünfzigste Geburtstag Schillers ins Haus stand, verfasste Karl Kraus die Satire Schrecken der Unsterblichkeit: »Sie werden hervorkriechen, ich ahnte es, sie werden hervorkriechen. Wenn ein Denkmal renoviert wird, kommen unfehlbar die Mauerasseln und die Tausendfüßler ans Licht und sagen: Denn er war unser!(…)Ehe wir von dem Künstler reden wollen, muss unbedingt auch nur die entfernsteste Möglichkeit beseitigt sein, dass vor einer Schillerbüste ein Männergesangsverein Aufstellung nimmt.« Für die höchste Pflicht angesichts der runden Jahreszahl hielt es Kraus, von dem Gefeierten den ihn vereinnahmenden Bildungsphilister abzuwehren.
Im Schillerjahr 2005 bietet sich eine erheblich veränderte Lage dar. In mancher Hinsicht hatten es alle drei– die Feiernden, der Gefeierte und der Satiriker– damals, vor rund hundert Jahren, leichter als wir heute. Die Feiernden wussten von keiner Distanz; Schillers Pathos kam ihnen grade recht, und wo es allzu schnaubend geriet, da warfen sie sich Seitenblicke zu, die dem Respekt indes keinen Abbruch taten. Schiller galt diesen Festrednern der Kaiserzeit als Geistesfürst: in seiner angeborenen oder besser angestorbenen Position durch persönliche Besonderheiten und selbst Mängel nicht zu erschüttern. Nichts leuchtete der Zeit mehr ein als die Weimarer Fürstengruft, wo Schiller bestattet liegt. Dies stellt die Stärke des monarchischen Prinzips dar, dass ihm die Pietät immer fraglos ist– so stark, dass sie jeden Spott und jede Vertraulichkeit aushält.
Diese Zeit besaß, was immer man sonst von ihrer schöpferischen Leistung sagen mag, eine spezifische Begabung dafür, Denkmäler zu schaffen. Der Hohn, dass so ein Denkmal doch zu nichts gut sei, als die Gedankenlosigkeit der Vorübergehenden zu seinen Füßen und den Taubendreck auf seinem Haupt zu erdulden, hat sich heute ermüdet. Wo immer man auf diese großen Denkmäler von vor hundert Jahren stößt, erblickt man einen städtebaulich geglückten Streich. An der Unbedeutendheit des geehrten Poeten, an der Fragwürdigkeit des dargestellten Schlachtenlenkers wachsen sie empor, um Plätze, Parks und ganze Stadtviertel um sich zu ordnen. Dass kein Mensch sie im eigentlichen Sinn betrachtet, mag man ihnen heute nicht mehr einwenden; das periphere Sehen, ja das bloße Wissen, dass ein Ding da ist, hat für eine Kultur mehr Gewicht als das zentrale Hinschauen. Sehr wohl und sehr schmerzlich würde jeder die Lücke bemerken, die an die Stelle tritt, wo früher ein eherner Schiller stand. Der raumbewusst ausgreifenden Gestalt solcher Monumente folgte nichts nach, das sich mit ihnen vergleichen ließe; es folgten die Denksteine des Ersten Weltkriegs, Klötze voll einer aztekischen Verfinsterung des Trotzes; dann nur noch die peinliche Verlegenheit, die unausweichlich allem anhaftet, was heute in Bronze gegossen wird. Insbesondere völlig verloren ist die Kunst, einen Sockel zu bauen. Die Figur eines verstorbenen Zeitungsplauderers in der Münchner Fußgängerzone, Passant unter Passanten und doch mit einem Rollkragenpullover aus Erz– nein, so geht es nicht. Neue Schillermonumente sind diesmal nicht zu erwarten; gerade eben noch, dass die Post zum 200. Jahrestag der Tell-Premiere eine Briefmarke herausgibt. Sie zeigt Tells Sohn als verschwommenen Schatten, der auf die Bühnenbretter fällt, auf dem Kopf den Apfel und dieser von einem Pfeil durchbohrt. Es ist die trübselige Schwundform eines Denkmals, worin selbst die elende Ironie, die überall herrscht, sich bis zum Infantilen erschöpft hat.
Die Schiller-Verehrung der Philister vor hundert Jahren war platt, aber sie hatte Fasson; sie wusste, wie man einen Lorbeerzweig um eine Schläfe windet. In ihrer klarumrissenen Kontur bot sie dem Satiriker die Zielscheibe, die er brauchte. Das Philistertum ist heute komplexer geworden; und obwohl der Männergesangsverein, der vor einem Gipskopf knödelt, nicht ganz und gar der Vergangenheit angehören mag, bietet er heute doch ein Sujet eher für die Feder eines Loriot als eines Karl Kraus.
Vor allem jedoch schien die Bedeutsamkeit Schillers ganz unumstößlich und nur ein mannhafter Akt vonnöten, um dem Falschen das Richtige zu entreißen. Das allgemeine emphatische Missverständnis bot die Gewähr, dass jedem Versuch der Umdeutung die Aufmerksamkeit sicher war. Wer durfte ihn besitzen? Das war die Frage damals. Heute fragt sich eher, wer ihn noch haben will.
Das Mechanische, das Gedenktagen wohl immer schon eigen war, hat sich nach dem, was Dekonstruktivismus und Postmoderne mit der Tradition angestellt haben, zur völligen Geistesabwesenheit fortentwickelt. Nichts kommt abhanden; aber alles ist gleichgültig geworden. Der Eintrittspreis für die Teilhabe ist auf nahe Null gesunken; Enthusiasmus befremdet. Natürlich wünscht sich niemand die pneumatischen Festakte zurück, sie seien aufrichtig oder erheuchelt. Aber es wird den Gästen nunmehr jede Art intellektuellen oder affektiven Aufwands grundsätzlich erlassen. Besichtigung genügt. Und wenn noch das Wesentliche besichtigt würde! Als Adorno vor kurzem hundert wurde, da war das am aufmerksamsten verfolgte publizistische Ereignis ein Buch, das seine kindischen Briefe enthielt, worin er sich eine trübe Erholung von den Anstrengungen der Dialektik gönnte. Noch schlimmer erging es Immanuel Kant, dessen zweihundertster Todestag dem Schillers um ein Jahr vorauslief. Auch hier hielt man sich, um sich nicht zu verheben, an das Private, das bei Kant doch extrem dürr ausfällt; das Publikum durfte ihn erleben, wie er zur Männergesprächsrunde am Mittagstisch lud oder seinen Senf selbst herstellte. Kein Gedanke daran, ob das, was er geschrieben hat, noch lesens- und bedenkenswert sei. Wer Kant nur aus den anlassgebundenen Zeitungsartikeln kennenlernen wollte, der musste zum Schluss kommen, sein wichtigster Beitrag zur Weltkultur sei die Erfindung der Kantstraße in den deutschen Neubaugebieten der Fünfziger gewesen.
Und jetzt ist Schiller dran. Die alte nationale Vereinnahmung muss man nicht mehr fürchten, denn das Nationale hierzulande ist friedfertig bis zur Vertrottelung geworden. (Das heißt, wenn nicht gerade ein Fußballländerspiel ansteht, bei dem doch noch das eine oder andere Nasenbein zu Bruch gehen kann.) Was ihm jedoch noch gefährlicher als Kant und Adorno werden könnte, das ist der Privatmann, der bei ihm so unvergleichlich viel mehr hergibt. An ihn wird man sich halten und das Jubiläum in seiner arithemtischen Zufälligkeit so begehen, wie wenn ein neuer Nachbar zugezogen wäre: Man macht gute Miene zum Unvermeidlichen, man tratscht über ihn, doch ohne Bosheit, und findet ihn eigentlich ganz nett, ein bisschen verschroben vielleicht.
Das hat es zu bedeuten, wenn Schiller auf einmal als »Idealist« gewürdigt wird. Vom Idealisten existieren zwei Begriffe, die ineinander verfließen. Auf der einen Seite steht die strenge, systematische Denkungsart Platons und der deutschen Philosophen; sie ist wohl weitgehend historisch geworden und hat sich erledigt. Schiller hat ihr nahe gestanden, ohne je eigentlich dazuzugehören. Aber nicht dieser Aspekt steht im Vordergrund. Idealist ist zweitens wohlwollende Bezeichnung für den Unpraktischen, der ans Gute im Menschen glaubt und daher häufige Entttäuschungen erlebt; für den Hans-guck-in-die-Luft, der den Wolken nachsieht und dabei in den Kanal fällt, wo ihn mitleidige Seelen herausfischen müssen. Man weiß die Güte dieses Menschen zu schätzen; aber man nimmt sie nicht wirklich ernst und schon gar nicht vorbildlich, weil sie durch ihre Lebensfremdheit, ihr mangelndes Urteilsvermögen ein wenig lädiert wirkt und zum Schmunzeln verleitet.
Im »Idealisten« soll die Gipsbüste zum Menschen wachgeküsst werden; nicht zu ihrem Vorteil. Man will damit, bei aller Sympathie, die Größe so klein wie möglich halten. Ein sinnfälliges Beispiel dafür bot unlängst der »Spiegel«, der sich entschlossen hatte, die Neuigkeiten der Woche zu überspringen und dafür Schiller aufs Titelblatt zu setzen. Sein rotblondes Haar war effektvoll zur Flammenlohe umgekämmt. So will man ihn haben: als Feuerkopf, als Struwwelpeter des Ideals. Es wird zur schrillen und doch netten Marotte wie ein Punkerschnitt, hübsch anzusehen, auch wenn man sich selbst nie so frisieren würde.
Schiller jedoch, und das stellt die Voraussetzung meines Buchs dar, bleibt eine Größe; eine in vieler Hinsicht problematische Größe. Die Tradition ist durchlöchert, fast nichts an ihr versteht sich mehr von selbst; die Kanondiskussion der letzten Jahre war der verzweifelte Versuch, einen geplatzten Luftballon wieder zusammenzukleben. Die Huldigung ist als Haltung der Rezeption an ihr Ende gelangt. Es muss einer schon gute Gründe beibringen, warum man diesen Autor jetzt wählen sollte, und was von ihm. Wählen ist ein freier Akt, aber ein gewichtiger.
Wer die Frage stellt, was uns Schiller heute bedeuten kann, muss sich mit zwei Fakten auseinandersetzen, von denen die Geltung dieses Autors bedroht und beeinträchtigt wird: die zeitgenössische Schwäche des Theaters; und die allgemeine Theoriemüdigkeit, oder nennen wir sie, um nicht den milden und falschen Eindruck einer Ermattung nach getaner Tat zu erwecken, lieber gleich Theoriefaulheit. Dem sollte man ins Auge sehen; und dann Mut zum zweiten Schritt sammeln, nämlich zuzugeben, dass es unser Manko ist und nicht dasjenige Schillers, wenn wir vor so Vielem, was er geschrieben hat, einigermaßen ratlos und unbehaglich stehen. Denn dass man schärfer denken sollte als es heutzutage meistens geschieht, und dass die Bühne nicht annähernd die Wirkungen erzielt, die der Höhe ihrer Subventionen entspräche, das empfinden wir, glaube ich, sehr wohl. Es ist in beidem, im Denken und im Theatralischen, bei Schiller dasselbe Sprachfeuer am Werk, ein Feuer des Hirns und nicht des Haarschnitts; ein Feuer, das ihn verbrennt und ihm ein frühes Ende bereitet. Im Ringen von Kalkül und hingerissener Fahrlässigkeit gelangt es zu Resultaten, durch die es sich oft selbst in Erstaunen setzt. Manche dieser Resultate sind von der bedenklichsten Art. Aber nicht daran liegt es, wenn dieses Feuer heute nicht fängt; sondern es fällt in eine nasse Epoche.
Es ist vor allem eine Epoche, die von der Besonderheit, ja man darf sagen Würde, dass wir gerade jetzt, unter Ausschluss aller Anderen, der Früheren wie der Späteren, lebendig sind, einen schwachen oder gar keinen Begriff hat. (Schiller besaß das Gefühl dafür in hohem Grade.) Ein Bändchen nennt sich »Schiller für Zeitgenossen«. Wer aber erwartet, dass sich hier ein Herausgeber der Aufgabe unterzogen hätte, Schiller mit Ernst auf seine gegenwärtige Verwendbarkeit hin zu untersuchen, der wird enttäuscht. Es findet sich hier u.a.: »Und setzet ihr nicht das Leben ein,/ Nie wird euch das Leben gewonnen sein.« Das ist zeitlos, bestenfalls. »Mit dem Pfeil, dem Bogen,/ Durch Gebirg und Tal,/ Kommt der Schütz gezogen,/ Früh am Morgenstrahl.« Das war schon für Schiller historisch. Vor allem aber handelt es sich um eine Gerümpelkammer einst kurrenter und heute eher pläsierlich wirkender Zitate vom Muster »Dem Manne kann geholfen werden« oder »Ehret die Frauen! sie flechten und weben/ Himmlische Rosen ins irdische Leben«, letzteres aus dem Langgedicht »Würde der Frauen«, das mit besserem Recht das Lied von der Glucke hieße. Der Zeitgenosse ist hier völlig auf das komplizenhafte Zwinkern, auf den munteren oder merkwürdigen Zeitgenossen heruntergebracht. So setzt er sich mit dem Idealisten ins Benehmen. Es ist, wie die Briefmarke zum Tell, ein Anblick von trauriger Lustigkeit.
Nun sind es also zweihundert Jahre, dass Schiller gestorben ist. Todestage sind die heikleren der beiden Jubiläumsarten, zu denen die geistige Menschheit ihren Gedenk-Kalender verdoppelt hat, damit, wie beim Heiligen Jahr im Vatikan, zuverlässig jede Generation einmal Gelegenheit erhält, zum Ewigen zu pilgern. Einen runden Geburtstag darf man einigermaßen unbefangen begehen; dieser Tag hat der Welt das künftige Genie geschenkt, man tritt, wie bei einem Fest des Jahreskreises, kraft Wiederholung froh in einen Anfang ein. Man freut sich mit dem Geburtstagskind, und würde es selbst, wie letzten Sommer Petrarca, siebenhundert. Der Todestag aber ist das Datum, das der Gefeierte, solang er tätig war, nicht wissen konnte: das größte und gnädigste Geheimnis seines Lebens. Dass wir es wissen; dass wir den Abschluss in der Hand haben, der dem Berühmten verborgen bleiben musste und durfte, wie uns der Tag unseres eigenen Endes gnädig verborgen ist: sollte zum Nachdenken bringen über das Wesen und den Preis aller Überlieferung. Geburtstage verpflichten mit ihrem runden Anlass zu nichts als guter Laune. Wenn jedoch die Gäste einer Totenfeier sich mit der Erkenntnis zufriedengeben wollen, dass ihr Todestagskind seit soundsoviel Jahren unter der Erde ist, dann wären sie besser daheim geblieben. Der Todestag sollte zur Besinnung über die Unsterblichkeit zwingen, die ohne Schrecken nicht zu haben ist. Denn es geht ihr notwendig der Tod voraus; und zuerkannt werden kann sie einem bedeutenden Menschen je nur von Sterblichen, die ihm, wenn sie ihn genießen wollen, ein Stück ihres eigenen Lebens, ihrer Zeit, ihrer Neigung, ihres Gedächtnisses, darzubringen bereit sein müssen– oder sie findet nicht statt. Wie sagt doch der Dichter? »Und setzet ihr nicht das Leben ein,/ Nie wird euch das Leben gewonnen sein.« Beim Wort Unsterblichkeit beginnen die geladenen Gäste unruhig zu werden; es gehört so überaus deutlich dem Vokabular des Mannes an, in dessen Namen sie hier zusammengetroffen sind. Ihm, Schiller, war es ernst mit dieser Vokabel, obgleich ihm, wenn er sie aussprach, zu viel Luft durch seine große Nase entwich. Mit diesem Kontrast kommen sie schwer zurecht und neigen deshalb dazu, ihn als komisch anzusehen. Wem es ernst ist mit Schiller, muss den Kontrast aushalten können.
MÄNTEL, SCHWARZ UND SCHARLACHROT
Der Fiesco und Schillers theatralisches Sprachdenken
Wenn Sie als Ehrengast zu einem Schiller-Abend geladen würden und dürften bestimmen, welches Stück von ihm an diesem Abend gepielt wird, wobei Sie die Garantie bekämen, dass man es wirklich gut macht– welches würden Sie wählen?
Ich würde mich für den Fiesco entscheiden. Und zwar vor allem deswegen, weil ich gespannt wäre, was »wirklich gut gemacht« heute auf der Bühne heißen kann. Die beiden anderen Jugend-Stücke Schillers erfreuen sich deswegen so großer Beliebtheit, weil sie den Regisseuren die Arbeit erleichtern; jeder kennt Die Räuber und Kabale und Liebe gut genug, dass sich das Verdienst des Autors ganz zurückstellen lässt und man sich stattdessen darauf konzentriert, welchen neuen Sitz im Leben ihnen diesmal wohl die Regie verpasst hat. Hat man die Räuber in eine Motorradbande verwandelt? Bietet sich Luise Millerin als mürrisch nuschelnder Teenager dar, der die Wände seines Mädchenzimmers mit Postern aus der »Bravo« dekoriert, vielleicht mit einem Piercing im Nabel?
Es ist zum Verzweifeln, wie wenig das zeitgenössische Theater aus seinem einzigen unangefochtenen Vorzug macht: dass es leibhaftige Menschen sind, die es zeigt; dass sie mit ihren Lungen dieselbe Luft atmen wie die anwesenden Zuschauer, dass ihre Zungen und Stimmbänder dieselbe Atmosphäre in Schwingungen versetzen. Aus solcher Nähe könnte der Schein, das heißt die Verabredung, dass diese Figuren etwas ganz anderes wären als die Menschen, die sie sind, in viel kühnerem Bogen aufsteigen als auf der Leinwand, wo alles längst gedreht und abgewickelt ist, ehe der erste zahlende Besucher den Spielfilm zu Gesicht bekommt. Wie flach ist der Filmakteur, wie unfrei in der kleinsten, immer identisch wiederkehrenden Nuance des Mienenspiels, wie tief unfähig, sich mit seinem Publikum zu verständigen! Mit einem Wort, wie leichen- und gespensterhaft. Das Theater, das überall sonst zurückbleibt, dessen special effects sich noch immer auf das Betrommeln eines Blechs beschränken, wenn es Donner macht, und das todsicher lächerlich wird, wenn es seine Figuren fliegen lassen will– das Theater hat die Lebendigkeit der nie wiederkehrenden Stunde. Das heißt, es könnte sie haben, wenn es sich auf seinen Schatz besinnen wollte, statt von der Leiblichkeit nur das Reißerische zu übernehmen, bevorzugt die Nacktheit– die ihm doch, da sie schlechterdings nur sie selbst ist und jeder Schein von ihr abgleitet, gefährlich werden muss. Das Theater, wie es sich heute präsentiert, konkurriert mit den neuen Medien auf dem unglücklichen Feld seiner technischen Armut und scheint seinen Reichtum vergessen zu haben. Wie oft habe ich den Regisseur verflucht, der die Schauspieler, die ersichtlich ihr Handwerk könnten, wenn man sie nur ließe, für seine Mätzchen verbrät wie ein stümperhafter Koch, der aus lauter erstklassigen Zutaten einen Fraß anrichtet und dafür gar noch gelobt werden will! Das Theater, das ist meine feste Überzeugung, wird nur dann eine Zukunft haben, wenn es wieder zum Theater der Schauspieler wird und dem Regisseur den Platz anweist, der ihm zukommt, irgendwo zwischen Garderobenfrau und Beleuchter.1
Am Fiesco muss die Regie zuschanden werden. Er ist ganz Plot und Geist, ein Schachspiel unter Aristokraten, und das stoffliche Pläsier, das sich etwa bei den Räubern zur breiten Ausmalung der Saufszenen ermuntert findet, bekommt hier keinen Fuß in die Türe. Selbst wenn eine hierüber verzweifelnde Inszenierung ihn zu einer Art Gondelmärchen umdeuten wollte oder was immer ihr sonst einfällt, bliebe jedenfalls so wenig von dem Stück übrig, dass es seinen abendfüllenden Charakter einbüßen und langweilig werden müsste. Die Bühne liebt ihn denn auch nicht besonders, auf zwölfmal Kabale und Liebe kommt noch kein einziges Mal Fiesco. Dabei wäre er für sie eine echte Herausforderung. Sie könnte zum Schauplatz werden, wo Dichter und Akteur, unbehelligt von der Dazwischenkunft eines Dritten, die Klingen kreuzen, um gegen- und miteinander ein rapides Stück aufzuführen, voll Pathos und Eleganz.
Im Fiesco tritt die Eigenart von Schillers dramatischem Genius am reinsten zutage. Er führt eine beschwingte, spannkräftige Sprache, die danach drängt, sogleich in Anschauung und Handlung überzugehen. Das unterscheidet Schiller, zum Vorteil der Bühne, etwa von Shakespeare, an dem sich Schiller sonst freizügig bedient. Shakespeare ist vielleicht der größere Dichter; aber der Dichter steht dem Dramatiker durchaus im Weg. Wenn Hamlet oder Macbeth zu ihren Monologen anheben, tritt ihre Wesensart als funkelnder Solitär hervor, gefasst in Shakespeares einzigartige Sprache– aber die Handlung kommt darüber zum Erliegen. Effizienz im Bau der Handlung gehört generell nicht zu Shakespeares Hauptanliegen, und das ist wahrscheinlich gut so. Der Zuschauer oder Zuhörer hat auch so alle Augen und Ohren voll zu tun, um sich in dem Zweierlei von Schauspiel- und Dichtkunst nicht zu verlieren, und oft genug ergeht es ihm wie dem Kinobesucher, der sich einen ausländischen Film mit Untertiteln ansieht: Er muss sich entscheiden, ob er den Text oder das Bild will, für beides zugleich reicht die Zeit nicht.
Das ist bei Schiller anders. Nicht dass er es dem Rezipienten unbedingt leichter macht; gerade beim Fiesco muss er scharf aufpassen, wenn er nicht die je entscheidende Wendung verpassen will. Aber bei Schiller steht alle Sprache bereit, um vom Geschehen verschlungen zu werden, und dauert doch als Sprache fort. Man lese das Personenverzeichnis des Fiesco. Da haben wir, als ersten Eintrag, »Andrea Doria, Doge von Genua. Ehrwürdiger Greis von achtzig Jahren. Spuren von Feuer. Ein Hauptzug: Gewicht und strenge befehlende Kürze.« Als nächstes folgt »Gianettino Doria, Neffe des Vorigen. Prätendent. Mann von sechsundzwanzig Jahren. Rauh und anstößig in Sprache, Gang und Manieren. Bäurisch-stolz. Die Bildung zerrissen.« »Beide Doria tragen Scharlach.« Nun erst kommt »Fiesco, Graf von Lavagna. Haupt der Verschwörung. Junger, schlanker, blühend-schöner Mann von dreiundzwanzig Jahren– stolz mit Anstand– freundlich mit Majestät– höfisch-geschmeidig und ebenso tückisch.« »Alle Nobili gehen in Schwarz. Die Tracht ist durchaus altteutsch.« Der Reihe nach treten sie an, knapper, aber auf ähnliche Weise charakterisiert. Den Abschluss bildet der Komet dieses Planetensystems, »Muley Hassan, Mohr von Tunis. Ein konfiszierter Mohrenkopf. Die Physiognomie eine originelle Mischung von Spitzbüberei und Laune.« Die Reihe der Damen ist kürzer; hier ragt hervor »Julia, Gräfinwitwe Imperiali, Dorias Schwester. Dame von fünfundzwanzig Jahren. Groß und voll. Stolze Kokette. Schönheit verdorben durch Bizarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gesicht ein böser mokanter Charakter. Schwarze Kleidung.«
Bei den meisten anderen Bühnenautoren würde man diese Liste, die fast zwei Seiten einnimmt, für eine schwere Belästigung ansehen müssen, als einen geschwätzigen Übergriff des Schriftstellers ins fremde Reich des Bühnenspiels. Den bösen mokanten Charakter der Dame kann er nicht vorschreiben und erzwingen– er muss einer Schauspielerin Gelegenheit geben, ihn zu agieren; ja er hätte es selbst zu dulden, wenn sie sich entschiede, diesen Charakter liebenswürdiger zu geben, als es ihm vorgeschwebt hat. Aber bei Schiller trägt diese Speisekarte deswegen so reichen Schmuck, weil sie bestimmt ist, als Vorspeise mitgegessen zu werden. Es handelt sich nicht um die malerische Zudringlichkeit eines Romanciers, der seinen Platz verfehlt hat. Sondern in dieser Galerie, deren Vorbild man sich leicht bei Tizian und Van Dyck denken kann, scheinen die Porträtierten sich in ihren Rahmen rühren zu wollen, noch ehe es losgeht. Auf diesen zerrissenen und wollüstigen und stolzen Gesichtern zuckt es schon in der Ruhe.
Die großen, dunklen Porträts der beiden genannten Maler leben aus dem gelassenen Vertrauen in die Macht des Kostüms. Neunzig Prozent der Oberfläche ihrer Bilder können der Wiedergabe kaum strukturierter Textilien gewidmet sein und machen doch nirgends den Eindruck des Stumpfen. Umso bedeutsamer betten sich darauf die Gesichter und die Hände, wie Embleme des Charakters und der ihm zugewiesenen Aktion. Schiller tut noch mehr, er erweckt auch die Gewänder von toten Hüllen, die sie sind, zum Leben der Gebärde, zu einem Schwarzen Theater, durch das wie ein Blitz das frevelhaft rote Tuch der Tyrannei fährt. Der Schluss des Dramas kann wirken, als hätten es hier die Mäntel ganz allein miteinander auszutragen, der schwarze des Republikaners Verrina und der rote Fiescos, der den alten Doria gestürzt hat und selbst Doge geworden ist.
»VERRINA (hält still, mit Wehmut). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesco. Hier ist ja niemand, der den Verrinaweinen sieht und einen Fürsten empfinden. (Er drückt ihn innig.) Gewiss, nie schlugen zwei größere Herzen zusammen, wir liebten uns doch so brüderlich warm– (Heftig an Fiescos Halse weinend) Fiesco! Fiesco! du räumst einen Platz in meiner Brust, den das Menschengeschlecht, dreifach genommen, nicht mehr besetzen wird.
FIESCO (sehr gerührt). Sei– mein– Freund–
VERRINA. Wirf diesen hässlichen Purpur weg, und ich bins– Der erste Fürst war ein Mörder und führte den Purpur ein, die Flecken seiner Tat in dieser Blutfarbe zu verstecken– Höre, Fiesco– ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen– Fiesco– das sind meine ersten Tränen– Wirf diesen Purpur weg.
FIESCO. Schweig.
VERRINA (heftiger). Fiesco– lass hier alle Kronen dieses Planeten zum Preis, dort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll knien vor einem Sterblichen– ich werde nicht knien– Fiesco. (Indem er niederfällt) Es ist mein erster Kniefall– Wirf diesen Purpur weg.
FIESCO. Steh auf, und reize mich nicht mehr!
VERRINA (entschlossen). Ich steh auf, reize dich nicht mehr. (Sie stehen an einem Brett, das zu einer Galeere führt) Der Fürst hat den Vortritt. (Gehen über das Brett) FIESCO. Was zerrst du mich so am Mantel?– er fällt! VERRINA (mit fürchterlichem Hohn). Nun, wenn der Purpur fällt, muss auch der Herzog nach. (Er stürzt ihn ins Meer) FIESCO (ruft aus den Wellen). Hilf, Genua! Hilf! Hilf deinem Herzog! (Sinkt unter)«
Das ist eine ganz unglaublich gute Szene. Sie ist es deswegen, weil der Schlag der zwei Herzen, erst zusammen und dann auseinander, an sich so winzig und intim, sich im Faltenfall des Textils zur grellen Sichtbarkeit entbreitet. Schiller weiß wie wenige andere Bühnenautoren, was ein Requisit ist und wie man die Hauptsache effektvoll ins Einzelne der scheinbaren Nebensache legt. Das Theater lebt aus der Gebärde, die raumgreifender und gröber sein muss als was sie darstellen soll, damit es auch für die letzte und billigste Reihe im Parkett nicht verlorengeht. Diese Gebärde teilt sich notwendig der Sprache mit, ja auf eine kurze Strecke versteht man von dieser Sprache eigentlich gar nichts, als dass sie sich gebärdet, mit Kronen, Popanz, Foltern und Planeten. Das macht nichts; es läuft hier nicht, wie bei Shakespeare, der Gedanke seitwärts auf und davon, vom Zuschauer nicht mehr einzuholen; sondern das Geschehen wird wie von einem knappen Fanfarenstoß begleitet und erhöht.
Was zwischen uns und den Fiesco tritt und die Unschuld des Vergnügens an ihm trübt, das ist der Woyzeck