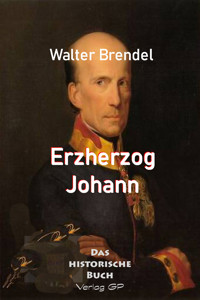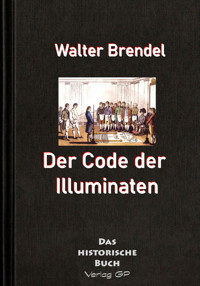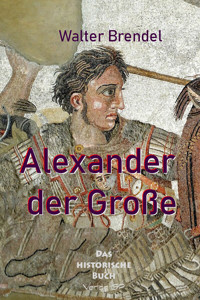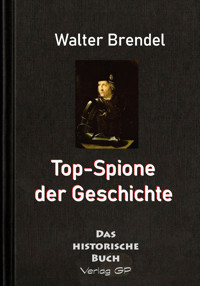Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine unglaubliche Geschichte soll sich im Jahre 1212 in Köln zugetragen haben, ein Kreuzzug der Kinder. Auf Geheiß eines sogenannten Kinderpropheten sollen sie sich zu Tausenden auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben, um die Heilige Stadt von den Muslimen zu befreien. Ohne elterliche Hilfe, unbewaffnet. Quer über die Alpen, bis zum Mittelmeer. Dort sollte sich das Meer dann teilen. Eine unglaubliche Geschichte. Zu unglaublich, um wahr zu sein. Ein mittelalterlicher Mythos. Oder gab es den Kinderkreuzzug möglicherweise doch? Zusammen mit Wissenschaftlern und Historikern begibt sich das Buch auf die Spuren des Kinderkreuzzugs, auf die Suche nach der historischen Wahrheit. Welche Quellen gibt es? Sind sie vertrauenswürdig? Oder ist alles nur ein mittelalterliches, grausames Märchen? Die Spurensuche beginnt in Köln, führt auf bislang unentdeckte Friedhöfe, in berühmte Klöster und mächtige Bibliotheken, führt weiter über die Alpen, durch Schnee und Eis, immer auf den Pfaden der Kinder. Welche Spuren hinterließen sie? Was erzählen die regionalen Chroniken über ihre Schicksale? Es ist eine Reise in opulenten Bildern durch Raum und Zeit. Eine Reise auf den Spuren des abenteuerlichen Kinderkreuzzugs und seiner Propheten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Brendel
Der Kreuzzug der Kinder
Der Kreuzzug der Kinder
Märchen oder historische Wahrheit?
Walter Brendel
Impressum
Texte: © Copyright by Walter Brendel
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Verlag:Das historische Buch, 2024
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Einführung
Aufbruch ins Heilige Land
Mythos oder Wahrheit
Zusammenfassung
Quellen
Einführung
Eine unglaubliche Geschichte soll sich im Jahre 1212 in Köln zugetragen haben, ein Kreuzzug der Kinder. Auf Geheiß eines sogenannten Kinderpropheten sollen sie sich zu Tausenden auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben, um die Heilige Stadt von den Muslimen zu befreien. Ohne elterliche Hilfe, unbewaffnet. Quer über die Alpen, bis zum Mittelmeer. Dort sollte sich das Meer dann teilen. Eine unglaubliche Geschichte. Zu unglaublich, um wahr zu sein. Ein mittelalterlicher Mythos. Oder gab es den Kinderkreuzzug möglicherweise doch?
Zusammen mit Wissenschaftlern und Historikern begibt sich das Buch auf die Spuren des Kinderkreuzzugs, auf die Suche nach der historischen Wahrheit. Welche Quellen gibt es? Sind sie vertrauenswürdig? Oder ist alles nur ein mittelalterliches, grausames Märchen?
Die Spurensuche beginnt in Köln, führt auf bislang unentdeckte Friedhöfe, in berühmte Klöster und mächtige Bibliotheken, führt weiter über die Alpen, durch Schnee und Eis, immer auf den Pfaden der Kinder. Welche Spuren hinterließen sie? Was erzählen die regionalen Chroniken über ihre Schicksale?
Fest steht: Franz von Assisi war ein Zeitgenosse der Kinderpropheten. Hatte er sie beeinflusst, war der Heilige Franziskus ihr großes Vorbild? Welches Wissen um die geheimen Hintergründe des Mythos sind in Rom, im Vatikan verborgen?
Es ist eine Reise in opulenten Bildern durch Raum und Zeit. Eine Reise auf den Spuren des abenteuerlichen Kinderkreuzzugs und seiner Propheten.
In zahlreichen historischen Chroniken wird berichtet, wie sich Tausende Kinder und Jugendliche zwischen acht und fünfzehn Jahren im Mittelalter auf die Pfade der gepanzerten Kreuzritter begaben.
In Köln zieht im Jahr 1212 ein Knabe namens Nikolaus Tausende von Kindern und Jugendlichen mit fanatischen Reden in seinen Bann: Sie seien auserwählt, Jerusalem zu befreien.
Nach dem Fall von Jerusalem 1187 bekam der Kreuzzugsgedanke erneut Auftrieb. 1212 traten in Köln und bei Orléans junge Propheten auf, die Zehntausende Kinder zum Zug ins Heilige Land brachten, für die meisten in die Katastrophe.
Am Anfang war das Wort. Das gesprochene, denn nur so entfaltete es in einer Welt des Analphabetismus seine Wirkung. Mobilisierend, mitreißend, auch bis ins Verderben. Ostern anno 1212, so bezeugen es Quellen wie die Kölner Königschronik, rief ein Junge namens Nikolaus Kinder und Jugendliche dazu auf, mit ihm ins Heilige Land zu ziehen – unbewaffnet und ohne Erwachsene. Erklären kann ein solches Himmelfahrtskommando nur bedingungslose Glaubensverwurzelung. Und in Köln, zu Beginn des 13. Jahrhunderts populärer Wallfahrtsort mit bedeutenden Reliquien, herrschte ein regelrechter Wettstreit der Frömmigkeit.
Der Kreuzzug der Kinder (Filmszene)
Groß war der Wunsch nach Seelenheil und noch größer die Angst vor Höllenqualen, mit denen Pfarrer von den Kanzeln bildgewaltig drohten. „Mittelalterliches Leben war Sterbensvorbereitung“, erklärt der Berliner Theologe Christoph Markschies. Sie geht dem historischen Gehalt der abenteuerlich anmutenden Geschichte um den jungen Prediger Nikolaus auf den Grund. Und einer weiteren, die im selben Jahr gut 500 Kilometer weiter westlich ihren Ausgang nahm. Dort scharte der Hirtenjunge Stephan aus dem Dörfchen Cloyes nahe Orléans eine minderjährige Gefolgschaft um sich. Ihm sei Jesus als Pilger erschienen, begründete er seine Mission.
Pilgern und Kreuzzüge, beides fand in der europäischen Christenheit jener Epoche breiten Widerhall. Die Päpste in Rom hatten seit dem Ende des 11. Jahrhunderts wiederholt dafür gesorgt, dass Heere im Zeichen des Kreuzes aufbrachen, um die Muslime aus dem Heiligen Land zu vertreiben. 1099 wurde Jerusalem erobert, ausgemordet und zum Sitz eines christlichen Königreiches gemacht. Nach der schweren Niederlage seiner Ritter bei Hattin eroberte Sultan Saladin 1187 die Stadt zurück, woran auch zwei folgende Kreuzzüge nichts änderten.
Also wurde die Kreuzzugsbotschaft weiterhin in Kirchen gepredigt. Das Pilgern wiederum versprach zweierlei – ein besseres Leben im Jenseits und exotische Erlebnisse fern des meist harten, gleichförmigen Alltags. Dass der Tod auf den unsicheren Routen des Mittelalters stets mitreiste, nahmen viele billigend in Kauf. Gottvertrauen musste als Versicherung unterwegs genügen.
Sie lebten oft schon in jungen Jahren außerhalb der Familie. Was aus unserer heutigen Sicht wie Abenteuerlust wirkt, war vielleicht eher eine Notwendigkeit, für sich selbst zu sorgen. In den kinderreichen Familien jener Zeit habe es nicht die „Nestwärme gegeben, wie sie heute Einzelkinder oder solche mit einem oder zwei Geschwistern bekommen. Die Vorstellung von der „Familie als Schutzraum“ sei ein deutlich jüngeres Konstrukt. Über alle Epochen hinweg gelte: „Kinder schauen sich an, wie das Leben läuft, und passen sich dem an. Das ist auch sinnvoll.“ Im Extremfall, etwa bei heutigen Straßenkindern in Südamerika, gehe es dabei ums Überleben.
Es war wohl ihr naives Gottvertrauen, das die Teilnehmer der Kinderkreuzzüge ihre Erfahrungen vergessen ließ. Denn weder Nikolaus’ noch Stephans Voraussagen sollten sich bewahrheiten. Das Meer blieb, und die jungen Kreuzfahrer befielen Zweifel und Schwermut. Manche von den deutschen sollen bis nach Rom weitergezogen sein, wo sie von Papst Innozenz III. vom Kreuzzugsgelübde gelöst wurden.
Anderen Kreuzfahrern erging es schlechter. Sie wurden gefangen und landeten auf den Sklavenmärkten des Orients. Viele starben, nur wenige kehrten zurück. Nikolaus’ Vater, dem vorgeworfen wurde, seinen Sohn aus Ruhmsucht zu dem Wagnis ermuntert zu haben, endete am Galgen.
Im Frühsommer 1212 zogen sie los: Ohne Waffen und in Lumpen, aber mit Trommeln, Fahnen und Kreuzen machten sich Kinder auf den Weg ins Heilige Land, um Jerusalem zu befreien. Aus dem Dorf Cloyes-sur-le-Loir folgten sie dem Hirtenjungen Stefan, der behauptete, ihm sei Jesus erschienen.
Mit Trommeln, Pfeifen und Steckenpferden: So stellte man sich im 19. Jahrhundert den Kinderkreuzzug vor.
Zur gleichen Zeit machten sich in Köln Kinder auf den Weg, wo sie Nikolaus folgten, einem nur zehnjährigen charismatischen Prediger, der schon einige Zeit diejenigen, die zu den Gebeinen der Heiligen Drei Könige in Köln pilgerten, belästigt hatte.
Die Reliquien hatte Rainald von Dassel nur knapp 50 Jahre zuvor noch in den alten karolingischen Dom geholt. So war Köln zu einem mächtigen Pilgerzentrum geworden.
Doch was nun geschah, wurde Wunder und Legende. Beide Züge umfassten Tausende Kinder. Manchmal ist von 7000 Kindern die Rede, bezogen auf den französischen Zug sogar von 30 000, die sich schließlich in Marseille einschiffen wollten. Der deutsche Zug ging rheinaufwärts und unter großen Entbehrungen über die Alpen nach Genua.
Dort, das hatte Nikolaus versprochen, werde sich das Meer teilen, sodass sie trockenen Fußes ins ferne Land ihrer Sehnsüchte gelangen könnten.
Die eigentliche Kreuzzugsbewegung war um diese Zeit in eine heftige Krise geraten. Hatte Papst Urban II. 1095 mit seinem Aufruf zum "heiligen Krieg" noch ein schwer bewaffnetes Heer in Marsch setzen können, das schließlich nach der Eroberung der heiligen Stätten Balduin von Boulogne zum "König von Jerusalem" ausrufen konnte, so waren die weiteren Kreuzzüge vergleichsweise erfolglos geblieben.
Der IV. Kreuzzug ging überhaupt nicht nach Jerusalem, sondern diente nur dazu, die Reste des Byzantinischen Reiches in Konstantinopel zu plündern.
In dieser Zeit machte das Gerücht die Runde, auch "das Wahre Kreuz Christi", die wichtigste aller Reliquien - tatsächlich nur ein Kästchen mit verschiedenen Holzsplittern -, sei von Muslimen unter Saladin erbeutet worden. Das wollten die Kinder der Sage nach zurückerobern.
Sollten nicht unschuldige Kinder sowieso mehr Aussichten auf Erfolg bei einem wahrhaft christlichen, nämlich friedfertigen Eroberungsversuch haben als Ritterheere? Doch der Pilgerzug der Kinder kam nicht weit. So war die Enttäuschung grenzenlos, als sich das Meer keineswegs teilte bei Ankunft des arg dezimierten deutschen Zuges in Genua. Die Bewegung zerstreute sich schnell.
Immerhin zogen einige der Kinder und Jugendliche weiter zum Papst nach Rom, um sich vom selbstauferlegten Eid entpflichten zu lassen. Der französische Zug geriet dem Vernehmen nach sogar in die Fänge von Piraten, die eine Überfahrt anboten, die Kinder in Wahrheit aber schon in Alexandria auf dem Sklavenmarkt verkaufen wollten.
Gab es diese sogenannten Kinderkreuzzüge wirklich? Oder handelt es sich dabei nahezu ausschließlich um Trivialmythen und Geschichten? Die belastbare Quellenlage ist äußerst schwach. Augenzeugenberichte gibt es gar nicht.
Einzig die Kölner Stadtchronik "Chronica Regiae Colonienses", die "Marbacher Annalen" und die stark ausgeschmückten Erzählungen des Zisterziensermönchs Alberich von Trois-Fontaines weisen auf eine "törichte Heerfahrt der Kinder und Unbesonnenen" hin. Aber schon die lateinische Bezeichnung "peregrinatio puerorum" zeigt eine mehr versprechende Spur auf. Unter "pueri", also Knaben, Kinder, verstand man damals im erweiterten Sinne eher Knechte, Hirten und Mägde, jedenfalls die unteren Stände abseits des stolzen Rittertums. So muss man sich vielmehr eine bunte Truppe der Abgehängten samt Dirnen und Taschenspielern vorstellen. Das Wachstum der reichen mittelalterlichen Städte ließ gerade ein verarmtes und wurzelloses Lumpenprekariat auf dem Lande entstehen.
Nicht umsonst wurden die Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner aus Protest gegen den Hochmut der neuen Reichen in den Städten etwa zur gleichen Zeit gegründet. So verweisen die Geschichten von den Kinderkreuzzügen eher auf verzweifelte Hunger- und Armutswallfahrten, die zu jener Zeit tatsächlich nicht selten anzutreffen waren.
Einzig das Ziel Jerusalem unterschied die Pilgerfahrt der angeblichen Kinder von zahlreichen ähnlichen Wanderbewegungen.
Doch die Vorstellung vom Kreuzzug der Kinder wuchs sich aus zu einer bis heute wirkmächtigen Legende. Der große polnische Regisseur Andrzej Wajda hat den Stoff nach dem Roman von Jerzy Andrzejewski in seinem Film "Die Pforten des Paradieses" 1968 zu einer düsteren Studie über Erlösungssehnsucht und Autoritätsgläubigkeit verarbeitet.
Neben vielen trivialliterarischen Versuchen der Fiktionalisierung in Romanen, wie zum Beispiel in dem des Fassbinder-Vertrauten Peter Berling, verfasste auch Bertolt Brecht ein Gedicht, betitelt "Kinderkreuzzug 1939", in dem es darum geht, wie eine Gruppe von Kindern mitten im Krieg "ein friedliches Land" sucht. "Bitte um Hilfe. Wir wissen den Weg nicht mehr", heißt es da an einer Stelle.