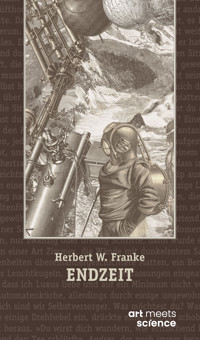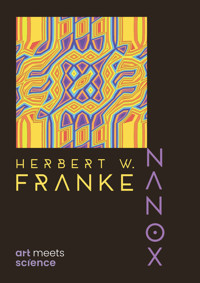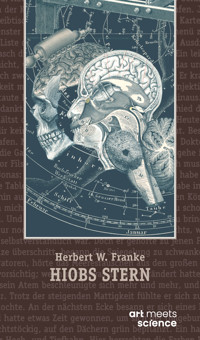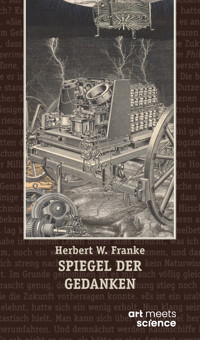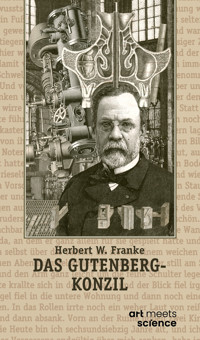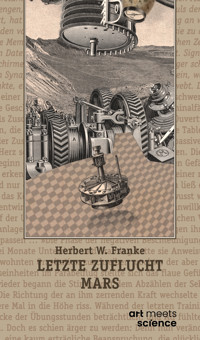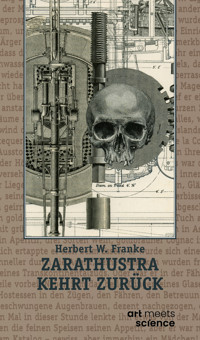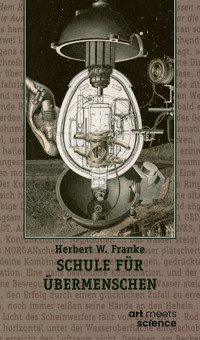Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: art meets science – Stiftung Herbert W. Franke
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Aus den grundlegenden biografischen Daten Frankes und den politischen und kulturellen Umständen seiner Umgebung ergeben sich Bedingungen und Chancen, welche sein Werk und seine Leistungen als Seismograf der Zeit erklären können. Bei einem Science-Fiction-Autor ist natürlich keine platte Abbildung der eigenen Erfahrungen und historischen Vorgänge in der Literatur zu erwarten, sondern ihre Umsetzung in fremde Welten und zukünftige Entwicklungen.« (Hans Esselborn) In diesem Sonderband anlässlich des 90sten Geburtstages des deutschen SF-Großmeisters vereinigten die Herausgeber Ulrich Blode, Hans Esselborn und Susanne Päch neben autobiografischen Texten und Kurzgeschichten des Autors – darunter eine bislang unveröffentlichte! – weitere Materialien, Gedichte – darunter die des »Astropoeticon«! – sowie Artikel, Essays und Rezensionen von Hans Esselborn, Ulrich Blode, Franz Rottensteiner, Peter Schattschneider, Christoph F. Lorenz, Robert Hahn und Bartholomäus Figatowski. Das Titelbild stammt von Thomas Franke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1070
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert W. Franke
Der Kristallplanet
Autobiografische Texte und Science-Fiction-Werke
SF-Werkausgabe
Herbert W. Franke
Band 29
Sonderband zum 90. Geburtstag des Autors
hrsg. von Ulrich Blode, Hans Esselborn und Susanne Päch
Herbert W. Franke
Der Kristallplanet
Autobiografische Texte und Science-Fiction-Werke
SF-Werkausgabe Herbert W. Franke
Band 29
Sonderband zum 90. Geburtstag des Autors
hrsg. von Ulrich Blode, Hans Esselborn und Susanne Päch
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2024 by art meets science – Stiftung Herbert W. Franke
www.art-meets-science.io
Dieses Werk wird vertreten durch die AVA international GmbH, München, www.ava-international.de
Titelbild: Thomas Franke
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
E-Book-Erstellung: global:epropaganda
Verlag
art meets science – Stiftung Herbert W. Franke
c/o mce mediacomeurope GmbH
Bavariafilmplatz 3
82031 Grünwald
ISBN 978 3 911629 28 7
Autobiografische Texte
Herbert W. Franke – Ich: HWF
Die jungen Jahre
Vermutlich ist es der Titel, der Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser, neugierig gemacht und dazu bewogen hat, dieses Buch aufzuschlagen: »Ich: HWF«.
Natürlich hat es noch weitere Vorschläge gegeben: »Zufall und Bestimmung«.
Auch dieser Titel hätte ganz gut zur Beschreibung meines Lebens gepasst, in dem, wie ich in der Rückschau feststelle, Zufälle oft eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wenn ich derzeit in Deutschland, in Bayern, lebe, so ist das dem Zufall zu verdanken, dass ich nach meinem Studium eben nicht in Österreich, wo ich geboren bin, sondern in Deutschland eine Stelle gefunden habe, an der ich finanziell versorgt war. Gerade so gut hätte ich allerdings auch in die Vereinigten Staaten von Amerika auswandern können, und dann würde der Bericht, den ich eben beginne, sicher völlig anders ausgefallen sein.
Ein anderer Vorschlag war: »Wanderer zwischen den Welten«.
Auch das hätte gepasst, es war der Titel einer Ausstellung, die das »Zentrum für Kunst und Medientechnologie«, Karlsruhe, erst vor Kurzem für eine mir gewidmete Ausstellung verwendet hat. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass ich mich, so wie es gekommen ist, nicht in einem einzelnen Bereich betätigt habe, sondern in mehreren, und zwar – das sind die Hauptgebiete: – als Schriftsteller, dessen Betätigungsfeld von wissenschaftlichen Artikeln bis zu Zukunftsromanen reicht; als Höhlenforscher, ein Aktionsfeld, das als Hobby begann und zu einer Reihe von Entdeckungen, doch gleichzeitig in den Fragenkomplex wissenschaftlicher, und zwar vorwiegend solcher des Vorzeitklimas, leitete. Und zu meinem eigenen Erstaunen führte einiges, was ich zunächst als Freizeitbeschäftigung betrieb, dazu, dass man mich als einen Künstler bezeichnete. Das bezog sich allerdings auf einen lange Zeit umstrittenen Sektor, nämlich jenen der Computergrafik und -kunst. Das hatte zur Folge, dass ich mir drei Versionen von Biografien zulegen musste, um sie, je nach der damit verbundenen Absicht, an die richtige Stelle zu bringen. Denn im deutschsprachigen Gebiet, und vielleicht auch anderswo, wird es nicht so gern gesehen, dass man sich mit sehr verschiedenartigen Dingen beschäftigt – man gerät dann bald in Verdacht, zwar Vieles zu wissen, aber das alles nur recht oberflächlich.
Noch ein weiterer Titel stand zur Debatte: »Bilder meines Lebens«.
Auch das wäre durchaus berechtigt gewesen, denn in meinem Leben haben Bilder von Anfang an eine große Rolle gespielt. Schon als Kind habe ich gerne gezeichnet und gemalt, einiges davon ist sogar noch erhalten; leider ist es durch den Übereifer eines Kunsthistorikers, der einige Zeit als mein Agent arbeitete, in den Besitz der Kunsthalle Bremen gekommen. Auch einen Fotoapparat bekam ich in relativ frühen Jahren, und später haben mich die Ergebnisse der wissenschaftlichen Fotografie fasziniert: die Bilder aus den Mikroskopen und Röntgenapparaten, Aufnahmen von Sonne, Mond und Sternenhimmel, und schließlich habe ich selbst fotografische Experimente gemacht, die anschließend folgerichtig in den Gebrauch des Computers hinausliefen, in dem ich ein für mich ideales Zeichen- und Malgerät entdeckte.
Dem Verlag habe ich es zu verdanken, dass dieser Band ungewöhnlich gut bebildert ist, ganz anders, als das sonst in Biografien die Regel ist. Zwar hätte das den Eindruck hervorrufen können, dass man Ihnen ein Bilderbuch vorlegen will, bei dem es nur um schöne Bilder geht, doch damit hätte ich mich nicht begnügt – der Zusammenhang mit den Bildern reicht viel tiefer: In diesen spiegelt sich in der Tat ein großer Teil meines Lebens. Eine Facette davon ist die Tatsache, dass ich zwar theoretischer Physiker bin, aber erst dann das Gefühl habe, etwas verstanden zu haben, wenn ich es mir bildlich vorstellen kann. Das hat es mir gehörig erleichtert, populäre Artikel und Bücher zu schreiben, da mir in ganz besonderem Maß das Mittel des Bildes zur Verfügung stand.
Wie auch immer, ich habe mich schließlich zu dem schon mehrfach erwähnten Titel »Ich: HWF« entschlossen, der einige besondere Vorzüge hat.
Erstens ist er kurz und entspricht damit den Gepflogenheiten der heutigen schnelllebigen Zeit – indem er sich nämlich an eine Leserschaft wendet, die nicht lange über die Bedeutung des Titels nachdenken will, sondern möglichst kurze und bündige Information darüber erwartet, was ihr zwischen den Buchdeckeln geboten wird. Der Titel bezeichnet klar und ohne dichterische Umschweife, worum es geht: um mich selbst.
In den Jahren meiner Industrietätigkeit habe ich viel mit Werbung zu tun gehabt, und dabei geht es doch im Grunde genommen darum, andere Menschen zu etwas zu bringen, was sie erwerben sollen, vielleicht sogar ohne richtigen Bedarf danach zu haben. Damals wurde das Buch »Die geheimen Verführer« von Vance Packard diskutiert, und meine Kollegen wie auch ich hatten oft Diskussionen darüber, ob eine solche Art der Beeinflussung nicht unmoralisch sei.
Nun habe ich vor meinen Studienjahren viele Arten der Manipulation am eigenen Leib kennengelernt, von den früheren Versuchen, mich zu religiösem Verhalten zu bekehren wie auch zum Wunsch, dem Vaterland und dem Führer das Leben zu weihen. Das Thema hat mich also sehr bewegt, und deshalb habe ich als eine Art Studie ein Buch mit dem Titel »Die Manipulation des Menschen« geschrieben: Ich wollte wissen, wie weit diese Art der Beeinflussung überhaupt möglich ist, wie man sich dagegen wehren kann und welche psychologischen Hintergründe dies überhaupt ermöglichen. Und so musste ich daran denken, dass ja schon die Auswahl eines Titels zu jenen Versuchen gehört, mit denen man von Anderen etwas erwartet und erwünscht. Und in der Tat kann selbst der einfachste Trick, die Aufmerksamkeit von Anderen zu erregen, der unmoralischen Handlung nahekommen, nämlich dann, wenn man beispielsweise die Prägnanz des Titels verwendet, um eine Ware anzudrehen, die die angedeutete Versprechung nicht erfüllt. Und das wäre beim vorliegenden Buch der Fall, wenn es sich eigentlich nur um eine Art Selbsttherapie handelte, was man bei vielen Biografien feststellen kann – oft genug wird etwas geschrieben und der Öffentlichkeit vorgelegt, was der Leserschaft nur wenig und nichts Wissenswertes vermittelt.
Für manche Leser meiner Bücher ist es bisher ein Geheimnis geblieben, was das »W« in meinem Namen zu bedeuten hätte. Das will ich jetzt lüften: Es steht für »Werner«. Als ich mich entschloss, meinen zweiten Vornamen in dieser Weise ans Tageslicht zu holen, war das noch nicht so üblich wie heute – es war mir bei den Namen von Amerikanern aufgefallen. Nachträglich bin ich aber recht zufrieden über diesen Entschluss, denn mein Familienname kommt sehr häufig vor, und auch mein erster Vorname war seinerzeit beliebt. Das geheimnisvolle »W« machte mich nicht nur interessanter, sondern bewährte sich zur Unterscheidung von anderen. So gab es in München einen Namensvetter ohne das »W«, es war ein bekannter Sinologe, doch immer wieder bekam ich Briefe, in denen um Auskünfte über die chinesische Geschichte gebeten wurde. Das trifft auch umgekehrt zu: Der leider inzwischen verstorbene Gelehrte wurde als Folge von Verwechslungen mit Fragen über Zukunftsliteratur belästigt. Bald nach meinem Umzug in den Münchener Raum tauschten wir die Adressen aus und leiteten die Anfragen verzögerungsfrei an den Kollegen, den ich persönlich nie kennengelernt habe, weiter.
Aber das nur nebenbei. Jedenfalls glaube ich, dass ich diese Biografie mit gutem Gewissen schreiben kann, und zwar so, dass man sie mit Interesse liest. Aber natürlich wünsche ich mir ein bisschen mehr – mein Weg hat mich um viele Ecken herumgeführt, an denen ich mich auch kräftig gestoßen habe, vor Probleme gestellt, die nicht nur mir Schwierigkeiten bereiteten, zu bemerkenswerten Erkenntnissen geführt, die man mitteilen sollte, es aber bis jetzt unterlassen hat …
Es gab aber auch eine Menge Unerwartetes, Komisches und Absurdes, was aus der Rückschau heraus heiter erscheinen mag, bei näherer Betrachtung aber auch manches enthält, durch das, was sich im Hintergrund ereignet hat, ins richtige Licht gestellt wird – in den Zusammenhang mit der allgemeinen Lage. Wenn ich also einiges davon schildere, was nebensächlich erscheint, dann geschieht das mit voller Absicht, ich habe insbesondere solche Ereignisse ausgewählt, die für diese Zeit typisch sind, die man mit Recht als chaotisch bezeichnen kann, und die Hintergründe des Geschehens beleuchten. Es wäre ganz in meinem Sinn, wenn ich auf diese Weise mit meinem Text und meinen Bildern auch Vergnügen bereiten könnte.
Kindheit
Ich beginne mit einem Teil, den ich zunächst einmal selbst als eine langweilige Pflichtübung empfand: einen Auftrag, dem man eben nachkommen muss, wenn man sich auf eine Biografie einlässt. Was ist von einer Schilderung der ersten Jahre schon zu erwarten? In dieser Hinsicht dürften sich verschiedene Biografien nur wenig unterscheiden. Nun habe ich aber feststellen müssen, dass es auch aus dieser Zeit erwähnenswerte Details zu schildern gibt, die Einfluss auf das spätere Leben hatten.
Wenn ich in zeitlicher Folge vorgehen möchte, dann fällt mir einiges ein, an das ich mich selbst nicht erinnern kann; es waren andere Personen, die mir davon erzählten. Dazu gehören so nichtige Dinge wie die Bemerkung, dass ich als Baby keinen Spinat mochte und ihn in hohem Bogen ausspuckte, wenn man mir ihn aufnötigen wollte.
Seltsam! – Heute esse ich Spinat recht gern. Umgekehrt war es mit Lebertran. Schon zu dieser Zeit scheint meine Mutter von der Angst geplagt gewesen zu sein, dass ich zu wenig essen würde, und so bekam ich als zusätzliches Stärkungsmittel dieses grässliche Fischtranprodukt, das bei jedem normalen Menschen Ekel erregt. Aber angeblich reagierte ich ganz anders: Nach den Ausführungen meiner Mutter griff ich mit meinen kurzen Ärmchen schon von Weitem nach dem Fläschchen, wenn es meine Mutter vom Sims des Schranks holte. Als sie einige Jahre später wieder mit einem Fläschchen Lebertran auf mich zukam, da wies ich es entrüstet ab und war durch nichts zu bewegen, auch nur einen Löffel davon hinunterzuschlucken. Ich habe meiner Mutter nicht geglaubt, dass ich dieses Gesöff einmal mit Vorliebe genossen hätte.
Vielleicht hatte sie das auch nur gesagt, um mich zur neuerlichen Einnahme zu bringen. Vielleicht unterscheidet sich meine Geschmacksrichtung aber tatsächlich von der in Österreich üblichen: So drücke ich mich beispielsweise vor jeder zünftigen Trinkerei, mit der man mich beglücken möchte – nicht aus Prinzip, sondern weil es mir nicht schmeckt. Ich bevorzuge Süßes. Und nehme die durch ein solches Bekenntnis ausgelösten spöttischen Bemerkungen gern in Kauf.
Zu den frühesten eigenen Erinnerungsstücken gehört ein hölzernes Wägelchen, in dem ich, durch einen Bügel vor dem Herabfallen geschützt, sitzen konnte. Rechts und links waren durchbohrte Kugeln, die man über Stangen hin und her schieben konnte. Erst später wurde mir bewusst, dass man mir dadurch einen simplen Abakus zur Verfügung gestellt hatte, und vielleicht beruht mein Interesse an Mathematik und digitaler Elektronik sogar darauf – wie auch mein Wunsch, mir das, was sich hinter den Zahlen und Formeln verbirgt, so konkret vorstellen zu können, wie die beweglichen Kugeln an meinem hölzernen Gefährt.
Ein weiteres Objekt meiner Erinnerung ist die Situation in einem Holzhaus in einem kleinen Ort in der Nähe von Wien, wo meine Eltern im ersten Stock ein Zimmer gemietet hatten, in dem meine Mutter und ich in meinen frühesten Jahren einige Sommerwochen verbrachten. Mir ist die Situation des Treppenhauses noch gegenwärtig, in dem Holzstiegen aufwärts führten. Auf dem Bretterboden des Erdgeschosses versuchte ich, gehen zu lernen, und bemühte mich bald auch mit Eifer, die Stufen zur ersten Etage hinaufzuklettern. Ob ich die Fortschritte durch Zählen der jeweils höchst erreichten Stufe zu bewerten versuchte, weiß ich nicht mehr, aber es erscheint mir durchaus möglich.
Eine andere Erinnerung, und da war ich schon ein wenig älter, bezieht sich auf das Signal der Feuerwehr, das mich und oft auch meinen Vater dazu brachte, zum Fenster zu laufen, um das merkwürdige Vehikel, das da unten vorbeifuhr, zu sehen. Dazu musste er mich hinauf zum Fenster heben, damit ich das, was da unten vorging, beobachten konnte. Andere Attraktionen, die mich interessierten, waren Flugzeuge, deren Lärm bis in die Wohnung drang. Auch das trieb mich zum Fenster, und wenn ich Glück hatte, konnte ich, von unten nach oben blickend, in dem für mich von unten sichtbaren Ausschnitt des Himmels für kurze Zeit die schwarze Silhouette des Fliegers entlang ziehen sehen.
Flugzeuge waren damals noch selten, und vielleicht ist mir deshalb eine Szene aus der Stadterhebungsfeier von Heidenreichstein im österreichischen Waldviertel, dem Geburtsort meines Vaters, in Erinnerung verblieben. Als Teil der Festlichkeit gab es eine Flugschau, und einige wichtige Leute des Gemeinwesens durften für kurze Flüge in das Vehikel steigen. Diese Ehre wurde auch meinem Großvater zuteil, der nach fünf Minuten Flug etwas bleich wieder aus dem Flugzeug wankte, durch diese Ehrung aber – zumindest bei mir – merklich an Respekt gewonnen hatte. Wie gern wäre ich mitgeflogen!
Damit bin ich zu einem anderen Teil meiner Kindheit gekommen, zu jenem Teil, der sich nicht auf Wien bezieht, sondern auf das damals noch kleine Städtchen Heidenreichstein. Dort lebten meine Großeltern und zwei der Schwestern meiner Großmutter mit ihren Männern, weiter der Bruder meines Vaters, Onkel Karl, mit seiner Frau und mit meinen Cousinen Irma und Helga sowie meinem Cousin Helmut.
Und dort lebte auch die Schwester meines Vaters, Tante Grete, die als Letzte in jenem Ortsteil geblieben war, in dem sich mein Großvater seinerzeit niedergelassen hatte. Ich kannte diesen als einen kleinen rundlichen Herrn, der schon früh seine Haare verloren hatte, aber voll Energie war und in der Familie ein strenges Regiment führte. Viele Erinnerungen an ihn habe ich nicht, dafür sind mir aber ein paar Geschichten im Gedächtnis haften geblieben, die ihn als bemerkenswerte Persönlichkeit kennzeichnen.
Eine davon geht weit in die Kindheit meines Vaters zurück. Er hatte sich eine Verkühlung eingefangen, und sollte mit einem speziellen Tee behandelt werden, den eine Hausgehilfin empfohlen hatte – Frau Resi, die ich als alte, aber rüstige Frau selbst noch kennengelernt hatte. Das Getränk war so scheußlich, dass sich der kleine Otto, mein Vater, schlichtweg weigerte, es zu trinken. Als alle Überredungsversuche nichts fruchteten, wurde mein Großvater ans Krankenbett geholt, und er erfuhr: »Der Otto will seinen Tee nicht trinken.«
Mein Großvater wandte sich an den Knaben und fragte ihn: »Warum trinkst du denn deinen Tee nicht?«
Mein Vater antwortete: »Er schmeckt nicht gut, das kann man nicht trinken!«
Mein Großvater beteiligte sich nun nicht an den Mahnungen, sondern wandte eine modernere und menschlichere Methode an, um Kinder zum Gehorsam zu bringen. Er griff nach der Tasse und sagte: »Ich werde dir zeigen, dass man das sehr wohl trinken kann.«
Er setzte die Tasse an die Lippen, nahm einen Schluck, stutzte für kurze Zeit, verzog das Gesicht und spuckte dann die Flüssigkeit auf den Boden. Er schrie: »Das Zeug kann kein Teufel saufen«, und verließ den Raum. Und mein Vater war zunächst einmal gerettet.
Die zweite Geschichte handelt davon, wie sein Vater den Heranwachsenden erwischt hatte, als er eine Zigarette zu rauchen versuchte. Der inzwischen schon etwas größere Otto machte sich auf eine Strafpredigt gefasst, aber es kam anders. Mein Großvater griff nach einem Etui und holte eine Zigarre heraus. »Du wirst dich doch nicht mit Zigaretten abgeben – Männer rauchen Zigarren«, erklärte er, gab meinem Vater Feuer und entfernte sich. Dieser war verwundert, aber auch stolz darauf, dass ihn sein Vater dermaßen als Mann bezeichnet hatte, und gab sich seiner Zigarre hin.
Nach kurzer Zeit wurde ihm unbeschreiblich übel, und wie es weiterging, braucht nicht näher beschrieben zu werden. Er hat später als Erwachsener trotzdem geraucht, wenn auch keine Zigarren, aber sein Vater hat das doch einige Jahre hinausschieben können.
Diese Geschichte entspricht auch meinen recht blassen Erinnerungen an den Großvater: als einen Mann, der streng war, aber gerecht. Im Übrigen stammte er aus der Lausitz, in der Nähe von Berlin. Er war in jungen Jahren nach Österreich ausgewandert und hatte dort eine Metallwarenfabrikation aufgebaut, die mehrere Gebäude umfasste. Die Anlage, die da außerhalb des Ortes entstanden war, in einer kleinen Randsiedlung mit dem Namen Edelmühle, konnte ich später allerdings nur von außen kennenlernen, da er sie nicht mehr besaß: Aus Vaterlandsliebe – er fühlte sich inzwischen voll als Österreicher – zeichnete er Kriegsanleihen, und zwar ein wenig mehr als zu empfehlen gewesen wäre, und so blieb ihm schließlich nur ein Rest seiner Fabrik, eigentlich nur eine etwas größere Werkstätte. Mein Vater weigerte sich, dieses Erbe anzutreten, und überließ es seinem jüngeren Bruder, meinem Onkel Karl. Mein Vater aber ging nach Wien, um zunächst zu studieren und später an der Technischen Hochschule zu arbeiten. Er wohnte bei der Schwester meiner Großmutter, die – etwas verwirrend – einen Sohn hatte, der ebenfalls Karl hieß, also ein Cousin meines Vaters war, sodass ich später zwei »Onkel Karl« hatte.
Die Fabrikanlage, die mein Großvater aufgebaut hatte, war nicht mehr im Besitz der Familie, an ihre Stelle trat die Färberei einer Strumpffabrik, von deren Wirken auch die in der Umgebung wohnenden Leute etwas mitbekamen, weil das Wasser des die Gegend durchquerenden Bachs in wechselnd bunten Farben auftrat – auf diese Weise wurden die Farbreste entsorgt. In dem letzten meinem Großvater verbliebenen Gebäude, einem Wohnhaus, hatte sich die Schwester meines Vaters, Tante Grete, niedergelassen, und daraus ergab sich die Möglichkeit, dass wir dort die »Sommerfrische« genießen durften. Das betraf vor allem mich und meine Mutter – wir verbrachten dort die sommerlichen Schulferien, während sich mein Vater mit den drei Wochen Urlaub begnügen musste, die ihm als »Staatsbeamten« zustanden.
Mein Vater
Aber weiter der Reihe nach, wobei ich ein wenig genauer auf meinen Vater eingehe und auf seine Jugendzeit zurückkomme. Nach der in Heidenreichstein absolvierten Volksschule schickte man den Zehnjährigen auf die nächstgelegene Realschule, die sich allerdings außerhalb von Österreich, jenseits der tschechischen Grenze, in der Ortschaft Budweis (heute České Budějovice) befand. Er hat sich dort offenbar nicht sehr wohl gefühlt, wahrscheinlich, weil dort etwas von den Spannungen spürbar wurde, die zwischen dem tschechischen und dem deutschen Anteil der Bevölkerung herrschte. Es dürften vier Jahre gewesen sein, die er dort verbrachte, worauf er seine Lehrjahre in Wien fortsetzte – bis zum Abschluss der Schulzeit mit einer Prüfung, die in Österreich auch heute noch »Matura« heißt und dem deutschen Abitur entspricht.
Mein Vater wohnte damals bei einer Schwester seiner Mutter, die sich in Wien angesiedelt hatte, und dann den Studenten weiterhin beherbergte. Mein Vater schloss dann sein Studium der Elektrotechnik an der damaligen Technischen Hochschule (jetzt Universität) in Wien ab und wurde anschließend der Assistent eines dort lehrenden Professors, von dem er oft skurrile Geschichten erzählte. Diese Storys benutzte ich später, während meines Studiums an der Wiener Universität, als Basis einiger meiner frühesten literarischen Versuche – ich wollte kurze Geschichten für Tageszeitungen schreiben, mit denen ich allerdings keinen Erfolg hatte. Ich nehme aber eine davon in dieses Buch auf, denn sie kennzeichnet nicht nur den Professor Sawulka, sondern auch das (noch recht primitive) frühe Stadium meiner literarischen Versuche.
Mein Vater strebte eine Professur an der Technischen Hochschule an, wozu er sich habilitieren sollte, doch dazu kam er nicht, denn Professor Sawulka erkrankte und konnte seine Vorlesungen nicht mehr halten. So kam es, dass das mein Vater übernehmen musste, und zwar über mehrere Jahre hinweg. Auch alle administrativen Aufgaben des Lehrstuhls hatte er zu erledigen, sodass keine Zeit für eine Habilitationsarbeit blieb. Erst Jahrzehnte später bekam er dort doch noch eine Professur.
Inzwischen, noch als Assistent, hatte er zwei Schwestern einer im selben Bezirk wohnenden Familie Mayr kennengelernt, und die ältere der beiden geheiratet. Ich habe ein Foto von ihr aus der damaligen Zeit geerbt, sie sah beachtenswert hübsch aus. Er überredete meine Großtante, seine geduldige Quartiergeberin, für mich die strenge Tante Kathi, dazu, auch die frisch angetraute Gemahlin mit aufzunehmen, was offensichtlich zu gewissen Reibereien führte. Und diese Situation verstärkte sich noch, als ich kurze Zeit darauf auf die Welt kam. Der Tante blieb immer weniger Raum in ihrer Wohnung, und schließlich zog sie sich in ein Zimmer zurück.
Es war ein dunkles Zimmer, nur durch ein schmales Fenster zum Hof fiel Tageslicht ein, und dort hielt sie sich die Tage über auf – ich weiß nicht, was sie dort tat. Nur wenn sie einmal besonders gute Laune hatte, durfte ich sie dort besuchen, und dann wurde mir hin und wieder ein besonderes Erlebnis zuteil: Tante Kathi kramte nämlich ein Kaleidoskop aus der Schublade und ließ mich hindurchblicken. Es hatte eine Hülse aus Kupfer, und der durchsichtige Teil war nicht, wie das heute üblich ist, mit Glasscherben gefüllt, sondern mit fein geschliffenen bunten, durchsichtigen Steinchen. Das, was ich da zu sehen bekam, zählte zu den schönsten Eindrücken meiner Kindheit. Ich konnte mich an diesen Bildern nicht sattsehen, und wenn ich das Gerät zurückgeben sollte, wehrte ich mich, und die Tante musste es mir mit sanfter Gewalt entwinden. Leider ist dieses Stück nicht wieder aufgetaucht, niemand anderer kann sich daran erinnern, und meine Cousine Traudl, die die Tante schließlich beerbt hatte, konnte trotz aller Mühe nichts finden, was einem Kaleidoskop auch nur im Geringsten ähnlich sah.
Damit ist meine Cousine ins Spiel gekommen, die in meiner frühen Jugend mein liebster Spielkamerad war. Da wir beide Einzelkinder waren, war sie für mich so etwas wie eine Ersatzschwester.
Hier sollte ich kurz auf die einigermaßen merkwürdigen Familienverhältnisse eingehen, die da in Wien entstanden sind. Wie schon erwähnt hatte meine Mutter eine zwei Jahre jüngere Schwester, und es war der Sohn meiner Wiener Großtante, der diese heiratete. Auf diese Weise erhielt ich eine doppelte Cousine und wurde zugleich mein eigener Cousin.
Davon merkte ich zunächst noch nichts, doch der stetig ansteigende Missmut meiner Großtante erscheint mir heute durchaus verständlich, denn zunächst hatte sie einen Schüler aufgenommen, der in der Wohnung nur wenig Platz beanspruchte, und nun wohnten bereits vier Leute darin, darunter ein quäkender Säugling.
Schuljahre
Meine Großtante, die Wohnungsinhaberin, ließ durchblicken, dass sie gern wieder allein über ihr Domizil verfügen würde, und da dieser Wunsch berechtigt war, beschlossen meine Eltern, sich nach einer Wohnung umzusehen. Das bedeutete eine große Ausgabe für einen schlecht bezahlten Assistenten an der Technischen Hochschule, und das wiederum zwang meinen Vater dazu, sich nach einer etwas besser bezahlten Position umzusehen; seine Absicht, über eine Habilitation einen Lehrstuhl an der Technischen Hochschule zu bekommen, musste er zunächst einmal aufgeben.
So trat er als Beamter in das in Wien etablierte Zentrale Amt für Eich- und Vermessungswesen ein, wo er als Sachbearbeiter für Elektrizitätszähler eingesetzt wurde. Sein direkter Vorgesetzter war übrigens der Sohn des bekannten österreichischen Physikers Ludwig Boltzmann, ein netter Kollege, mit dem sich auskommen ließ. Das tröstete ihn ein wenig über die Tatsache hinweg, dass zunächst einmal an die erhoffte Lehrstelle an der Technischen Hochschule nicht zu denken war.
Für mich war der bald darauf folgende Umzug in die Argentinierstraße mit der Hausnummer 66, unsere neue Adresse, ein wichtiges Ereignis, nicht zuletzt deshalb, weil ich in der neuen Wohnung ein eigenes Kabinett bekam. Die Wohnung lag im dritten Stock eines Eckhauses, im vornehmen Bezirk Wieden. Die Argentinierstraße führt vom Karlsplatz leicht bergauf bis zum Wiedner Gürtel mit dem Südbahnhof, den wir von unseren Fenstern aus sehen konnten. Folgte ich der umgekehrten Richtung, der Argentinierstraße talwärts, so kam ich an meiner Volksschule vorbei, ein paar Hundert Meter weiter auch an der RAVAG, dem zentralen Gebäude von Radio Wien, wo ich einmal mit einem Knabenchor singen musste. Nach der ersten Probe sagte der Dirigent: »Da brummt doch einer – versuchen wir es noch einmal!«
Diesmal bewegte ich ohne zu singen den Mund, und nun war an unserem Gesang nichts mehr auszusetzen. Der Gesang ist die einzige Kunstform, für die ich mich völlig ungeeignet fühle.
Ich hoffe, man entschuldigt mir diese Abschweifung, die durch eine spontane Erinnerung ausgelöst wurde. Aber auch an den weiteren Verlauf der Straße knüpfen sich Erinnerungen. Vom Rundfunkgebäude aus sind noch einige Seitenstraßen zu queren, bis man zum Karlsplatz kommt, wo die Technische Universität liegt, damals noch als Technische Hochschule bezeichnet. Dazwischen gab es aber noch einige für mich bedeutsame Orte. Der eine war eine im Souterrain eines bürgerlichen Hauses liegende Halle, in der ich jahrelang Tischtennis spielte. Und ein paar Schritte in eine Seitengasse hinein lag die Wohnung meines Schulkameraden, Freundes und später auch noch Gefährten vieler Höhlenfahrten Alois Hach, genannt Ali.
Noch ein paar Hundert Meter weiter öffnet sich die Argentinierstraße zu einem großen Park, der sich längs der Vorderfront der Technischen Hochschule erstreckt.
Und ihr gegenüber liegt außer dem Musikvereinsgebäude auch noch das Wiener Künstlerhaus, in dem ich später zum Mitglied gewählt wurde. Nach den Statuten sind die gewählten Mitglieder auch Besitzer des Vereinsvermögens – ich hätte mir in jungen Jahren nicht träumen lassen, dass mir eines Tages ein, wenn auch recht kleines Stück (ein Ziegel?) des alten Prunkgebäudes gehören würde. Auch dazu gibt es einiges zu berichten, aber davon später.
Doch zurück zur Argentinierstraße, die jahrelang die Bezugsachse meiner Bewegungen in Wien war. Im letzten Haus im oberen Teil der Straße rechts befand sich nun unsere neue Wohnung. Über die gesamte Schulzeit hinweg, wie auch noch während der Zeit meines Studiums war die Wohnung im Eckhaus Argentinierstraße und Wiedner Gürtel die Verkörperung meiner Heimat. Das war mein Zuhause über die Schulzeit hinweg, wie auch noch während der Zeit meines Studiums. Als nach dem Krieg die Straßenbahn nicht fuhr, ich aber die nötigen Vorlesungen besuchen wollte, ging ich Tag für Tag die Argentinierstraße hinunter, holte meinen Freund und Studienkollegen Ali ab, und dann durchquerten wir, weiterhin zu Fuß, die Innere Stadt, um zum Physikalischen Institut im Stadtteil Währing zu kommen, das direkt an der literarisch besungenen Strudlhofgasse lag – und noch liegt. Und als ich dann in die Bundesrepublik Deutschland zog, stand mir immer noch das Kabinett zur Verfügung, das ich »mein Zimmer« nennen durfte. Erst als ich nach meinem Studium in die Bundesrepublik Deutschland umgezogen war und mein Vater und später auch meine Mutter gestorben waren, ging mir das Wohnrecht verloren – ich hätte gern noch einen Fuß in Wien behalten –, und so führte diese Wendung zur endgültigen Trennung von meiner Heimat, obwohl ich die österreichische Staatsbürgerschaft bis heute nicht aufgegeben habe.
Meine Eltern fanden nicht nur die Lage der Wohnung recht günstig, sondern auch den Zeitpunkt unseren Umzugs, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil ich erst ein Jahr danach mit der Schule anfangen musste, und diese, zumindest in den folgenden Jahren, nicht zu wechseln brauchte. Von der neuen Wohnung aus waren es nur zehn Minuten zum Schulgebäude. Meine Mutter hatte ihren Beruf als Fremdsprachensekretärin anlässlich meiner Geburt aufgegeben und sah sich als Hausfrau und Mutter – eine Tätigkeit, die ihren Intentionen nicht ganz entsprach –, die Situation war nun einmal so eingerichtet, wie es damals üblich war. Doch sie versuchte, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern, und las englische und französische Zeitschriften und Bücher auch noch in höherem Alter.
Zwischendurch versuchte sie auch noch, mir englische Sprachkenntnisse beizubringen, wobei sie besonderen Wert auf die Aussprache legte. Ich muss allerdings gestehen, dass mir diese Beanspruchung nicht gerade Freude bereitete, besonders da ich es meiner Mutter nie recht machen konnte, wenn es darum ging, das »th« richtig englisch auszusprechen. Das schien für meine gute Mutter das Wichtigste am Englischunterricht zu sein. Mit dem Ergebnis war sie nicht zufrieden, die Laute, die ich hervorbrachte, klangen eher so, wie wenn jemand auszuspucken versucht. Da bei mir nun auch die Schulpflicht hinzugekommen war, und ich außerdem Klavierspielen lernen sollte, war ich doch unversehens stark beansprucht, und meine Mutter setzte ihren Englischunterricht nur noch sporadisch – und erfolglos – fort.
Der Zweite Weltkrieg wirkte sich auf mein Leben entscheidend aus, es wäre sicher völlig anders verlaufen, wenn es zu dieser Katastrophe nicht gekommen wäre. Es begann damit, dass meine Schule verlagert wurde, und ich plötzlich anstatt Englisch Latein lernen musste.
Mit fünfzehn Jahren wurde ich zum Kriegsdienst eingezogen. Es ging darum, eine Gruppe von Schülern aus den bombengefährdeten Regionen Norddeutschlands zu betreuen und zu beaufsichtigen. Der Schauplatz dieses Unternehmens war ein beliebtes österreichisches Skigebiet, südlich von Wien. Jetzt hatten wir Herbst, in den großen Hotels waren Erholung suchende verwundete Soldaten untergebracht, und unsere Gruppe hatte ein Gebäude zur Verfügung, das normalerweise als Fremdenpension diente. Die jungen Leute, die wir hier trafen, waren mit ihrem Lehrer hierhergekommen, das war eine von den Eltern gestellte Bedingung. Da der Platz in unserer Pension nicht reichte, war in der Nähe noch ein weiteres Haus als Unterkunft bereitgestellt, und in etwas weiterer Entfernung gab es auch noch eine Mädchenklasse aus demselben Ort.
Gleich an einem der ersten Tage bekam ich die schlechte Laune des eifrigen Lehrers zu spüren. Ich weiß nicht, ob er das selbst eingeführt hatte, oder ob dafür allgemeine Vorschriften bestanden – jedenfalls mussten wir, das Führungspersonal, in der Gemeinschaft frühstücken und uns dazu um halb acht Uhr im Essraum versammeln. Das fiel mir als Langschläfer recht schwer, doch hatte man mir schon jahrelang Gehorsam beigebracht, und so ließ ich mich rechtzeitig wecken, ging hinunter in den Waschraum, um mich fertigzumachen, und kehrte dann wieder in mein ein Stockwerk höher gelegenes Zimmer zurück, wo ich die Uniform anzog. Denn es war klar und auch gar nicht anders zu erwarten – wir mussten in Hitler-Jugend-Kleidung antreten. Zu dieser Ausstattung gehörte auch eine Bluse, die sich nicht knöpfen ließ, sondern die man über den Kopf ziehen musste. Es hatte also wenig Sinn, sich vorher sauber zu frisieren, denn bei der Prozedur mit der engen Bluse wurde die schönste Haartracht zerstört.
Und es war gleich einer der ersten Tage, als mich der Lehrer erwischte: Ich kam wieder aus dem Zimmer zurück, zwar mit geputzten Zähnen und ordentlich gewaschen, aber mit einigermaßen zerrauftem Haar. Er trat auf mich zu und warf mir vor, ungewaschen meinen Dienst anzutreten. Ich wehrte mich natürlich und sagte, dass ich fix und fertig gesäubert sei, und nur noch zwei Minuten in den Waschraum gehen würde, um mich zu kämmen – meine Aufgabe des Weckens hatte ja noch fünf Minuten Zeit. Das aber rührte den alten Herrn nicht, er blieb bei seinem Vorwurf, und wir gingen im Streit auseinander.
Dieser Lehrer erwies sich als der inoffizielle Leiter dieses Unternehmens, jedenfalls sah es so aus, und er machte uns das Leben schwer, indem er in alle möglichen unserer Entscheidungen eingriff und darauf Wert legte, dass wir seine Vorschläge akzeptierten. Und wenn sich einer der Schüler durch Heini und mich ungerecht behandelt fühlte, brauchte er nur zu seinem Lehrer zu gehen, der uns sofort zur Rede stellte und uns vorschrieb, was wir zu tun hätten.
Als erschwerender Faktor wirkte sich merkwürdigerweise auch das Klima aus, oder richtiger, die Tatsache, dass unser Einsatz in den Spätherbst fiel. Hier, am Semmering, hatte sich die Gruppe aus Norddeutschland schon drei Monate aufgehalten, und wir waren nur zur Ablösung der vorher hier beschäftigten »Führungskräfte« eingesetzt worden.
Der erste Tag: Heini und ich beratschlagten eine Weile und kamen dann auf die Idee, den Vormittag zu benutzen, um uns auf das Skifahren vorzubereiten, das uns offenbar nicht erspart bleiben sollte. Wir borgten uns Ski aus, im Übrigen solche, wie sie heute keiner mehr benutzen würde – sie wurden mit Riemen unter den Schuhen angeschnallt. Als ich sie befestigt hatte – ich stand am Rand des »Idiotenhügels«, dem leicht geneigten Abhang, der den Anfängern vorbehalten ist, und hatte die Stöcke noch nicht in der Hand, als sich meine Ski in Bewegung setzten und ich mit zunehmender Geschwindigkeit talwärts rutschte. Es ging immer schneller, in der Ferne sah ich einen Zaun geradewegs auf mich zukommen, ich streckte schon die Arme abwehrend aus, als ich in eine Mulde geriet, von der aus es wieder ein wenig bergauf ging, und genau vor dem Zaun, ohne etwas dazu zu tun, blieb ich stehen – und hatte meine erste Skifahrt erfolgreich hinter mich gebracht. Schon beim zweiten Versuch, diesmal mit Stöcken, geriet ich in Querlage, und es warf mich der Länge nach in den Schnee.
Wir hatten erfahren, dass die Schüler erwarteten, dass man zu einer auf der anderen Seite des Tals liegenden Abfahrtsstrecke ging, gerade unter einer Skischanze, um von dort hinunter zu brausen. Und dann kam Heini auf eine glorreiche Idee: »Wie wäre es, wenn wir eine Skiwanderung veranstalten würden?«
Ich verstand ihn natürlich sofort: Mit den Skiern annähernd eben über einen Weg zu gleiten, erschien uns weitaus einfacher, als es mit einem Abhang oder gar einer Abfahrt zu versuchen. Am Nachmittag, als sich alle einfanden, um mit dem üblichen Programm zu beginnen, teilte ihnen Heini mit, dass es eine Wanderung geben würde, worauf sich zunächst einmal zaghafter Widerspruch anmeldete, worüber wir aber hinweggingen, und dann bewegten wir uns ungefähr zwei Stunden über bequeme Wege – unter zunehmendem Murren der inzwischen schon ganz guten Skifahrer aus dem Norden.
Als wir dieses Programm am zweiten Tag zu wiederholen versuchten, ließ sich der Widerstand nicht brechen, und schließlich landeten wir genau unter der Sprungschanze. Die Mutigsten setzten genau unter der Schanze an, um die Abfahrt in voller Länge zu genießen, und nun blickten alle erwartungsvoll, skeptisch, spöttisch auf uns, um unser Können zu beurteilen und uns vielleicht im Schnee landen zu sehen.
Heini, der doch ein bisschen besser Ski fahren konnte, als er am Tag zuvor angedeutet hatte, kam gut unten an, und mir blieb nichts anderes übrig, als mich auch vorsichtig zum Übergang in den Steilhang vorzuschieben und dann, mit den Stöcken balancierend, so gut wie möglich hinunterzukommen. Das geschah unter den Augen der kritischen Zuschauer, und diese gewannen den Eindruck, dass ich wohl kein vorbildlicher Skifahrer war, doch immerhin das konnte, was man von einem Österreicher erwarten musste.
Auf diese Weise verliefen die meisten Tage, die wir dann über mehrere Wochen hinweg in der Skigegend des Semmerings verbrachten, und mein Vorgesetzter Heinrich wie auch ich waren über jeden Tag froh, an dem man wegen des Schneetreibens oder wegen Tauwetters nicht auf die Piste gehen musste. In späteren Zeiten wurde ich gelegentlich von Freunden zum Skifahren eingeladen, aber ich hatte genug davon und habe dankend abgelehnt.
Genauso unangenehm wie diese Überraschungen, war mir die Tatsache, dass wir in unserer Eigenschaft als Hitlerjungen die üblichen Verhaltensmuster zu gebrauchen hatten. Dazu gehörte es, dass man die Gefolgschaft vor jedem neuen Schritt im Programm antreten ließ, dass man mit ihnen marschieren und dabei die üblichen Befehle erteilen musste, beispielsweise zum Anstimmen von Liedern. Ich versuchte mich davor zu drücken, indem ich einen von den Schülern zu einem Assistenten ernannte, gewissermaßen einen »Unter-unter-Führer«, der es offenbar ganz gern übernahm, diese militärischen Spielchen zu spielen. Das geschah allerdings nur so lange, wie Heini es duldete, dass ich seine Befehle immer gleich weitergab und sie andere ausführen ließ, und eines Tages von mir verlangte, dass ich das selbst zu tun hätte.
Zu meiner Überraschung wurde ich nach einigen Wochen abgelöst, und ich weiß bis heute nicht, ob sich der Lehrer über mich beschwert, ob sich Heini jemand anderen als Unterführer gewünscht hatte, oder ob es die Tatsache war, dass inzwischen der Großteil meiner Schulklasse in Wien zu den Flakhelfern eingezogen worden war. Als ich in die Schule zurückkam, saßen nur noch wenige im Klassenzimmer, darunter zwei oder drei, deren Gesundheit den militärischen Dienst nicht zuließ, und zwei andere, die in ihrer Funktion als Führer der allgemeinen Hitlerjugend ebenfalls vom Schuldienst befreit gewesen waren. Immerhin – auf diese Weise erhielt ich Gelegenheit, noch einige Wochen lang die Schulbank zu drücken und ein ziviles Leben zu führen.
Doch meine Verbindung mit Heini und seinen Untergebenen war nicht völlig abgebrochen, und dadurch kam es zu einem Ereignis, das böse hätte ausgehen können. Vor meiner Abreise hatte er mich nämlich gebeten, ihm mithilfe meiner chemischen Kenntnisse einen Stoff zusammenzubrauen, von dem ich ihm berichtet hatte, und der eine bemerkenswerte Eigenschaft hat: Es genügt, einige kleine Bröckchen davon anzufeuchten, um damit eine Zersetzung zu veranlassen, die unter Abdampfen von Schwefelwasserstoff erfolgt. (Ich will das Rezept lieber nicht angeben, denn diese chemische Reaktion gibt es heute noch!)
Heini teilte mir auch Näheres über seinen Plan mit, und so war ich gern bereit, ihm zu helfen. Es war nämlich ein Besuch im Wohnhaus der Mädchen geplant, Heini wollte mit einigen seiner getreuesten Untergebenen in der Nacht hineinschleichen und dort die von mir gelieferte Stinkbombe hinterlassen. Das sollte eine kleine Rache für einen Streich sein, den uns die »Oberführerin« der Mädchenklasse Anni gespielt hatte. Sie war recht attraktiv, etwa so alt, wie wir, und uns als weibliches Wesen in diesem Alter natürlich weitaus überlegen.
Als Heini und ich einmal das zweite für die Unterkunft der Klasse bestimmte Gebäude am Abend betraten, um zu kontrollieren, ob alle zur gebotenen Stunde zu Bett gegangen waren, fanden wir Anni im Schlafraum vor, wie sie am Bett eines der Jungen saß und in ein schelmisches Gespräch vertieft war. Wir waren sehr erstaunt darüber, doch sie schien nichts dabei zu finden, sondern trat dann zu einem anderen Bett, um sich auch dort mit dem Jungen zu unterhalten. Das konnten wir doch nicht zulassen? Wir baten sie, das Gebäude zu verlassen, ernteten aber nur Spott von Anni und die Entrüstung der in den Betten liegenden Knaben. Es dauerte eine ganze Weile, ehe sie sich bequemte, unseren Anordnungen zu folgen, und sie tat es mit so spöttischem Lachen, dass die Jungen in den Betten ihr Vergnügen daran hatten.
Unter diesen Umständen war es für mich durchaus verständlich, dass Heini etwas tun musste, um seine Ehre zu retten. Und dazu konnte sich mein übel riechende Gase aussendender Stoff durchaus eignen. Im Übrigen ist Schwefelwasserstoff in der dabei auftretenden Verdünnung unschädlich, doch der Geruch ist wirklich scheußlich.
Ich will hier nicht beschreiben, wie man die fragliche Substanz, die Aluminium und Schwefel enthält, erzeugt, jedenfalls tat ich das in der Küche unserer Wohnung in Wien, meine Eltern hatten mir erlaubt, dort am Nachmittag den Küchentisch für chemische Versuche zu verwenden. Ich musste eine Eternitplatte darüber legen, konnte dann aber mit meinen Chemikalien und dem Bunsenbrenner hantieren, so oft ich wollte. Natürlich machte es mir den größten Spaß, Schießpulver und Sprengstoff zu erzeugen, aber auch Thermitmischungen und Feuerwerkskörper, und schließlich auch Stoffe, die Dämpfe oder übel riechende Gase abgaben.
Es waren nur wenige Bröckchen, ich konnte sie in einen Briefumschlag stecken, und sandte diesen mit der Post zum Ort Semmering, in die Pension »Soundso«, deren Namen ich nicht mehr weiß. Natürlich wartete ich mit Spannung auf den Ausgang der Aktion, den mir Heini versprochen hatte, doch ich hörte nichts von ihm. Stattdessen kam eine Vorladung von der Gestapo (Geheime Staatspolizei), eine Institution, mit der man am liebsten nichts zu tun hatte. Mit gemischten Gefühlen fand ich mich im ersten Wiener Bezirk ein und wurde an einen Beamten geleitet, der mir Platz anbot, mich forschend ansah und dann aus seiner Schublade einen Brief herausholte – es war jener, den ich an Heini geschickt habe. Er sagte: »Können Sie sich denken, warum Sie hier sind?«
»Keine Ahnung«, antwortete ich.
»Aber das ist doch der Brief, den Sie verschickt haben«, war die Antwort.
»Gewiss«, gab ich zurück, »doch was ist mit diesem Brief?« Inzwischen war mir natürlich klar, was geschehen war. Irgendjemand hatte diesen Brief abgefangen und den verdächtigen Inhalt gefunden. Doch es war noch schlimmer.
Der Beamte schlug eine Mappe auf, holte ein Stück Papier heraus und las mir vor: »›Von einer im Postamt deponierten Sendung kam ein so übel riechender Gestank, dass die Mitarbeiter die Büroräume räumen mussten.‹ Sagt Ihnen das nichts?«
Nun hatte ich genug Zeit gehabt, mir eine Ausrede zu überlegen, und ich antwortete: »Gewiss, an diesem Ereignis kann dieser Brief durchaus schuld sein, doch wundert mich das sehr, so etwas ist nämlich nur möglich, wenn er im Postamt oder beim Transport feucht geworden ist.«
Ich erklärte ihm dann, dass es sich um einen völlig geruchlosen Stoff handelt, solange er nicht mit Wasser in Verbindung tritt, und ich mir nicht erklären könne, wie er im Postamt nass geworden sein sollte. Der Beamte wollte natürlich wissen, wozu ich diese Substanz an einen Hitler-Jugend-Führer geschickt hatte, und ich antwortete forsch: »Er wollte eine Geländeübung machen, und einen Gasangriff simulieren. Daher bat er mich, ihm diese paar Brocken zu schicken, die im Brief waren. Er wollte mit ihnen den Einfluss eines giftigen Gases nachahmen, ich kann aber versichern, dass der Schwefelwasserstoff, der hier ausgetreten war, in der Verdünnung absolut unschädlich ist. Im Übrigen ist der dasselbe, was bei Menschen abgeht, wenn sie von Blähungen geplagt sind.«
Der Beamte überlegte eine Weile, und da fügte ich hinzu: »Sie wissen ja, dass wir bei der Ausbildung für militärische Einsätze uns auf alle Arten von Angriffen vorbereiten müssen, wie sie von den Gegnern ausgehen.«
Mein Gegenüber nickte, offenbar mit meiner Erklärung zufrieden, und er meinte, wir müssten nun nur noch ein Protokoll abfassen. Er ergriff einen Füllfederhalter, wie man sie damals noch verwendete, und begann zu schreiben, was ihm offenbar nicht leicht fiel. Dann sagte er: »Sie sind ja ein Gymnasiast, und da können Sie mir doch ein bisschen bei der Formulierung behilflich sein.«
Darauf ich: »Aber selbstverständlich, gern.« Und ich diktierte ihm den Wortlaut, wobei ich am Schluss noch anfügte, dass ich mich »hiermit auch beim Postamt beschweren möchte, da die Sendung offenbar unsachgemäß behandelt wurde, sonst hätte ja keine Feuchtigkeit in den Brief geraten können«. Dieses Protokoll musste ich noch unterschreiben, und ich verabschiedete mich dann mit freundlichem Handschlag von dem netten Polizisten.
Nun ist nur noch zu ergänzen, was Heini unternahm, der sich von mir im Stich gelassen wähnte. Er musste sich also etwas anderes ausdenken: Er schlich sich mit einigen Getreuen wie geplant ins Mädchenheim, stibitzte Unterwäsche und zog die dann auf dem vorm Haus aufgebauten Fahnenmast auf. Als die Mädchen am nächsten Tag nach ihren Kleidern suchten, bemerkte jemand, dass ihre Unterhöschen und Büstenhalter oben am Fahnenmast im Winde flatterten, und die Empörung war groß. Als ich davon erfuhr, bedauerte ich zum ersten Mal, nicht mehr am Semmering gewesen zu sein.
Heini hatte einige Mühe, mit dem Ärger und den Strafandrohungen der Mädchen und des Lehrers fertig zu werden, doch im Grunde genommen war er natürlich sehr befriedigt, denn letzten Endes hatte er bewiesen, dass man mit uns nicht beliebig umspringen konnte.
Flakhelfer
Die wenigen Wochen, in denen ich noch zur Schule ging, waren nur ein Zwischenspiel. Auch mir blieb nicht erspart, was die meisten meiner Schulkameraden schon erlebt hatten, nämlich die Einberufung zu den Luftwaffenhelfern, die auch als Flakhelfer bekannt waren tun – »Flak« heißt »Fliegerabwehrkanone«. Heute ist oft von einer »Generation der Luftwaffenhelfer« die Rede, womit im Prinzip die Jahrgänge um 1927 herum gemeint sind. Im Jahr 1943 waren wir sechzehn Jahre alt, und da so gut wie alle älteren männlichen Semester als Soldaten »ihre Pflicht taten«, mussten wir einspringen, um etwas zu erledigen, was normalerweise Aufgabe der Soldaten gewesen war, und zwar jene der Abwehr feindlicher Flieger, vor allem der Bombenangriffe. Dabei hatten wir nicht den Status von Soldaten, und daher auch nicht deren Rechte. Wir waren in die Organisation des Militärs eingebunden, unsere Vorgesetzten waren Soldaten, die meisten Unteroffiziere oder auch höherrangige Militärangehörige, die entweder bereits zu alt für den kriegerischen Einsatz waren oder auch so stark verwundet zurückgekehrt, dass sie für diese Dienste nicht mehr fähig waren. Auf der anderen Seite behielten wir den Status von Schülern, und das hieß, dass neben unseren militärischen Pflichten auch jene der Schule gültig waren, und dazu kamen an einigen Nachmittagen der Woche Lehrer für ein paar Stunden an die Einsatzorte. Überflüssig zu betonen, dass auf diese Weise kein geregelter Unterricht möglich war.
Ich selbst wurde nicht in eine mit Geschützen ausgestattete Batterie berufen, sondern in ein Befehlszentrum. Es lag am Rande der Stadt in Ramersdorf, im jenseits der Donau liegenden Ortsteil von Wien namens Floridsdorf. Das bedeutete eine gewisse Ausnahmesituation, denn wir hatten nichts mit der Bedienung der Geschütze zu, sondern mussten Spezialdienste im Rahmen der für das Militär nötigen Telefonverbindungen übernehmen. So bekamen wir auch keine Ausbildung an den Geschützen, sondern lernten, wie man Telefonleitungen legt und wie man eine Telefonzentrale bedient. Wir waren nur eine kleine Gruppe von sieben oder acht Halbwüchsigen, und auf unser zartes Alter wurde bei uns insofern Rücksicht genommen, als wir zunächst nicht in den Baracken untergebracht wurden, sondern in einem Ziegelbau, der vermutlich früher eine Schule gewesen war. Dort wohnten auch die Offiziere, die mit der Organisation der Arbeit in den im Umkreis von rund zwanzig Kilometern liegenden Batteriestellungen zu tun hatten, wo die meisten unserer Schulkameraden gelandet waren. Im selben Gebäude waren übrigens auch mehrere gleichaltrige Mädchen untergebracht, die als Schreibkräfte und Sekretärinnen ebenfalls Kriegsdienst zu leisten hatten.
Im Übrigen waren wir an dieser Stelle von den übrigen Soldaten abgeschnitten, die ein paar Schritte entfernt vom Schulgebäude in Baracken untergebracht waren, und damit auch der direkten Aufsicht von Unteroffizieren und dergleichen enthoben.
Gleich am ersten Abend trafen wir mit den Mädchen zusammen, und nach und nach kam es auch zu mehr oder weniger zarten Bindungen. Ich selbst verliebte mich damals in ein hübsches, blondes Mädchen, auf das allerdings auch ein junger Offizier sein Augenmerk gerichtet hatte, und gegen diese Konkurrenz hatte ich natürlich keine Chance.
Die bevorzugte Position im Schulgebäude erregte alsbald den Neid der in dieser Einheit beschäftigten Soldaten, und schließlich wurden wir aus unserer aus mehreren Gründen angenehmen Behausung ausquartiert und bekamen eine der Baracken zugewiesen – eine unter rund einem Dutzend anderer, die auf einem unbebaut gebliebenen Nachbargrundstück errichtet worden waren.
Einer der Gründe für diese Maßnahme lag gewiss auch daran, die Freundschaften mit den Mädchen zu unterbinden, doch wer uns junge Menschen vor allen Anfechtungen schützen wollte, hatte damit gerade das Verkehrte getan, denn direkt hinter unserer Baracke war ein Gitterzaun, und nach einer neutralen Zone, einem Streifen von etwa einem Meter Breite, ein zweiter. Und auf der anderen Seite waren aus Frankreich für Hilfsdienste rekrutierte Mädchen untergebracht, die sich schon an den nächsten Tagen am Zaun versammelten, was von unserer Seite aus natürlich auch geschah, und bei der sich anbahnenden Verständigung kamen mir meine Kenntnisse in der französischen Sprache zugute: Ich musste damit meinen Kameraden aus den Gymnasien zu Hilfe kommen, die mit Latein und Griechisch wenig Erfolge erzielen konnten. Es gab auch ein Mädchen, das mir Liebesbriefe schrieb, in Französisch, und durch den Gitterzaun hindurch zuschob, und ich antwortete ihr mit meinem Französisch. Leider hatte sie nicht die äußerlichen Qualitäten, die mich zu einer näheren Bekanntschaft gereizt hätten. Es war auch gar nicht so leicht, den Mädchen näherzukommen, und erst in den letzten Wochen unseres Aufenthalts entschlossen wir uns, einen von uns zu unterstützen, der sich nichts dringender wünschte, als einen näheren Kontakt mit der von ihm ausgewählten, recht ansehnlichen Frau. Wir halfen alle zusammen, um ihn über den Gitterzaun zu hieven, und auch die Belegschaft der anderen Seite half der Dame über den zweiten Zaun, sodass es in der neutralen Zone doch zur Aufnahme näherer Beziehungen kommen konnte.
Aber wie gesagt, kurze Zeit darauf war die Zeit in Ramersdorf vorüber, und man versetzte uns zu unserem Leidwesen in eine Geschützstellung. Sie lag relativ weit oben am Hang des Bisambergs, der größten Erhebung in der engeren Umgebung von Wien, und deshalb auch von Weitem schon durch die hohen Sendemasten erkennbar, die die RAVAG, die österreichische Rundfunkgesellschaft, erbaut hatte. Nun war sie natürlich ein Teil des deutschen Sendenetzes geworden und sandte wie in anderen Teilen des Deutschen Reichs den üblichen Einheitsbrei an Nachrichten und Unterhaltung aus.
Hier erst merkten wir, was uns bisher erspart geblieben war. Aus unserer Sicht gehörte zu diesen Annehmlichkeiten auch die Tatsache, dass man in Ramersdorf für unsere kleine Gruppe keine Lehrer einsetzen mochte, sodass wir in den vergangenen Wochen nicht auch noch vom Unterricht geplagt wurden. Das war hier ganz anders. Die Zahl der Sechzehn- und Siebzehnjährigen war hier so groß, dass man jeden zweiten Nachmittag der Wochentage mehrere Lehrer auf den Berg hinauf schickte, die dort in den Baracken für deren Belegschaften einen Unterricht aufzuziehen versuchten.
Es war ein recht griesgrämiger alter Lehrer, der für unsere Baracke verantwortlich war. Er gab uns verschiedene Aufgaben, beispielsweise Aufsätze zu schreiben oder mathematische Aufgaben zu lösen, und in dieser Zeit achtete er streng darauf, dass sich alle von uns eifrig den gestellten Aufgaben widmeten. Er war nicht nur Gymnasiallehrer, sondern auch Reserveoffizier, und er schien Gefallen daran zu finden, in Uniform aufzutreten, wodurch er auch so etwas wie soldatische Befehlsgewalt ausüben konnte.
Als sich einer von uns während einer solchen Stunde nebenbei einem Käsebrot widmete, regte er sich darüber auf und fügte auch hinzu, dass er den unangenehmen Geruch der Käsesorte nicht vertragen könne. Die Nahrungsmittel, mit denen wir verköstigt wurden, waren nicht sehr abwechslungsreich, und so gab es auch am nächsten Schultag jenen Käse, den man in Österreich »Quargel« nennt, im Grunde genommen nichts anderes als Harzer Käse, der sich ja durch besondere Geruchsnuancen auszeichnet. Das brachte uns auf die Idee, diesen als eine Abwehrmaßnahme zu gebrauchen, und jeder von uns musste einige dünn geschnittene Scheiben seines Käsevorrats abgeben. Dann wurde einer von uns zu den Querbalken hinauf gehoben, wo er die Käsestücke ausbreitete. Und diese Aktion erwies sich durchaus als erfolgreich, denn kaum war der Lehreroffizier eingetreten, verspürte er den milden Käsegeruch, rümpfte die Nase, erteilte uns zwar wie sonst auch die Aufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch, verkündete aber im Übrigen, dass er diesmal außerhalb der Baracke auf die Fertigstellung warten würde.
So gemütlich ging es aber dort oben nicht immer zu. Hier lernten wir einige Dinge kennen, die zum Tagesablauf von Soldaten gehören, vor allem das frühe Aufstehen, das anschließende Exerzieren und schließlich noch Übungen an den Geschützen.
Glücklicherweise dauerte diese Periode nicht allzu lang, und die aus Ramersdorf eingeschleuste Gruppe, die man wohl als einen Fremdkörper empfand, wurde weiterversetzt, in eine ebene Gegend, die noch öder war, als die immerhin nette Ausflugslandschaft des Bisambergs. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Bezirk diese Sandgrube gehörte, in der man die Flakgeschütze aufgestellt hatte; soviel ich mich erinnere, musste man mit der Straßenbahn zur Endstation Schwechat fahren und dann noch mehrere Kilometer gehen, um an diese Stätte aufgewühlter Erde zu kommen. Auch hier bestand die Besatzung aus mehreren Dutzend Luftwaffenhelfern, dazu kamen einige Unteroffiziere und ein Oberleutnant, und als für uns überraschende Beigabe waren da auch noch rund zwanzig russische Gefangene, die sich freiwillig zur Arbeit gemeldet hatten, weil sie dadurch gewisse Erleichterungen bekamen. Das bezog sich vor allem auf reichlichere Bemessung der Essensrationen, und diese Maßnahme war auch berechtigt, denn ihre Aufgabe war es, aus den in der Umgebung der Geschütze errichteten Behältern die schweren, für die Flak benötigten Geschosse heranzuschleppen und sie dann in das hochgerichtete Geschützrohr zu schieben. Gerade Letzteres war in der Tat recht schwer, und es war nicht die pure Rücksicht auf uns dem Knabenalter kaum Entwachsenen, dass man uns diese Tätigkeit ersparte. Wir waren für etwas Besseres vorgesehen, was man uns als Angehörige höherer Schulen zutraute, nämlich die Justierung der Geschütze. Drei an der Kanone Beschäftigte hatten Kopfhörer auf und bekamen im Ernstfall Zahlen durchgesagt, nach denen sie die Richtung der Geschütze einstellen mussten. Das wurde natürlich häufig geübt, denn es musste ja unter erschwerten Bedingungen, unter Umständen auch unter Beschuss, vor allem aber recht schnell vonstattengehen.
Doch auch hier kamen wir, die Gruppe aus Ramersdorf, etwas zu spät, und hatten einen Teil des Unterrichts versäumt. So horchte ich mich ein wenig um, und stellte fest, dass es auch hier Telefone zu betreuen gab und überdies ein Mangel an geschultem Personal bestand. Wir meldeten uns daher beim für den Telefondienst verantwortlichen Soldaten, der einen etwas höheren Rang als ein normaler Unteroffizier bekleidete – ich erinnere mich nicht mehr, wie dieser genannt wurde.
Jedenfalls machten wir diesen durchaus netten Mann darauf aufmerksam, dass wir ein ausgebildeter Telefontrupp waren, und erreichten prompt, dass er uns für Spezialdienste anforderte. Das bedeutete einen erwähnenswerten Wechsel in der Lebensqualität, vor allem dadurch, dass wir nicht mehr an die Tageseinteilung gebunden waren und deshalb auch die üblichen Exerzierübungen nicht mitmachen mussten. Wir kamen auch in eine eigene Baracke, was schon deshalb nötig war, weil wir auch den Vermittlungsdienst übernehmen mussten, und das hieß, dass wir im Sechsstundentakt in einem in die Erde eingetieften Raum saßen, direkt neben dem Befehlsstand, in dem auf einem runden Tisch eine Landkarte der Umgebung abgebildet war. Darum herum versammelten sich bei einem Kampfeinsatz die höheren Chargen.
Es gelang mir sogar, meine eigene Situation noch weiter zu verbessern, und zwar dadurch, dass ich mich freiwillig für den Nachtdienst meldete, der von acht bis zwölf Uhr dauerte. Das hatte Vorteile, beispielsweise dass es wenig zu tun gab. Da der größte Teil dieser Zeit in die Nachtruhe fiel, rief auch kaum noch jemand an, und ich konnte meine Zeit mit Lesen oder dem Hören von Musik verbringen.
Die dort verlangte Tätigkeit war denkbar einfach. Man saß vor einem Vermittlungsschrank und wartete, bis sich jemand durch ein Klingelzeichen aus dem Netz meldete. Man erkundigte sich, wen er sprechen wollte, und verband ihn schließlich, indem man eine zu jeder internen Telefonposition gehörige Strippe zog, die man dann zum Kontakt mit der Außenwelt in die Buchse der Schalttafel einschob.
Es gab damals eine Vorschrift, dass wir, alle unter achtzehn Jahre alt, nicht in der Frühschicht von Mitternacht bis acht Uhr früh eingesetzt werden durften, und so war es unser Unteroffizier, der dies übernehmen musste. Er merkte bald, dass er auf diese Art zu keiner geordneten Ruhezeit kam, denn wenn er schlafen wollte, störten ihn seine einer anderen Tageseinteilung unterworfenen Mitbewohner. So beschloss er, zu uns in die »Telefonbaracke« zu ziehen. Dort waren allerdings alle zweistöckigen Betten besetzt, und so suchte er sich eine Schlafstätte aus, die schon jemand anderer ausgesucht hatte. Seine Wahl fiel genau auf mein von mir ebenso bewusst ausgesuchtes Bett, wo ich es mir in der zweiten Etage gemütlich gemacht hatte. Ich musste es räumen, doch nach kurzem Überlegen besorgte ich mir eine Matratze, die ich auf dem Boden hinter dem Ofen ausbreitete. Dort hatte ich es sogar bequemer als die anderen, zumindest wurde ich durch das Knarren der Bettbalken und das Schnarchen weniger gestört.
Am nächsten Tag, als sich unser Vorgesetzter nach seinem Nachtdienst unter der Decke verkrochen hatte und wohl auch gerade selig eingeschlafen war, öffnete sich die Tür, und der »Unteroffizier vom Dienst«, der UvD – lediglich eine Arbeitsbezeichnung, denn es war ein einfacher Gefreiter – wollte die Stube kontrollieren, um eventuell das Exerzieren schwänzende Luftwaffenhelfer aufzuspüren. Natürlich erblickte er nun eine unter Decken liegende Gestalt, er trat hinzu, riss die Decke herunter und schüttelte den Schlafenden. Der richtete sich erstaunt auf, und dann ging ein Donnerwetter auf den Gefreiten nieder, das dieser wohl nie vergessen hat. Er verließ fluchtartig die Baracke, und seither traute sich kein UvD mehr in unsere Unterkunft.
Auf diese Weise hatten wir es uns doch einigermaßen erträglich eingerichtet, und es gab damals ja auch noch einiges, worauf man sich freuen konnte, beispielsweise dienstfreie Abende, an denen man Karten spielen konnte oder Musik über die alle Baracken umfassende Lautsprecheranlage hörte. An den Sonntagnachmittagen wurde auch Fußball gespielt, und hiervon ist mir etwas in Erinnerung geblieben, an das ich doch hin und wieder denken musste. Ich stand gerade vor dem gegnerischen Tor, als ein vom Tormann zurückgeboxter Ball auf einem Bogen über mich hinweg zu fliegen drohte, sodass ich ihn in meiner aufrechten Haltung nicht erreichen konnte. Da drehte ich mich um, ließ mich auf den Rücken fallen, traf den Ball mit den Fußspitzen und erreichte eines der ganz wenigen Tore, die mir bei solchen Gelegenheiten gelungen waren. Der Leser wird bereits ahnen, was das bedeutete: Nicht Uwe Seeler ist der rechtmäßige Erfinder des Fallrückziehers, sondern ich bin es, seit meiner Zeit als Luftwaffenhelfer.
Wir stellten bald fest, dass unsere Tätigkeit als Telefontrupp sogar mit einer gewissen Machtposition verbunden war. Beispielsweise war es sehr einfach, die über unsere Zentrale geführten Gespräche mitzuhören. Natürlich war das verboten, und man sprach nicht darüber, aber manche unserer nicht so glücklichen Kameraden, die am Geschütz eingesetzt wurden, merkten doch, dass wir stets gut unterrichtet waren, und über Kenntnisse verfügten, die das Leben in der Batterie betrafen.
Unsere Möglichkeiten reichten sogar darüber hinaus – so konnten wir die Herstellung einer Verbindung auch rundweg ablehnen, wenn beispielsweise die Braut eines Unteroffiziers anrief, den wir nicht leiden konnten. Die konnte lange warten, bis sie ihn ans Telefon bekam.
Einmal kam ein Anruf für den Befehlshaber dieser Batterie, Oberleutnant Butz, der im Zivilberuf Gymnasiallehrer war – eine für diese Umgebung recht zahme Erscheinung, mit der sich auskommen ließ. Einmal wurde er am Telefon verlangt, doch ich musste mitteilen, dass er nicht erreichbar war (was diesmal auch den Tatsachen entsprach).
Da informierte mich der Anrufer darüber, dass es für eine abendliche Filmvorführung, die im Speisesaal stattfinden sollte, die Auswahl zwischen zwei Filmen gab: Einer spielte im Mittelalter, wobei es um die tapfere Verteidigung gegen anstürmende Feinde ging, bei der anderen handelte es sich um einen jungen Musiker, der flotte Schlagermusik schrieb und am Schluss die ihm nahestehende Tänzerin heiratete. Das sollte ich dem Oberleutnant mitteilen, sobald er wieder zu erreichen war.
Nun hatte ich diesen guten Mann einmal sehr beeindruckt: Als er während meines Nachtdienstes zu einer Kontrolle in die Telefonvermittlung kam, hatte ich gerade ein Philosophiebuch von Immanuel Kant vor mir liegen. So hatte ich bei Oberleutnant Butz sehr an Respekt gewonnen. Als ich ihm dann später die beiden Filme beschrieb, die wir aussuchen könnten, bat er mich um einen Rat, und mir kam es natürlich darauf an, ihn zur Wahl des Musikfilms zu bringen, der uns allen mehr Freude machen würde als die düstere Kriegsgeschichte mit gezielter Vorbildfunktion. Ich wusste allerdings auch, dass der Oberleutnant ein Liebhaber von klassischer Musik war, und daher erzählte ich ihm nur allgemein von schönen Liedern, ohne auf die weiteren Einzelheiten einzugehen. In der Tat wurde dann dieser von mir ausgewählte Film gezeigt, wobei auch Herr Butz dabei war, der den Vorführraum allerdings schon nach kurzer Zeit entsetzt verließ. Er sprach mit mir über die schlechte Qualität der gehörten Musik, und ich zeigte mich recht bestürzt und wies darauf hin, dass ich Näheres darüber ja auch nicht gewusst hätte.
Der Telefondienst brachte, wie man sieht, doch eine gewisse Abwechslung mit sich, ganz im Gegensatz zu dem anödenden Alltag der an den Geschützen Beschäftigten.
Andererseits gab es natürlich auch Einiges, das sich als unangenehm oder auch bedenklich erwies. Eines dieser Ereignisse hängt mit einem Radioempfänger zusammen, der im neben der Telefonzentrale liegenden unterirdischen Befehlszentrum stand. Der reizte uns natürlich vor allem deshalb, weil er nicht nur eine Einheitswellenlänge empfangen konnte, auf dem offizielle deutsche Sendungen übertragen wurden (die zivilen Rundfunkgeräte, vor allem die üblichen Volksempfänger, nahmen auch nur diese Wellenlänge auf), sondern auch andere Wellenlängenbereiche, und das bedeutete für uns Telefonisten die Möglichkeit, Sendungen ganz anderer Art zu hören, speziell solche, die für Propagandazwecke von den Stationen der Kriegsgegner ausgestrahlt wurden. Es war für den im Nachtdienst Beschäftigten eine reizvolle Tätigkeit, zu späten Stunden hinüber in die Zentrale zu gehen und diesen Apparat einzuschalten, der offiziell für die Übertragung von Positionen einfliegender Feindflugzeuge gedacht war.
Das waren jene Angaben, die die Leute am Geschütz brauchten, um ihre Kanonen auszurichten. Diese Geschütze ließen es nicht zu, damit einfach auf den Gegner zu zielen und abzudrücken, sondern man schoss ins Ungewisse und wunderte sich eher darüber, wenn dabei gelegentlich ein Treffer erzielt wurde. Glücklicherweise geschah das nur selten, denn die österreichischen Gebiete blieben zunächst noch einigermaßen von den Angriffen verschont – was sich einige Jahre später ändern sollte.
Nun saß ich einmal an einem Abend, als mein Stubengenosse Peter, genannt »Petsi«, in der Telefonzentrale Dienst hatte, in unserer Baracke … als ich plötzlich aufhorchte, denn aus dem Lautsprecher kam eine mir normalerweise sehr angenehme Musik – ich kannte sie bereits, es war der in Deutschland als »Negermusik« abqualifizierte Jazz, den ich mir in späten Nachtstunden vergönnte. Auf diese Weise lernte ich diese Musik kennen und schätzen. Mithilfe der Kenntnisse des Klavierspiels, die mir mein Klavierlehrer vermittelt hatte, versuchte ich an freien Abenden an einem in der Kantine stehenden Klavier oder auch bei den seltenen Besuchen zu Hause während des Ausgangs, diesen Stil aufzugreifen und improvisierend weiter zu entwickeln.