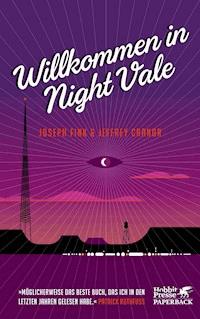14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman aus Night Vale! Ein mysteriöses, Häuser verschlingendes Erdbeben, das sich nach allen Regeln der Wissenschaft niemals hätte ereignen dürfen, und eine seltsame religiöse Sekte, deren Gott seine Gläubigen zu verschlingen droht, halten die Bewohner von Night Vale in Atem. Nilanjana ist eine Außenseiterin in Night Vale, dem freundlichen Städtchen mitten in der Wüste. Sie arbeitet im Team von Carlos, dem angesehensten Naturwissenschaftler der Stadt. Eines Tages erhält sie den Auftrag, die Ursache von seltsamen Geräuschen, die aus der Wüste kommen, herauszufinden. Haben diese etwas mit dem rätselhaften Erdbeben zu tun, das das Haus des Eigenbrötlers Larry Leroy gleichsam verschluckt hat? Bei ihren Nachforschungen stößt Nilanjana auf eine religiöse Sekte mit Namen »Die Freudige Vereinigung des Lächelnden Gottes«, die ein schreckliches Geheimnis birgt. In Night Vale beginnt ein atemberaubender, vielleicht sogar tödlicher Kampf zwischen Wissenschaft, Glaube und religiösem Eifer. »Witzig und brillant. Ich packe meine Sachen und wandere aus nach Night Vale.« Ransom Riggs, Autor von ›Die Insel der besonderen Kinder‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Joseph Fink & Jeffrey Cranor
Der Lächelnde Gott
Aus dem Englischen von Birgit Herden
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»It Devours!« im Verlag
HarperCollins Publishers, New York 2017
© 2017 by Joseph Fink and Jeffrey Cranor
Für die deutsche Ausgabe
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: © Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung der Daten vom Originalverlag; Coverentwurf und Illustration: © Rob Wilson, Vorsatzillustration: © Jessica Hayworth
Datenkonvertierung von Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96263-5
E-Book: ISBN 978-3-608-11101-9
Dieses E-Book beruht auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für Jillian Sweeney und Meg Bashwiner
1
Nicht jeder glaubt an Berge, obwohl wir sie doch mit eigenen Augen sehen können.
Die Wissenschaftler beharren halbherzig darauf, Berge seien das Ergebnis tektonischer Verschiebungen, Ausstülpungen an den Rändern riesiger Gesteinsplatten. Hinter vorgehaltener Hand verbreiten sie sogar, Berge seien durch einen ganz natürlichen Prozess im Laufe vieler Jahrtausende entstanden.
Die meisten Menschen aber glauben, dass es keine Berge gibt. Selbst wenn sie sie sehen können, was oft der Fall ist, erklären sich die Ungläubigen das damit, dass der Verstand eine Illusion erzeugt, um das Unbegreifliche zu erklären, so wie er Götter und Monster in den Sternen zu erkennen glaubt, Botschaften in Teeblättern oder Codes in Wolkenmustern.
Doch ob real oder nicht, Berge bilden einen Ring um diese Wüste, wie der Rand um einen leeren Teller. Verstreut auf diesem Teller liegen kleine Städte mit Namen wie Red Mesa und Pine Cliff, und genau in der Mitte liegt Night Vale.
Über Night Vale kreisen Hubschrauber und schützen die Einwohner vor sich selbst und anderen. Über den Hubschraubern befinden sich die Sterne, die total bedeutungslos sind. Über den Sternen befindet sich die Leere, die total bedeutungsvoll ist.
Oft sieht man geheimnisvolle Lichter durch diesen überfüllten Himmel ziehen. Eigentlich handelt es sich dabei bloß um außerirdische Raumschiffe oder um Auren, zurückgelassen von Reisenden durch die Dimensionen, aber so einfache Erklärungen sind langweilig. Die Leute von Night Vale denken sich oft ausgefallene Geschichten aus, um die Lichter zu erklären. (»Einst liebte der Himmel einen ganz speziellen Felsen. Doch die Jahrtausende haben den Felsen zu Staub zermahlen. Der Felsen wusste nie etwas vom Himmel. Er liebte nur den Wind, der ihn langsam erodierte.«) Manchmal ist es okay, etwas schön zu finden, ohne es genau zu verstehen.
Wie in vielen Städten befindet sich in der Mitte von Night Vale die Innenstadt, mit dem Üblichen, was zu einer Innenstadt gehört: einem Rathaus, einem lokalen Radiosender, vermummten Gestalten, einer Bibliothek, einem schillernden Vortex, den die Polizei mit gelben Bändern abgesperrt hat, gefährlichen streunenden Hunden und Propaganda-Lautsprechern an jeder Ecke.
Jenseits der Innenstadt liegt die Altstadt von Night Vale, eine Wohn- und Einkaufsgegend, die während des Wirtschaftsbooms der frühen 1930er Jahre geplant und gebaut wurde. Nach dem Krieg ist das Viertel ziemlich heruntergekommen, doch in den letzten Jahren wurde es durch neue Hausbesitzer und kleine Geschäfte, große Metallbäume und räuberische Katzen neu belebt.
Jenseits der Altstadt von Night Vale liegen sandige Brachflächen, die ganz genau das sind, was Sie sich darunter vorstellen. Und jenseits der sandigen Brachflächen kommt Buschland, das so ziemlich das ist, was Sie sich darunter vorstellen. Und jenseits des Buschlands kommen der Gebrauchtwagenhandel und das Haus von Old Woman Josie und schließlich, draußen am Rande der Stadt, das Haus von Larry Leroy.
So lange er zurückdenken konnte, hatte Larry allein gelebt. Er besaß ein Telefon, das kaputt war, und ein Auto ohne Räder, das hinter dem Haus auf vier Zementblöcken aufgebockt war. Versteckt unter dem Auto befand sich eine unterirdische Kammer voller Konserven und Wasserflaschen und einem Jahresvorrat an Schweinswürsten in Schmalz. Früher hatte Larry ein Gewehr gehabt, aber das hatte er gegen das Auto ohne Räder eingetauscht. Ein Auto ohne Räder, hatte er sich gedacht, bot mehr Sicherheit als ein Gewehr. Trotz den freundlichen Mahnungen des Ortsverbandes der National Rifle Association (»Gewehre töten keine Menschen. Gewehre sind der neue Grünkohl. Gewehre sind überhaupt das Allergesündeste.«) hatte sich Larry in Gegenwart von Gewehren nie recht wohl gefühlt.
Mit Anfang zwanzig hatte ihn sein Vater einmal mit auf die Jagd genommen. Larry mochte seinen Vater nicht. Er hasste ihn auch nicht. Irgendwann hatte Larry nach dem Gewehr gegriffen, das hinten im Pickup seines Vaters auf der Ladefläche verstaut war, und dabei hatte ihn ein Skorpion, der auf dem Gewehrlauf saß, in die Hand gestochen. Seitdem traute Larry Gewehren nicht mehr.
Inzwischen mochte Larry Skorpione. Immerhin fraßen sie Eichhörnchen, die Larry wirklich hasste. Er achtete eher selten darauf, auf welch unlogische Weise der menschliche Verstand Phobien entwickelt.
Am jenem Abend beugte er sich über den Schuhkarton auf seinem Schreibtisch und klebte behutsam einen winzigen braunen Schnurrbart, den er aus einem Stückchen Baumrinde gemacht hatte, auf das winzige Gesicht der W.-E.-B.-DuBois-Figur. Was noch fehlte, war die Handlaserkanone, für die Dubois berühmt war. Larry hörte ein Geräusch – es klang nach den Krallen der Eichhörnchen, die in seinem Keller herumtobten. Hoffentlich hatten die Skorpione ordentlich Appetit. Er wandte sich nun der Miniaturversion des fünfköpfigen Drachen zu, der Rachel McDaniels hieß und den DuBois häufig ritt, wenn er seine Reden hielt. DuBois sprach immer von einem Standpunkt großer moralischer und physischer Überlegenheit zu den Intellektuellen und Politikern, die Amerikas Schwarzen ihre Rechte verwehrten. Er sprach außerdem vom Rücken eines fliegenden Drachen.
Larry arbeitete an einem Diorama, das DuBois’ berühmten Sieg über die deutsche Armee im Jahr 1915 feierte: Es zeigte DuBois und Rachel in ihrer Bibliothek, wie sie sich über der Kapitulationserklärung triumphierend abklatschten.
Larry verehrte den Kriegshelden und großen Bürgerrechtler und hatte ihm mit dem detailreich ausgearbeiteten Schuhkarton einen Schrein errichtet. Larrys Familie hatte für Geschichte nie viel übrig gehabt. Immer wieder hatte sie ihm erklärt, dass Geschichte gar nicht existierte, weil sie sich nicht mehr ereigne. Sobald sich etwas ereignet habe, sagten sie jeden Abend beim Essen, sei es vorbei und gehöre damit ins Reich der fiktiven Erinnerung. Sie sprachen mit gesenkten Köpfen, und dann begannen sie zu essen.
Vielleicht war er ein rebellischer Jugendlicher gewesen. Oder er hatte einfach den oft wundersamen, oft tragischen Mythos der Menschheitsgeschichte erforschen wollen. Larry vergötterte seine Helden: W. E. B. DuBois, Helen Keller, Redd Foxx, Luis Valdez und Toni Morrison. Er fühlte sich dafür verantwortlich, ihr Vermächtnis zu wahren, der Welt ihre großen Geschichten und Taten in Erinnerung zu rufen, sodass sie sich auch in der Gegenwart noch gegenwärtig fühlten. Geschichte ist real, ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, sagte Larry oft – nicht mit Worten, sondern Taten.
Kleider, Gesichtsbehaarung, Mobiliar, alles im Miniaturformat, die meisten Stücke nicht größer als Larrys kleiner Finger. Das erforderte ein ruhiges Auge und eine ruhige Hand. Anders als bei den meisten Menschen, war Larrys Hand mit dem Alter ruhiger geworden und bei nachlassender Schnelligkeit geschickter. Fachmännisch plazierte er DuBois’ Schnurrbart unter die große Nase des großen Denkers und legte dann die Pinzette beiseite, um am Hintergrund des Dioramas, der Bibliothek, zu arbeiten.
Mit einem Mal vernahm Larry ein Surren und Brummen. Er konnte es im ganzen Körper spüren. Das Geräusch kam und ging in sanften Wellen, die einen leicht einlullen konnten, wenn man so in die Arbeit versunken war. Dann aber kamen die Wellen schneller, und das stete Surren schwoll an zu einem wütenden Gebrüll. Die Metallteller und Tassen in seiner handgezimmerten Küche begannen zu klappern, und das Dach ächzte in seiner Stahlkonstruktion.
Er warf einen Blick auf den Erdbeben-Kalender, den er an die Wand gepinnt hatte. Jeden Monat wurde dieser Kalender von Vertretern einer nebulösen, aber nichtsdestoweniger bedrohlichen Regierungsbehörde ausgeliefert, mitten in der Nacht schoben sie einen braunen Umschlag unter der Tür durch. Laut dem Kalender war für heute kein Erdbeben vorgesehen.
Larrys Blick fiel auf W. E. B. DuBois und Rachel McDaniels in ihrer großen gelehrten Bibliothek. Ein Tropfen von seinem Schweiß, so groß wie DuBois’ Kopf, landete auf McDaniels’ Rücken, brach die frisch angeklebten Stacheln ab und verschmierte die Farbe.
Larry wischte sich über die Stirn. Er schwitzte selten, selbst in der Wüstenhitze. »Es ist eine trockene Hitze«, versicherten die Wüstenbewohner anderen gern und versuchten dabei zu verbergen, dass sie sich etwas vormachten. Aber heute war die Hitze ungewöhnlich. Larry spürte sie nicht in der Luft, sondern unter seinen Stiefeln, und sie kam nicht von der Sonne, sondern entstand durch Reibung. Der Sand unter dem Sperrholzboden strahlte eine Gluthitze aus, als rieben sich zwei Welten aneinander.
Larrys braunes Unterhemd war dunkel vor Schweiß. Er hörte die Teller und Tassen mit einem Krachen aus dem offenen Küchenschrank fallen. Der Boden, sein Haus, sein ganzes Selbst bebte. Das war nicht das sanfte Schwanken und Wanken eines von der Stadtverwaltung anberaumten Erdbebens. Es fühlte sich eher nach Schlägen an, die jemand von unten austeilte. Eine riesige unterirdische Faust hämmerte gegen die Wüste.
Er stand auf und stolperte ins Wohnzimmer, da wurde sein Haus von einem weiteren heftigen Schlag getroffen. Mit dem Gesicht voran fiel Larry der Länge nach durch die offenstehende Haustür.
Angst hatte er nur um seine Dioramen. Ihm war klar, dass eines Tages das Ende von allem kommen würde, und lange davor würde es für Larry zu Ende gehen. Er war nicht so arrogant, dass er von seinem Tod als dem Ende dachte, der war nur einer von Milliarden Enden vor dem Ende. Nur wenn man glaubt, die Geschichte drehe sich um einen selbst, ist der Tod das Ende.
Eines Tages würde man ihn tot in seinem Haus draußen am Rande der Stadt auffinden, das wusste er, und es störte ihn auch nicht weiter. Zwar hatte er keine Kinder, doch das Vermächtnis, das Kinder darstellen, ist ohnehin begrenzt. Die wenigsten Menschen wissen viel über ihre Familie vor ihren Urgroßeltern, und viele Leute erinnern sich noch nicht einmal an diese Generation. Ein Gedenken über zwei Generationen hinweg, mehr liefern Kinder nicht, danach ist jeder vergessen. Larry aber würde stapelweise Texte, Dioramen und Patchworkdecken hinterlassen. Eine eigenhändig erschaffene Geschichtsschreibung, den Versuch, seinen Helden Unsterblichkeit zu verleihen und so vielleicht auch die eigene Geschichte etwas zu verlängern. Er wollte keinen kurzen Nachruf im Night Vale Daily Journal – sein Tod sollte die Geschichte der Entdeckung seiner großartigen Sammlung sein, des Werks seines dann zu Ende gegangenen Lebens.
Er hatte bereits Briefe geschrieben – an Sarah Sultan, die Präsidentin des Night Vale Community College (darin die Anweisung, seine Dioramen der Kunstabteilung des College zu spenden), an Leann Hart, die Herausgeberin des Daily Journal, an Cecil Palmer, den Moderator des lokalen Radiosenders (einen selbst geschriebenen Nachruf, zusätzlich noch Nachrufe für Leann und Cecil) und an Michelle Nguyen, die Inhaberin von Dark Owl Records. Die würde sich sicher irre freuen, Larrys große Polkamusik-Sammlung zu erben – von ihm selbst komponiert, aufgeführt und mit einem Mikrokassettenrekorder aufgenommen. Michelle verabscheute jede Musik, die populär genug war, dass mehr Menschen als sie selbst und die Dark-Owl-Mitarbeiter sie hörten, also würden Larrys Melodien bei ihr auf offene Ohren stoßen. Sein letzter Wille sah vor, dass all diese Briefe verschickt und seine Besitztümer dann entsprechend verteilt würden.
Die Früchte seines künstlerischen und akademischen Strebens waren seine Kinder, und die würden hoffentlich länger überdauern als zwei vergessliche Generationen.
Er konnte spüren, wie seine Wange anschwoll, da, wo er gegen den Türrahmen geknallt war. Inzwischen setzten die unterirdischen Schläge seiner Küche und seinem Wohnzimmer arg zu. Vor seinen Augen stürzten Decke und Wände ein und verwandelten sich in Staub und Trümmer. Seiten aus seinen Büchern und persönlichen Schriften wurden aufgewirbelt, flogen hinauf zu den Hubschraubern und Sternen oder segelten träge wie unmotivierte Tauben im Wind.
Er hechtete ins Haus zurück, drückte sich an einer verbleibenden Wand ab und rannte zurück in sein Atelier. Das DuBois-McDaniels-Diorama war leicht beschädigt, aber noch zur retten.
Auch andere Dioramen standen noch mit aufrechten Wänden da: Jahrzehnte akribischer Arbeit und liebevollen Handwerks. Sein Stolz-und-Vorurteil-Diorama, sein allererstes, wies noch die Unfertigkeit des Anfängers auf, kündete aber zugleich von der Kühnheit des jungen Künstlers. Elizabeth Bennets Schwert war in Blut getaucht (Larry hatte sein eigenes verwendet), und ihre Augen hatte er aus poliertem Onyx gefertigt. Egal, wo man stand, immer starrte Bennet einen mit jener brennenden Rachsucht an, die sie als Schurkin unsterblich gemacht hatte und für die sie in die Literaturgeschichte eingegangen war.
Er setzte die DuBois-Schachtel auf dem Arbeitstisch ab und ging zu der Wand hinüber, wo er seine Dioramen in einem Regal hinter Plexiglasscheiben aufbewahrte. Der bockende Boden warf ihn nach vorn. Er rüttelte kurz an jedem Regalboden, überzeugte sich davon, dass alles gut gesichert war.
Krack.
Der Dielenboden unter ihm riss auf. Larry verlor das Gleichgewicht, konnte sich aber gerade noch an einer tragenden Säule neben der Regalwand festhalten. Noch ein lauter Knall, und der halbe Arbeitstisch hing plötzlich schräg über einem Loch, das sich im Boden aufgetan hatte. Die DuBois-Schachtel geriet ins Rutschen und schlitterte auf den Abgrund zu. Larry sprang. Er sprang selten, eigentlich machte er überhaupt nie etwas schnell, nun aber tat er beides. Gerade noch erreichte er die Schachtel, trat mit dem Fuß auf den wegstürzenden Tisch und stieß sich ab, katapultierte sich in die Höhe und krachte gegen die Wand, das Diorama seines Lieblingsredners schützend in den Armen.
Für eine Weile herrschte Stille, Larry hörte nur seinen eigenen keuchenden Atem und den Schweiß, der auf den Boden tropfte. Der Boden glühte. Seine Füße begannen sich zu verkrampfen. Doch sein Kopf war ganz leicht. Er trug DuBois nach draußen und setzte den Karton behutsam, in sicherer Entfernung von dem schwankenden Gebäude, auf dem Boden ab.
Er zog eine Schubkarre aus dem Graben und rannte zurück in das einstürzende Haus. Was er auf die Schnelle an wichtigen Dokumenten fand, warf er in die Karre, zusammen mit seinen Briefen an die Menschen von Night Vale. Er raffte seine Gedichte und Theaterstücke zusammen, dann hastete er zurück ins Atelier. Die Arme wurden ihm lahm, die Schubkarre war schon halbvoll. Vorsichtig stapelte er ein Diorama nach dem anderen obenauf – die Arbeit seines Lebens, eine zerbrechliche Pyramide aus Farbe, Plastik und Papier.
Über sich hörte er die Decke ächzen. Ganz oben auf den Stapel in der Karre stellte er Jane Austens Meisterwerk. In diesem Augenblick gab es erneut einen lauten Knall, dann hörte man ein Reißen und Knirschen. Larrys Ohren klingelten, und er fiel – oder vielmehr rutschte – auf die Knie. Der Boden unter ihm wölbte sich nach oben. Die leeren Regale stürzten ein. Er starrte nach unten in das Loch, sah Dreck, Holz und Plexiglas hinunterfallen, alles fiel und fiel und traf niemals auf, fiel in ein tiefes, bodenloses Nichts.
Der Boden riss immer weiter auf, die Holzdielen verbogen sich und wurden ins Loch gezogen. Er kämpfte darum, mit den Stiefeln auf der steilen Schräge Halt zu finden. Mit letzter Kraft stieß er die Schubkarre von sich weg – wenn er es nicht schaffte, dann sollten wenigstens die Dioramen eine Chance bekommen. Die Karre schlingerte ein kleines Stück die Schräge hoch, dann rollte sie wieder zu ihm zurück. Die Pyramide seines Lebenswerks geriet ins Schwanken, drohte umzukippen.
Larry rutschte ab, fand mit dem Stiefel keinen Halt mehr, spannte noch einmal die Beine an und stieß sich ab, fasste wieder Fuß und gewann an Schwung. Er schubste die Karre über den Rand der Schräge und stürzte ins Wohnzimmer, weg von dem zusehends größer werdenden Loch in seinem Rücken. Er flitzte um die Ecke und hinaus durch die Tür.
Er fand sich auf der Veranda wieder, sah im Licht der untergehenden Sonne hinaus auf die Wüste. Hinter ihm stürzte sein Haus ein, vor ihm die Welt.
Sein Vorgarten, der eigentlich nur aus Steinen und ein paar vertrockneten Büschen bestand, war verschwunden. Alles bis zum Straßengraben war eine leere Grube. Die Erde vor ihm war komplett verschwunden, und damit auch W. E. B. DuBois und Rachel McDaniels.
Larry blieb kaum Zeit, das Geschehen zu begreifen, da gab es schon den nächsten Knall. Er wusste es noch nicht, doch dieser würde der letzte und fürchterlichste sein. Die Stufen zur Veranda verschwanden in einer Explosion aus Sand. Seine Hände brannten, als ihm die hölzernen Griffe der Schubkarre entrissen wurden. Noch einmal blitzten Elizabeth Bennets Augen in einem wutentbrannten Orange, als sie zusammen mit den anderen verehrten Helden ins Vergessen stürzte. Alles, was jemals seine Existenz bezeugt hatte, stürzte vor seinen Augen ins Nichts. Hinter ihm sanken auch die Überreste seines Hauses krachend in die Grube. Er stand auf einem Stück Holz, in einem Türrahmen, umgeben von einem sich ausbreitenden, klaffenden Nichts.
Er blickte dem Erdboden hinterher, der in die Tiefe stürzte. Er sah auf zu den Sternen und der Leere, die sich himmelwärts fallend von ihm entfernten.
Und Larry glaubte einfach nicht, was er da sah – auch nicht, als das letzte Stück Boden unter seinen Füßen wegsackte und er ins Nichts fiel. Aber Larry glaubte ja auch nicht an Berge, obwohl er sie mit eigenen Augen sehen konnte, wenn auch nur noch für wenige Sekunden.
2
Nilanjana Sikdar starrte die Bakterien an. Die Bakterien starrten nicht zurück. Ohne jedes Bewusstsein wimmelten sie umher.
Bei ihrem Experiment ging es um ein Stoffwechselprodukt der Bakterien, um eine Substanz, die sich als Pestizid in der industriellen Landwirtschaft einsetzen ließ. Im Augenblick allerdings machte sich Nilanjana mehr Gedanken darum, warum die Bakterien hauptsächlich auf einer Seite der Petrischale wuchsen. Das musste nicht unbedingt etwas bedeuten. Doch es konnte etwas bedeuten. Alles konnte für irgendjemanden etwas bedeuten. Und es sah ungleichmäßig aus. Unordentlich. Nur zu gern hätte sie ein paar Bakterien auf die andere Seite geschubst, doch das wäre ganz unwissenschaftlich gewesen, und ohnehin lassen sich Bakterien schlecht schubsen. Vielleicht konnte sie eine Seite der Schale leicht anheben. Nur um ein paar Bakterienkolonien auf die leere Seite zu befördern. Dann wäre es gleichmäßiger. Wissenschaftlicher wäre es nicht, aber doch ordentlicher. Nein, das konnte sie nicht tun. Das Verhalten der Bakterien zu manipulieren, wäre falsch. Sie seufzte. Die Bakterien würden ungleichmäßig wachsen. Sie würde lernen, damit fertigzuwerden, so wie sie gelernt hatte, mit allem anderen in ihrem Leben fertigzuwerden.
Wenn man so wie Nilanjana seit fast vier Jahren in einer Stadt wie Night Vale lebte, dann gab es jede Menge, mit dem man fertigwerden musste. Rachsüchtige Geister. Entführungsversuche neugieriger Aliens. Städtische Feiertage mit erschreckend hohen Opferzahlen. Mit all dem hatte sie leben gelernt. Dennoch störten die Bakterien sie mehr, als sie gegenüber irgendjemandem hätte zugeben können.
Nilanjana hob die Schale ein Stückchen an. Sie würde es einfach niemandem verraten. Dickköpfig verharrten die Bakterien auf der linken Seite.
Sie machte sich ein paar Notizen in ihrem Notizbuch, das sich exakt auf einer Linie mit der Petrischale und dem Mikroskop befand. Als sie mit dem Schreiben fertig war, legte sie ihren Stift wieder an seinen Platz. Ihr Arbeitstisch war ansonsten leer. Für ihre Arbeit brauchte sie nichts außer ihrem Experiment und ihrem Notizbuch, und sie konnte auch nichts um sich herum gebrauchen, für dessen Dasein es keinen Grund gab. Ihr Tisch war ein erfreulich leeres Rechteck, mit dem Mikroskop und dem Notizblock zu beiden Seiten der Mittellinie.
Und einem kleinen Rinnsal Nährlösung, das sich seinen Weg zur Tischkante bahnte.
»Scheiße«, sagte sie.
»Hm?«, sagte Luisa.
Luisa arbeitete am Tisch nebenan. Bei ihrem Experiment ging es darum, sichtlich enttäuscht von Kartoffeln zu sein, und das war Luisa auch – selbst als sie zu Nilanjana hinüberschielte, bedachte sie den Haufen Erdäpfel auf ihrem eigenen Tisch weiterhin mit missbilligenden Blicken. Ihr Platz war nicht unordentlich, allerdings sah neben Nilanjanas jeder Platz unordentlich aus. Luisas Platz sah also unordentlich aus. Ein Papierstapel war umgekippt und hatte sich über den Tisch verteilt. Ihre Kartoffeln bildeten einen willkürlichen Haufen, sie hatte sie nach dem Zufallsprinzip ausgelegt, um nicht das Ergebnis ihres Experiments zu verfälschen, was immer das auch sein würde.
»Ach nichts«, sagte Nilanjana. »Na ja, ich hab nur was verschüttet. Nicht weiter schlimm.« Sie deutete auf ihren Arbeitstisch.
»Ich bin ja so was von enttäuscht«, sagte Luisa.
»Wie bitte?«
»Entschuldige, damit waren die Kartoffeln gemeint. Außer mit optischen Signalen muss ich ihnen meine Enttäuschung in bestimmten Abständen auch akustisch vermitteln. Nur für den Fall, dass sie hauptsächlich auf Geräusche reagieren.«
»Reagieren sie denn überhaupt auf Geräusche?«
»Da gibt es nur einen Weg, das herauszufinden«, sagte Luisa heiter und optimistisch. Ihre Miene blieb dabei ernst und verdrossen. »Also, das hat echt kein Niveau.«
»Haben Kartoffeln denn ein Niveau?«
»Ich meine nicht die Kartoffeln. Dich meine ich, Nils. Was soll das überhaupt für ein Experiment sein, das du da machst?«
»Ach weißt du, das ist tatsächlich interessant. Ich stelle den pH-Wert des Nährmediums in kleinen Schritten so ein, dass jede …«
»Nils, ist das überhaupt Wissenschaft?«
»Ja.«
»Ach wirklich? Hm, ich bin immer noch nicht sicher, was Wissenschaft überhaupt sein soll. Dein Experiment klingt mehr nach einem Kunstprojekt.«
Sie stieß eine Kartoffel an, die daraufhin den Haufen herunterkullerte. Entweder bemerkte Luisa es nicht oder es war ihr egal.
»Auf jeden Fall solltest du deine Zeit nicht mit unwichtigen Experimenten wie dem da verschwenden. Du solltest an größeren, prestigeträchtigeren Dingen arbeiten. An Projekten, mit denen man Preise gewinnt. Wie den Beste-Wissenschaft-Preis oder den Diese-Wissenschaft-war-gut-Preis von der Gesellschaft Guter Wissenschaftler. Schau dir nur mich und meine Kartoffeln an.«
Mit einer Handbewegung forderte sie Nilanjana auf, sich ihre Kartoffeln anzusehen, und da Nilanjana das ohnehin schon tat, riss sie die Augen auf, um zu zeigen, dass sie nun noch genauer hinsah.
»Weißt du, wie viel Fördergeld ich für diese Kartoffelsache bekomme? Wenn alles nach Plan läuft, kann ich den Rest meiner Laufbahn damit verbringen, von Kartoffeln enttäuscht zu sein. Von dem Presserummel ganz zu schweigen.«
Nilanjana interessierte sich nicht sonderlich für Fördergelder und Preise. Natürlich waren die Klatschblätter voll von Geschichten über steinreiche Forscher, aber das war nicht der Grund, warum sie Wissenschaftlerin geworden war. Sie wollte schlicht die Natur der Welt ergründen. Am glücklichsten war sie, wenn sie jeden Tag ins Labor ging, mit ihren Bakterien arbeitete und abseitige, nicht-kommerzielle Dinge entwickelte, die der Gesellschaft zugute kamen, wie zum Beispiel Medikamente oder Pestizide.
Seit drei Jahren erforschte sie nun schon diese Bakterien, um ein natürliches Pestizid zu entwickeln. Bislang gingen Bauern gegen schädliche Insekten vor, indem sie sie anzündeten, doch das wirkte sich oft ungünstig auf die Nutzpflanzen aus, auf denen die Insekten lebten. Nilanjana waren auch schon einige Durchbrüche gelungen. Zu Beginn des Jahres hatte sie es geschafft, eine Sprühlösung zu entwickeln, die Holzbohrkäfer von Bäumen fernhielt. Allerdings fingen die Käfer meist zu schreien an, wenn sie mit dem Spray in Kontakt kamen. Sie hörten gar nicht mehr auf mit dem Gebrüll, und das war alles andere als angenehm. Also versuchte Nilanjana derzeit, die Rezeptur zu verfeinern.
Wissenschaft war für sie ein fortwährender Prozess der Vervollkommnung. Jede Antwort brachte neue Fragen hervor, die sich zu mehr und mehr Antworten verzweigten. Nilanjana wollte die Wissenslücken mit Fakten und Beweisen füllen, damit die Menschen das Unerklärliche nicht länger mit Mutmaßungen und Legenden erklären mussten. Je weniger dem Reich der Mythen angehörte, desto besser würde es der Menschheit gehen. Wenn es dafür Preise und Fördergelder gab, umso besser. Doch Nilanjana ging es nicht um Anerkennung. Ihr ging es um die ordnenden Prinzipien, darum, das Weltwissen aufzuräumen.
»Ja klar. Aber Luisa, versteh doch. Ich mag dieses Experiment. Es ist interessant. Und wenn es interessant ist, ist es wichtig. Das sagt jedenfalls Carlos immer.«
»Hm, Carlos. Carlos ist ein großer Wissenschaftler, Nils, aber wenn es darum geht, Karriere zu machen, davon versteht er nicht viel. Da halt dich lieber an mich. Ich kann dir helfen, wirklich voranzukommen.«
»Okay, ja, aber trotzdem.« Nilanjana deutete auf die Schale mit den Bakterien. In diesem Augenglick gab es einen ohrenbetäubend lauten Knall, gefolgt von einem fluoreszierenden Blitz. Ihre Hand schoss vor und stieß die Petrischale um.
»Entschuldige!«, sagte Mark. Sein Arbeitsplatz befand sich hinter den beiden, und er arbeitete an einer Maschine, die einen blendenden Blitz erzeugen sollte, gefolgt von einem Knall, um die Leute zu erschrecken. Seit Wochen allerdings bekam er die Reihenfolge nicht hin.
»Oh nein, verdammter Mist! Das war die Arbeit von einem Monat. Ich brauche ein Papiertuch. Entschuldigt mich.«
Luisa zuckte mit den Schultern.
»Von mir aus. Ich will mich nicht aufdrängen. Ich habe es ja nur gut gemeint, und ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht.«
»Das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben, wir haben doch nur …«
»Ach, entschuldige, Nils. Das galt wieder den Kartoffeln.«
Nilanjana stand auf, um irgendetwas zu holen, womit sie die sich ausbreitende Sauerei aufwischen konnte. Ein Teil ihres Tisches war mit Nährlösung überzogen, und das machte sie völlig fertig.
Mark blickte äußerst schuldbewusst drein, als sie an ihm vorbeiging.
»Das tut mir echt leid. Ich hätte dich mit der Drucklufthupe warnen sollen, damit du weißt, dass ich gleich meine Maschine teste, aber du weißt ja selbst, wie das ist. Ich war einfach so in mein Experiment vertieft.«
Sie nickte und tat den Ärger mit einer Handbewegung ab. Sie wusste genau, wie das war. Sie mochte Mark, und es tat ihr leid, dass es mit seinem Experiment nicht gut lief, auch wenn seine verbissene Arbeit daran ernsthafte psychische und physische Schäden bei ihr verursachte.
»Hör nicht auf sie«, sagte er und schraubte eine Abdeckung auf, um herauszufinden, was das Problem mit seiner Maschine war. Sie leuchtete schwach auf und gab ein Gurgeln von sich, das niemanden mehr erschreckte. Er schüttelte den Kopf. »Wenigstens war’s die richtige Reihenfolge«, murmelte er.
»Ach weißt du, ich höre ihr zu, aber deshalb höre ich noch lange nicht auf sie«, sagte Nilanjana. »Ich bin stolz auf mein Experiment. Es geht um etwas, das mich interessiert, und es funktioniert. Oder es hat funktioniert. Es hat funktioniert, bis ich es umgestoßen habe.«
Sie öffnete die Tür zur Notfallstation des Labors, die nichts außer einer Rolle Papiertücher enthielt.
»Oder ich weiß nicht. Ich schätze, das ist es halt, was ich mache. Ich arbeite an kleinen Experimenten, nur für mich selbst. Vielleicht ist das alles, was für mich drin ist. Das wäre schon okay.«
»Was immer dich glücklich macht, Nils.« Er stocherte mit dem Schraubenzieher in der Maschine herum. »Das meine ich nicht ironisch. Echt, was immer dich glücklich macht. Bist du denn glücklich?«
»Mir geht es gut.« Sie schaute auf das Rinnsal, schauderte und wickelte sich eine lange Bahn Papiertücher um die Hand, die sie mit einem heftigen Ruck abriss. »Ich muss nicht glücklich sein, solange es mir gut geht.«
Während sie die Nährlösung mit dem riesigen Papierbausch aufwischte, überlegte sie, ob es ihr denn wenigstens gut ging. Wie konnte man das wissen? Wie würde ein objektiver Test für Glück aussehen, oder einer fürs Gutgehen? Welche Daten würde man dafür erheben müssen? Ließ sich »gut« überhaupt objektiv nachweisen?
Sie dachte über die anderen Wissenschaftler nach. Es gab mehrere Tische in dem großen Labor, und an jedem arbeitete ein Forscher an seinem ganz eigenen Experiment. Manche der Experimente sprühten Funken oder sangen, andere sonderten Flüssigkeiten ab oder gelierten. Nur manche der Experimente dachten oder fühlten. An einer Wand hing ein Whiteboard mit verschiedenen Projektnamen und den damit verbundenen Beobachtungen. Eine lautete: »Bienen?«, eine andere: »Hypothese: Alles ist furchtbar und wir sollten uns verstecken«.
Das Labor lag im Wissenschaftsviertel, einem Gewerbegebiet, in dem ziemlich rohe Sitten herrschten – wegen der ständigen Fehden zwischen rivalisierenden Wissenschaftlern war die Gegend nicht ungefährlich. Besonders zwischen Astronomen und Ornithologen brachen immer wieder Kämpfe aus, es gab Überfälle auf offener Straße, die mit dem lauten Vorlesen aus Peer-Review-Journalen begannen und damit endeten, dass jemand mit einer zerbrochenen Bierflasche zustieß. Nilanjana hielt sich aus diesen Streitereien heraus, aber es war einigermaßen verstörend, an verblassenden Blutflecken und herausgerissenen Seiten einer wissenschaftlichen Veröffentlichung vorbeizugehen – daran erkannte man immer den Schauplatz einer besonders heftigen Auseinandersetzung.
Und doch ging es ihr gut. Es ging ihr gut, wenn sie an ihren Experimenten arbeitete. Sie kam gut mit Luisa und Mark zurecht. Es ging ihr gut in einem Raum voller kluger Leute, die sie respektierten, selbst wenn sie die anderen kaum kannte. Es tat ihr gut, zur Arbeit zu kommen und über die Arbeit zu reden oder auch einfach über das Leben. Sie kam gut damit zurecht, die Abende allein zu Hause, nicht in einem Raum voller Menschen zu verbringen. Sie kam gut damit zurecht, die ihr bekannten Menschen nur zu bestimmten Stunden zu sehen und zu anderen Zeiten für sich allein zu sein. Sie kam gut damit zurecht, eine Außenseiterin zu sein – die Leute in Night Vale erinnerten sie regelmäßig daran, dass sie nicht hier aufgewachsen war. Sie war schon immer eine Außenseiterin gewesen, und es ging ihr gut dabei. Es war ihr auch gut gegangen, als sie als kleines Mädchen Käfer getötet, durch ein Mikroskop geschaut und Mikroben in gleichmäßigen Mustern angeordnet hatte. Auch ohne Freunde, die das verstanden oder mochten, war es ihr gut gegangen. Sie wurde zwar auf keine Party eingeladen, aber auch von niemandem gepiesackt oder verspottet, und das war gut so. Vielleicht war sie nicht glücklich. Vielleicht war das, was sie tat, nicht wichtig, vielleicht half es niemandem. Aber das war schon in Ordnung. »Es geht mir gut« – es war gut, sich das zu sagen.
»Nilanjana«, sagte eine sanfte, rauchige Stimme. Sie sah von ihrem Tisch auf, den sie die ganze Zeit, ohne dass es ihr bewusst gewesen war, mit Papiertüchern bearbeitet hatte.
Carlos stand in der Tür zu seinem Büro. Er sah ängstlich aus. Nein, besorgt. Nein, ängstlich.
»Nilanjana, kannst du mal reinkommen? Ich brauch deine Meinung zu … Komm bitte einfach mal rein.«
Es kam nicht oft vor, dass Carlos andere Wissenschaftler in sein persönliches Labor bat. Er führte dort seine ganz eigenen, speziellen Experimente durch, bei denen es darum ging, Night Vale vor den verschiedenen übernatürlichen Gefahren, die die Stadt bedrohten, zu bewahren. Er bastelte dort auch Collagen aus Zetteln voller Liebeserklärungen an seinen Mann. Das alles war äußerst wichtige Arbeit, und er wurde dabei nicht gerne gestört. Nilanjana konnte sich nicht erinnern, wann er sie das letzte Mal in sein Büro gebeten hätte.
Hätte sie gewusst, welche Ereignisse die nun folgende Unterhaltung in Gang setzen würde, wäre sie total verängstigt gewesen oder vielleicht überglücklich und dann wieder total verängstigt. Sie hätte so vieles gefühlt, was sie nicht mehr gefühlt hatte, seit sie in diese seltsame Stadt gekommen war, wo sie nicht recht dazugehörte. So aber fühlte sie sich nur verwirrt.
»Klar«, antwortete sie. »Ich bin gleich bei dir.«
»Pfui«, sagte Luisa und bedachte ihre Kartoffeln mit einer verächtlichen Handbewegung.
3
Nilanjana hatte an Carlos kein Interesse, außerdem war er mit Cecil Palmer, dem Moderator des lokalen Radiosenders, verheiratet. Trotzdem konnte ihr schwerlich nicht auffallen, wie umwerfend gut er auf seine Art aussah. Selbst sein Stirnrunzeln war perfekt, und er fuhr sich auf perfekte Weise durch das perfekte Haar.
Natürlich herrscht unter Wissenschaftlern immer ein enormer Druck, gut auszusehen. Die äußere Erscheinung spielt für die wissenschaftliche Karriere eine entscheidende Rolle, und immer wieder sehen sich Topwissenschaftler den unterschiedlichsten Anschuldigungen ausgesetzt – man verdächtigt sie, mit Operationen und ungesunden Diäten nachzuhelfen, und sie stehen unter ständiger Beobachtung durch die Klatschmagazine und Boulevard-Blogs. Carlos jedoch hielt sich aus all dem heraus. Er war ein schöner Mann, aber das hatte ihn nie interessiert. Ihn interessierten nur zwei Dinge: seine Arbeit als Wissenschaftler und seine Familie.
Nilanjana kannte Carlos’ Familie nicht näher. Sie wusste, dass seine Nichte Janice, ein Mädchen im Teenager-Alter, mit Spina bifida zur Welt gekommen war, und auch wenn die regelmäßigen Untersuchungen ihrer Augen, ihrer Nieren und ihrer Wirbelsäule jedes Mal ohne Befund blieben, nahm Carlos sich immer wieder ganze Tage frei, um Zeit mit ihr, seinem Bruder und seiner Schwägerin zu verbringen.
Nilanjana wusste, dass Carlos’ Mann Cecil manchmal große Risiken einging, wenn er als Reporter in einer Stadt recherchierte, die so schreckliche Geheimnisse barg wie Night Vale, und dass Carlos dann regelrecht in Panik verfiel. Er lief in seinem Büro auf und ab und versuchte, nicht den Sender anzurufen und zu fragen, ob Cecil etwas zugestoßen sei. Wenn Carlos so um Cecils Sicherheit bangte, war im Labor an Arbeit kaum zu denken. Nilanjana wusste auch, wann Carlos sich für den Abend verabredet hatte, denn dann schmierte er sich Gel ins Haar und trug seinen eindrucksvollsten Laborkittel.
Sie hatte keine Ahnung, warum Carlos jetzt mit ihr sprechen wollte. Hoffentlich betraf das Problem seine Arbeit. In Liebesdingen konnte sie nicht viel beitragen. Nicht, dass sie noch nie einen Freund gehabt hätte. Sie war ein erwachsenes menschliches Wesen, das sich für andere menschliche Wesen interessierte, und seit der Highschool hatte sie Beziehungen gehabt. Doch als Ratgeberin fühlte sie sich nicht qualifiziert. Wie jeder andere wurstelte sie sich so durch. Gelegentlich machte das Spaß, oft fühlte sie sich einsam, egal, ob sie gerade mit jemandem zusammen war oder nicht.
Carlos unterbrach ihre Gedankengänge, indem er ein Schaubild herunterzog, auf dem in großen Buchstaben WISSENSCHAFT zu lesen war.
»Das Thema unserer heutigen Unterhaltung ist die Wissenschaft. Ich habe zur Veranschaulichung diese Abbildung vorbereitet.«
Gott sei Dank.
Er bedeutete ihr, sich zu setzen, aber sie saß nicht gerne, und so bedeutete sie ihm, dass sie lieber stand. Ihre Gesten gingen eine Weile hin und her, ohne dass einer von ihnen den anderen verstand. Schließlich setzte sich Carlos, und sie blieb stehen.
»Du bist im Bilde über das Haus«, begann er.
»Meinst du das generelle Konzept eines Hauses?«
»Äh, nein, entschuldige, ich meine das Haus, das nicht existiert.«
Er zog ein anderes Schaubild herunter. Darauf war ein Haus zu sehen.
»Ja«, sagte sie. »Das Haus kenne ich. Es existiert nicht. Es sieht aus, als würde es existieren. Wenn man hinschaut, kann man es sehen, und es steht zwischen zwei weiteren, identischen Häuern, da wäre es also naheliegend, dass es existiert, eher, als dass es nicht existiert, aber …«
» … in Wahrheit existiert es nicht«, beendete er den Satz.
»Richtig. Wirklich ein eigenartiges Haus. Oder eigentlich kein eigenartiges Haus. Eigenartig, aber kein Haus? Schwer zu entscheiden, wie man das ausdrücken soll.«
Jeder in der Stadt wusste von dem Haus, das aussieht, als würde es existieren, obwohl es nicht existiert. Unter Wissenschaftlern war es eine gängige Mutprobe, an der Tür zu klopfen und dann wegzurennen. Carlos selbst hatte das Haus einmal betreten. Worüber er aber nicht sprach. Wann immer die Sache zur Sprache kam, tat er sie mit einer Handbewegung ab oder wechselte das Thema.
Seinen Forschungsnotizen hatte Nilanjana entnommen, dass sich das Innere des Hauses komplett von dem des gewöhnlichen Fertighauses unterschied, für das man es hielt, wenn man durch die Fenster hineinsah. Befand man sich im Haus, gab es dort keine Möbel und keine Dekoration, mit Ausnahme der kleinen Schwarz-Weiß-Fotografie eines Leuchtturms. Das Haus war kein Haus, sondern der Zugang zu einer Anderswelt, zu einer leeren, unermesslichen Wüste. In dieser Anderswelt gab es einen einzigen Berg, der jedem, der ihn sah, sehr glaubwürdig vorkam. Oben auf dem Berg befand sich der Leuchtturm auf der Fotografie. Es herrschte dort ein kaltes Licht, das von überall her zu kommen schien – eine Sonne hatte Carlos nie gesehen.
Hypothese: Die Wüstenanderswelt war kalt und leer gewesen, und Carlos hatte sich darin verloren gefühlt, abgeschnitten von allen geliebten Menschen. Für Carlos gab es nichts Wichtigeres als die Menschen, die er liebte – ein Ort mit niemandem und nichts darin hatte ihn schwer traumatisiert.
Seit Carlos vor ein paar Jahren aus dieser Anderswelt zurückgekehrt war, war er von dem Haus besessen. Und wie immer, wenn jemand besessen von der Wahrheit war, hatte das den Stadtrat nervös gemacht.
»Ihr Job ist es, Wissenschaftler zu sein«, hatte ihm der Stadtrat durch eine kindliche Botin mit leeren Augen mitteilen lassen. Diese war praktischerweise mitten in der Nacht aus der Dusche getreten und hatte sich auf Carlos gestürzt, als er zum Pinkeln aufgestanden war. »Also sehen Sie hübsch aus und schreiben Sie Ihre Aufsätze. Fangen Sie bloß nicht an, nach der ›Wahrheit‹ zu suchen. Sie sind Wissenschaftler, kein Schnüffler.«
»Oh Mann«, sagte Nilanjana, als Carlos ihr von der Botschaft des Rats erzählte.
»Ja, das hat mich echt aufgeregt«, sagte Carlos. »Und dann hatte ich natürlich die kindliche Botin mit den leeren Augen an der Backe, und du weißt ja, wie lange der Stadtrat immer braucht, bis er endlich kommt und sie wieder abholt. Am Ende mussten wir sie drei Wochen lang zur Schule fahren. Morgen gehen wir zu ihrer Abschlussfeier, sie ist fertig mit der achten Klasse.«
»Niedlich.«
»Total niedlich. Aber ich werde nicht zulassen, dass noch jemand durch diese Anderswelt zu Schaden kommt, egal, was der Stadtrat will. Die haben tatsächlich versucht, mich aufzuhalten.«
Das hatte sich folgendermaßen zugetragen.
Carlos war auf die Idee gekommen, das Haus, das nicht existiert, zu vermessen, und zwar mit einer wandgroßen Maschine in seinem Büro. Die Maschine verfügte über Radar, Mikrowellen und Laser, spuckte Zahlen aus und gab dabei ein hohes, surrendes Geräusch von sich.
An vielen Tagen, vor allem wenn es heiß war, standen die Wohnzimmerfenster des Hauses, das nicht existiert, zur Straße hin offen, und dann konnte Carlos versuchen, den Abstand zwischen den nichtexistierenden Außenwänden des Hauses und dem Paralleluniversum in seinem Inneren zu vermessen. Schließlich überprüft man jedes neue Gebäude routinemäßig auf mögliche Zugänge zu Paralleluniversen und vermisst dann deren Tiefe mittels Laserstrahlen, also hatte Carlos das entsprechende Messgerät der Bauingenieure für seine experimentelle Problemstellung einsetzen können. Sah man durch das Fenster ins Haus, schien der Raum ein gewöhnliches Wohnzimmer zu sein: Sessel, Sofa, Lautsprecher ohne Lautstärkeregler für die Verbreitung der städtischen Propaganda, ein Reservesofa für Notfälle. Der übliche Kram eben. Aber ihm war klar, dass es sich bei all dem um eine optische Täuschung handelte, was ja nur ein hochtrabender Fachbegriff für eine Lüge ist.
Als er dann seine Maschine angeschaltet hatte, war alles schiefgelaufen. Tief unter dem Wüstensand hatte es gerumpelt. Der ganze Boden hatte gebebt. Fast wie bei einem Erdbeben, allerdings war dieses nicht menschengemacht oder hatte wie ein normales Erdbeben im Kalender der Stadtverwaltung gestanden. Die Erschütterungen und der Krach hatten all seine Messungen unbrauchbar gemacht.
Wissenschaftliche Forschung hatte schwierig zu sein. Denn was war Forschung schließlich anderes als ein Haufen gelangweilter menschlicher Wesen, die nach einer Herausforderung suchten, wenn es zu einfach wurde, einfach zu glauben? Also hatte Carlos die Maschine neu eingerichtet, sorgfältig kalibriert und noch einmal gestartet. Wieder hatte es gerumpelt, gleich als sein Finger den Schalter umlegte. Das Experiment war ruiniert.
»Jemand beobachtet mich. Jedes Mal, wenn ich das Experiment starten will, fängt es zu rumpeln an, und alles ist verdorben. Jemand will nicht, dass dieses Haus erforscht wird. Wer immer es ist, der mich aufhalten will, ich glaube, er hat seine eigene Gegenmaschine, um meine Forschung zu verhindern.«
Er zog ein drittes Schaubild herunter, dieses Mal eine Karte, auf der die Rumpelereignisse eingetragen waren. Lauter orangefarbene Klekse in der Wüste, rund um die Stadt.
»Außer den seismischen Aktivitäten, die meine Daten verhunzt haben, scheinen auch ganze Teile des Erdbodens verschwunden zu sein. Es werden Menschen vermisst.«
»Aber wer würde die Wahrheit unterdrücken wollen?«, fragte Nilanjana. »Abgesehen von der Geheimpolizei, dem Stadtrat, der Bürgermeisterin, allen möglichen nationalen Regierungen und andersweltlichen Invasoren?«
»Ganz genau«, sagte Carlos. »Am wahrscheinlichsten ist es der Stadtrat, denn die haben mich schon gewarnt.«
Carlos hatte eine Audienz beim Stadtrat beantragt – eine mutige Entscheidung. Welch vielgestalte, extradimensionale Bestie auch immer in der Ratskammer hauste und dort Rauch, Schwefel und Stadtverordnungen absonderte, sie hatte auf jeden Fall einen Heißhunger auf Menschen. Für Carlos aber wogen die Wissenschaft und die Sorge um seine Mitmenschen stärker als alle Bedenken, und so hatte er einen feuerfesten Laborkittel angelegt und sich die Augen verbunden, um die grauenhafte, sich windende Kreatur nicht sehen zu müssen. »Was sollen wir getan haben?«, hatte der Stadtrat in vielen Stimmen und Tonhöhen, unisono und im Surround-Klang gefragt. »Wir waren im Urlaub. Wir haben gar nichts getan. Was wirfst du uns da vor?«
»Dass Sie meine Experimente mit dem Haus, das nicht existiert, ruinieren. Und mich davon abhalten, das zu verstehen, was ich verstehen muss.«
Vom Rat war ein Zischen gekommen.
»Dir wurde befohlen, diese Sache zu unterlassen. Unsere Geduld hat Grenzen.«
»Also haben Sie meine Experimente mit diesem Rumpeln unter der Erde verhindert?«
»Närrischer Wissenschaftler. Wahrheitssucher. Glaubst du, du bist der Einzige, der sich für dieses Haus interessiert? So viele Leute wollen sich Zugang zu seiner verborgenen Macht verschaffen.«
»Was für eine Macht? Was für Leute?«
»Wir haben schon zu viel gesagt. Wir sollten dich verschlingen. Aber es gibt einflussreiche Medienschaffende, die ihre schützende Hand über dich halten. Fliehe, wenn dir dein Leben lieb ist.«
»Was ist die Macht des Hauses? Was wissen Sie?«
Der Rat hatte laut aufgebrüllt. Eine feuchte, schwammige Hand hatte sich um Carlos’ Hals gelegt.
»Der Worteschmied hat uns vor dem gewarnt, was nur darauf wartet, in unsere Stadt einzudringen. Du willst hinter Türen blicken, die niemals geöffnet werden sollten. Stelle deine Forschung ein, oder sie wird für dich eingestellt werden.«
Die nassen Finger hatten fester zugegriffen. Carlos war zurückgewichen, und nach und nach hatte sich der Griff gelockert, die Finger hatten ihn freigegeben. Geblieben war ihm nur der Geruch einer auslaufenden Batterie, ein säuerlicher Geruch, den er hinten auf der Zunge schmeckte.
»Der Worteschmied?«, fragte Nilanjana. Unwillkürlich hatte sie sich vorgebeugt, ganz im Bann seiner Erzählung. »Wer ist denn das?«
»Keine Ahnung«, sagte Carlos. »Hab den Ausdruck noch nie gehört. Noch ein Rätsel. Rätsel über Rätsel über Rätsel.«
Er zog an einer Kordel, und mit einem schnalzenden Geräusch rollten sich alle drei Grafiken wieder auf.
»Es scheint, als hätte ich mit meiner Forschung einen Punkt erreicht, an dem ich nicht länger weitermachen kann.«
»Du kannst nicht einfach aufgeben, nur weil der Stadtrat das sagt.«
»Doch, Nils, ich fürchte, genau das muss ich tun.«
Er seufzte und stand auf, sah durchs Fenster auf den gesprungenen Asphalt der Einkaufsmeile, auf der sein Labor angesiedelt war. Auf dem Parkplatz standen ein paar Autos. Hungrige Bürger machten hier halt, um nebenan bei Big Rico’s eine Pizza zu essen. Teenager kamen auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen her, um miteinander rumzumachen oder in geteiltem Erschrecken zum unfassbaren Nachthimmel aufzusehen. Regierungsvertreter in Anzügen saßen in schwarzen Limousinen ohne Kennzeichen und lauschten mit ausdruckslosen Mienen auf jedes Wort, das jemand sagte.
»Wissenschaft ist die kompromisslose Suche nach der Wahrheit. Aber Wissenschaft kann nur im Rahmen eines menschlichen Lebens praktiziert werden. Und das menschliche Leben ist total kompromittiert. Besonders das Leben hier, in unserer wachsamen kleinen Stadt.«
Er blickte zu den schwarzen Limousinen hinüber, dann wandte er sich wieder Nilanjana zu. Mit lautlosen Lippenbewegungen: Verstehst du?
Sie nickte.
»Nils, ich würde dich nie bitten, mir dabei zu helfen, dieses Experiment durchzuführen. Ich würde dich nie bitten, mir dabei zu helfen, den Ursprung des Rumpelns zu finden. Es wäre gefährlich, diese Sache weiterzuverfolgen. Wenn ich dich darum bitten würde, dann hättest du jedes Recht, durch diese Tür zu gehen und zu deinen Bakterien zurückzukehren.«
»Warum würdest du denn gerade mich fragen und nicht einen der anderen Wissenschaftler?«, fragte sie. »Ich meine, wenn du tatsächlich mit diesem Experiment weitermachen würdest, was du ja ganz offensichtlich nicht tust.«
Im Labor vor dem Büro gab es plötzlich einen lauten Knall, und durch den Spalt unter der Tür sah man einen hellen Blitz. Sie konnten Luisa schreien hören: »Ich bin echt so enttäuscht!« Es war unklar, ob sie Mark oder eine Kartoffel meinte.
Carlos blickte kurz zur Tür und schaute dann wieder Nilanjana an. Er lächelte ihr zu und streckte die Hand aus. Sie nahm die Hand und nickte in stummem Einverständnis.
Ein Experiment, das verhindert worden war. Ein Haus, das nicht existierte. Ein Rätsel, vor dem der Stadtrat Angst hatte. Und ein Mensch oder ein Wesen, das Worteschmied genannt wurde. Das Ganze schien völlig undurchsichtig, unlösbar.
Doch das Studium der Wissenschaft hatte sie gelehrt, wie man mit dem Unlösbaren umgeht. Daten sammeln. Hypothesen aufstellen. Die Hypothesen prüfen. Das Gelernte verwenden, um noch mehr Daten zu sammeln. Und bald schon würde sich das Unlösbare als eine dünne, nachgiebige Barriere erweisen.
Sie würde mit dem vergleichsweise objektiven, messbaren Teil der Geschichte beginnen. Mit dem Rumpeln in der Wüste.
»Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen«, sagte sie und ging zur Tür. »Wenn du mich jetzt entschuldigst – ich muss meine Bakterien loswerden und in die Wüste fahren. Es gibt dort ein paar persönliche Dinge, um die ich mich kümmern muss.«
Danke, sagte er lautlos.
Sie fegte ihr nutzloses, ruiniertes Experiment vom Tisch in den Abfalleimer – von der Seite sah Luisa sie verwirrt an, wobei sich ihre übliche, in Enttäuschung erstarrte Miene kurzzeitig lockerte – und ging dann raus zu ihrem Wagen.
Unvermittelt musste Nilanjana lachen, als sie den Motor anließ. Sie lachte aus echter Freude, ohne zu verstehen, warum sie diese Freude empfand.
In was ritt sie sich da nur hinein? Sie lachte voller Glück. Sie hatte keine Ahnung.
4
Als der Barista den Americano zum Überlaufen brachte, versicherte ihm Darryl Ramirez, dass das doch überhaupt nichts ausmache. Das könne jedem passieren, der Barista solle sich deswegen bloß nicht geißeln. Aber der Barista starrte Darryl bloß böse an und verdrehte die Augen. Mit ein paar schnellen, zornigen Bewegungen wischte er über die Theke und knallte ihm dann die Tasse hin. Unwillkürlich fing Darryl an, sich zu entschuldigen, obwohl es doch sein Kaffee gewesen war, der verschüttet worden war.
Darryl tat die Sache aufrichtig leid. Seine Worte waren ganz ernst gemeint gewesen, aber etwas in seinem Auftreten bewirkte, dass andere ihm Gemeinheit oder Sarkasmus unterstellten. Er hatte ehrlich versucht, den Barista wegen seines Fehlers zu trösten, doch das war wie Hohn rübergekommen – Hohn über die Unfähigkeit des Mannes, seinen Job zu machen, einen Job, der trotz der ständigen gegenteiligen Beteuerungen von Barista Local 485 ziemlich einfach war. Er bedankte sich bei dem Barista und sagte: »Glaube an einen Lächelnden Gott, mein Freund.« Dabei machte er mit der ausgestreckten Faust eine Kreisbewegung. Doch der Barista war schon mit der nächsten Bestellung beschäftigt.
Schuld waren die Jahre in der Kirche, dachte Darryl. Die Kirche hielt alle ihre Mitglieder dazu an, der Welt stets mit guter Miene zu begegnen. Sie sollten auf diese Weise Freude verbreiten – ein hehres Ziel, doch letztlich galt dadurch die Zurschaustellung mehr als die Verbindung zu den eigenen Gefühlen. Die Folge war, dass Darryl auf Menschen außerhalb der Fröhlichen Gemeinschaft des Lächelnden Gottes oft unaufrichtig wirkte, selbst wenn er wirklich etwas Positives empfand. Aber vielleicht kam er auch einfach nicht mit Menschen klar. Jedenfalls nicht im persönlichen Umgang. Schon früh in seinem Leben hatte er es sich angewöhnt, Mitteilungen zu schreiben, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hatte, damit sein Tonfall oder sein Gesichtsausdruck die Botschaft nicht beeinträchtigten.
Nilanjana hatte aufgeschaut, als sie seine Stimme hörte, und als sie dann die Reaktion des Baristas sah, nahm sie an, dass Darryl ihn angeschrien hatte. Baristas wurden in Night Vale öfter mal angeschrien. Das lag nicht etwa daran, dass die Baristas schlecht in ihrem Job oder unsympathische Menschen waren. Ganz im Gegenteil. In Night Vales Baristaviertel wohnten die talentiertesten Kaffeekocher und Aficionados. Auf der Galloway Road gab es einen Häuserblock mit gleich sechs Cafés. Für eine Wüstenstadt wurde heißer Kaffee hier echt ernst genommen.
Es lag an der allgemeinen Höflichkeit und dem Talent der Baristas, dass die Kunden sie so schlecht behandelten. Bei so vielen Cafés war der Wettbewerb einfach hart. Außerdem gehört es zum normalen menschlichen Verhalten, höfliche Menschen schlechter zu behandeln als unhöfliche. Einen Menschen, der sich höchstwahrscheinlich nicht wehren wird, kann man leichter unterdrücken. Unhöfliche Menschen dagegen lassen sich meist nichts gefallen, mit denen legt man sich lieber nicht an.
Nilanjana beobachtete, wie Darryl, den schon getroffen zu haben sie sich ziemlich sicher war, einen einzigen Tropfen Sahne in seinen Kaffee gab und dann sorgfältig umrührte. Für ein solches Ausmaß an Genauigkeit und Ordnung hatte sie durchaus etwas übrig. Zugleich nahm sie es ihm übel.
Sie war direkt vom Labor in die Wüste gefahren, doch die Stelle, wo Carlos das Rumpeln kürzlich nachgewiesen hatte, war von den Vertretern einer nebulösen, aber nichtsdestoweniger bedrohlichen Regierungsbehörde umlagert gewesen. Das war keine Überraschung. Wann immer in der Stadt etwas Ungewöhnliches geschah, tauchten Vertreter von allen möglichen Behörden auf, um die Angelegenheit akribisch zu untersuchen und zu dokumentieren. Doch bald würden sie fertig sein, und dann hätte Nilanjana den Ort für sich. In der Zwischenzeit war sie zum Spikey Hammer, einem ihrer Lieblingscafés, gefahren – um der Hitze zu entkommen und um an einem Tisch zu sitzen und nichts zu tun, damit sie nicht in ihrem Auto sitzen und nichts tun musste.
Sie hatte einen riesigen Kaffee bestellt, einen halben Liter Filterkaffee (Espresso dauerte zu lange), mit genau zwei Esslöffeln Milch und drei Päckchen Zucker. Manchmal tat sie auch einen halben Teelöffel von einem der Gewürze hinein, die in dem Café auslagen – Zimt, Muskat, Paprika, Metallspäne, usw. Sie wollte einfach nur heißes Koffein, und was immer das Zeug trinkbar machte, war eine willkommene Dreingabe. Sie brachte immer ihre eigenen Messlöffel mit, um sicherzugehen, dass ihre Gewohnheiten präzise eingehalten wurden.
Vor ihr, ordentlich aufgereiht auf dem Tisch, lagen die Notizen, die sie sich heute Morgen bei ihrem Treffen mit Carlos gemacht hatte. Sie hatte einen Stift in der Hand, hielt ihre Hand so, als würde sie schreiben, war dabei aber tief in Gedanken versunken und starrte ins Leere. Sie hatte Darryl beobachtet und sich darüber klarzuwerden versucht, ob sie ihn irgendwie kannte. Seine tiefe Verlegenheit gegenüber dem Barista einerseits, seine Freundlichkeit und sein offensichtlicher religiöser Eifer andererseits. Ihre Gedanken waren abgeschweift, als sie über die unzähligen Möglichkeiten nachsann, wie sie einen Fremden kennengelernt haben mochte. Sie hätte zu ihm hingehen und ihn fragen können, stattdessen starrte sie auf die leere Stelle, wo er sich gerade noch befunden hatte: eine Reihe von Flyern, die an einer Pinnwand aufgehängt waren.
»LERNE GITARRESPIELEN!«, stand auf einem, darunter in kleinerer Schrift: »Gemäß der Stadtverordnung 12.546B, erlassen am 1. August, wird das Verbrechen, nicht Gitarre spielen zu können, mit einer Geldstrafe von bis zu 12 000 Dollar und 3 Jahren Gefängnis geahndet. Lerne noch heute, Gitarre zu spielen!«
Auf einem anderen war ein Fahrrad abgebildet. »Haben Sie dieses Fahrrad gesehen? In diesem Universum, auf dieser Zeitachse hat es nie existiert. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, wenn Sie dieses Fahrrad gesehen haben, ich muss nach Hause.« Es waren kein Name und keine Kontaktinformation angegeben.
Wieder hörte sie Darryls Stimme. Er sprach gerade mit einem anderen Gast. Wieder machte er diese kreisförmige Bewegung mit der Faust und überreichte dann eine kleine Broschüre. Dabei lächelte er vielsagend. Sein Gegenüber lächelte nichtssagend. »Aufhören«, sagten die Umstehenden, hielten sich die Ohren zu und schüttelten den Kopf, bis Darryl zu reden aufhörte und sich entfernte.
Er ging auf verschiedene Leute im Café zu und fragte jedes Mal: »Haben Sie schon einmal vom Lächelnden Gott gehört?« Dann machte er die Sache mit der Faust. Einer erwiderte die Geste. Die beiden sahen einander an und summten eine Sekunde lang unisono einen tiefen Ton, dann brachen sie ab und setzten ihren Weg fort, als wären sie einander nie begegnet. Darryl sah auf seine Uhr und sprach dann einen weiteren Fremden an.
Die Uhr erinnerte Nilanjana daran, woher sie Darryl kannte. Vor etwa zwei Jahren hatten sie und ihre Kollegin Connie eine Studie über die Zeit durchgeführt und dafür Stand- und Armbanduhren untersucht, die sie überall in der Stadt in verschiedenen Geschäften gekauft hatten. In einem dieser Geschäfte war Darryl Verkäufer gewesen.
Er hatte ihr widersprochen, er hatte nicht gefunden, dass an der Zeit etwas seltsam sei. Sie hatte versucht, ihm die Wissenschaft dahinter zu erklären, hatte ihm Abbildungen und digitale Modelle gezeigt, um zu demonstrieren, dass jede Zeiteinheit eigentlich immer gleich lang währte und dass die Zeit in den meisten Teilen der Welt vorwärts verlief, sich in Night Vale aber ständig änderte – manchmal liefen Minuten rückwärts oder sprangen vor, und für jeden Menschen verging die Zeit anders. Manche Menschen blieben über Jahrhunderte hinweg neunzehn, ohne zu altern. Nilanjana und Connie hatten ein paar solcher Extremfälle studiert, Darryl aber war für logische Argumente unzugänglich. Er glaubte nur, was sich für ihn richtig anfühlte: Die Zeit war total normal.
Sie beugte sich wieder über ihre Notizen, dachte weiter über ihren Plan nach, das Rumpeln in der Wüste zu erforschen, doch immer wieder kamen ihr diese frustrierenden Diskussionen über die Zeit in den Sinn. Geistesabwesend griff sie nach ihren Unterlagen und stieß dabei gegen ihren Kaffee. Sie schrie leise auf.