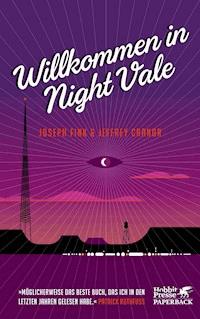
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Night Vale, ein Städtchen in der Wüste. Irgendwo in der Weite des amerikanischen Südwestens. Geister, Engel, Aliens oder ein Haus, das nachdenkt, gehören hier zum Alltag. Night Vale ist völlig anders als alle anderen Städte, die Sie kennen – und doch seltsam vertraut. Jackie Fierro betreibt schon lange das örtliche Pfandhaus in Night Vale. Eines Tages verpfändet ein Fremder einen Zettel, auf dem in Bleistift die zwei Worte »King City« geschrieben stehen. Jackie hat sofort ein merkwürdiges Gefühl. Kaum ist er in Richtung Wüste verschwunden, erinnert sich niemand an ihn – aber Jackie kann das Papier nicht mehr aus der Hand legen. Zusammen mit der alleinerziehenden Mutter eines jugendlichen Gestaltwandlers geht Jackie daran, das Rätsel von »King City« zu lösen. Ihr Weg führt die beiden in die Bibliothek von Night Vale, die allerdings noch kaum jemand wieder lebend verlassen hat ... »Möglicherweise das beste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.« Patrick Rothfuss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Willkommen in Night Vale
Joseph Fink & Jeffrey Cranor
Aus dem Englischen von Wieland Freund und Andrea Wandel
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Welcome to Night Vale«
© 2015 by Harper Collins, New York
Für die deutsche Ausgabe
© 2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung der Daten vom Originalverlag; Coverentwurf und Illustration: © Rob Wilson,
Datenkonvertierung von Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-96137-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10940-5
Dieses E-Book beruht auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
1
2
3
Die Stimme von Night Vale
4
5
6
Die Stimme von Night Vale
7
8
9
10
Die Stimme von Night Vale
11
12
13
14
15
Die Stimme von Night Vale
16
17
18
19
Die Stimme von Night Vale
20
21
22
23
24
25
Die Stimme von Night Vale
26
27
Die Stimme von Night Vale
28
29
30
31
Die Stimme von Night Vale
32
33
Die Stimme von Night Vale
34
35
36
Die Stimme von Night Vale
37
38
39
40
Die Stimme von Night Vale
41
42
43
44
45
46
Die Stimme von Night Vale
47
48
49
Die Stimme von Night Vale
50
Die Geschichte der Stadt Night Vale ist lang und verschlungen, sie reicht Tausende Jahre zurück, bis zur ersten Besiedlung der Wüste. Darum wird es im Folgenden nicht gehen.
Es genügt zu sagen, dass Night Vale eine Stadt wie viele Städte ist, mit einer Stadthalle und einer Bowlingbahn (der Desert-Flower-Bowlingbahn im Arcade Fun Complex) und einem Diner (dem Moonlite All-Nite Diner) und einem Supermarkt (Ralphs) und, selbstverständlich, einer lokalen Radiostation, die sendet, was wir wissen dürfen. Rundherum ist Wüste, flach und leer. Vielleicht ähnelt Night Vale Ihrer Stadt. Vielleicht ähnelt Night Vale Ihrer Stadt mehr als Sie zugeben wollen.
Es ist eine freundliche Wüstenstadt, die Sonne ist heiß hier, der Mond wunderschön, und seltsame Lichter ziehen über den Himmel, während wir alle so tun, als würden wir schlafen.
Willkommen in Night Vale.
1
Pfandhäuser in Night Vale funktionieren so:
Erstens braucht man einen Gegenstand zum Verpfänden.
Um daran zu kommen, muss man viel Zeit hinter sich gebracht, Jahre aufs Leben und Existieren verwendet haben, bis man schließlich restlos davon überzeugt ist, dass es einen selbst gibt und dass es Gegenstände gibt und dass es so etwas wie Eigentum gibt, wobei sich, so unwahrscheinlich das alles auch ist, diese absurden Überzeugungen derart zusammenfügen müssen, dass man am Ende der Eigentümer eines Gegenstandes ist.
Gute Arbeit. Fein gemacht.
Zweitens, wenn Sie schon einmal glauben, einen Gegenstand zu besitzen, müssen Sie an einen Punkt gelangen, an dem Sie Geld nötiger brauchen als diesen Gegenstand. Das ist der leichteste Schritt. Seien Sie einfach Eigentümer eines Gegenstandes und eines Körpers mit Bedürfnissen und warten Sie ab.
Das einzige Pfandhaus in der Stadt Night Vale wird von der sehr jungen Jackie Fierro betrieben. Es hat keinen Namen, aber wenn Sie es brauchen, werden Sie wissen, wo es ist. Dieses Wissen kommt ganz plötzlich, zum Beispiel wenn Sie unter der Dusche stehen. Sie brechen zusammen, von einer grellen glühenden Dunkelheit umgeben, finden sich auf Händen und Knien wieder, während Ihnen das warme Wasser über den Rücken rinnt, und Sie werden wissen, wo das Pfandhaus ist. Sie riechen Moder und Seife und kriegen eine Panikattacke bei dem Gedanken, wie einsam Sie sind. Wie immer beim Duschen.
Bevor Sie Jackie Ihr Pfand anbieten können, müssen Sie sich die Hände waschen, das ist auch der Grund, warum überall im Laden Schüsseln mit destilliertem Wasser stehen. Während des Händewaschens müssen Sie ein bisschen singen. Ohnehin sollten Sie beim Händewaschen immer singen. Schon aus hygienischen Gründen.
Wenn Sie sich ordnungsgemäß gesäubert haben, legen Sie das Pfand auf den Tresen und Jackie begutachtet es.
Jackie wird ihre Füße auf den Tresen legen und sich zurücklehnen.
»Elf Dollar«, wird sie sagen. Sie sagt jedes Mal »elf Dollar«. Sie werden nicht antworten. Sie sind eigentlich überflüssig bei diesem Vorgang. Sie sind eigentlich überflüssig.
»Nein, nein«, wird sie sagen und abwinken. Und dann wird sie den wahren Preis nennen. Meist ist es Geld. Manchmal etwas anderes. Manchmal sind es Träume, Erfahrungen, Visionen.
Dann werden Sie sterben, aber nur für eine kleine Weile.
Das Pfand wird ein Preisschild bekommen. Elf Dollar. Alles in diesem Laden kostet so viel, ganz egal, welchen Kredit sie darauf gewährt hat.
Wenn Sie nicht mehr tot sind, wird sie Ihnen einen Pfandschein geben, gegen den Sie Ihren Gegenstand auslösen oder den Sie jederzeit anschauen können, um sich an den Gegenstand zu erinnern. Die Erinnerung an den Gegenstand ist gratis.
Sie verlassen diese Geschichte jetzt. Sie waren nur ein Beispiel, und wahrscheinlich ist es ohnehin sicherer für Sie, nicht mehr in dieser Geschichte vorzukommen.
Jackie Fierro schaute aus dem Fenster auf den Parkplatz. Niemand, der kam. Sie würde bald schließen. Relativ gesehen, war sie immer kurz davor zu schließen und gleich zu öffnen.
Hinter dem Fenster befand sich der Parkplatz und dahinter die Wüste und dahinter der Himmel, meist leer, teils sternenbedeckt. Aus ihrem Blickwinkel waren all diese Schichten weit entfernt, von ihrem Platz am Tresen alle gleichermaßen unerreichbar.
Sie war gerade erst neunzehn geworden. Solange sie denken konnte, war sie gerade erst neunzehn geworden. Das Pfandhaus gehörte ihr schon lange, vielleicht seit Jahrzehnten. Uhren und Kalender funktionieren nicht in Night Vale. Die Zeit selbst funktioniert nicht.
In all den Jahren als gerade erst neunzehn Jahre alt gewordene Inhaberin des Pfandhauses verließ Jackie das Geschäft nur, wenn es geschlossen war, und dann ging sie auch bloß in ihre Wohnung, wo sie die Füße auf den Wohnzimmertisch legte und Lokalradio hörte und im Fernsehen die Lokalnachrichten sah.
Nach den Nachrichten zu urteilen, schien die Welt da draußen ein gefährlicher Ort zu sein. Ständig gab es eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes, die Night Vale bedrohte. Wilde Hunde. Eine gefühlsbegabte glühende Wolke, die Gedanken kontrollieren konnte (auch wenn die Glühwolke seit ihrer Wahl in den hiesigen Schulausschuss nicht mehr ganz so bedrohlich war). Alte Eichentüren, die in eine andersweltliche Wüste führten, wo die derzeitige Bürgermeisterin monatelang gefangen gehalten wurde. Es schien sicherer, keine Freunde oder Hobbys zu haben. Bei der Arbeit sitzen, mit gesenktem Kopf, seinen Job machen und dann zu Hause sitzen, ein Glas Orangensaft nach dem anderen, Radio an, sicher vor allem, was die Routine durchbrechen könnte.
Ihre Tage verbrachte sie still, inwendig leer oder in Gedanken. An manchen Tagen machte sie Inventur. An anderen staubte sie die Regale ab. Jeden Tag saß sie da und dachte nach. Sie versuchte an den Tag zu denken, an dem sie den Laden übernommen hatte. Es musste einen solchen Tag gegeben haben, aber die Einzelheiten waren ihr entfallen. Sie machte das hier seit Jahrzehnten. Sie war sehr jung. Beides stimmte.
Sie wusste, dass Neunzehnjährige zum Beispiel aufs College gehen. Sie wusste, dass andere Neunzehnjährige auf einem schwierigen Arbeitsmarkt keinen Job finden und bei ihren Eltern wohnen. Sie war froh, dass keines von beidem auf sie zutraf.
Sie verstand die Welt und ihren Platz darin. Sie verstand nichts. Die Welt und ihr Platz darin waren nichts und das verstand sie.
Weil es in Night Vale keine Arbeitszeiten gab, schloss sie ihren Laden nach Gefühl.
Wenn das Gefühl kam, dann kam es, und dann mussten die Türen verschlossen, aus den Angeln gehoben und gut versteckt werden.
Das Gefühl kam. Sie schwang die Füße vom Tresen. Ein annehmbarer Tag.
Old Woman Josie, die draußen beim Gebrauchtwagenhandel wohnte, war mit einer großen Anzahl billiger Plastikflamingos zu ihr gekommen. Sie hatte sie in einem großen Leinensack reingetragen und wie loses Wechselgeld auf den Tresen gekippt.
»Ich gebe diese Kleinen nicht um meinetwillen ab«, sagte Old Woman Josie in strengem, förmlichem Ton zu einer kahlen Wand rechts neben Jackie und machte mit der Hand beiläufig eine ausladende Geste, »sondern für die Zukunft.«
Die Hand noch immer ausgestreckt, hielt Josie inne. Jackie entschied, dass die Rede beendet war.
»Na schön, Mann, ich gebe dir elf Dollar dafür«, sagte sie. Old Woman Josie musterte mit zusammengekniffenen Augen die kahle Wand.
»Ah, okay, dann« – Jackie wurde weicher, stupste einen der Flamingos an und betrachtete seinen weichen Plastikbauch – »pass auf. Ich gebe dir eine Nacht ruhigen Schlafs.«
Old Woman Josie zuckte mit der Schulter.
»Einverstanden.«
Eine Nacht ruhigen Schlafs war ein wahnsinnig großzügiges Angebot. Die Flamingos waren nichts wert, aber es waren so viele, und Jackie konnte einfach nicht anders. Sie lehnte niemals ein Pfand ab.
»Pass auf, dass du sie nicht ungeschützt anfasst«, sagte Josie, sobald sie das Totsein hinter sich hatte.
Mit Hilfe eines Lappens legte Jackie die Flamingos einen nach dem anderen ins Regal, jeden von ihnen hatte sie mit einem handgeschriebenen Elf-Dollar-Preisschild versehen. Die meisten Pfande sollte man sowieso nicht anfassen, dachte Jackie.
»Mach’s gut, Liebes«, sagte Josie und nahm den Schein, den Jackie ausgefüllt hatte. »Komm irgendwann mal vorbei und sprich mit den Engeln. Sie haben nach dir gefragt.«
Die Engel lebten mit Old Woman Josie in einem kleinen Reihenhaus, dessen Reihe nicht mehr stand; es war gleichsam am Stadtrand stehen gelassen worden. Die Engel erledigten die Hausarbeit für sie, und Josie verdiente ein bisschen Geld, indem sie Sachen verkaufte, die die Engel berührt hatten. Über Engel wusste man nur wenig. Ein wenig wusste man.
Natürlich gibt es keine Engel. Es ist illegal, ihre Existenz zu erwägen oder ihnen einen Dollar zu geben, wenn sie das Geld für den Bus vergessen haben und durch die Gänge von Ralphs Supermarkt schweben und nach Wechselgeld fragen. Die große Ordnung der Engel ist ein törichter Traum und für Einwohner Night Vales ohnehin verbotenes Wissen. Alle Engel von Night Vale leben draußen bei Josie. Es gibt keine Engel in Night Vale.
Um die Mittagszeit hatte Jackie einen Wagen beliehen. Es war ein Mercedes, erst ein paar Jahre alt, den ein junger Mann in einem völlig verdreckten grauen Nadelstreifenanzug mit einiger Dringlichkeit anbot. Es war beeindruckend, wie er den Wagen auf den Tresen hievte, aber alles braucht seine Ordnung, und der Wagen musste auf den Tresen. Er wusch sich die Hände und sang. Das Wasser färbte sich braunrot.
Sie entschied sich, ihn von elf auf fünf Dollar runterzuhandeln, und er nahm lachend das Geld und den Schein.
»Das ist gar nicht lustig«, sagte er und lachte.
Und schließlich tauchte am späten Nachmittag eine Frau namens Diane Crayton auf – Jackies Gefühl nach war es kurz vor Ladenschluss.
»Kann ich helfen?«, fragte Jackie. Sie war sich nicht sicher, wieso sie das fragte, denn sonst grüßte sie Leute, die in den Laden traten, so gut wie nie.
Jackie wusste, wer Diane war. Sie organisierte Spendensammlungen für den Lehrer- und Elternverband. Manchmal kam Diane vorbei und verteilte Flyer, auf denen Dinge standen wie »Night Vale High School LEV-Spendenaktion! Verhelfen Sie Kindern zu der städtisch anerkannten Bildung, die sie verdienen. Ihre Unterstützung ist zwingend vorgeschrieben und freiwillig!«
Mit ihrem freundlichen Gesicht und in den bequemen Kleidern sah Diane in Jackies Augen wie eine Frau aus, die im LEV aktiv ist. Sie fand auch, dass Diane mit ihrem dezenten Make-up und ihrem seriösen Auftreten wie eine Kreditberaterin aussah. Sie würde wie eine Apothekerin aussehen, sollte sie jemals den üblichen weißen Kittel, die Gasmaske und die hippe Wathose tragen.
Für Jackie sah sie nach vielem aus. Am meisten sah sie wie jemand aus, der Raum- und Zeitgefühl verloren hatte.
Diane holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche. Ohne ihre aufrechte, distanzierte Haltung aufzugeben, weinte sie eine einzelne Träne in den Stoff.
»Ich würde das gerne anbieten«, sagte sie und sah Jackie zum ersten Mal an.
Jackie begutachtete das Taschentuch. Die Träne würde bald trocknen.
»Elf Dollar. Das ist mein Angebot«, sagte sie.
»Einverstanden«, sagte Diane. Ihre schlaff herabhängenden Arme hatte sie jetzt zu ihrer Handtasche hochgezogen.
Jackie nahm das tränenbenetzte Taschentuch und gab Diane ihren Schein und das Geld.
Nach ihrem kurzen Tod bedankte sich Diane und eilte aus dem Laden. Jackie brachte das Elf-Dollar-Preisschild an der Träne an und legte sie ins Regal.
Ein angenehmer Tag also. Jackie drehte das Schild an der Tür so, dass GESCHLOSSEN darauf stand, und berührte dabei mit der Hand das Fenster, hinterließ ihren Geist auf dem Glas, eine erhobene Hand, die »Stopp« oder »Komm her« oder »Hallo« oder »Hilfe« oder vielleicht auch nur »Ich bin hier. Zumindest diese Hand ist real« bedeutete.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit den Gegenständen auf dem Tresen zu, und als sie wieder aufsah, war der Mann da.
Er trug ein hellbraunes Jackett und einen Hirschlederkoffer. Er hatte normale menschliche Züge. Er hatte Arme und Beine. Kann sein, dass er Haare hatte, vielleicht trug er auch einen Hut. Alles ganz normal.
»Hallo«, sagte er. »Mein Name ist Everett.«
Jackie kreischte. Der Mann war völlig normal. Sie kreischte.
»Tut mir leid«, sagte er. »Haben Sie geschlossen?«
»Nein, ist schon in Ordnung, nein. Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, ich hoffe«, sagte er. Von irgendwoher ertönte ein Summen. Aus seinem Mund?
»Ich habe etwas, das ich gern verpfänden würde.«
»Ich …«, sagte sie und machte eine Bewegung mit der Hand, um alles anzudeuten, was sie vielleicht als Nächstes hätte sagen können. Er nickte ihrer Hand zu.
»Danke für Ihre Hilfe. Habe ich mich vorgestellt?«
»Nein.«
»Ah, ich bitte um Vergebung. Mein Name ist Emmett.«
Sie gaben sich die Hand. Auch nachdem er sie losgelassen hatte, zitterte ihre Hand noch.
»Ja, also«, sagte er. »Hier ist es.«
Er legte einen schmalen Streifen Papier auf den Tresen. Mit einem stumpfen, schmierenden Bleistift hatte jemand die Worte »KING CITY« darauf geschrieben. Die Handschrift war zitterig und der Stift war sehr fest aufgedrückt worden. Sie konnte nicht aufhören, auf den Zettel zu starren, obwohl sie keine Ahnung hatte, was eigentlich interessant an ihm war.
»Interessant«, sagte sie.
»Nein, nicht sehr«, sagte der Mann im hellbraunen Jackett.
Während der Mann sich die Hände wusch und leise sang, zwang Jackie sich dazu, die Füße auf den Tresen zu legen und sich zurückzulehnen, denn alles braucht seine Ordnung. Ein paarmal sah sie dem Mann ins Gesicht, stellte aber fest, dass sie vergessen hatte, wie er aussah, sobald sie nicht mehr hinguckte.
»Elf Dollar«, sagte sie. Der Mann summte weiter und leise Stimmen fielen ein, offensichtlich kamen sie aus dem Hirschlederkoffer.
»Woher kommt das?«, fragte sie. »Warum bieten Sie mir das an? Was soll ich damit?«
Ihre Stimme war schrill und rauh. Sie klang überhaupt nicht wie sie selbst.
Der Mann sang jetzt im Chor mit den Stimmen aus dem Koffer. Er schien ihre Fragen nicht zu hören.
»Nein, nein, tut mir leid«, sagte sie im vollen Bewusstsein, wie schlecht sie verhandelte, aber nicht in der Lage, damit aufzuhören. »Mein Fehler. Dreißig Dollar und eine Vorstellung davon, was Zeit ist.«
»Abgemacht«, sagte er und lächelte. War das ein Lächeln?
Sie gab ihm die dreißig Dollar und verriet ihm ihre ungefähre Vorstellung davon, was Zeit war.
»Das ist sehr interessant«, sagte er. »So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Im Allgemeinen denke ich gar nicht.«
Dann starb er. Normalerweise nutzte sie diese Zeit für den Papierkram, das Ausfüllen des Scheins. Sie tat nichts. Sie klammerte sich an den Streifen Papier in ihrer Hand. Er war nicht mehr tot.
»Tut mir leid. Ihr Schein.«
»Nicht nötig«, sagte er, möglicherweise mit einem Lächeln, nach wie vor. Sie konnte sein Gesicht nicht gut genug erkennen, um sicher zu sein.
»Nein, Ihr Schein. Alles braucht seine Ordnung.« Sie füllte einen Schein mit den Informationen aus, die auf jeden Schein gehörten. Einer Zufallszahl (12,739), der Lichtqualität zur Zeit der Transaktion (»gut«), einem allgemeinen Eindruck des Wetters draußen (»bedrohlich«), ihren derzeitigen Gedanken zur Zukunft (»bedrohlich, aber gut«) und der Skizze von einem Herz, so wie ein Herz ihrer Ansicht nach auszusehen hatte, und keinen dieser pulsierenden Klumpen aus Lehm und Stroh, die krebsartig in unserer Brust wuchern, wenn wir neun Jahre alt werden.
Er nahm den Schein, als sie ihn ihm zusteckte, dann bedankte er sich und wandte sich zum Aufbruch.
»Auf Wiedersehen«, sagte sie.
»KING CITY«, sagte der Papierstreifen.
»Auf Wiedersehen«, winkte der Mann und sagte nichts.
»Warten Sie«, sagte sie. »Sie haben mir gar nicht gesagt, wie Sie heißen.«
»Oh, Sie haben recht«, sagte er, die Hand an der Tür. »Mein Name ist Elliott. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben.«
Die Tür schwang auf und fiel zurück ins Schloss. Jackie hielt den Streifen Papier in der Hand. Zum ersten Mal in ihrem Leben, wie lang auch immer es schon währen mochte, war sie sich nicht sicher, was sie als Nächstes tun sollte. Sie hatte das Gefühl, dass ihre seit Jahrzehnten unveränderte Routine gestört worden war, dass etwas anders gelaufen war. Aber sie hatte zugleich keinen blassen Schimmer, warum sie dieses Gefühl hatte. Es war nur ein Streifen Papier, den sie fest umklammerte, mehr nicht.
Sie machte den Papierkram fertig; bei der Zeile »Verpfändet von« hielt sie inne. Sie konnte sich nicht an seinen Namen erinnern. Sie sah auf den Streifen Papier. »KING CITY«. Sie sah auf und aus dem Fenster, um noch einen Blick auf ihn zu werfen, bloß um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.
Vom Tresen aus konnte sie den Mann im hellbraunen Jackett sehen. Er lief in die Wüste hinaus. Am äußersten Rand des vom Parkplatz herüberschwappenden Lichtscheins konnte sie ihn so gerade noch erkennen. Seine Arme ruderten wild, sein Koffer schwang hin und her. Seine Beine schritten weit aus, schwere Wolken aus Sand stiegen hinter ihm auf, den Kopf hatte er in den Nacken geworfen, selbst von dort, wo sie saß, konnte sie sehen, dass ihm der Schweiß in den Nacken lief. Es war die Art Rennen, die vor etwas wegläuft und nicht irgendwohin. Dann ließ er den schwachen Lichtschein hinter sich und war verschwunden.
2
Da ist dieses Haus. Es ist nicht anders als andere Häuser. Also, stellen Sie sich ein Haus vor.
Andererseits ist es ganz anders als andere Häuser. Stellen Sie sich dieses Haus also noch einmal vor.
Abgesehen davon, dass es zugleich anders und nicht anders als andere Häuser ist, ist es genau wie alle anderen Häuser.
Hinsichtlich seiner Form ist es nicht anders als andere Häuser. Es hat eine hausähnliche Form. Würde man Leuten ein Bild von ihm zeigen, würden sie sagen, dass es sich definitiv um ein Haus handelt.
Andererseits ist es hinsichtlich seiner Form auch anders als andere Häuser. Es hat eine geringfügig andere Form. Es handelt sich definitiv um ein Haus, aber es ist noch etwas anderes, etwas Schönes an diesem Haus, würden die Leute vielleicht sagen, wenn man ihnen ein Bild zeigen würde. »Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Es ist mehr wie … wie … Genau genommen nervt es mich jetzt. Hören Sie bitte auf, mir dieses Bild zu zeigen. Bitte«, würden genau diese Leute wenig später flehen. »Es ist eine schreckliche, schreckliche Schönheit, die ich nicht verstehe. Bitte aufhören.«
»Okay«, würde der Mensch, der den Leuten das Bild zeigt, antworten, weil es sich möglicherweise um einen guten und mitfühlenden Menschen handelt. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob dieser Mensch gut und mitfühlend ist, wenn man nicht mehr von ihm weiß, als dass er anderen Menschen Bilder von Häusern zeigt, aber es macht keinen Sinn, durchs Leben zu gehen und schlecht von Menschen zu denken, die man nicht kennt.
Es kann als sicher gelten, dass das Haus ein abgeschlossenes Gebäude ist, das von Menschen erbaut wurde und Menschen gehört.
Es wäre verrückt anzunehmen, das Haus habe eine Persönlichkeit, eine Seele. Warum sollte das jemand annehmen? Aber es ist wahr. Das Haus hat eine Persönlichkeit, eine Seele. Aber es war verrückt, das anzunehmen. Tun Sie so was niemals.
Eine andere Sache, die dieses Haus von anderen Häusern unterscheidet, ist, dass es denkt. Die meisten Häuser denken nicht. Dieses Haus hat Gedanken. Diese Gedanken sind auf einem Bild nicht zu sehen. So wenig wie die Gedanken eines Menschen. Dennoch finden sie in die Welt. Meist durch Träume. Ein Mensch schläft, und plötzlich hat das Haus einen Gedanken: Maulwurfsgrau löst keine Emotionen aus. Es ist eine praktische und nichtssagende Farbe. Niemand bricht darüber in Tränen aus. Oder ein anderer Gedanke: Oh, mein Gott – Zeit! Was ist das überhaupt, Zeit? Und der Mensch, der schläft, hat vielleicht gerade genau denselben Gedanken.
Derlei Gedanken können auch unter der Dusche geteilt werden. Schlechtgelaunte Gedanken. Wütende Gedanken. Gedanken, die ungedacht bleiben sollten, bevor man mit der Öffentlichkeit interagiert. Gedanken wie [tiefes gutturales Grollen] oder [Knöchelknacken, geballte Faust, zusammengebissene Zähne, Augen, die nichts mehr sehen, Wasser, das über ein starres Gesicht rinnt].
Gedanken sind überall. Manchmal sind sie ganz prosaisch und zweckmäßig. An der Trockenbauwand hinter dem Kopfende des Bettes knabbert ein Nagetier, könnte so ein Gedanke sein.
Eine andere Sache, die dieses Haus nicht von anderen Häusern unterscheidet, ist, dass es Menschen beherbergt. Es beherbergt eine Frau, zum Beispiel.
Stellen Sie sich eine Frau vor.
Gut gemacht.
Es beherbergt außerdem einen Jungen, noch ist er nicht ganz ein Mann. Er ist fünfzehn. Sie wissen, wie das ist.
Stellen Sie sich einen fünfzehnjährigen Jungen vor.
Nö. Das war total daneben. Versuchen Sie es noch einmal.
Nein.
Nein.
Okay, aufhören.
Er ist groß. Er ist mager, hat kurzes Haar und lange Zähne, die er absichtlich verbirgt, wenn er lächelt. Er lächelt mehr als er denkt.
Stellen Sie sich einen fünfzehnjährigen Jungen vor.
Nein. Noch mal.
Nein. Nicht mal annähernd.
Er hat Finger, die sich bewegen, als hätten sie keine Knochen. Er hat Augen, die sich bewegen, als hätte er keine Geduld. Er hat eine Zunge, deren Form sich täglich ändert. Er hat ein Gesicht, dessen Form sich täglich ändert. Er hat ein Knochengerüst und Haut und Haare, die sich täglich ändern. Er scheint anders auszusehen als in Ihrer Erinnerung. Er ist immer anders als zuvor.
Stellen Sie sich ihn vor.
Gut. Das war gar nicht übel.
Sein Name ist Josh Crayton.
Ihr Name ist Diane Crayton. Sie ist Joshs Mutter. Sie sieht sich selbst in Josh.
Josh sieht nach vielem aus. Ständig ändert er seine Gestalt. So gesehen ist er anders als die meisten Jungen seines Alters. Er glaubt, mehrere Dinge gleichzeitig zu sein. Viele von ihnen stehen im Widerspruch. So gesehen ist er wie die meisten Jungen seines Alters.
Manchmal nimmt Josh die Gestalt einer Krummschnabel-Spottdrossel an oder die eines Kängurus oder die eines viktorianischen Kleiderschranks. Manchmal verschmilzt er seine Gestalten: Fischkopf mit Elfenbeinhauern und Schmetterlingsflügeln.
»Du hast dich unheimlich verändert«, sagen die Leute oft zu ihm. Sie sagen das zu allen Teenagern, aber bei Josh meinen sie es besonders ernst. Josh weiß nicht mehr, wie er ausgesehen hat, als ihn egal wer zum letzten Mal sah. Wie die meisten Teenager war er immer genau das, was er ist, bis er es nie gewesen ist.
Es gab da mal ein Mädchen, das Josh nur mochte, wenn er zweibeinig war. Josh mag nicht immer zweibeinig sein und fand das enttäuschend. Es gab da mal einen Jungen, der Josh mochte, wenn er ein niedliches Tier war. Josh ist gern ein niedliches Tier, doch seine Vorstellung von niedlich unterschied sich von der des Jungen. Das war eine weitere Enttäuschung für Josh, aber auch für den Jungen, der riesige Tausendfüßler gar nicht niedlich fand.
Diane liebte Josh in all seinen Erscheinungsformen. Sie selbst wechselte ihre Gestalt nie, allenfalls zeigte sie jene graduellen Veränderungen, die das Alter mit sich bringt.
Manchmal versuchte Josh Diane zu foppen, indem er die Gestalt eines Alligators, einer Traube von Fledermäusen oder eines Hausbrands annahm.
Diane wusste, dass sie auf der Hut sein musste, für den Fall, dass es sich wirklich um ein gefährliches Reptil oder einen Schwarm rabiater geflügelter Säuger oder ein Haus in Flammen handelte. Sobald sie die Lage erkannt hatte, beruhigte sie sich und liebte ihn als das, was er war und wie er aussah. Ganz egal, wie er aussah. Schließlich war sie die Mutter eines Teenagers.
»Hör auf zu kreischen und in die Schränke zu flattern«, sagte sie beispielsweise. Grenzen zu setzen, war wichtig.
Manchmal erschien Josh in Menschengestalt. Wenn er das tat, war er klein, pausbäckig, pummelig und trug eine Brille.
»So siehst du dich selbst, Josh?«, fragte Diane einmal.
»Manchmal«, antwortete Josh.
Diane bedrängte ihn nicht weiter. Seine knappen Antworten gaben ihr das Gefühl, dass er nicht reden wollte.
Josh wünschte sich, seine Mutter würde mehr mit ihm reden. Seine knappen Antworten waren Zeichen seiner sozialen Unsicherheit.
»Was?«, fragte Josh an einem Dienstagabend. Er hatte eine glatte, violette Haut, ein spitzes Kinn, krumme, hagere Schultern.
Der Fernseher lief nicht. Ein Schulbuch lag aufgeschlagen da, aber niemand las darin. Ein Telefon leuchtete, ein spitzer Daumen hämmerte auf die Tastatur.
»Lass uns reden«, sagte Diane an der zersplitterten Tür. Sie wollte die Tür nicht aufstoßen. Es war nicht ihr Zimmer. Sie gab sich große Mühe. An diesem Tag hatte sie Jackie eine Träne verpfändet. Es hatte sich gut angefühlt, dass jemand etwas von ihr so ausdrücklich wertschätzte. Auch waren die Ausgaben in diesem Monat höher als sonst gewesen, und sie hatte das Geld gebraucht. Schließlich war sie alleinerziehend.
»Über was?«
»Irgendwas.«
»Ich lerne.«
»Du lernst? Ich will dich nicht beim Lernen stören.«
»Pling«, fügte das Telefon hinzu.
»Wenn du lernst, verschwinde ich«, sagte sie und tat so, als würde sie das Telefon nicht hören.
»Was?«, fragte Josh an einem anderen Abend. Es war ein Dienstag, oder es war kein Dienstag. Seine Haut war hellorange. Oder sie war tief dunkelblau. Oder direkt unter seinen Augen plusterten sich dicke Borsten. Oder seine Augen waren wegen der Schatten, die die schafsähnlichen Hörner warfen, überhaupt nicht zu sehen. So war es an den meisten Abenden. Das war das Einerlei der Elternschaft.
Der Fernseher lief nicht. Ein Schulbuch lag aufgeschlagen da, aber niemand las darin. Ein Telefon leuchtete.
»Wie geht es dir?«, fragte Diane manchmal.
Manchmal fragte sie: »Wie läuft’s?«
Manchmal sagte sie: »Wollte nur mal nach dir sehen.«
»Josh«, sagte Diane manchmal, von der Tür aus, am Abend. Manchmal klopfte sie. »Josh«, wiederholte sie manchmal nach einigem Schweigen. »Josh«, wiederholte sie manchmal ohne weiteres Schweigen.
»Punkt, Punkt, Punkt«, antwortete Josh manchmal. Nicht laut, sondern wie in der Sprechblase eines Comics. Er stellte sich Dinge vor, die er noch sagen könnte, wusste aber nicht, wie.
Im Großen und Ganzen mag ich keinen Taft, dachte das Haus, und Diane teilte diesen Gedanken.
»Josh«, sagte Diane, die auf dem Beifahrersitz ihres burgunderroten Ford Kombi saß.
»Was?«, fragte die Wolfsspinne auf dem Fahrersitz.
»Wenn du Autofahren lernen willst, musst du mit den Füßen an die Pedale kommen.«
Die Wolfsspinne streckte sich, zwei ihrer mittleren Beine wuchsen bis zum Bodenblech und berührten leicht die Pedale.
»Und sieh nach vorn auf die Straße, Josh.«
Auf dem Körper der Spinne saß ein menschlicher Kopf mit dem Gesicht und dem Haar eines fünfzehnjährigen Jungen, der Unterleib ging jetzt in einen primatenähnlichen Torso über. Die Beine blieben spindeldürr und lang. Er dachte, es sähe cool aus, wenn er als Spinne Auto fuhr. Obwohl er den Grund dafür nicht hätte nennen können, war es ihm wichtig, beim Fahren cool auszusehen.
Diane sah zu ihm hinüber. Von ein paar Federn auf seinem Rücken und den Schultern abgesehen, hatte Josh eine völlig menschliche Gestalt. Diane sah sie aus dem Hemdsärmel ragen, beschloss aber, dass nicht jeder Streit das Streiten lohnt.
»Menschlicher Körper beim Autofahren.«
Diane sah sich selbst in Josh. Sie war auch mal ein Teenager gewesen. Sie hatte ein Gefühl für Gefühle. Sie fühlte mit. Sie wusste nicht, womit, aber sie fühlte mit.
Josh schnaubte, aber Diane erinnerte ihn daran, dass er sich an ihre Regeln halten musste, wenn er Auto fahren wollte, wozu gehörte, darauf zu verzichten, eine knapp zehn Zentimeter große Wolfsspinne zu sein. Diane erinnerte ihn an sein Fahrrad und dass es ein überaus vernünftiges Transportmittel sei.
Dianes Aufgabe, ihrem Sohn das Fahren beizubringen, erforderte zusätzliche Geduld, nicht nur, weil Josh darauf bestand, seine körperliche Identität ständig neu zu bewerten, sondern auch, weil das Auto ein Schaltgetriebe hatte.
Stellen Sie sich vor, einem fünfzehnjährigen Jungen Autofahren in einem Schaltwagen beizubringen. Zuerst musst du die Kupplung treten. Dann musst du einem der beiden Getränkehalter ein Geheimnis zuflüstern. Diane fiel das leicht, weil sie weder eine gesellige noch eine in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit war und von daher noch die banalste Tatsache ihres Lebens ein Geheimnis war. In Joshs Fall war das schwer, da noch die banalste Tatsache im Leben eines Teenagers ein Geheimnis ist, das er nicht vor seinen Eltern preisgeben will.
Dann, nach dem Kuppeln und dem Geheimnis, muss der Fahrer den Schaltknüppel, einen ins Armaturenbrett gequetschten zersplitterten Holzpflock, packen und schütteln, bis etwas – egal was – passiert, und dabei gleichzeitig eine Reihe von Geheimzahlen in eine am Lenkrad angebrachte Tastatur tippen. Und all das, während sonnenbebrillte Vertreter einer nebulösen, aber nichtsdestoweniger bedrohlichen staatlichen Behörde in einer Limousine mit sehr dunkel getönten Scheiben auf der anderen Straßenseite Fotos machen (und ab und zu winken). Für einen Fahranfänger ist das ein ziemlicher Druck.
Josh war oft genervt von seiner Mutter. Das hatte damit zu tun, dass Diane nicht die beste Lehrerin war. Es hatte auch damit zu tun, dass Josh nicht der beste Schüler war. Es gab noch weitere Gründe.
»Du musst mir zuhören, Josh«, sagte Diane immer.
»Ich hab’s kapiert. Ich hab’s kapiert, okay?«, sagte Josh immer und kapierte gar nichts.
Diane stritt gern mit Josh über das Autofahren, schließlich redeten sie dabei miteinander, hatten eine Beziehung. Es war nicht leicht, die Mutter eines Teenagers zu sein. Josh genoss die Zeit ebenfalls, nur nicht so bewusst. Oberflächlich ging es ihm dreckig. Er wollte einfach nur Autofahren und nicht all die Dinge tun, die dafür nötig sind, zum Beispiel ein Auto haben und fahren lernen.
Und manchmal sagte er, weil er wusste, dass es sie verletzte: »Warum kann mein Dad nicht kommen und es mir beibringen?« Danach fühlte er sich mies, weil er sie verletzt hatte. Diane fühlte sich danach auch mies. Sie saßen dann beide im Auto und fühlten sich mies.
»Du machst das gut heute«, sagte Diane einmal zu Josh, ohne besonderen Grund, nur um die Stille zu überbrücken.
Sonst mache ich es also nie gut, dachte Josh, weil er den Zusammenhang, in dem ihre Bemerkung gefallen war, nicht verstand.
»Danke«, sagte Josh laut, um die Stille gnädig zu überbrücken.
»An vielen Dingen musst du aber noch arbeiten«, sagte Diane nicht. »Es tut mir leid, dass dein Vater nicht hier ist«, sagte sie auch nicht. »Aber ich gebe mir so große Mühe, Josh. Gebe ich, gebe ich, gebe ich«, sagte sie nicht. In Selbstbeherrschung war sie gut.
Ich bin ein echt guter Fahrer, dachte Josh oft, sogar wenn er zu nah an die Leitplanken kam, mit dem Reifen über den Bordstein holperte und vermummten Gestalten die Vorfahrt nahm, was für das gesamte Stadtgebiet den vorgeschriebenen stundenlangen Stillstand zur Folge hatte. Die Verkehrsregeln von Night Vale sind byzantinisch, zivile Fahrer werden nur bei Bedarf über sie in Kenntnis gesetzt.
Ihre Fahrstunden endeten oft mit einem »Gut gemacht« und einem »Danke« und einer kurzen Pause und einem Rückzug in getrennte, stille Zimmer. Später würde sie klopfen und »Josh« sagen, und Josh würde antworten oder auch nicht antworten.
Diane tat weh. Sie war sich nicht bewusst, dass sie wehtat, aber es war so. So oft sagte sie aus so vielen verschiedenen Gründen »Josh«.
Josh liebte seine Mutter, aber er wusste nicht, warum.
Diane liebte ihren Sohn, und es war ihr egal, warum.
Noch ein Grund, warum dieses Haus sich von anderen Häusern unterscheidet, ist, dass heimlich eine anonyme Frau in ihm wohnt, aber das ist für diese Geschichte nicht wichtig.
3
»KING CITY« stand auf dem Papier.
Jackie hatte in ihrem ganzen Leben noch nie Angst gehabt. Sie kannte Vorsicht und Unbehagen und Trauer und Freude, Gefühle, die der Angst allesamt ähnlich sind. Aber Angst hatte sie nie gespürt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























