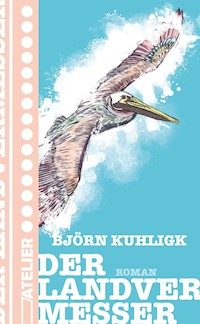
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Müller ist vierundvierzig, ohne Selbstvertrauen, neurotisch und voller Ängste. Sein Job, seine Affäre, seine Wohnung, einfach alles in seinem Leben ist halbherzig und glanzlos. Die Nachricht vom Tod seines älteren Bruders Thomas, der seit vielen Jahren in Kolumbien und ohne Kontakt zu Müller lebte, trifft ihn überraschend hart. Er löst sich aus seinem trägen Alltag, nimmt seinen Jahresurlaub und steigt in den Flieger nach Cartagena. In der karibischen Hafenstadt erwarten ihn Thomas' attraktive Freundin Laura, ein halbes Jugendstilhaus, ein kleines Vermögen und die große Frage, wer sein Bruder eigentlich war. Nach und nach gleitet er in das Leben, das Thomas zurückgelassen hat. Gibt es für Müller in Kolumbien eine Chance auf mehr Herz und Glanz? »Der Landvermesser« ist ein atmosphärischer Roman über Entfremdung und Identität, Entfernung und Nähe und eine brillante Beschreibung zweier Landschaften, die Kolumbiens und die seiner Hauptfigur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BJÖRN KUHLIGK
DER LANDVERMESSER
ROMAN
Für Christine
Inhalt
Der Landvermesser
Über den Autor
Danke
Geliebt sei, wer sich hinsetzt.
César Vallejo
Müller parkte das Auto in Schaprode auf dem Mehrtagesparkplatz, nahm den kleinen Rucksack, stellte ihn neben den Rollkoffer und zog das Brillenetui aus der Vordertasche des Rucksacks. Er strich sich die Haare nach hinten, obwohl sie nicht lang waren, und setzte die Sonnenbrille auf. Da lag die Insel. Für zwei zusätzliche Tage, lächerlich. Mit seinen Überstunden hätte er allen seinen Kollegen einen freien Tag spendieren können. Er hatte sich durchgesetzt, zwei Gespräche in der Personalabteilung waren notwendig gewesen, um diesen Kurzurlaub bewilligt zu bekommen. Er sah auf den breiten Strich in der Ferne, der zu schweben schien. Die Mittagssonne stand im Zenit. Müller warf keinen Schatten. Er passierte die Gaststätte »Zum Fährmann«, zündete sich eine Zigarette an, zog das Smartphone aus der Hosentasche und rief seine Nachrichten ab. Zwei Rechnungen, eine Geburtstagseinladung des Kollegen, mit dem er mittwochs immer Mittagspause machte, und eine E-Mail von einer Laura Velazquez mit dem Betreff »Thomas«. Er öffnete die Nachricht und las, dass sein Bruder gestorben war, dass er bitte nach Cartagena kommen sollte, um sich zu verabschieden und das Erbe zu regeln. Er schaltete das Gerät aus. Wartete kurz, schaltete es wieder ein und las die Nachricht erneut. Er beobachtete, wie erst ein großer grüner Traktor auf die Fähre manövrierte und dann die Urlauber mit ihren Rollkoffern hinaufliefen. Er sah der Fähre eine Weile nach, verfolgte mit dem Blick die Wellen, die das aufschäumende Wasser warf. Dann senkte er den Kopf und starrte auf den Boden, auf die Struktur der aneinandergefügten hellgrauen Steinflächen, auf die Fugen. Als er es bemerkte, hob er den Blick wieder. Seine Zigarette war runtergebrannt. Er ließ sie fallen. Müller war leer. Große Brüder dürfen nicht sterben. Er ging zwei Schritte vor. Wieder zwei. Blieb stehen. Dann öffnete er den Koffer und zog sich einen Kapuzenpullover an. Er lief am Hafenbecken entlang, an dem Imbiss »Blauer Affe« vorbei. Große Brüder dürfen nicht sterben. Große Brüder müssen bleiben. Sie müssen länger leben. Egal wo. Für immer. Er zog sich die Kapuze des Pullovers ins Gesicht, holte tief Luft, hustete und kotzte ins Wasser. Dann ging er zu seinem Auto und fuhr zurück nach Berlin.
In der Personalabteilung, die er nach seiner Rückkehr von der Ostsee aufsuchte, bat er um den kompletten Jahresurlaub, immerhin dreißig Tage, den er erst im Spätsommer hatte nehmen wollen. Ab morgen, ein Todesfall in der Familie, er müsse dringend ins Ausland. Sie zuckten mit den Schultern, eine Unmöglichkeit, zwei Tage seien laut Manteltarifvertrag bei einem Todesfall in der Familie zugesichert, mit einem weiteren Tag könnten sie ihm entgegenkommen. Er schüttelte stumm den Kopf, sagte mehrmals leise »bitte«, und als auch das nicht weiterhalf und Müller spürte, dass er vor einer Wand stand, zitterte er erst und begann dann in seiner Verzweiflung herzzerreißend zu heulen, worauf eine der beiden Frauen Taschentücher reichte. Die andere, die unter einem Poster des Matterhorns saß, sagte eilig, das wäre ja wohl was, wenn man da keine Lösung fände, nicht behilflich sein könnte. Nachdem sie den kompletten Jahresurlaub mit sofortigem Antritt bescheinigt hatten, sprachen sie ihm tröstend ihr Beileid aus und wünschten Kraft.
Bis er den Wohnblock erreichtte, wuchtete Müller seine Gedanken hin und her. Die Wohnung wirkte dunkler als sonst, vielleicht war eine der beiden Deckenleuchten im Flur durchgebrannt. Das Sofa sah aus wie der Schatten eines Sofas. Daneben lehnte ein gerahmter Druck von Paul Klee an der Wand. Schon seit zwei Jahren lehnte der dort. Es hatte ein paar Tage gegeben, da hatten ein Hammer und eine Schachtel mit Nägeln davor gelegen. Schließlich hatte er aber beides wieder in die Werkzeugkiste geräumt. Er buchte, ohne zu zögern, die Flüge. Erst als die Buchungsbestätigung per E-Mail kam, stutzte er, dass er einen Platz in der Businessclass gewählt hatte und einen Rückflug an seinem vorletzten Urlaubstag, sodass er vier Wochen in Kolumbien sein würde. Auf dem Hinflug würde er zweimal umsteigen müssen, in Madrid und in Bogotá, es würde zweiundzwanzig Stunden dauern. Unglaublich, dachte er für einen Moment, wie viel Geld er für die Flüge bezahlt hatte! Sein hysterisches Lachen prallte gegen die Wände. Müller klingelte nach einigen Überlegungen und Überwindungen bei seiner Nachbarin Frau Klein und bat sie, seine Pflanzen zu gießen, solange er wegen eines beruflichen Aufenthaltes im Ausland sei. Frau Klein, eine kleine, hagere Frau um die sechzig, lächelte und sagte, dass sie das natürlich machen könne. In der Nacht schlief er kaum. Er wälzte sich im Bett herum. Nachdem er endlich eingeschlafen war und ihn dann ein Albtraum geweckt hatte, stellte er sich gegen drei Uhr nachts auf den Balkon. Sein Pyjamaoberteil war nass vor Schweiß. Er befühlte seine Fingerkuppen, aus denen im Traum Teufelsfratzen herausgewachsen waren, die er fasziniert betrachtet hatte, bis er die Schmerzen spürte, die ihn schreien ließen. Die Wohnungen gegenüber waren dunkel, der Hof war dunkel, der Himmel schwarz. Er brauchte eine Weile, um sich in der Wirklichkeit zu orientieren und sicher zu sein, nicht in den Traum zurückzukehren, wenn er wieder einschlief. Dann legte er sich ins Bett, wickelte seine Beine trotz der Wärme in die Decke und strich langsam und selbstvergessen über seinen Bauch.
Am Morgen brachte Sabine ihn zum Flughafen. Er hatte sie darum gebeten, was er zuvor noch nie getan hatte. Müller sah bleich und müde aus und zitterte leicht vor Aufregung. Sie brachte ihn zum Check-in, umarmte ihn und küsste ihn auf die Wange. »Du kannst immer anrufen. Ich bin da!«, sagte sie. Kurz griff sie nach seinen Händen. Müller bewegte sich nicht und nickte nur leicht. Dann ging er auf die Sicherheitskontrolle zu.
Vor dem Gate setzte er sich und suchte in seinem Smartphone nach alten Fotos von seinem Bruder, fand aber keine. Er konnte sich nicht mal daran erinnern, ihn überhaupt mit diesem Gerät fotografiert zu haben. Den Anruf von Sabine drückte er weg. Müller war dankbar, dass sie ihn von zu Hause abgeholt und zum Flughafen gebracht hatte, aber jetzt war sie ihm zu nah, zu viel.
Sie hatten sich auf der Arbeit kennengelernt, eine Freundschaft für Müller, und doch eine auf Abstand gehaltene, die in der Schwebe blieb. Sie hatte ihn, als sie an einem Sonntag durch den Grunewald spaziert waren, gefragt, ob er in sie verliebt sei. Er hatte abweisend reagiert, wie sie daraufkomme, nein, alles klar für ihn, sie sei seine beste Freundin und ob sie denn nicht denke, dass es enge Freundschaften zwischen Frauen und Männern gebe? Wahrscheinlich hätte Sabine ihn gerne geboxt und gerufen, nein, gibt es nicht, wo lebst du denn? Doch sie traute sich nicht, da sie wohl Angst hatte, ihn zu verlieren. Er kam allein klar, er wollte keine Beziehung, er wollte nichts, was ihn in irgendeiner Form hinterfragen könnte, ihn und sein Leben, mit dem er zufrieden war. Sabine kam hin und wieder vorbei. Sie kochten gemeinsam, redeten über das Büro und tratschten über ihre Kollegen. Manchmal schliefen sie miteinander. Für Müller eine Triebabfuhr, eine Bestätigung. Es hätte auch jemand anders sein können, es war nicht wichtig.
Müllers mittelgroßer Körper hatte eine athletische Grundkonstitution, doch in den letzten Monaten war ihm ein Bauch gewachsen, den er erst wie einen Fremdkörper betrachtet hatte, etwas, das unmöglich zu ihm gehören konnte, etwas, das demnächst wieder verschwunden sein würde, und den er, als er weder kleiner wurde noch verschwand, zwar nicht mochte, aber letztendlich akzeptierte und vertraut berührte. Seine Augenringe waren dunkler und breiter geworden, und jede Stunde, die er zu wenig schlief, schien sich unterhalb seiner Augen einzugravieren. Die Wochenenden nutzte er nicht mehr, um so viel wie möglich zu erleben. Er schlief früh ein und wachte früh auf. Seine Freunde traf er nicht mehr oft. Laute Musik wurde schnell anstrengend, ein paar seiner Schamhaare waren grau geworden. Wenn er sich morgens länger im Spiegel ansah, sah er in ein Gesicht, das etwas erlebt hatte. Kein Gesicht, mit dem man einen Sportverein gründen möchte. Nein, er würde nicht mehr anfangen, Eishockey zu spielen oder Klavier oder Tango zu lernen. Er arbeitete in einem mittelgroßen Unternehmen, das Daten für medizinische Versorger sammelte, ein Schreibtischjob in einem Großraumbüro, gut bezahlt mit Weihnachtsgeld, und Freitag ab eins machte jeder seins. Er hatte sich eingerichtet. Flirten war etwas, das er nicht mehr tat. Es war egal. An seiner linken Wange zog sich eine längliche Narbe in der Form von Sylt entlang, die er sich an seinem achtzehnten Geburtstag geholt hatte, als er besoffen und mit schulterlangen Haaren mit seinen Freunden beschloss, den Bürgersteig zu meiden, überhaupt den Boden nicht mehr zu berühren, und stattdessen über die geparkten Autos zu laufen. Auf der Frontscheibe eines Opel Kadetts war er ausgerutscht und mit dem Kopf auf der Höhe der linken Blinkleuchte aufgeschlagen. Seine Haare trug er inzwischen mittelkurz, sie waren noch immer haselnussbraun. Wurde Müller wütend, leuchtete seine Narbe knallrot. Er war noch nie auf Sylt gewesen.
Müller betrat als erster Passagier das Flugzeug und setzte sich in die zweite Reihe der ersten Klasse. Er drückte den Anruf von Sabine weg. Kurz darauf schrieb sie eine Nachricht, dass er sich bitte melden solle, wenn er in Madrid angekommen sei. Er schaltete das Handy aus. Kurz nachdem das Flugzeug abgehoben hatte, sah er den Alexanderplatz und den Fernsehturm, der wie eine Nadel in der Stadt steckte, das Tempelhofer Feld und dahinter im Dunst den Häuserkranz, in dem er wohnte. Die Maschine zog nach rechts weg. Ich bin jetzt allein, dachte Müller und schluckte trocken. Er blätterte in zwei Tageszeitungen. »Coffee or tea, Sir?« Die Stewardess lächelte ihn an, ein Lächeln, das ihre Augen nicht begleiteten. Eine Fratze in Uniform. Er sah auf die beiden Thermoskannen und spürte eine Müdigkeit, die ihn zu überrennen schien. Er lehnte dankend ab und hüllte sich in eine Decke. Dann blickte er aus dem Fenster, sah auf die Wolken hinab, auf die Krümmung der Erde, auf das diffuse Licht zwischen dem Planeten und der Atmosphäre, und schlief ein. Nach einer Weile zuckte er zusammen. Ein stechender Schmerz zog durch seinen Rücken. Er fluchte leise. »Wissen Sie was, Herr Müller?«, hatte die junge Physiotherapeutin gesagt, die er vor Monaten nach dem zweiten Hexenschuss aufgesucht hatte. »Ein gequälter Rücken muss nicht sein!« Sie hatte ihn angestrahlt, als hätte sie soeben den einen Lösungssatz gesagt, der Müller helfen würde, fortan ein besseres Leben zu führen. Arme und Beine im rechten Winkel, Tisch- und Stuhlhöhe werden an den Körper angepasst, volle Ausnutzung der Sitzfläche und aufrechtes Sitzen. »Und: Atmen Sie tief, ja, genau, atmen Sie tief in ihre Mitte, gut, und jetzt versuchen Sie bitte, bis in die Füße zu atmen! Der ganze Körper soll sich weiten!«
Er ging auf Toilette, und als er vor der Schüssel stand, dachte er: Verrückt, ich fliege nach Kolumbien, ich bin in zehn Kilometern Höhe und pinkle Richtung Erde.
In Madrid lief er zu den Intercontinental-Flügen, setzte sich in der Nähe des Abflug-Gates in ein Restaurant und bestellte ein kleines Bier. Dachte er an Thomas oder Sabine, bekam er leichte Kopfschmerzen, deshalb bemühte er sich, die Gedanken sofort zu verdrängen und an gar nichts zu denken, was Müller ziemlich gut beherrschte. Abseits der Warteschlange lief er hektisch auf und ab. Er ging davon aus, dass er bei Langstreckenflügen eine Thrombose bekommen könnte, und so einen zum Herzen wandernden Knoten wollte er nicht in seinem Körper haben. Er wollte leben, natürlich, unbedingt! Die Kontrolle an Leute abzugeben, die er weder kannte noch von deren Fähigkeiten er wusste, gehörte nicht zu Müllers Begabungen. Und wie sollte er Vertrauen in eine Maschine haben, in ein zusammengeschweißtes Stück Metall, angetrieben von Technik. Selbst die besten Hochleistungsrechner, an denen er arbeitete, machten mal schlapp und mussten ausgewechselt werden. Er lief auf und ab.
Müller hatte einen Grad von Müdigkeit und Erschöpfung erreicht, in dem selbst das gedämpfte klackernde Geräusch, das die kleine Uhr mit dem dünnen goldenen Gliederarmband am Handgelenk der Stewardess verursachte, zu einem Lärm wurde, den er kaum ertrug. Die Minuten fransten aus. Er hörte das Brummen der Triebwerke und wurde in den Sitz gedrückt, als die Maschine beschleunigte und abhob.
Als er mit Sabine zu der Station des Flughafenbusses gehastet war, hatte er Svenja auf dem U-Bahnhof gesehen. Er hatte sie an ihrer Körperhaltung erkannt, wie sie kerzengerade, mit leicht nach rechts abgewinkeltem Kopf auf einer der Bänke saß. Sie sah alt aus, alt und erschöpft. Neben ihr saßen zwei laute Kinder, vielleicht acht und zehn Jahre alt. Ein dumpfes, leeres Gefühl zog ihm in den Magen. Sie hatten oft über Kinder gesprochen, es hätten seine Kinder sein können. Fast zwanzig Jahre hatte er sie nicht gesehen und nicht gesprochen. Fast sieben Jahre waren sie zusammen gewesen. Sie waren erwachsen geworden, und dann wechselte Svenja ihre Arbeitsstelle und teilte sich ein Büro mit Ferdinand, der ihr gegenüber auf der anderen Seite der großen Arbeitsplatte saß. Ferdinand war zehn Jahre älter, machte Sport, tanzte gerne, hatte einen festen Männerabend in der Woche und fuhr am Wochenende ins Umland zu Badeseen und schmierte nach zwei Monaten an einem dieser Seen Svenjas Rücken mit Sonnencreme ein.
Sie hatten sich noch ein paar Jahre zu den Geburtstagen kurze Nachrichten geschrieben, bis auch dieser Kontakt abbrach. Was hätte er sagen sollen? Wie geht es dir, ach so, deine Kinder, dein Mann, dein Auto, dein Haus im Umland in der Nähe eines Badesees, deine Karriere. Hier bin ich: Das ist mein Beruf, der eigentlich ein Job ist, das ist meine Zweizimmerwohnung, das ist mein Schrottauto, das mein Fahrrad, das ist mein Bauch und das hier, sieh sie dir an, ist meine Traurigkeit, und mit der fliege ich jetzt nach Kolumbien zum Grab meines Bruders. Hätte sie doch gar nicht wissen wollen! Sie hatte ihn verlassen. Müller richtete sich in seinem Sitz auf, atmete scharf ein und wieder aus, legte seine Beine hoch und dachte dann, dass er nach all diesen Jahren noch immer verletzt war. Svenja sah alt aus und nicht mehr schön oder attraktiv. Es beruhigte ihn auf eine merkwürdige Art. Auch er selbst, so dachte er, hatte alles an Attraktivität verloren. Ihm wuchsen der Bauch und ein leicht hängendes Doppelkinn, und seine Augenringe hatten sein Gesicht verändert. Wahrscheinlich, dachte Müller, wäre es besser gewesen, sie nicht zu sehen, dann wäre sie noch immer schön und jung und hätte keine Kinder. Sie würde in seiner Vergangenheit leben und es wäre gut. Er bestellte einen frischgepressten Orangensaft, und das goldene Gliederarmband klackerte, als die Frau das Glas vor Müller abstellte.
Wenn Svenja ihn nun sehen könnte, könnte sie sehen, wie er breitbeinig in zehntausend Metern Höhe in einer Iberia-Maschine in der ersten Klasse saß und sich einen Film ansah, in dem ein einziger Mann mit einem Arsenal an Waffen, das in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg versteckt war, Europa vor einem terroristischen Angriff beschützte. Müller, an seinem frischgepressten Orangensaft nippend, ein Mann von Welt, den nichts aus der Fassung bringen konnte, frisch rasiert, im Anzug, die Kontinente wechselnd, den Atlantischen Ozean unter sich. Doch sofort kehrte die Unruhe zurück an Müllers Oberfläche. Denn natürlich war er voller Angst, er hatte so viel Angst, er hätte eine Ausbuchtung am Bauch haben müssen. Müller hätte vielleicht das Bunkerversteck in den Bergen Norditaliens gefunden, doch niemals hätte er einen Menschen töten können, und wie sollte überhaupt jemand Europa vor der Vernichtung retten, der sich gerade von seinem Sakko und einer Flugzeugdecke einen Zusammenhalt vorgaukeln ließ?
Er dachte an seinen Bruder, an die Nachricht, die ihn in dieses Flugzeug gebracht hatte, an die Strecke, die er zurücklegen würde, eine für Müller unfassbare Strecke. Er saß, angespannt bis in die Haarspitzen, eine Anspannung, die gar nicht wusste wohin und die ihn mit einem aufblühenden Hautausschlag an beiden Handgelenken ausgestattet hatte. Müller versuchte sich zu beruhigen, indem er stetig und tief ein- und ausatmete. Weiten, der Körper sollte sich weiten. Bis in die Füße. Dringend musste er etwas schlafen. Er bestellte ein Glas Sekt und ein zweites, setzte die Schlafbrille auf und nickte ein. Als er wieder aufwachte, fühlte er sich für einen Moment besser. Unter ihm war der Atlantik mit seiner unfassbaren Weite. Müller hatte einen Klumpen im Magen, einen Stein, der ihn nach unten zog. Er fühlte sich betäubt. Er war nun allein, der Letzte der Familie, und er hatte nicht mal Kinder. Hätte er welche, würde er etwas von sich weitergeben können. Aber was würde er denn weitergeben, was genau? Vielleicht das Leben an sich? Die Erinnerungen? Seine guten Eigenschaften? Und welche, bitte, sollten das denn sein? Seine Pünktlichkeit, seine Genauigkeit? Er schüttelte den Kopf, als wäre er mit einem Gegenüber im Gespräch. Aber nein, er wusste nicht mal das! Svenja hatte Kinder. Er hatte Sabine, und das war zu wenig, viel zu wenig. Tief atmen, ganz tief, der Körper sollte sich weiten! Nein, es funktionierte überhaupt nicht. Was für ein Schwachsinn! Warum brauchte er überhaupt einen geweiteten Körper? Er atmete viel zu schnell, er hechelte beinahe. Als er sich wieder beruhigt hatte, blieben auf seiner Hose zwei handtellergroße Schweißflecken zurück. Er betrachtete die Wolkenbänke.
In der Oberstufe war die Tür von Thomas’ Zimmer meistens geschlossen gewesen. Manchmal war Müller heimlich hineingegangen. Er hatte nichts angefasst, er war in der Mitte des Raumes gestanden und hatte sich die Poster der Heavy-Metal-Bands angesehen, Pantera, Slayer, Sepultura, Typen, die böse in die Landschaft guckten, und hatte nichts damit anfangen können. Er kannte die Musik. Sie war wie das Zimmer: keine Einladung für ihn, hereinzukommen. Thomas war fast immer müde, schlecht gelaunt gewesen. Oft reagierte er abweisend oder aggressiv, wenn Müller ihn etwas fragte oder nur in seiner Nähe sein wollte. Er war Müller abhandengekommen, vielleicht auch der Welt und sich selbst. Erst in Hamburg, wohin Müller seinem Bruder für den Zivildienst gefolgt war, war Thomas in großen Schritten wieder auf ihn zugegangen. Müller war anfangs verwundert und freute sich über die wiedergekehrte Vertrautheit. »Wir fahren nach Prag, basta!«, sagte Thomas eines Abends, als sie in Övelgönne an der Elbe entlangliefen, ging am nächsten Tag zu einem Reisebüro, und ein paar Stunden später fuhren sie mit einem Bus von Hamburg nach Prag. Am Abend erreichten sie das Hotel, einen Klotz in einem Außenbezirk der Stadt, inmitten eines Industrieareals. Ihr Zimmer war im siebten Stock mit Blick auf einen schachtartigen Innenhof. In der Mitte des Hofes, fast zentriert, lag ein verendeter Vogel im daumenhohen Neuschnee. Am zweiten Tag entdeckten sie nachts an der Uferstraße der Moldau eine Kneipe, die, nachdem sie den Raum betraten, abgeschlossen wurde, und so standen sie, keiner weiteren Worte als »Danke« und »Guten Tag« auf Tschechisch mächtig, in dieser Kneipe, umgeben von Arbeitern, die Lieder sangen und von einem zahnlosen Akkordeonspieler begleitet wurden. Das Lokal hatte die Größe eines Wohnzimmers. Die Wände und die Decke waren holzvertäfelt. Einfache Holzstühle und Hocker standen um ramponierte quadratische Tische. Man behandelte sie als Gäste, die von der Nacht hereingespült worden waren, und stellte ihnen Glas nach Glas auf den Tisch, die sie schweigend und alles um sich herum neugierig beobachtend austranken. An ihrem Tisch saßen zwei ältere Frauen, denen sie hin und wieder zulächelten und die sich nach einiger Zeit erhoben, etwas auf Tschechisch in den Raum riefen. Alles verstummte. Die Bedienung lief etwas hektisch umher, teilte randvolle Schnapsgläser an alle aus, stellte sich dann hinter das Brett, das der Tresen war, und wartete. Die beiden Frauen erhoben sich wieder, sagten etwas, und dann sahen alle auf Thomas und Müller und hielten die Gläser hoch.
»Was machen wir jetzt?«, flüsterte Müller.
»Mitmachen!«, rief Thomas und stand auf. »Wir machen mit, komm, los!«
Er nahm eine stramme Haltung an, eine Haltung, von der Zivildienstleistende wahrscheinlich annahmen, dass Wehrdienstleistende mehrmals am Tag genauso antreten müssten.
»Děkuju!«, rief Thomas laut. Er stellte sein Glas ab, streckte beide Arme gerade von sich, als wäre ihm soeben ein Oscar zugesprochen worden. »Wir danken Ihnen, dass wir hier sein dürfen. Es ist schön hier. Thank you!«
Thomas zog Müller hoch, der unsicher lächelte und sein Schnapsglas hob.
»Thank you, Prag«, sagte er leise und verbeugte sich.
Die Kneipe klatschte und johlte. Die zwei Frauen kamen um den Tisch herum, umarmten die beiden, und zwei Männer, die am Tresenbrett standen, sangen, begleitet von dem Zahnlosen, die Hymne der DDR. Danach begann die große Vorstellungsrunde. Alle kamen nacheinander an ihren Tisch, umarmten sie und sagten ihre Vornamen. Die Brüder verließen mit zwei geschenkten Bierflaschen als Letzte das Lokal. Hinter ihnen wurden die Rollläden heruntergelassen. Thomas öffnete die Flaschen mit den Eckzähnen. Da standen sie in dem pastellfarbenen Licht des Morgens, glücklich und betrunken. Vor ihnen glitt die Moldau vorbei.
Als Müller aufwachte, zog draußen mit einer rötlich-sanften Lichtwelle langsam der Tag herauf. Er lag wach mit geschlossenen Lidern, er döste, die Arme vor der Brust verschränkt, als könnte er sich damit die Welt vom Leib halten. Er ging auf die Toilette, trank Wasser, aß Obst. Müller hing zwischen zwei Kontinenten in der Luft und wartete. Er wünschte, er könnte immer weiter warten und würde niemals ankommen. Er schlief wieder ein. Mit dem Geschmack von Schlaf und Alter im Mund wachte er auf und fühlte sich wie zerschlagen. Sein Rücken schmerzte. Er setzte sich auf und zog die Fensterblende hoch. Die Wolken waren nah, fast greifbar. Sonnenstrahlen brachen an unzähligen Stellen hindurch. Die Maschine senkte sich. Bogotá lag in gleißendem Licht. Er beugte sich weiter zu dem Fenster und versuchte, die Archaik und Monstrosität dieser Stadt zu begreifen, die er dort unten sah, eine einzige Fläche aus Häusern, begrenzt von weit entfernten Bergen, die Wolken zum Greifen, für Müller nicht fassbar. Kolumbien, er war da! Er lächelte kurz. Er war der, der in einem Flugzeug mehrere Zeitzonen überflogen hatte. Für einen flüchtigen Moment hatte er ein offenes, ein schönes Gesicht. Doch als er seinen Rucksack aus dem Gepäckfach holte, kippte sein Gesicht zurück in die Traurigkeit, mit der er Deutschland verlassen hatte. Er fühlte stechende Schmerzen in seinem Rücken. Zwei Stewardessen sagten »¡Hasta la próxima!«, und Müller nickte, als er mit gesenktem Kopf an ihnen vorbeiging und seine Füße das erste Mal außereuropäischen Boden betraten. Er war nun 2300 Meter über der Meeresoberfläche und hatte zwei Stunden Zeit, bis er weiter nach Cartagena fliegen würde.
Hinter der Kontrolle wurde er von einer Soldatin angehalten, die erneut seinen Pass sehen wollte und ihn aufforderte, seinen Namen zu sagen. Wenn Müller nach seinem Namen gefragt wurde, sprach er ihn aus, als bestünde er nur aus einer einzigen tonlosen Silbe. Ein Name, der unwichtig war, schnell vergessen, etwas, das Müller mit sich herumtrug wie einen zu schweren und zwecklosen Gegenstand. Er öffnete kaum die Zahnreihen, als legte er es darauf an, ein weiteres Mal gefragt zu werden. Und wurde er ein zweites Mal gefragt, kam das Wort »Müller« akkurat artikuliert aus seinem Mund, penetrant wie etwas Befohlenes. Da nun die Soldatin direkt vor ihm stand, im Hintergrund ein Soldat mit einem Maschinengewehr im Anschlag, übersprang er vor Angst den ersten Schritt und sagte deutlich seinen Namen. Er musste den Rucksack öffnen, die Frau überprüfte den Inhalt, sah in jede der drei kleinen Außentaschen, tastete den Boden ab. Er sollte ihn wieder schließen, der Soldat senkte die Waffe und die Frau schob ihn wortlos weiter. Adrenalin pumpte durch Müller, seine Beine zitterten. Vielleicht hatten sie ihn für einen Kurier gehalten? Er lehnte sich mit dem Rücken gegen ein bodentiefes Fenster, beruhigte seine Atmung und sah sich um. Soldaten liefen in Dreiergruppen umher und kontrollierten männliche Reisende. Es waren unfertige Gesichter, die zwischen den Helmen und den Schutzwesten aussahen wie hineinmontiert. Er drehte sich um und drückte seine Stirn sanft gegen das kühle Glas. Die Sonne brach ein weiteres Mal durch die Wolken und verteilte einen Fächer aus Strahlen auf der Piste. Da ist da, Müller. Er sah sich nach einem Raucherraum um und rauchte in sehr kurzer Zeit fünf Zigaretten. Dann passierte er eine Ladenpassage und lief auf und ab, ein unruhiger Müllerkörper, der nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte. Um überhaupt etwas zu machen, wechselte er an einem Bankschalter Geld. Er quittierte den Empfang mit seiner Unterschrift und musste Daumen und Zeigefinger auf ein Stempelkissen drücken und dann die beiden Kuppen auf die Kästchen über seiner Unterschrift pressen.
Er ging zu den nationalen Gate-Schaltern. Als die Maschine steil in den bewölkten Himmel stieg und das erwachende Bogotá zurückließ, sah Müller die Bergkette, über deren Kämme der kühle Morgenwind auf das Hochplateau herunterwehte. Er beugte sich vor und blickte auf die Erde hinab. Nach einer Weile lag der Río Magdalena wie eine riesige Schlange unter ihm. Er sah schneebedeckte Gipfel, senkte den Blick wieder auf den Fluss, zurück auf die Berge. Die Anden, das müssen die Anden sein, dachte Müller und riss ein Lächeln an. Er sah Dörfer, Kleinstädte, das Firmament. Und weil Müller Müller war, dachte er, als er minutenlang den Lauf der Schlange verfolgte, dass es rechts und links dieses breiten Stromes einen gefährlichen, alles und jeden verschlingenden Urwald geben musste. Wenn es nun ein Unglück gäbe, dachte er und verkrampfte, und er hier abspringen müsste, mit einem Fallschirm, und noch lebendig, aber schwer verletzt unten ankäme, als einziger Überlebender vielleicht, mit zahlreichen Knochenbrüchen, die es unmöglich machten, sich fortzubewegen, die Natur würde ihn fertigmachen, er würde von Tieren angegriffen und Stück für Stück gefressen werden. Ach, Schwachsinn, Müller, mach dich locker! Er hatte noch nie in seinem Leben eine so lange Reise gemacht, und es schien ganz unkompliziert, ganz einfach zu gehen, keine Hindernisse, keine Probleme, warum auch? Warum, zum Teufel, dachte Müller, sollte es auch Probleme geben? Weil er davon ausging, dass es immer und überall Probleme gab, dass immer, überall und bei jedem Vorgang, und sei er noch so banal, eine Optimierung vorzunehmen war. Und warum war das überhaupt seine erste längere Flugreise? Mit vierundvierzig Jahren, wenn der männliche Durchschnittsdeutsche längst das Bergfest seines Lebens gefeiert hatte, flog Müller das erste Mal über einen Ozean, trank währenddessen Sekt und sah attraktiven Stewardessen auf den Arsch, wofür er sich schämte, jedoch immer wieder hinsah, und sich bemühte, hinter all diesen Erlebnissen so etwas wie eine beruhigende Normalität zu entdecken und keine fand. Nichts, dachte er, absolut gar nichts ist normal. Er flog über die Anden, sah einen Fluss, gegen den alle Flüsse, die er bisher gesehen hatte, Bäche waren, reiste zum Grab seines toten Bruders und spielte mit dem Gedanken, sich aus einem abschmierenden Flugzeug mit einem Fallschirm zu retten. Alles schien aus dem Ruder zu laufen. Er lehnte seine pochende Stirn an das kalte Fenster und sah hinab auf Kolumbien, auf das satte Grün rechts und links der Wasserschlange, auf kleine Städte und Dörfer auf Hügeln, in Tälern. In weiter Ferne türmten sich die von unten hell erleuchteten Wolken, die nach oben hin aus sich selbst herauswuchsen. Es war wundervoll, es war ungeheuerlich. Und weil Müller Müller war, bekam er kurz den Verdacht, es könnte sich um einen Irrtum, eine Verwechslung handeln, vielleicht, so dachte er für einen kurzen Moment, war er gar nicht gemeint. Dann senkte sich die Maschine und Müller erkannte am Stadtrand eine große Ölraffinerie mit meterhoher Gasfackel, dann Hausdächer, ein Fußballstadion, wieder Dächer, nördlich und südlich der Altstadt Hochhäuser. Die Maschine flog dicht über dem Meer eine Kurve, vorbei an kleinen und bewaldeten, der Küste vorgelagerten Inseln und setzte auf.
Die Hitze war ein riesiger drückender Körper. Müller legte Mantel und Sakko über seinen Rucksack, krempelte die Ärmel seines Hemdes hoch und atmete schnell und flach. Er stand neben der Turbine, oben auf der mobilen Gangway. Sofort hatte er angefangen zu schwitzen. Die verdammte Turbine, dachte er, und dann begriff er, dass er in der Karibik war und es so heiß bleiben würde, wie es war. Müller lief über das Rollfeld, durch einen Gang, der von Pflanzen gesäumt war, die er nicht kannte, durch die Passkontrolle und wartete an dem Transportband auf seinen Koffer. Der Raum war heruntergekühlt und Müller zog seinen Mantel wieder an. Seine Nackenhaare waren nass. Hoffentlich ist Laura da, dachte er und kratzte sich an den Handgelenken. Er wusste nicht, wo sein Hotel war. Weder kannte er Lauras Telefonnummer noch ihre Adresse. Und er wusste nicht, wo der Friedhof lag, auf dem sein Bruder beerdigt war. Er kratzte sich. Der Hautauschlag, der zwischen Bogotá und den Anden fast verschwunden war, blühte wieder auf. Seine Handgelenke sahen aus, als würde er zwei breite Armreife





























