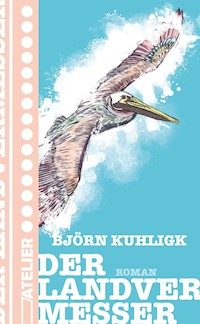Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Björn Kuhligk hat sich aufgemacht, auf dem Mauerweg das alte West-Berlin zu umrunden. Unterwegs auf der 160 Kilometer langen Strecke erinnert er sich an seine Erlebnisse in der geteilten Stadt, an Gummitwist bei Regen, an Fahrradtouren am Wannsee. In Gesprächen mit radelnden Rentnern, engagierten Schriftstellern und redseligen Currywurstverkäufern erfährt er mehr über eine Stadt, die es nicht mehr gibt, ihre Bewohner und die Grenze, die sie umgab. Eine Lektüre voller Witz und zugleich ein literarischer Begleiter für alle Berliner und Neugierigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Björn Kuhligk
ÜberallNachbarn
Wie ich auf dem Mauerweg dasalte West-Berlin umrundete
Mit Fotos des Autors
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
E-Book im be.bra Verlag, 2022
© der Originalausgabe:
be.bra Verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2022
Asternplatz 3, 12203 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlaggestaltung: Manja Hellpap, Berlin
ISBN 978-3-8393-4140-7 (epub)
ISBN 978-3-8148-0265-7 (print)
www.bebraverlag.de
Für Christine
Die Havel vom Wachturm Nieder Neuendorf
Ich war vierzehn
Ich war vierzehn und die Mauer fiel um. Sie ist nun schon länger verschwunden, als sie stand. Das gilt auch für West-Berlin. Obwohl West-Berlin nicht umfiel, so wenig wie die Mauer.
Ich bin aufgewachsen in dieser Stadt, in der es Militärparaden der alliierten Streitkräfte gab, bei denen die Sieger an den Besiegten vorbeiliefen und von ihnen bejubelt wurden. RAF-Fahndungsplakate hingen in jeder Postfiliale, die soziale Treffpunkte waren. Ich spielte mit meinen Freunden auf der Straße und niemand, wirklich niemand trug einen Jutebeutel mit dem Aufdruck: »If you want reality, take the bus«. Auf dem Wannsee fuhr »Moby Dick«, ein Passagierschiff, das aussah wie ein Wal. Ich hatte ein Postsparbuch, ein dünnes Heft, in dem jede Ein- oder Auszahlung mit Unterschrift und Stempel und dem aktuellen Kontostand handschriftlich vermerkt wurde. Es gab die »Zweite Hand«, eine dicke, in hoher Auflage gedruckte Zeitung für private Kleinanzeigen, in der man Sachen anbieten oder danach suchen konnte: Fahrräder, Autos, Nachhilfe, Küchenschränke, Haustiere, Lebenspartner. Auf den Straßen liefen alte Männer mit fehlenden Gliedmaßen und verhärmten Gesichtern, Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg.
An jedem zweiten Samstag, bis diese Regelung 1991 abgeschafft wurde, fand Schulunterricht statt. Es gab keine Tage, an denen das Aufstehen schwieriger und die Lustlosigkeit, in die Schule zu gehen, größer war. Hanna-Renate Laurien, die in den Berliner Tageszeitungen den Beinamen »Renate Granate« erhielt, wohnte bei uns um die Ecke. Ich sah sie oft auf der Straße. Sie war acht Jahre lang Senatorin für Jugend, Schule und Sport, sie kandidierte gegen Männer, sie war die erste und bislang einzige Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, sie hatte eine imposante Beton-Frisur und sah auch sonst wie eine strenge Schuldirektorin aus, in deren Büro man als Schüler lieber nicht geladen werden wollte. Anne Klein, die Hanna-Renate Lauriens Amt übernahm, das umgestaltet und fortan Senatsverwaltung für Jugend, Frauen und Familie genannt wurde, lebte mit ihrer Freundin zusammen. Ich erinnere mich an einen Waldspaziergang, und sicher war es im Grunewald, mit meinen Eltern und meiner Schwester. Ich stritt mit meinem Vater darüber, ob es in Ordnung sei, offen lesbisch zu leben und gleichzeitig eine öffentliche Position zu haben. Ich war vehement dafür, dass es niemanden etwas angehe, wie man lebt, und dass es so oder so gut sei, wenn Menschen, die Menschen ihres Geschlechts lieben, dies auch in der Öffentlichkeit tun würden und können. Mein Vater hatte, so ahnte ich, eine ähnliche Meinung, vertrat aber die öffentliche, und so stritten wir. Ich war vierzehn Jahre alt und es war meine erste hitzige politische Diskussion. Anne Klein trat 1990 nach der Räumung der Mainzer Straße zurück. Aber das ist eine andere Geschichte.
In meiner Erinnerung ist West-Berlin eine graue Stadt. Sie hat mich geprägt, sie ist ein Teil von mir, und wem das zu pathetisch ist, dem ist es zu pathetisch, mir piepe. Dieses Buch orientiert sich an meinen Erinnerungen, an denen eines höchstens vierzehn Jahre alten Heranwachsenden. Es ist ein lückenhaftes Buch, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich war 1989 zu jung, um vollständig von West-Berlin erzählen zu können. 1975 wurde ich in West-Berlin geboren, in dem Jahr, in dem die DDR begann, die ursprüngliche Mauer, die als Provisorium fungierte und zu Teilen aus übereinandergeschichteten Betonplatten bestand, partiell durch Stahlbetonstücke von vier Metern Höhe zu ersetzen. Ich habe bis 1989 genügend West-Berliner Luft geatmet, um über diese Luft, die ich atmete, erzählen zu können. Und von all dem, was sie umgab. Bis vor vielleicht zehn Jahren wurde ich immer wieder gefragt, wenn ich sagte, ich käme aus Berlin, ob West oder Ost? Meistens habe ich zurückgefragt: Spielt das eine Rolle? Oder ich sagte: Rate mal! Ich war schlichtweg davon genervt. Denn nach der Antwort »West« folgte meistens ein kurzes betroffenes Schweigen, weil das Gegenüber erhofft hatte, ich käme aus dem Osten, und ein bisschen beschämt war, mich für einen Ossi gehalten zu haben, denn der gefragt hatte, kam todsicher aus den – wie man sagte – alten Bundesländern und wusste jetzt auch nicht mehr, was er sagen sollte. Wenn sich das Gegenüber auf das Ratespiel einließ, wurde ich fast immer für einen Ost-Berliner gehalten – an welchen Parametern er oder sie das auch immer festgemacht hatte. Ich fand es ganz cool, es hatte schließlich auch etwas Interessantes, für einen anderen gehalten zu werden. Auf die andere Frage, die mir in den Neunzigerjahren hin und wieder gestellt wurde, wie es für mich war, in West-Berlin zu leben – umgeben von der Mauer –, fiel es mir schwer zu antworten. Die Mauer war da, sie war etwas Gegebenes, ich kannte es nicht anders, da war Schluss, und weil wir nicht direkt an der Mauer wohnten, konnte ich mich ungehindert in alle Himmelsrichtungen bewegen. Und doch gab es ein geflügeltes Wort, das besagte, dass man in West-Berlin keinen Kompass brauchte, weil man sich nicht verlaufen konnte: Irgendwann würde man an die Mauer kommen, und da war immer Osten.
Ein Ort lässt sich am besten durch seine Grenzen definieren, und so war es ein kurzer gedanklicher Weg zu der Idee, den Mauerweg, die ehemalige Grenzlinie zwischen West-Berlin und der DDR, mit dem Fahrrad entlangzufahren, mit offenen Augen und neugierig und einem Rucksack voller Erinnerungen. Ich schrieb auf, was ich sah, was ich hörte, was ich erlebte und woran ich mich erinnerte. Dieses Buch erzählt davon.
Vom Hermannplatz nach Rudow
Deine Mama hat ’n Kaufhaus am Hermannplatz
Und macht da die ganz dicke Kasse
Und dein Alter hat ’ne Kneipe in der Urbanstraße
Doch gehört mehr zur breiten Masse
Als Rio Reiser 1990 »Sonnenallee« sang, war dieses Lied noch kein Track und Rio Reiser wurde Interpret seiner Lieder genannt. Ich war fünfzehn Jahre alt und die Mauer hatte erst vor einem Jahr ihre Funktion verloren.
Hinter mir liegt die Urbanstraße, seitlich steht das Karstadt-Gebäude, vor mir fährt ein Türke auf einem Fahrrad, der seinem Kumpel noch »Tamam!«, »Einverstanden!«, zuruft und ihm winkt, als er losfährt. Am Lenker seines Fahrrads schaukeln zwei große orangefarbene Plastiktüten, die mit Fladenbroten gefüllt sind, im Rhythmus seiner Beinbewegungen. Er fährt zügig, aber sehr langsam die Sonnenallee entlang. Er lässt sich weder von den hupenden Autos im morgendlichen Verkehr noch von den Bussen davon abbringen, hier ganz genau nach ausschließlich seinem Tempo zu fahren. Da eigentlich jeder Berliner Busfahrer das gemeine Zeil verfolgt, so viele Radfahrer wie möglich auszubremsen, legt der Mann mit den Broten eine bewundernswerte Ruhe und Gelassenheit an den Tag.
Ich fahre hinter ihm her, ich überhole ihn nicht, obgleich ich es könnte. Es ist fast ein Akt der Verweigerung, hier auf einer der trubeligsten Straßen Berlins mit vielleicht sieben Stundenkilometern am Straßenverkehr teilzunehmen. Von weitem sehe ich schon das Estrel Hotel, das aussieht wie ein großer Schiffsbug. Eine Weile wurde es als Konzerthalle genutzt, bis auch endlich der Letzte bemerkte, dass die Akustik in einem großen Sitzungssaal selbst mit der besten frei verkäuflichen Sound-Anlage der letzte Husten ist. Hinter dem Hotel biegt der Mann mit den Broten links ab. Dort wo sich der Grenzübergang Sonnenallee befand, verlasse ich die Sonnenallee. Dieser Grenzübergang wurde erst durch die Verfilmung von Thomas Brussigs Roman »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« auch außerhalb Berlins bekannt.
Auf dem Bürgersteig steht neben einem geparkten Sechstonner ein Graphoskop, ein Aussichtsfernrohr, wie sie mitunter auf hohen Gebäuden, Türmen oder Hügeln zu finden sind. Einwurf ein Euro und die Welt rückt für eine Minute näher heran. Doch dieser Graphoskop irritiert, denn was ist hier auf der Sonnenallee in weiter Ferne zu beobachten? Eigentlich nichts, absolut nichts. 1999 ließ der Senat zwei dieser Fernrohre der Künstlerin Heike Ponwitz errichten. Sie sollen an die sieben innerstädtischen Grenzübergänge erinnern. Was wäre, schaute ich hinein, durch sie zu sehen? Eine Wohnanlage, geparkte Autos und hin und wieder fährt der M41 vorbei, jene Buslinie, deren Endstation ein paar Meter entfernt ist und die Richtung Stadtmitte bis zum Hauptbahnhof führt. Es gibt wohl kaum eine Berliner Buslinie, auf der sich mehr Kinderwagen bewegen und Menschen, die, während sie Bus fahren, ihre ganz eigenen, sehr interessanten Anliegen an die Öffentlichkeit tragen. Die Menschen, die diesen Bus steuern, haben Nerven aus Stahl, ummantelt mit schallisoliertem Material, und nach Feierabend dürfen sie den eigens für sie von den Berliner Verkehrsbetrieben errichteten Freizeitbereich betreten. Wahlweise können sie dort große Eisbecher essen, alle Folgen von »Stirb langsam« sehen, einen Boxsack malträtieren oder werden von freundlichen, sehr gut aussehenden Menschen, denen es verboten ist zu reden, massiert.
Neben dem Südlichen Heidekampgraben stehen Weiden und Kastanien. Es ist abrupt um einige Dezibel leiser. Links vor den dreistöckigen Mietshäusern spielen Kinder Federball. Ein Mann geht mit einem weißen und einem schwarzen Hund spazieren. Die Himbeersträucher blühen. Eine grauhaarige Frau sitzt auf einer Bank und schaut zu, wer hier vorbeikommt. Einige Wolken, die zerrupft aussehen, ziehen langsam über den klaren, blauen Himmel. Bevor ich wieder abbiege und den Britzer Zweigkanal kreuze, sehe ich drei Altglascontainer auf der anderen Straßenseite, die in den Vereinsfarben von Hertha BSC gestrichen sind. Darüber hat jemand in roter Farbe »FC Union« geschrieben, die innerstädtische Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga.
West-Berlin war ein Dorf, zusammengesetzt aus vielen sehr kleinen Dörfern, und das hat geformt. Noch drei Jahrzehnte nach 1989 sagen viele, wenn sie vorhaben, für einen Einkauf den Bezirk zu verlassen, sie gehen in die Stadt oder in die City. Ich bin nun in Britz. Britz gehört zu Neukölln, wovon der Britzer natürlich nichts wissen will. Ich komme auch niemals im Leben aus Steglitz, sondern aus Lankwitz, klar. Es behaupten auch nur wenige, dass sie in Reinickendorf leben. Es ist natürlich eher Hermsdorf, Frohnau, Tegel oder Heiligensee, ebenso klar. Und niemand kommt so richtig dahinter, was nun von Belang ist und was unwichtig. Aber es ist schon wieder ziemlich klar, dass der Kladower erst nach Gatow fährt, dann nach Spandau, dann über die Heerstraße und dann Berlin erreicht. Aber lebt der Rixdorfer außerhalb von Neukölln und der Schmargendorfer gleich bei Schöneberg oder knapp daneben? Ähnlich merkwürdig muss es für manche sein, wenn mit den alten Postleitzahlen jongliert wird. In 41 wohnte, wer Geld hatte. In 36, wer nicht. Und zwischen 36 und 61 lag nicht nur eine ganze Welt, sondern auch eine Haltung zur Welt, verbunden mit Geld, und die Kunst des Boule-Spiels am Landwehrkanal und der Kanal sowieso. 1993, mit der Umstellung auf die fünfstelligen Postleitzahlen, behielt ich zwar den groben Überblick, verlor aber den für die feinen Unterschiede. Doch feine Unterschiede und Berlin, das sind zwei Dinge, die nicht zueinanderfinden.
An der Chris-Gueffroy-Allee in Britz
Gleich auf der linken Seite des Weges haben gute Menschen ein großes Insektenhotel gebaut. Auf der anderen Kanalseite halte ich an der Stelle, an der Chris Gueffroy im Februar 1989 mit einem Freund versuchte, nach West-Berlin zu kommen, und erschossen wurde. Er sollte der letzte von 136 Menschen sein, die an der Berliner Mauer getötet wurden. 1964 versuchte Hans-Joachim Wolf ein Stück weiter, den Kanal zu durchschwimmen. Einundsechzig Mal wurde auf den Siebzehnjährigen gefeuert. Er wurde tödlich verletzt. Wieder ein Stück weiter überwanden 1971 zwei West-Berliner Freunde, die sich in der DDR ein besseres Leben versprachen, die Mauer und wurden auf dem Todesstreifen beschossen. Werner Kühl verblutete. Die Schützen wurden mit der »Medaille für vorbildlichen Grenzdienst« geehrt. Ich stehe vor den Stelen, die an sie erinnern, dahinter ragt ein großer Fabrikbau in Form einer überdimensionierten Kaffeepackung empor, aus der fünf dünne Schornsteine sich in den gesamtdeutschen Himmel erheben. Die drei Männer wurden an Orten erschossen, an denen sie heute auf diese Packung Jacobs Krönung sehen würden.
Zwei Rocker, die vielleicht zu wenig Geld für ein eigenes Motorrad haben, fahren auf ihren aufgemotzten Fahrrädern an mir vorbei. Aus der Boom-Box, die einer der beiden an seinem Lenker befestigt hat, schallt »Seek & Destroy« von Metallica in Konzertlautstärke, und der Kopf des Mannes bewegt sich im Takt der Gitarren, doch würde er hier auf seinem Rad ein ordnungsgemäßes Headbanging hinlegen, käme er keine zwei Meter weit. Beim Anblick der beiden fällt mir auf, wie vieles sich verändert hat und dass bereits in den Achtzigerjahren in der Pop-Kultur ein Spiel mit den Geschlechterrollen stattfand. David Bowie ging als die androgyne Kunstfigur Ziggy Stardust durch die Welt. In einem Musikvideo tanzte er mit Mick Jagger und beide machten nichts anderes, als drei Minuten miteinander tanzend zu flirten. Hardrock-Bands traten mit langen Haaren und geschminkt auf. Dieter Bohlen kam in einem rosafarbenen Jogginganzug auf die Bühne, Thomas Anders trug Lackschuhe, Ringe und eine Kette, deren Anhänger die Buchstaben des Namens seiner Frau waren. Und ich, ich ging mit meinem Walkman zu einem Frisör, der nur Männer frisierte. Es war der einzige bei uns in der Nähe. Der Laden war immer voll. Drei wurden frisiert, dahinter saßen fünf, sechs Männer auf einer langen Bank, die Rücken an der Wand, und warteten darauf, dranzukommen. Die Frisöre waren im gleichen Alter wie die wartenden Männer. Es wurde Blech geredet. Ich muss meinen ganzen Mut zusammengenommen haben, als ich, endlich an der Reihe, auf dem Frisierstuhl saß und sagte: »Einmal Steckdose, bitte«. Der Mann verstand leider überhaupt nicht, was ich damit meinte. Hätte er, ebenso wie ich, die »Bravo« gelesen, und manchmal »Pop/Rocky« und »Popcorn«, wüsste er vielleicht, was ich damit meinte. Nein, ich musste ihm erklären, dass ich eine Frisur haben wollte, bei der die Haare alle nach oben stehen. Der Mann sagte eine Weile nichts und dann sagte er: »Nein!« Die Männer hinter mir nahmen ihr Gespräch wieder auf. Ich fühlte mich hilflos und war maßlos enttäuscht und wusste nicht mehr weiter. Also keine »Steckdose«. Ich ließ mir die Frisur schneiden, die alle hatten, die den Laden wieder verließen. Sie hieß wahrscheinlich »Weltkrieg« und die Haare waren kurz. Auf dem Heimweg hörte ich im Walkman Jennifer Rush, war euphorisiert von dieser Musik, von dieser Stimme, die sich zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit bewegte, und sie sang »The Power of Love«, und sicherlich, so viel wusste ich, hatte die Liebe Power, und wenn sie diese Power hatte, wollte ich sie auch haben, und zwar sofort.
Weiter auf dem Mauerweg. Aus den Pappeln, die rechts des Weges stehen, fliegen die Samen, kleine weiche, flauschige Büschel, als schneite es im Sommer, und hätte ich mich im Gesicht nicht so üppig mit Sonnencreme eingeschmiert, würde mir das Zeug nicht im Gesicht kleben. Ich fahre unter der Autobahnbrücke durch, Richtung Süden, an die Stelle, wo der Britzer Zweigkanal auf den Neuköllner Schifffahrtskanal und den Teltowkanal trifft, dessen Wasser bei Köpenick aus der Dahme kommend nach Westen in den Griebnitzsee fließt. Ich halte an, weil dort eine Frau steht, die ein Foto macht. Und macht jemand irgendwo ein Foto und jemand anders sieht es, schwenkt der Blick auf das, was fotografiert wird. Also sehe ich wie die Frau auf den Punkt des Wasserzusammenflusses und fotografiere ihn auch. Es geht ein leichter Wind, vereinzelt treiben zerfranste Wolken. Ich fahre weiter, parallel zur Autobahn, Richtung Schönefeld – und weil Sie sicherlich alle, wirklich alle Witze und Sprüche über Schönefeld schon mindestens einmal gehört haben, werde ich keinen davon wiederholen.
Ein paar hundert Meter von hier, auf der Neuköllner Seite des Kanals, lag das »blub«. Mit zweiundvierzig Jahren, in einem Alter, in dem der durchschnittliche Erwachsene alles Mögliche tut, nur nicht durch verrottete, dem Verfall preisgegebene Gebäude laufen, begann ich genau dies mit einem Freund in meiner Freizeit zu tun. Wir hatten unsere Fotoapparate dabei, waren auf der Jagd nach guten Bildern und begeistert davon, in Gebäuden zu stehen, die ehemals Fabriken, Sporthallen, Botschaften, Fakultäten oder Supermärkte waren. Öffnet man einmal die Augen für diese Art von Gebäuden, scheint es sie in Massen zu geben, eine Stadt in der Stadt. Das ehemalige »blub«, die Abkürzung für Berliner Luft- und Badeparadies, gehört zu diesen verlassenen Orten. 1985 eröffnete das Freizeitbad, das mit Sprüchen warb wie »Berlin blubst vor Vergnügen«, mit denen man heute niemanden mehr erreichen könnte. Das »blub« gehörte für mich zu den besten Orten meiner Kindheit. Es gab mehrere Whirlpools, ein Außenbecken, einen Wildwasserkanal, zwei Rutschen. Es war schlichtweg die Weiterführung einer steil aufragenden Kinderfantasie und die Tage – es waren nicht viele –, die ich hier verbringen konnte (denn wenn, dann waren wir von morgens bis abends hier), waren wundervolle Tage. Wir stromerten über das 35 000 Quadratmeter große Gelände, spielten mal hier, mal dort, aßen Pommes, tranken Brause und immer schien die Sonne, klar, auch drinnen. 2005 schloss das »blub« und 2012 auch die Saunalandschaft. Das Gelände verwilderte und wurde zu einem Treffpunkt von Jugendlichen. Immer wieder kam es zu Brandstiftungen. Nun sollen 450 Wohnungen auf dem Gelände entstehen. Wir befinden uns aber noch immer in Berlin, also wird der Termin fristgerecht überzogen werden und Geld wird irgendwo zwischen Holding 1 und Holding 2 verdunsten.
An der Spitalstraße halte ich kurz an. Unter der breiten Brücke ist es ruhig und kühl, zwei Bojen schaukeln sachte im Wasser. Ein Mann auf einem Tourenfahrrad kommt mir entgegen. An seinem Lenker sind vier Trinkflaschen und zwei Rückspiegel befestigt, auf dem Gepäckträger zwei voluminöse Taschen. Es sieht absurd aus, als würde er ein Insekt reiten – ausgestattet wie einer, der nach ein paar Wochen in Sibirien ankommen will. Er nickt mir zu. In die akustische Schutzmauer, die uns von der Autobahn trennt, sind in regelmäßigen Abständen Türen eingelassen, auf denen »Betreten des Autobahngeländes verboten« steht. Aus der langen Phalanx der Pappeln schneit es ununterbrochen. Alle paar Meter wische ich mir über das Gesicht. Der Lärm der Autos ist sehr laut, ein immerwährender Sound, der sich zu einem Klangteppich ausgebreitet hat. Für einen Moment schließe ich die Augen und versuche mir vorzustellen, dass das Rauschen der Autobahn das Rauschen des Meeres sein könnte, aber es funktioniert nicht. Eine Gruppe Rennradfahrerinnen überholt mich. In ihrem Tempo könnten sie es schaffen, noch heute den kompletten Mauerweg zu fahren.
Ich erinnere mich daran, wie wir an der Strecke der Tour de France standen, die begleitend zur 750-Jahr-Feier Berlins eine ihrer Etappen in West-Berlin absolvierte. Schließlich konkurrierten die beiden Stadthälften miteinander, denn auch Ost-Berlin beging eine 750-Jahr-Feier, doch so eine Tour de France, die gab es nur einmal, und sie führte durch die freie Welt – in West-Berlin 106 Kilometer auf sicherlich langweilig ebener Strecke. Und sie führte durch eine Zeit, in der Jugendliche erst Walkmans und später Discmans hatten, in der Männer lange Haare trugen, es Rollerblades-Diskotheken gab und Diskotheken noch nicht Clubs hießen und alle Menschen Schambehaarung hatten. Die Jahre der Berlin-Blockade waren lange vorbei, manche hatten sie noch erlebt, manche nicht. Man trug Partyhüte, legte sich Luftschlangen um. Es gab Schichtsalat und Käse-Stecker, Bowle wurde angesetzt und es wurde überall geraucht, wirklich überall, auch im Fernsehen. Es waren fette Jahre, es wurde geprasst. Der Krieg war fast nur noch eine Anekdote. Es gab Telefonzellen, es gab die D-Mark. Es gab Vanilleeis, Schokoladeneis und Erdbeereis und überall, wo es Eisbecher gab, gab es auch Banana-Split. An einer der Yorckbrücken stand in weißen Großbuchstaben: »Wir wollen nicht ein Teil vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei«. Fast jedes Kind hatte einen Zauberwürfel und spielte Gummitwist. Meine Mutter trug Blazer mit Schulterpolstern, mein Vater trug graue Anzüge mit dünnen Krawatten und eine breite Brille. Meine Schwester trug stonewashed Karottenjeans und eine löwenartige Frisur, wie sie viele Frauen und Mädchen und Männer hatten. Ich trug wie mein Vater eine breite Brille, ich trug Kniestrümpfe, auch im Sommer, auch in Sandalen, auch bei 35 Grad, und Schweißbänder an den Handgelenken, weil man das so machte und ich es cool fand.
Seit den frühen Morgenstunden also saß der gemeine Lankwitzer mit Stullenpaketen und Thermoskannen auf den mitgebrachten Campingstühlen und wartete auf die Fahrer der Tour de France. Ich war mit meiner Schulklasse an der Strecke. Wir warteten zwei Stunden, dann fetzte eine Kolonne von Autos vorbei, die Werbung herumfuhren. Rechts und links fielen Bonbons zu Boden, die wir aufsammelten. Ich ergatterte außerdem einen Luftballon der französischen Tageszeitung »France Soir«, die seit 2012 nicht mehr existiert. Zu Hause blies ich ihn auf und spielte damit Fußball. Ehe wir die Blicke scharfstellen konnten, war der Tross schon durchgerauscht, eine enorm schnell herannahende und genauso schnell wieder verschwindende Bewegung in den Augenwinkeln. Dann schossen die Fahrradfahrer vorbei. Es ging alles enttäuschend schnell. Der Start war am Sowjetischen Ehrenmal auf der Straße des 17. Juni gewesen, die Route ging über den Wedding, Reinickendorf, über den Rohrdamm, Kladow, die Havelchaussee, über die Potsdamer Chaussee durch Zehlendorf bis zum Steglitzer Kreisel, nach Lankwitz, Britz, über den Hermannplatz, die Yorckstraße, das Ziel war am Rathaus Schöneberg. Mittlerweile kenne ich alle diese Orte, die auf diesen 106 Kilometern liegen. Ich habe dort meine Kindheit verbracht, ich war dort nachts unterwegs, hatte dort meine erste Wohnung, eine meiner Arbeitsstellen, habe dort geheiratet, mein Opa wohnte um die Ecke, es waren Ausflugsziele. Alles Berlin, alles Zuhause, alles überschaubar.
Aber zurück zu dem großen Stadtjubiläum: 1987 wurde der 750. Geburtstag Berlins begangen. Während zu diesem Anlass in Ost-Berlin das Nikolaiviertel wieder aufgebaut wurde, besann man sich in West-Berlin auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts, ließ auf Bezirksebene lokale Geschichtsvereine forschen und unterstützte sie finanziell. Außerdem fand natürlich das Übliche statt, um West-Berlin als offene, neugierige Weltstadt zu präsentieren: Am Großen Stern gab es ein großes Volksfest, die Motorradstaffel der Polizei, die eh bei keiner größeren Veranstaltung fehlte, zeigte ihre Kunststücke und das Deutsche Turnfest machte Station im Olympiastadion. Michael Jackson, David Bowie und andere spielten kostenlose Open-Air-Konzerte. Der Senator für Kulturelle Angelegenheiten Volker Hassemer beauftragte den Neuen Berliner Kunstverein mit der Konzeption und Durchführung eines Skulpturenwegs, der durch die City führen sollte. Die Skulpturen wurden 1987 auf dem Kurfürstendamm aufgestellt und zeigten Wirkung. Vielleicht hat es im Nachkriegsdeutschland und bis jetzt in Berlin keine ähnlich heftige Auseinandersetzung über Kunstwerke im öffentlichen Raum gegeben, darüber, was Kunst darf, ob sie überhaupt etwas dürfen darf oder auch provozieren sollte. Zwei Skulpturen standen im Fokus: »2 Beton-Cadillacs in Form der nackten Maja« des Bildhauers Wolf Vostell, zwei in Beton gefügte Cadillacs auf dem Rathenauplatz, und die fast zwölf Meter hohe, aus Polizeiabsperrgittern und zwei Einkaufswagen bestehende Skulptur von Olaf Metzel auf dem Kurfürstendamm, direkt gegenüber vom Café Kranzler, erregten die Gemüter. Wo denn, bitteschön, hier irgendwelche Kunst zu sehen sei? Die Skulpturen waren plötzlich da, und fuhren wir mit dem Auto an einer von ihnen vorbei, gelang das nicht ohne einen Kommentar der Eltern, die sie anfangs ziemlich hässlich fanden und sich doch bemühten, uns Kindern zu verdeutlichen, dass Kunst ziemlich viel darf. Ich war fasziniert von diesen Skulpturen, von der Möglichkeit, Gegenstände ihrer Funktion zu entheben und etwas gänzlich anderes damit zu machen. Fast 25 Jahre später sollte es zu einem grauenhaften Backlash kommen. 350 sogenannte »Buddy Bären« wurden angemalt und in der Stadt aufgestellt. Es sollte Kunst sein, vielleicht ist es auch welche, und meine Toleranz ist groß und weit und farbig und reicht von Berlin bis Berlin, also einmal um den Erdball. Auch wenn ich diese Bären mitsamt ihrer Niedlichkeit und Regressivität abgrundtief verachte und wahrscheinlich auch die Menschen nicht mögen würde, die sie erfunden und aufgestellt haben, lebe ich mit ihnen, mit den Bären wie den Menschen, die sie erfanden, und achte darauf, so wenig Zeit wie möglich in ihrer Nähe verbringen zu müssen.
1987 war aber noch einiges mehr los: West-Berlin wurde von der CDU regiert. Eberhard Diepgen, der nichts sagte, auch wenn er sprach, und trotzdem Politik betrieb, war Bürgermeister. Vielleicht sind die Buddy Bären, wer weiß das schon, die logische Weiterentwicklung von Eberhard Diepgen. Heinrich Lummer, der Mann, der 1999 in einem rechtsextremen Verlag ein Buch mit dem Titel »Deutschland muss deutsch bleiben« veröffentlichte, im »Ostpreußenblatt« darlegte, dass Stalin und die US-Regierung die Vernichtung des deutschen Volkes durch erzwungene Einwanderung fremder Völker geplant haben, auch die türkische Einwanderung nach Deutschland sei darunter zu verstehen, war Innensenator. Und die von diesen Oberförstern regierte Stadt feierte 750. Geburtstag. Eine Volkszählung war ursprünglich für den April angesetzt und wurde heftig kritisiert und boykottiert – auch von einigen meiner Lehrer. Am 1. Mai wurde in den frühen Morgenstunden der Mehringhof, ein linkes Zentrum, von dem aus der Boykott organisiert wurde, mit der Begründung »Gefahr im Verzug« von der Polizei aufgebrochen und durchsucht. Daraufhin kam es erstmalig im Rahmen der 1. Mai-Demonstration in Kreuzberg zu Ausschreitungen, die so heftig wurden, dass sich die Polizei über Stunden aus dem östlichen Teil Kreuzbergs, der Gegend um die Skalitzer Straße, zurückzog. Über dreißig Geschäfte wurden geplündert, auch kleine Läden und der Bolle-Supermarkt am Görlitzer Bahnhof, der später in Flammen aufging und einstürzte. Erst Jahre später gestand ein Pyromane diese Tat, der für 350 Brände in Berlin und Süddeutschland verantwortlich war, unter anderem den des Blockhaus Nikolskoe, des Reetdachs des U-Bahnhofs Dahlem Dorf und einer Feuerwehrstation in Neukölln. Im Sommer 1990 wurde er festgenommen. In einem Interview mit der »taz« sagte er: »Am Kontrollpunkt in Dreilinden habe ich ein BVG-Häuschen angesteckt, einen Taxifahrer am Löschen gehindert und dann auf die Polizei gewartet. Ich brauchte Hilfe. Ich konnte und wollte nicht mehr weitermachen.« Seit diesem 1. Mai 1987 findet jedes Jahr eine Demonstration mit anschließenden Ausschreitungen und Kraftproben mit der Polizei in Kreuzberg statt. Es ist eine feste Verabredung, ein bisschen wie Weihnachten, Ostern oder der Geburtstag der Tante. Alle wissen, was passieren wird. Als Ronald Reagan im Juni 1987 nach West-Berlin kam und am Brandenburger Tor eine Rede hielt, in der er Michail Gorbatschow aufforderte: »Tear down this wall!«, demonstrierten 50 000 Menschen gegen seine Anwesenheit in der Stadt. Am Kurfürstendamm kam es zu Krawallen. Kreuzberg wurde vorsichtshalber hermetisch abgeriegelt, der Verkehr der U-Bahn-Linie 1 für drei Stunden eingestellt. Das war die Atmosphäre in West-Berlin im Jahr 1987, in der die Ausstellung »Topographie des Terrors«, seit vielen Jahren von Bürgerinitiativen gefordert, eröffnet wurde. Als einziger Repräsentant des Berliner Senats war Volker Hassemer bei der Eröffnung zugegen.
Ich fahre weiter neben der Autobahn. Ich habe die Glanzleistung vollbracht, mich bei 33 Grad im Schatten mit Socken, Turnschuhen und Jeans auf den Weg zu machen, und so suche ich mir einen Ort für eine Pause am Kanal. Als Erstes wasche ich mir die Sonnencreme und den verbliebenen Pappelflaum aus dem Gesicht und halte dann für eine Weile meine Füße ins Wasser. Neben mir eine Brombeerhecke, die aussieht wie eine Wucherung, hinter mir das Rauschen der Autobahn und vor mir das leise, langsame und glitzernde Fließen des Wassers. Weiter, einfach weiter. Ich stehe auf und überlege für einen Moment, umzukehren. Es ist viel zu warm für meinen Plan, heute so weit wie möglich zu kommen. Ein Segelboot, das durch einen kleinen Motor angetrieben wird, gleitet vorüber. Es ist dunkelblau. Die drei auf dem Boot tragen dunkelblaue Hosen, weiße Polohemden und grüne Schirmmützen. Die Frau steuert, die beiden Männer lümmeln an dem eingeklappten Segelmast. Weiter, einfach weiter.
Die Autobahn ist nun durch eine Mauer abgetrennt, auf die allerlei Graffitis gesprayt sind. Es ist ein guter Ort dafür, sicherlich kommt hier niemand in der Dunkelheit vorbei. Ein Jogger, der mich vor einer Weile, als ich unter der Brücke pausierte, in einem beachtlichen Tempo überholte, sitzt hechelnd auf einer der vier Holzbänke mit Blick auf den Kanal. Er trägt knallgelbe Joggingschuhe, die aussehen, als wären sie gestern Vormittag erst bei ihm angeliefert worden. Sicherlich hätten sie ihn weiterbringen sollen als bis zu dieser Bank. Wie bescheuert, denke ich, bei diesen Temperaturen zu joggen, und dann, jaja, ich fahre in Socken und Jeans durch die Gegend. Quer über den Asphalt hat jemand mit weißer Kreide geschrieben: »Wie wollen wir miteinander leben?« Hundert Meter weiter: »Finde Sinn«, wieder hundert Meter weiter: »Suche Wahrheit!« Gedanken, die hier vielleicht ohne die Erfahrung von Corona nicht stehen würden. Dann sind da plötzlich drei junge, gut aussehende Männer mit nackten Oberkörpern und schwarzen Badehosen neben dem Schriftzug »Brauchen Gemeinschaft«, was als kompaktes Bild etwas kitschig aussieht. Auf der anderen Seite befindet sich eine Industrieanlage mit fünf großen weißen, runden Tanks, die Mineralöle lagern, dicht nebeneinander direkt am Wasser. Sie spiegeln sich im Wasser, die Sonne scheint darauf, und alles sieht unwirklich überbelichtet aus. Unter der Massantebrücke steht eine Gruppe nasser Jugendlicher, die immer wieder in den Kanal springen und dann die steile, an der Mauer befestigte Leiter heraufklettern. Was sollen sie auch sonst machen? Das meiste, was mit Spaß zu tun hat, findet nicht statt oder ist untersagt, die Clubs sind geschlossen, die Kinos auch, Konzerte gibt es nicht. Aber zum Glück ist da dieser Kanal.
Es ist einer der ersten Tage der Sommerferien. Auf dem Mauerweg ist so viel los, als wäre eine ganze Kleinstadt unterwegs, und alle haben sie Satteltaschen, Trinkflaschen und Fahrräder, die aussehen, als könnten sie länger fahren als bis zum nächsten Supermarkt und wieder zurück. Und alle sehen entspannt und vor allem sportlich aus, selbst jene, denen von ganz alleine Bäuche gewachsen sind. Es ist eine schöne Atmosphäre auf diesem asphaltierten Weg. Brombeerbüsche neben Brombeerbüschen, die hohen Bäume bewegen sich leicht im Wind, und könnte wer die Autobahn etwas leiser stellen, wären die vielen Vögel besser zu hören, die in den Zweigen und in den Brombeerranken Rabatz machen. Der Lastkahn »Consensus«, der kurzzeitig Berühmtheit erlangte, als er vor ein paar Jahren unter der Jannowitzbrücke für ein paar Stunden stecken blieb, wird mit Rindenmulch beladen. Es staubt von der Laderampe. Es sieht aus, als würde dort etwas brennen und der Rauch zur Seite ziehen. Um einige Bäume, die direkt am Ufer wachsen, sind Biberschutzzäune errichtet worden.
Am Ernst-Ruska-Ufer Ecke Hermann-Dorner-Allee fahre ich unter der Brücke hindurch und amüsiere mich kurz über die vielen Schilder, die auf Flughafenhotels hinweisen. Auf der anderen Seite des Teltowkanals stehen zwei Männer vor der Sixt-Autovermietung, gelangweilt bis in die Kniekehlen, und rauchen. Der Parkplatz ist voll, es ist Corona, es ist nichts los. Wer mietet jetzt ein Auto, wer kommt jetzt mit dem Flugzeug an? Wer braucht jetzt Flughafenhotels? Hinter der Vermietung liegt ein idyllischer See, umgeben von meterhohem Schilf und einem massiven grünen Metallzaun, hinter dem ein Uferstreifen den See umringt, auf dem eine kleine Herde Schafe im Schatten liegt. Rechterhand ein Stück Berliner Mauer, vielleicht zwanzig Meter lang, eingezäunt von dem gleichen Modell Zaun. Auf der Westseite stehen Schrebergärten, dann ein dreißig Meter breiter Wiesengürtel, frisch gemäht, und ein paar neu gepflanzte Bäume. Auf der Ostseite kleine Einfamilienhäuser, eins wie das andere, dahinter ragen sagenhaft hässliche Hochhäuser in den blauen Himmel. Links wieder ein Lärmschutzwall mit der allgegenwärtigen Warntafel, und ja, schon gut, ich werde das Autobahngelände auf keinen Fall betreten. Die Hitze hat sich mittlerweile auf mich gelegt, doch zum Glück weht ein leichter Wind. Ich fahre langsamer, ich muss mir nichts beweisen, nirgendwo ankommen, der Weg ist klar, einfach weiter. Links die Ostplatte, rechts das Wasser und ein Schild: »Ausfahrt Schönefeld-Süd in 1500 Metern«. Die Autobahn biegt nach links, der Weg führt nach rechts. Ich sehe wieder zu den Plattenbauten.
Ich bin selbst in einem Wohnblock aufgewachsen, einer Westplatte, die zwischen sechs und acht Stockwerke hat. Auf diesem Gelände, in dem ein großer Innenhof mit zahlreichen Bäumen und eine Rodelbahn liegen, befand sich früher an der Ostseite eine Gärtnerei. Von dieser Gärtnerei waren seitlich des Areals, zwischen Zaun und Spielplatz, einige Apfel-, Pflaumen- und Marillenbäume stehen geblieben, auf denen wir im Sommer und Herbst herumkletterten und deren Früchte wir aßen. Jenseits des Zaunes lag ein verwildertes Grundstück, auf dem sich weiter hinten ein Gebäude befand, in dem Nonnen lebten. Es war eine Mutprobe höchsten Maßstabs, den Zaun zu überklettern und für einige Augenblicke auf der anderen Seite zu stehen. Es kursierten unter uns Kindern die wildesten Geschichten von Wachhunden und Kindern, die von den Nonnen geschnappt wurden und einen Mordsärger bekamen.
Wir waren eigentlich immer im Hof, bei Wind und Wetter. Wenn es regnete, stellten wir uns in den Hofeingängen unter und spielten Gummitwist. Waren wir nur zu zweit, öffneten wir das Gummi und banden es um eine der Säulen. War es sehr heiß, verbrannten wir mit einer Lupe auf dem Parkplatz das Unkraut, das zwischen den Steinen wuchs. Wir probierten es auch an Ameisen und Regenwürmern aus. Es funktionierte und ekelte mich. Ich liebte die heißen Tage sehr, ich war fast immer draußen, spielte mit den anderen Kindern Cowboy und Indianer, war meistens einer der Indianer und hatte eine Pistole, deren Munition ich bei Woolworth kaufte, hatte immer Schürfwunden an den Knien und mochte den Geruch der ersten dicken Regentropfen eines Gewitters. Ich unternahm für mich damals lange Fahrradfahrten zu einem Schreibwarenladen nach Marienfelde, der die Sachen im Angebot hatte, die alle hatten oder alle wollten, und so auch ich. Einmal kaufte ich dort einen Gürtelclip-Schlüsselanhänger, den es in verschiedenen Neonfarben gab. Ich nahm einen gelben. Den Plastikkarabiner befestigte ich an einer Gürtelschlaufe meiner Jeans, steckte das Schlüsselbund – bestehend aus Wohnungs-, Haustür- und Fahrradschlüssel – in die Hosentasche, und das gerollte gelbe Plastikband hing nun zwischen Schlaufe und Tasche und sah erwachsen und wichtig aus. Ein anderes Mal kaufte ich einen Zauberwurm, der aus einem flauschigen Material bestand und an dem ein kaum sichtbarer Nylonfaden befestigt war. Wir alle hatten einen Zauberwurm und zeigten einander damit Kunststücke. Wenn ich mich zu Hause am Nachmittag langweilte, und ich konnte mich prächtig langweilen, ging ich runter auf den großen Innenhof und traf auf andere Kinder, die sich ebenso prächtig langweilten. Rasch begannen wir etwas zu spielen. Wenn es Schnee gab, und es gab in meiner Erinnerung in jedem Winter Schnee, trafen wir uns an dem kleinen Rodelberg, der damals natürlich groß war. Ich ging erst wieder nach Hause, wenn es dunkel war und die Kälte zunahm, ich gegen einen Baum gefahren war, die Finger eisig kalt waren, meine Eltern mich zum Abendessen holten oder keiner mehr draußen war. Wenn wir Durst oder Hunger hatten, aßen wir Schnee.
An der offenen Nordseite des Hofes befand sich eine fußballfeldgroße Fläche, die verwildert war. Die Büsche und das Unkraut standen uns über die Köpfe, das Zentrum dieser Fläche bildeten mehrere Fliederbüsche, durch die wir zwei sich kreuzende Gänge gelaufen hatten. Eines Nachmittags – wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs – rissen wir uns Stöcke von den Büschen, entfernten die kleinen Zweige und hatten nun Waffen. Wir zogen krakeelend durch die Gänge. Das hier war unser Reich, nie betrat ein Erwachsener diese Fläche, selbst dann nicht, wenn einer von ihnen nach einem von uns suchte, weil das Abendessen auf dem Tisch stand. Der Erwachsene blieb am Rand stehen und rief den Namen des Kindes. Nun aber, an diesem Nachmittag, war diese Verabredung hinfällig. Ein Mann saß in dem Gang, durch den wir kamen, auf einem kleinen Teppich. Er saß auf den Knien und senkte immer wieder seinen Oberkörper, sodass seine Stirn den Teppich berührte. Wir starrten ihn eine Weile an, unsicher, in welche Situation wir da geraten waren. Dann sprachen wir ihn an. Er ignorierte uns, oder bemerkte er uns überhaupt nicht? Es war sehr unheimlich. Wir verharrten viele lange Sekunden, bis wir uns leise in den Gang, aus dem wir gekommen waren, zurückzogen. Erst nach ein paar Tagen erzählte ich meinen Eltern davon, und sie erklärten mir, dass der Mann nur einen ungestörten Platz zum Beten gesucht und wohl gedacht habe, er hätte einen gefunden. Ein paar Jahre später – ich war schon erwachsen, zumindest an manchen Tagen – wurde erst die Fläche gerodet, dann kamen Bagger, dann entstand ein Gebäude.
Es wird ländlich, mit großen Wiesen, auf denen Pferde stehen, die zum angrenzenden Milchhof Mendler gehören. Der Milchhof wurde 1930 in Schöneberg gegründet. Bis zu zweitausend dieser Betriebe, die größtenteils in Mietshäusern untergebracht waren, gab es damals in Berlin. Sie hatten zur Aufgabe, die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Kühe und Hühner wurden in Hinterhöfen gehalten, Schweine, die mit Küchenabfällen aus den Krankenhäusern in der Nähe gemästet wurden, im Keller. 1982 musste der Milchhof Mendler als letzter Betrieb im Rahmen der Berliner Stadtsanierung an seinen heutigen Standort umziehen, bewirtschaftete nun landwirtschaftliche Nutzfläche und vergrößerte seinen Viehbestand. Da Mitte der Neunzigerjahre das Verfüttern von Küchenabfällen verboten wurde, verlegte sich Mendler auf ein weiteres finanzielles Standbein: Pensionspferdehaltung und die Vermietung von Stallflächen.
Mir fällt der weitflächige Innenhof des Wohnblocks ein, in dem meine Oma wohnte: der Schrammblock, der 1925–30 erbaut wurde. Es ist ein Block, der bereits zu dieser Zeit eine Tiefgarage und Vorgärten hatte. Die Treppenhäuser sahen mies aus, obwohl natürlich alle Treppenhäuser von Mietshäusern in den Achtzigerjahren mies aussahen. Schaute ich aus den schmal geschnittenen Doppelfenstern der Wohnung, erblickte ich einen weiträumigen Innenhof, der aus nichts anderem bestand als einer verkarsteten Rasenfläche mit einem Müllhäuschen in der Mitte. Manchmal kam ein Leierkastenmann und drehte seine Runde im Innenhof, von Haus zu Haus. Meine Oma wickelte dann ein paar Groschen in Aluminiumpapier und meine Schwester oder ich durften das Geld zu ihm hinunterwerfen. Ich habe nie ein Kind in diesem Innenhof gesehen. Mit dem Namen Schrammblock wurde der Bauer Otto Schramm geehrt, der auf der Fläche des heutigen Volksparks Wilmersdorf eine Badeanstalt, das Seebad Wilmersdorf, sowie das Tanzlokal »Schramms Tanzpalast« bewirtschaftete. Schramm war einer der Bauern, die ihr Land, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts plötzlich in der Randlage des schnell wachsenden Berlins befand, für enorm viel Geld an Investoren verkauften. Diese Bauern wurden deshalb »Millionenbauern« genannt. Einer davon war Georg Blisse, nach dem die heutige Blissestraße benannt wurde.
Meine Oma lebte allein und sah viel aus dem Fenster auf die Straße, und manchmal vertrieb sie sich die Zeit damit, die Nummernschilder der Autos zu notieren, die durch ihre Straße fuhren. Sie war schwerhörig und ihr Fernseher dröhnte bis zu den Nachbarn, die sich irgendwann beschwerten. Mein Vater kaufte ihr Kopfhörer mit einem langen Kabel, das mich mächtig beeindruckte. Manche der älteren Kinder, die ich kannte, hatten bereits einen eigenen Walkman, doch die Kabel, die zu den Kopfhörern reichten, waren kurz. Die meiner Oma hätten jeden Vergleich gewonnen. Manchmal waren meine Schwester und ich für ein paar Stunden allein bei ihr und dann kochte sie Buchstabensuppe. Wir saßen am Küchentisch, von dem meine Oma die Decke abgenommen und der eine Resopal-Oberfläche hatte, suchten in der Suppe nach den passenden Buchstaben und legten Wörter am Rand der Suppenteller. Sie brühte sich manchmal Kaffee auf und vergaß ihn dann. Wenn sie ihn wiederentdeckte und einen Schluck davon nahm, sagte sie: »Kalter Kaffee macht schön!« Es ist ein Satz, den ich jedes Mal denke, wenn mir das gleiche passiert. Irgendwann verließ meine Oma ihre Wohnung nicht mehr. An jedem 24. Dezember gab es eine feste Tagesordnung: Wir besuchten sie am Vormittag und am Nachmittag kam mein Opa mit seiner Freundin zu uns. Als meine Oma im hohen Alter selbst mit Hilfe der Nachbarin, die in einem ähnlichen Alter war, nicht mehr zurechtkam, fanden meine Eltern für sie einen Platz in einem Altenheim in der Nähe unserer Wohnung. Wenn ich sie besuchte, schob ich sie in ihrem Rollstuhl durch den Garten. Ich setzte mich auf eine Bank, richtete den Rollstuhl so aus, dass wir uns sehen konnten, und erzählte ihr von meinem Alltag. Da ich mitten in der Pubertät war, müssen es interessante Geschichten gewesen sein. Sie reagierte fast nie auf das, was ich sagte, und ich wusste, ich konnte ihr alles Mögliche erzählen, niemand anderes würde es je erfahren. Ich erkannte an ihrer Mimik, dass es nicht wichtig war, was ich sagte. Es war, so hoffte ich, gut, dass ich da war und dass ich überhaupt mit ihr sprach.
Ich fahre ein Stück weiter, der Landschaftspark Rudow-Altglienicke schließt sich nahtlos an. Mein Blick geht in die Weite. Es ist irritierend, bin ich doch gerade noch kilometerlang neben der A 113 hergefahren und habe mich vergeblich bemüht, das Rauschen der Autos für das von Brandungswellen zu halten. Nun sehe ich eine Streuobstwiese, einen kleinen Tümpel, schief gewachsene Weiden und Schilf. Von einer breiten terrassierten Böschung aus, den Blick nach Westen gerichtet, kann man sicherlich gut beobachten, wie nach einem mit Hitze aufgeladenen Tag die Sonne niedergeht. Auf einem Schild steht, dass im Sommerhalbjahr eine Beweidung mit Wasserbüffeln stattfindet, doch ich sehe weit und breit keinen seiner Art, vielleicht auch wegen Corona, wer weiß. Ich halte an einem Imbiss, vor dem seitlich am Weg ein großes gelbes Schild steht: »Endlich wieder Erdbeerbowle!« In dem kleinen Vorgarten hängt über der gesperrten Bierbank, an der zwei Männer sitzen und Bier trinken, und ihre Gesichter sehen aus, als würden sie wenig anderes tun, das Schild: »Freibier gab’s gestern«. Ein Langnese-Mülleimer, dessen Farben ausgeblichen sind, steht neben dem Eingang. Ich nicke den Männern zu, sie nicken zurück. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und setze die Maske auf.
»Das brauchen Sie nicht. Nur, wenn Sie sich so besser fühlen«, sagt die Frau, die hier bedient.
Ich setze die Maske wieder ab.
»Currywurst oder Bowle?«, fragt sie.
Ich lache und bestelle eine Cola. Neben der Durchreiche, über der ein Plastikschutz hängt, steht seitlich ein Hertha-BSC-Maskottchen, auf dem steht ein Maskottchen von Union Berlin mit einem roten Knüppel in der Hand. Ich nehme die Cola und frage die Frau: »Und für wen sind Sie jetzt? Hertha oder Union?«
Die Frau winkt ab. »Das ist mir egal. Immer für den, der besser ist. Und Sie?«
Ich stelle die Flasche auf den Tresen und sehe sie ernst an: »Werder Bremen«
»Aua!«, sagt sie. »Das schaffen die nicht mehr!«
»Doch, doch, und in der nächsten Saison spielen sie oben mit, werden Sie sehen!«
Die Frau sieht mich derart belustigt an, dass es fast an Hohn grenzt.