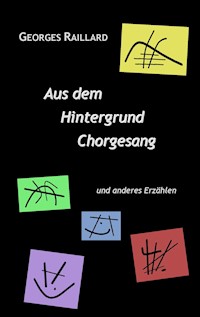Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus dem Alltag von Flussumleitern, Pflanzentänzern, Schlüsselfressern, Bücherbarbieren und schmetterlingstauglichen Welterrettern. "Schlimme Geschichte!", meinte jemand. "Alle Geschichten sind schlimm!", erwiderte er.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Raillard
Der Lauf des Amazonas
Geschichten
Books on Demand
INHALT
D
ER
L
AUF DES
A
MAZONAS
Der Lauf des Amazonas
Himmelblau
Der müde Pflanzentänzer
Im Schatten des Ölbaums
Der Welterretter
Trockenheit
Terrasse
50 Rappen
Die Hochzeitsnacht
Die WC-Spülung
Adressat
Die Förderung der schönen Künste
Der Pfeilmensch und der Menschpfeil
Der Beträuger und der Bedrohrer
Wortvögel
Die zuverlässigste Versicherung
Geistesgegenwart
Eine Heldin
Ausländerinnen
Schaum
Im Lift hinunter
L
ANUTTI, EINE
R
ANDFIGUR
Vorwort des Herausgebers
Gorilla-Vektor
Die Wunschmaschine
Schmetterlingstauglichkeit
Ernährungsgewohnheiten von Bienenköniginnen
Dunkelheit
Das Allzweckmedikament
Kleidophagie und ihre Eindämmung
Vaterschaft
Zeitschnecke
Eindringling
Vegetarier
Ikone XY: Stand der Diskussion
Gold und Rot
Engelberg
Der Reizdarm des Kolumbus
Ecken
Dessert
Nachwörter
N
OVEMBERGESCHICHTEN
Im Zentrum
Lavendel und Zypresse
Mann mit Mappe
Der Bücherbarbier
Ein Kamin
Sommerurlaub
Gabelung
Totenlichter
Mein Großvater
Spiegelgesicht
Wegbereiter
Über die Grenze
Liebeshaus
Friedhof
Nachtmaschine
Geheimnisgarten
Der Drache sitzt in der Mitte
Lebensmelodie
Im Tram
DER LAUF DES AMAZONAS
Der Lauf des Amazonas
Lag er schon länger wach? Von irgendwoher blubberte es; sonst frühmorgendliche Ruhe. Er wälzte sich aus dem Bett, trottete zum Fenster und streckte den Kopf hinaus. Überraschend floss der Amazonas nicht vor seinem Fenster vorüber. Sollte man mal ändern, dachte er; nach dem Frühstück vielleicht. Erleichtert und voller Befriedigung, als wäre mit diesem Gedanken das Große geleistet und, bis auf wenige unwesentliche Einzelheiten, vollendet, legte er sich wieder ins Bett und schlief noch lange, bevor er sich ans Werk machte.
Himmelblau
Der Isonius-Park wird im Volksmund auch Schönwetterpark genannt, denn an Tagen ohne Sonnenschein bleibt er bekanntlich geschlossen. Warum dies so ist und woher die Redensart stammt, darüber gibt sich allerdings kaum jemand Rechenschaft ab. Den Namen Isonius mag man noch mit Malerei in Verbindung bringen, aber mehr nicht. Höchste Zeit also, dass den geneigten Besuchern von nah und fern die wahre Geschichte der Entstehung dieses Parks zur Kenntnis gebracht wird.
Aderbald Isohn (latinisierend Isonius genannt) war in der Tat ein Maler, und zwar des 15. Jahrhunderts. Allerdings hat er kein einziges Bild gemalt. Fertiggemalt, müsste man sagen, denn eins, ein einziges, hat er angefangen zu malen, sein erstes. Es war schon recht weit gediehen und zeigte eine schöne Landschaft. Es fehlte nur noch der Himmel. Blau sollte er werden. Isonius blickte zum Himmel empor. Er band den Pinsel zuerst an eine Besenstange, dann an eine Bohnenstange, schließlich an einen langen Ast einer Eiche und versuchte, den Pinsel in den blauen Himmel zu tauchen. Doch der Pinsel blieb trocken. Womöglich begünstigt vom Herumwedeln des Pinsels in der Höhe, kam bald Wind auf, und der Wind brachte Regenwolken. Rasch stellte der Maler Zuber auf, in der Hoffnung, das Regenwasser enthalte etwas heruntergespültes Blau vom Himmel, wenn auch nur in Stäubchenform. Doch sooft er das aufgefangene Regenwasser auch umrührte, siebte und destillierte, es blieb farblos und durchsichtig.
Ein Nachbar erzählte ihm von einem blauen See in der Nähe. Sogleich fuhr der Maler mit einer großen Flasche hin. In der Tat, wunderbar blau lag der See vor ihm. Rasch füllte er die Flasche mit der kostbaren Flüssigkeit und ruhte vor dem Rückweg noch am Ufer aus. Doch wieder überzog sich der Himmel, das Wasser des Sees entfärbte sich von Blau über Grün zu Grau und ebenso das Wasser, das er in seine Flasche gefüllt hatte. Enttäuscht leerte er es aus und zottelte nach Hause.
Während er so lief, kam ihm eine Idee: Was im Fall des Sees möglich war, musste doch auch in einem Bild gelingen. Kaum angekommen, schabte er das obere Drittel des Bildes zu einer Vertiefung aus und leerte Wasser hinein. In der Tat: Der nach verzogenen Regenwolken wieder makellos prangende Himmel spiegelte sich im Wasser: Endlich überwölbte die gemalte Landschaft ein blauer Himmel! Aber kaum hängte er das Bild an die Wand, rann das Wasser aus der Vertiefung zu Boden.
Aufhängen konnte er den blauen Himmel nicht. Er musste horizontal malen. Da kam ihm eine neuerliche Idee. Was die Natur mit dem See konnte, konnte er auch. Mit einem Zaun aus Holzlatten steckte er ein großes Rechteck ab. Darin grub er kleine Täler und schüttete kleine Hügel auf. Er pflanzte Blumen und Büsche und Bäume. Er legte einen Teich an, dessen Wasser vom Zaun begrenzt wurde und den Himmel blau spiegelte. Zum Schluss vergoldete er die Latten des Zauns, wie er es mit dem Rahmen eines Bildes getan hätte – und fertig war das Gemälde, das ein Garten war!
Ob diese neue, von Isonius begründete Kunst „Gartenmalerei“ genannt werden sollte oder eher „Malgärtnerei“, darüber wurde trefflich und lange gestritten. Fraglos ist aber ihr Ergebnis, unser schöner Isoniuspark, einen Besuch wert – bei schönem Wetter!
Der müde Pflanzentänzer
Als der Tänzer noch kein Tänzer war, tanzte er aus lauter Lebensfreude. Unermüdlich schlugen seine Füße auf den Boden, pflügten die Erde, wirbelten die Krume auf – und siehe! Wo er hintrat, spross es aus dem Boden. Es wuchsen kleine Pflanzen und große, farbig blühende und blütenlose, fleischige und zarte. Keine Pflanze war gleich wie die andere, weil jeder Schritt und jeder Tritt des Tänzers anders war, neu, ein erfüllter Augenblick.
Sobald er aber Hunger hatte, aß er von den Früchten, die manche Pflanzen trugen.
Der Tänzer begann zu ermüden: erst nur ein bisschen in den Füßen und Beinen. Unwillkürlich tanzte er hin und wieder dieselben Schritte, wie ein Echo auf schon Getanztes. Seine Bewegungen begannen Muster zu bilden, was weniger Aufmerksamkeit erforderte. Die Pflanzen sprossen einförmiger unter seinen Füßen.
Er sah: Manche der sich wiederholenden Pflanzen trugen keine Früchte. Da bemühte er sich, diejenigen Schritte zu tanzen, die fruchttragende Pflanzen sprießen ließen.
Als der Tänzer so müde wurde, dass er nur noch wenig tanzen mochte und immer weniger Pflanzen wuchsen, überlegte er sich einen Ausweg. Er nahm je eine lange Stange in seine Hände und stocherte damit überall dort, wo er mit seinen müden Füßen nicht mehr hinlangte, im Boden. Er hielt die Stangen weit von seinem Körper ab und erreichte selbst Stellen, an die er früher, als er noch frisch gewesen war, nicht hingereicht hätte. Nun gediehen überall ähnliche Pflanzen, dem gleichförmigen Schlagen der Stangen auf den Boden entsprechend.
Ohne die Stangen wären weite Flächen verödet. So aber reifte Frucht im Übermaß.
Schließlich wurde der Tänzer zu müde, um seine Beine und Füße noch zu bewegen. Er setzte sich hin. Auch die Stangen waren ihm nun zu schwer. Dafür baute er eine Maschine, die für ihn über das Land tanzen sollte, ein spinnenbeiniges, sich fortbewegendes Gerüst. Er drückte den Knopf, die Maschine setzte sich klappernd in Bewegung. Jeder ihrer zahllosen Füße schlug unermüdlich auf den Boden, und Pflanzen schossen empor, ganze Felder, ganze Ländereien derselben fette Frucht tragenden Pflanze. Derweil schlummerte der Tänzer friedlich und erholte sich von den Strapazen.
Nach dem Schlaf fühlte sich der Tänzer wieder frisch und munter. Er wollte wieder tanzen, so spontan wie am Anfang. Aber überall hatte die Maschine schon getanzt und tanzte immer weiter und ließ ihm keinen freien Fleck mehr.
Im Schatten des Ölbaums
Der Ölbaum gibt ihnen Frucht und Fülle, sein Geäst spendet Schatten und Muße. Wo der Baum steht und wächst, sprosst und fruchtet, ist das Reich ihres Lebens; hier ruhen sie, hier essen sie, hier freuen sie sich und danken sie.
Die Mutter dankt dem Baum: „Im Schatten deiner Blätter fehlt es uns an nichts; gelobt sei die Sonne, die ihn gebiert!“
Der Vater dankt der Sonne: „Dein Licht gibt dem Baum die Kraft zum Wachsen und Gedeihen; gelobt sei sein Schatten, der uns vor deinem Feuer schützt!“
Sie hegen den Baum, der ihnen Schatten spendet, die Sonne, die ihnen das Licht sendet, und die Erde, auf die der Schatten fällt. Sie verzieren den Rand des Schattens mit bunten kleinen Steinen, ritzen mit Zweigen Zeichnungen in den sonnenbeschienen Staub, tanzen den Gang der Sonne und den Zug des Schattens und besingen das Reifen der Früchte.
Aus der dürren Weite erscheint ein Mann, fällt auf die Knie und ruft: „Oh Sonne, brenne jeden Flecken dieser Erde und tilge alle Schatten von ihm, auf dass er sich zur Reinheit des Lichtes, das du allein bist, erhebe!“
Voller Unmut sieht er die Menschen im Schatten des Ölbaums sitzen und sagt: „Unsere Ahnen lehren uns: Meidet die Schatten oder bekämpft sie, denn sie sind unrein und böse! Flieht das Dunkel, sucht das Helle! Licht und Glanz befördert, wo ihr steht und geht, Finsternis rottet aus, wo ihr sie seht!“
Schon schwingt er zornig die Axt, ihre Klinge dringt tief ins Holz. Der Ölbaum ächzt und schwankt, angstvoll kriechen die Menschen aus seinem Schatten. Endlich kracht er zu Boden; Krume, Sand und Staub wirbeln weit auf.
Der Mann hebt sein Gesicht empor: „Lass meinen Arm nicht erlahmen, solange die Kräfte der Finsternis nicht besiegt sind!“
Und seine Axt fällt die Pinie links, die Steineiche rechts, den Zitronenbaum hüben, die Dattelpalme drüben, sie schlägt und schlägt. Sie reißt die Schatten von den Menschen herab, treibt die Menschen aus den Schatten heraus.
Endlich liegen alle Bäume in seinem Umblick darnieder, sind ihre Schatten getilgt. Der Mann wirft sich dankend in den Staub: „Heil mir, dass ich als Helfer des Lichtes erwählt!“
Dann wird es Abend. Die Sonne sinkt zum Horizont, ihre Strahlen verglühen. Auf der Erde breitet sich Dämmerung, Düsternis, Dunkel aus. Der Mann springt auf: Hat er nicht alle Schatten vertrieben? Hat er nicht dem Licht zur vollkommenen Herrschaft verholfen? Noch krönt die Sonne orange die ferne Hügelkette, noch ist Zeit!
Los rennt der Mann, der Sonne nach. Durch Ebenen und über Berge rast er, damit ihm nie Nacht werde, in gewaltigen Schritten, fegt mit ausgebreiteten Armen dahin, in jeder Hand eine Axt, Büsche und Bäume am Wegesrand niedersäbelnd, eine Schneise der Schattenlosigkeit.
Und so zieht er um die ganze Erde, immer ist ihm Tag, die Reinheit des Lichtes.
Endlich hält er inne, erschöpft, die Hände in den Hüften, den Kopf im Nacken, um Atem ringend. Hoch steht die Sonne am Himmel. Dann lässt er den Oberkörper nach vorn fallen, die Hände auf die Knie gestützt, er kommt langsam wieder zu Kräften. Auf dem Boden sieht er einen Schatten. Es ist sein Schatten. Erschrocken richtet er sich auf: Es ist sein Schatten, nun länger. Er bückt sich wieder: Es ist sein Schatten, jetzt zusammengedrückt. Es ist der Schatten, den er wirft.
Aufrecht steht er da, drückt die Brust heraus, er versteckt sich nicht. Licht ist Licht, er dagegen, auch er ist Finsternis. Schon holt er aus, das Schwert in der Hand, seine Spitze gegen sich gewendet.
„Freue dich am Licht, statt den Schatten zu ächten!“, ruft der Vater.
„Freue dich am Schatten, statt das Licht zu entfesseln!“, ruft die Mutter.
Der Schatten ihrer Bäume beraubt, stehen die Menschen beieinander in der Sonne. Auch sie werfen Schatten, jeder den seinen. Nur einen Augenblick hält der Mann inne. Dann holt er erneut aus, sein Arm wird länger und stärker, das Schwert in seiner Hand größer und mächtiger, seine Klinge saust durch die Luft, schlägt rundum die Köpfe ab, bevor es an den Ursprung, die Mitte seiner Kraft, seiner Bewegung, seines Schwungs, seines rasenden Schattens, zurückkehrt und sie durchbohrt, und endlich wirft nichts einen Schatten mehr.
Der Welterretter
Eines Tages beschloss Alois, die Welt zu retten. Er legte die Stirn in Falten, um darüber nachzusinnen, wie dies zu bewerkstelligen wäre. Schritt für Schritt entwarf er seinen Plan. Endlich, nach langen Stunden und vielen Tassen Kaffee und süßen Fettklößchen, die er sich von seiner Frau brühen, braten und bringen ließ, war der Plan fertig. Sogleich machte er sich daran, alles Nötige in die Wege zu leiten, um ihn in die Tat umzusetzen.
„So kann ich nicht in die Hauptstadt!“, schrie er und streckte seiner Frau anklagend dreckverspritzte Schuhe entgegen.
„Kannst ja barfuß gehen!“, schrie seine Frau zurück. „Bin ich deine Magd? Hättest deine Schuhe selber putzen können, statt auf der faulen Haut zu liegen!“
„Merkst du denn nicht, jede Minute zählt! Putze ich jetzt noch meine Schuhe, verliere ich unaufholbare Zeit; gehe ich mit dreckigen Schuhen in die Hauptstadt, werde ich nicht anerkannt und hochgeschätzt und kann nichts bewirken!“
Er schlug sich die Hände vor das Gesicht.
„Der Weltuntergang ist nicht mehr abzuwenden! Du bist schuld daran, du allein, du Weltmörderin!“
Er rannte ins Schlafzimmer, vergrub seinen Kopf unter der Bettdecke und sprach an diesem Tag kein Wort mehr.
Am folgenden Tag war die Welt zum Glück doch noch nicht untergegangen, weil in der Zwischenzeit jemand