
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Es war einmal im Herbst
- Sprache: Deutsch
Die 60er Jahre: eine Zeit des Umbruchs und der Rebellion. Zehn Jahre vor Edas erster Begegnung mit Jamie erlebt sie ihre turbulenten Jugendjahre inmitten von Rock 'n' Roll und Flower-Power auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Als ihr Vater schon früh von ihr geht, muss Eda lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist konfliktreich und auch ihre Schwester Ortrud versucht, sich ihr immer wieder in den Weg zu stellen. Ein Glück, dass sie Freunde an ihrer Seite hat. Doch werden ihre Mühen reichen, ihren verschollenen Vater wiederzufinden? Eine Geschichte über das Lernen und Leiden in der Jugend, von den ersten Erfüllungen und Enttäuschungen, über Trennung und Wiedersehen, Freundschaft und Liebe. Es war einmal im Herbst - Band III Die beiden finalen Akte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Richard Isenheim wurde 1997 in Bietigheim-Bissingen geboren, dessen historische Altstadt maßgeblichen Einfluss auf den Schreibprozess nahm. Im Großraum Stuttgart verbrachte er die ersten vierzehn Jahre seines Lebens, bis er mit seiner Familie in den Landkreis Sigmaringen zog. Dort beendete er die Realschule, um anschließend ein technisches Gymnasium zu besuchen. Schon im Alter von dreizehn Jahren begann Isenheim mit der Schreiberei. In seinen Geschichten stehen tiefe Charakterwandlungen, wahre Freundschaften und die Höhen und Tiefen des Lebens im Vordergrund.
Mein Dank
an alle, die bis zum Schluss
Vertrauen zeigten
und der Geschichte und mir
die Treue hielten.
Ich wünsche noch einmal
schöne Stunden beim Lesen.
Ihr
Richard Isenheim
Inhalt
IV. AKT
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
V. AKT
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Epilog
IV. AKT
Mai 1979
Frühling – das Ende allen Winterleides. Und doch ging der Harfenton unberührt an ihm vorüber.
Jamie stand vor Edas Grab. Seit ihrem Tod im Herbst waren inzwischen ein und ein halbes Jahr vergangen. Bisher hatte er es nicht verkraftet, sie zu besuchen; geschweige denn das Grab zu pflegen. Trotzdem zierten Efeu und blaue Blumen die dunkle Erde. Eine kleine Laterne brannte in der Mitte. Jemand musste hier gewesen sein, um an seiner Statt das Unkraut zu jäten, neue Blumen zu setzen und alte auszuwurzeln.
Er war ein schlechter Mensch! Einer dieser Witwer, denen nachgesagt wurde, zu schnell über den Tod eines geliebten Menschen hinweggekommen zu sein. Doch solche, die derart sprachen, lagen im Unrecht. Ihr Tod fühlte sich am heutigen Tag noch genau so an als wäre es erst gestern gewesen. Noch immer verfolgte ihn die Frage nach dem Warum. Warum hatte sie es getan? Warum auf diese Art?—
Obgleich er sie verstehen konnte, wollte er die Wahrheit nicht anerkennen. Seine Frau war krank geworden und das Wissen über ihren Tod seit Jahren bekannt. Was für ein Mensch wäre er, würde er sie dafür verfluchen, den Weg lediglich verkürzt zu haben? Aber warum Eda? Sie, gerade sie, die stets die Stärkere von beiden war; selbst in der Stunde ihrer größten Not.
Eda war kein Feigling, sondern eine Kämpferin gewesen; obgleich von Feigheit nicht die Rede sein konnte.
Da spürte er die Gegenwart einer Frau, die einige Meter hinter ihm zum Stehen kam.
»Das ist ein schönes Grab«, sagte sie und kam einen Schritt näher. Jamie sah über die Schulter, doch er erkannte im Augenwinkel nur Umrisse. Die Frau kam langsam heran. Sie trug langes, helles Haar.
»Danke…«
Er hatte die Hände in den Hosentaschen, sein Haupt war weiter gen Boden geneigt.
»Hier liegt meine Ehefrau«, ergänzte er schließlich.
»Das tut mir leid.«
Ein tiefes Seufzen kam über seine Lippen. »Sie hat den Tod einfach nicht verdient…«
Die Frau schluckte, ehe sie antwortete: »Wer hat das schon…«
»Es heißt«, fuhr er danach fort, »nur die Guten sterben jung. Doch sie war mehr als das! Ich habe sie verehrt wie keinen anderen! Sie war eine starke Frau – die stärkste, die ich kannte!«
Die Frau neigte sich ein Stück nach vorn, um die Inschrift auf der Kupfertafel zu lesen: »Der Tod scheidet; der Tod vereint.«
»Darf ich fragen: Wie ist sie gestorben?«
Jamie seufzte. Noch immer schenkte er ihr keinen Blick.
»Sie hat sich mit dem Auto das Leben genommen.«
»Was?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht!«
Wie bitte? Er war neugierig geworden und wandte sich um.
»Die Eda, die ich kannte«, fuhr sie fort, »würde sich nie das Leben nehmen.«
»Wer sind Sie?«
Die blonde Frau lächelte. »Mein Name ist Johanna Neumann. Eda war meine beste Freundin. Wir kannten uns aus der Schule.«
Mit diesen Worten reichte sie ihm die Hand und er sah ihr in die Augen. Ihr Blick war liebenswürdig und gütig; genau wie der von Eda immer war.—
Eine Freundin? Eda hatte ihm nie irgendwelche Freundinnen vorgestellt.
»Johanna, aha.« Er erwiderte den Händedruck. »Jamie Winter. Schön Sie kennenzulernen.«
»Die Freude ist ganz meinerseits!«
Die Frau, die sich Johanna nannte, blickte für einen Moment in den Himmel. Die Sonne war hinter einigen Wolken hervorgekommen und ließ ihre Strahlen wärmend auf ihre Gesichter fallen. Heute war ein schöner Tag.—
»Eda«, begann sie schließlich, »hat sich nicht das Leben genommen. Wenn ich eines über sie weiß, dann ist es das.«
Darauf seufzte er. »Das hatte ich auch geglaubt.« Und er senkte das Haupt. »Ich hatte gedacht, ich kenne sie und weiß, was in ihr vorgeht, doch ich habe mich geirrt…«
»Jamie, du hast dich nicht geirrt!« Johanna schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was genau passiert ist –und ich muss es auch nicht– aber ich kannte Eda und ich weiß, dass sie sich nicht das Leben genommen hat!«
Er schnaubte. »Was wissen Sie über meine Frau, das ich nicht weiß?«
Doch sie trotzte dem Spott und lächelte. »Ich schätze, ich weiß eine ganze Menge. Schließlich habe ich mit Eda meine Jugend erlebt. Ich habe sie lachen, weinen und toben gesehen. Und ich weiß auch, dass sie über so vieles nicht sprechen wollte. Ich weiß, was Eda für ein Mensch war.«
Es war als wollte er etwas sagen, doch Jamie blieb stumm.
»Haben Sie sich nie gefragt, warum Eda nichts über ihre Jugend erzählt hat; warum sie bei bestimmten Dingen immer ausgewichen ist?«
Jamie schluckte, sein Blick war auf den Boden gerichtet, als er die Verse eines Gedichtes hörte wie die Noten einer vergessenen Melodie. Die Worte stiegen über Johannas Lippen, langsam und bedacht.
»Schon ins Land der Pyramiden flohn die Störche übers Meer;
Schwalbenflug ist längst geschieden—«
»—auch die Lerche… singt nicht mehr.«
Sein Blick funkelte, dann trat er einen Schritt nach vorn. »Bitte erzählen Sie mir mehr!«
Eins
Eda fuhr mit Fernlicht durch die Nacht. Ihre Hände umklammerten das Lenkrad, während sie kerzensteif vor dem Steuer saß. Herannahende Lichter, wie grelle Augen, hinterließen blendende Fackeln auf ihren Brillengläsern. War die Straße ohne den Regen nicht schon unübersichtlich genug? Doch das Wasser prasselte wie aus Eimern auf die Scheibe.
»Konzentrier dich, Eda, konzentrier dich!«, ermahnte sie sich selbst. »Schau auf den rechten Rand, lass dich nicht irritieren!« Sie wiederholte die Worte ihres Fahrlehrers, der ihr diesmal keinen Beistand leisten konnte. In dieser Nacht fuhr sie allein in ihrem silbernen VW Käfer.
Von hinten nahte sich ein grelles Licht, das immer heller und größer wurde, bis der Mercedes auf einen halben Meter hinten auffuhr. Der Fahrer scherte zum Überholen aus.
»Konzentrier dich auf den rechten Rand! Nicht in die Scheinwerfer sehen… Verdammt, Fernlicht aus!«
Doch innerhalb von wenigen Sekunden war der Mercedes zu zwei kleinen roten Punkten zusammengeschrumpft, die im Nebel schließlich ganz verschwanden.
Bald war ein Ortsschild zu sehen. Eda bremste und bog ab. Nun wurden die Straßen kleiner und der Asphalt allmählich durch Kies ersetzt. Die vereinzelten Autos, die am Straßenrand parkten, verengten den Weg umso mehr. Sie musste sich mühen, nicht vom Weg abzukommen, der es in seiner Breite bald un-möglich machte, dass sich zwei Fahrräder gefahrlos entgegenkommen konnten.
Dann eine enge Linkskurve, die auf eine steile Straße führte. Der Motor begann an Kraft zu verlieren, war kurz davor abzuschalten, als sie in den ersten Gang zurückschaltete. »Ja ja, ich schalt ja schon…«
Eda verließ wieder die Ortschaft, fuhr in Richtung Waldrand. Schließlich hielt sie an, doch blieb einen Moment sitzen. Ein tiefer Atemzug und sie nahm sich die Brille ab, legte sie ins Handschuhfach und verließ das Auto. Als sie unter freiem Himmel stand, fühlte sie, wie ihr ganzer Körper einen dünnen Schweißfilm trug. Die Luft war noch immer warm und schwül.
Ein kurzer Moment, in dem sie ihre Hände in die Hüfte stemmte und einen scheinbar bedeutungslosen Blick in Richtung der Häuser warf. Dann, als wäre sie aus einem tiefen Gedanken gerissen, schüttelte sie ihren Kopf, verschloss das Auto und ging die Straße hinunter. Ein erfrischender Windstoß kam ihr entgegen, worauf sie genüsslich die Augen schloss. Sie hatte schon den ganzen Tag auf eine kühle Nacht gewartet, wo es doch schon seit der frühen Mittagszeit derart warm und gewittrig war.
Da erreichte sie die Türschwelle. Das Licht ging an und sie sah sich selbst im Glas der Haustür. Es lag eine gewisse Ausdruckslosigkeit in ihrem Gesicht. Ihr Mund war leicht geöffnet; und doch schien eine Deutungshoheit in ihren ebenmäßigen Zügen zu liegen. Es war mehr als der schlichte Wunsch eines jungen Mädchens anderen gefallen zu wollen. Die saphirblauen Augen blickten sie müde und doch tiefgründig im Spiegelbild an. Ein buntes Haarband schmückte ihren Kopf, während ihr der Pony bis über die Augen-brauen reichte. Eda hatte Schlaghosen an und trug eine groovy Flower-Power-Tunika mit Clox-Schuhen.
Es dauerte einen Moment, bis sie die Tür öffnete und hineinging; und es war, als wäre sie dabei bemüht so unauffällig wie möglich zu sein. Eda machte kein Licht, als sie durch den Hausgang schlich und langsam und bedacht hinter sich die Wohnungstür schloss. Ihr Blick folgte dem unbeleuchteten Flur. Von der Stube aus fiel Licht ins Esszimmer. Auf dem Tisch stand noch irgendwelches Geschirr vom Mittag. Das Geräusch eines laufenden Fernsehers war zu hören. Ihre Mutter war also noch wach. Anders im Zimmer ihrer Schwester, wo durch die angelehnte Tür nur Dunkelheit zu sehen war.
Eda ging in ihr Zimmer, wo sie hinter sich die Tür zuzog. Der Raum war nicht besonders groß und geräumig, aber dennoch wohnlich eingerichtet. Die Glühbirne an der Decke war von einem bunten Lampenschirm umgeben. Ebenso farbenfroh waren die Vorhänge mit ihren Retro-Mustern sowie die Tapete und der Bettüberzug. Auf einem kleinen Schrank stand eine Vase mit einer Grünlilie, darüber ein Setzkasten mit verschiedenen Porzellanfiguren, Stickereien und bunten Knöpfen. Ein alter Sessel stand in einer letzten freien Nische zwischen Kommode und Schreibtisch, dessen Oberfläche zur Hälfte von einem Plattenspieler eingenommen wurde.
Kaum war Eda in ihrem Zimmer, ließ sie sich in die weiche Bettwäsche fallen. Ein Lächeln der Erleichterung lag auf ihren Lippen und sie schloss langsam die Augen.
Plötzlich ein lauter Stoß. Die Tür öffnete sich. Der laute Ton ließ sie hochfahren.
»Wo bist du gewesen und was schleichst du einfach in dein Zimmer?«
»Ich war bei Freunden…«, raunte sie mit dünner Stimme.
»Das seh ich!«
Eda schwieg. Stattdessen ließ sie sich wieder zurück in ihre Bettwäsche fallen. Ihre Mutter kam herein.
»Das muss aufhören mit diesem Ausgehen bis in die Puppen! Weißt du eigentlich, wie spät es ist?«
»Ja ja, noch früh genug, Maria.«
Da türmte sich ihre Mutter bedrohlich vor ihr auf.
»Nein, Eda, das hört jetzt auf! Du bist von nun an spätestens um dreiundzwanzig Uhr zu Hause!«
Wie spät war es überhaupt? Ein Uhr? Zwei Uhr? Eda warf einen Blick auf ihren Wecker. Es war zehn Minuten nach eins. In weniger als fünf Stunden würde der Wecker klingeln. Oh ja, sie würde es bereuen.–
»Und nenn mich nicht Maria, ich bin schließlich deine Mutter!«
»Ja, Maria!«
»Nein, ich mein es ernst!«, erwiderte sie. »Ich werd dich noch über‘s Knie legen müssen, egal wie alt du jetzt bist.«
»Ich bin achtzehn, Mutter!… Außerdem arbeite ich.–«
»Aber du lebst in meinem Haus und hast deine Füße unter meinem Tisch!«
»Dein Haus?«, raunte sie. »Das hat Vater mit Opa zusammen aufgebaut.«
»Junges Fräulein, ich sag dir jetzt eins!«
Sie nickte. »Aha?«
»Wenn sich bis morgen dein Benehmen nicht bessert und du dich nicht endlich disziplinierter gibst, war es das mit der Verköstigung.«
»Du wolltest mich sowieso schon lange los haben, ist es nicht so?«
Ein kurzer Moment der Stille.
»Eda?«
»Das ist nicht erst seit gestern so.« Dabei setzte sie sich auf und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. »Seit wann eigentlich?« Ihr Blick schweifte nachdenklich durch den Raum. Eda konnte kaum noch einen rechten Gedanken fassen, ihre Augen brannten, der Kopf schmerzte, die Müdigkeit war kurz davor sie zu überrennen.
»Eigentlich seitdem Vater weg ist… Nein, länger schon.–«
»In Ordnung!« Ihre Mutter hob mahnend den Zeigefinger. »Heute noch! Heute Nacht lass ich mir das noch gefallen, aber morgen! Morgen…« Ihre Mutter wandte sich von ihr ab, dann hielt sie nochmals inne. »Warum riecht es hier drin eigentlich so beißend? So nach fauligem Gras… Lüftest du nicht?«
Sie schluckte. »Wer lässt denn das Geschirr seit vorgestern auf dem Tisch stehen?«, fragte Eda. »Ich bin euch zwei ja nur noch am Hinterherräumen! Wann macht Ortrud mal einen Finger für uns krumm?«
Marias Lippen bebten. Sie rang sichtlich nach Worten. »Weißt du, was dir fehlt?«
»Was?«
»Ein strenger Vater, der dir zeigt, wo‘s langgeht.«
»Ein Vater…«, schnaubte Eda, nicht sicher, ob sie lachen oder weinen sollte. »Du suchst doch nur einen, der mir den Hintern versohlt, wenn ich nicht nach deiner Pfeife tanze! Du bist nur zu feige, es selbst zu tun!«
»Willst du es drauf anlegen?«
Eda zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Versuch‘s doch!«
Wieder der mahnende Zeigefinger, wieder die Drohung, die keine Wirkung mehr zeigte. »Du wirst schon noch sehen!«
Die Tür ging zu, so laut, wie sie geöffnet worden war.
Erleichterung ging durch ihre Brust, als sie tief durchatmete und die Augen schloss. Am liebsten wäre sie noch bei ihren Freunden, würde ihre Sommerferien genießen und sich keine Sorgen um das Später machen; noch über das Wie und Was und Überhaupt. Die Wahrheit sah anders aus. Morgen früh war Montag und sie musste um sieben bei der Arbeit sein. Eda musste einen beruhigenden Gedanken fassen, um einschlafen zu können. Doch auch wenn ihr die Bilder vom Abend noch immer im Kopf herumschwirrten, konnten sie nicht das Unbehagen über eine weitere sinnlose Arbeitswoche übertönen. Vor einer Stunde noch lag sie in einem bequemen Sitzkissen bei entspannender Beat-Musik. Sie saß in einer Garage, rings um sie waren weitere Leute.
René, ein schmaler Junge mit Schlaghosen, Schnürhemd und Jackett lag auf einem alten Sofa; seine Linke stützte den Kopf, die andere hing leger zu Boden.
Auf einem ebenso abgenutzten Sessel saß ihre beste Freundin Johanna.
Jemand spielte auf der Gitarre. Es war Jörg, der als Einziger auf einem nicht gepolsterten Stuhl saß und ein paar Rhythmen ausprobierte. Eine Zigarette steckte in seinem Mundwinkel und blonde Bartstoppeln bedeckten sein Gesicht.
Eine bemerkenswert tiefe Stimme durchkreuzte das Gitarrenspiel. »Joe! Mach mal das Radio an!«, sagte René.
»Warum ich?«, konterte das blonde Mädchen.
»Warum ich?«, fragte er stattdessen und ging auf Blickkontakt.
»Du bist näher.«
»Aber mir gehört die Garage.«
Johanna gab sich geschlagen. Lustlos trottete sie zum anderen Ende des Raums an Renés Sofa vorbei zum Radio.
»Dufte!« René erhob sich. Die beiden standen sich gegenüber. Der schmächtige Junge war kaum größer als das Mädchen. Trotz des markanten Kehlkopfs fiel es schwer, anzunehmen, dass dem jugendlichen Gesicht mit dem braunen Pilzkopf eine solch tiefe Stimme zugeordnet war. Und doch ging etwas Rhetorisches von ihm aus, etwas Überzeugendes, das ihn trotz seiner energielosen Schulterhaltung zum Rädelsführer seiner Sippe machte. Er nickte grüßend, als Johanna vor ihm stehen blieb. Schließlich ging sie an ihm vorbei.
»Oh Mann, ich krieg Hunger«, sagte er und ging zum Tisch hinüber, auf dem das Radio stand, öffnete eine der Schubladen und zog eine versteckte Büchse heraus. Eda öffnete ein Auge und spähte zu ihm hinüber. Obwohl sie nichts sah, wusste sie, was er tat. Nach einer Weile stellte er das Etui zurück und verschloss die Schublade mit einem Schlüssel. Als er sich umdrehte, steckte ihm eine Zigarette im Mund. Renè tastete sich nach einem Feuerzeug ab. Er hob die Augenbrauen, als er Edas Blick bemerkte. Als er dann fündig wurde und die Tüte anzündete, ließ er sich überirdisch entspannt auf seinem Sofa nieder, den Stängel zwischen Daumen und Zeigefinger haltend.
»Dufte…«, wiederholte er. »Ich bin bedient, astrein!«
Johanna stand wieder vor ihm. »Hey!«
»Hi!«, nickte er und sah sie voller Seelenruhe von oben bis unten an. Schließlich nahm er einen weiteren Zug und reichte ihr dann die Zigarette. Auch sie nahm einen kräftigen Zug, legte den Kopf in den Nacken und schaukelte mit den Schultern.
»Eda?«
Sie schaute auf. Johanna kam ihr entgegen und reichte ihr den Joint. Wortlos führte sie ihn zwischen ihre Lippen und schloss dabei die Lider, zog ihre Augenbrauen zusammen, bis sich ihre Gesichtsmuskeln wieder entspannten. Danach öffnete sie ihre Augen und tat für einen Moment nichts außer zu atmen. Im Anschluss reichte sie den Joint weiter nach links, wo ihn Jörg durch seine Zigarette ersetzte, die er unbekümmert auf den Boden warf und mit der Schuhspitze ausdrückte.
René schrie auf. »Spinnst du, Mann? Das is‘ mein Boden…« Doch sogleich beruhigte er sich wieder. »Egal, entspannen wir uns einfach!«
»Eda sieht entspannt aus.«
Als sie ihren Namen hörte, öffnete sie wieder ihre Augen. Johanna sah sie neugierig an.
»Hm?«
Sie schniefte irritiert und blinzelte einige Male, was Johanna zum Lachen brachte.
»Hartes Zeug, was?«
»Ist das neu?«
René nickte.
»Ja, neuer Stoff. Erst gestern gekauft.«
Sodann meldete sich Jörg zu Wort. »Jetzt hab ich‘s!«
»Du hast was?«
»Ich hab den Beat raus!«, und er spielte Twist & Shout auf der Gitarre. Ab der Mitte des Songs setzte René mit dem Gesang ein:
»Well, shake it up, baby, now!«
Seine rauchige Stimme imitierte heute Abend hervorragend die von John Lennon.
»Bombastisch!«
Sie lachten allesamt.
»Wir werden vielleicht doch noch eine Band!«, meinte René tollkühn.
Jörg schüttelte den Kopf. »Ne, ne, lass ma‘!«
»Komm schon, Junge! Wo is‘ der Rocker in dir?«
»Wie wird das eigentlich«, fragte Johanna nachdenklich, »wenn wir bald studieren?«
Ein entsetzter Blick auf das Mädchen.
»Was soll‘n dann sein?«
»Na ja, wir haben das Abitur hinter uns, René. Jetzt geht‘s weiter!«
»Abitur?«, frage Jörg. »Lang ist‘s her. War das überhaupt noch in diesem Leben?«
Sie lachten.
»Wenn ich noch mal was davon brauch‘«, fuhr er fort, »dann gebt mir bitte Bescheid! Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Aber ich übernehm‘ ja eh den Laden von meinem Vater. Was ist eigentlich mit euch?«
René kratzte sich am Hinterkopf. Um nichts sagen zu müssen, nickte er schließlich Johanna zu.
»Na ja«, meinte sie. »Ich hab mich für Mathe beworben…«
Ein kurzer Moment absoluter Stille, bis ein Aufschrei des Entsetzens durch den Raum ging. René schrie am lautesten.
»Also, dass du bekifft bist, das wussten wir ja, aber…«
Eda grinste.
Johanna begann zu lachen. »Du hättest gerade dein Gesicht sehen müssen, René. Du bist voll drauf reingefallen.«
Wieder kratzte er sich nichtssagend am Hinterkopf. Allein Edas Gesichtsausdruck verriet, dass sie den Scherz durchschaut hatte.
»Eda versteht mich«, und sie neigte sich ihr zu, so als wollte sie sie umarmen. Die beiden Mädchen lächelten einander an. »Ach Eda, mein Schwesterherz.–«
René nickte ihr zu. »Was ist eigentlich mit dir, Eda?«
Die Blicke waren nun auf sie gerichtet.
»Hm«, machte sie. »Ich weiß nich‘ so recht.«
»Jaaa! Das ist der richtige Hippie!«
»Nein, nein, René«, wehrte sie ab. »Es is‘ nicht so, dass ich mich ‘n Scheiß drum scheren würde; ich weiß bloß nich‘, ob ich zum Studieren genug Geld zusammenkrieg.«
»Du arbeitest doch im Moment in dieser Reifenfirma, nö?«
»Ja, aber«, unterbrach ihn Johanna, »die paar Kröten reichen sicher nicht für vier Jahre Uni.«
»Hm, ich müsste dann halt an den Wochenenden arbeiten.«
»Supa!«, machte er ironisch.
Seufzend klopfte sie auf ihr Sitzkissen. »Ach Leute, ich bin doch selber hin- und hergerissen.«
»Verunsicher sie doch nicht, René!«
»Tu ich nich‘, Jörg.«
»Ne, ihr verunsichert mich nicht, ihr erinnert mich bloß dran, dass ich es bin.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Ich würd‘ ja am liebsten Literatur oder so was studieren oder Germanistik; meinetwegen auch Romanistik.«
»Natürlich, war klar«, nickte er einsichtig.
Jörg beugte sich nach vorn. »Hattest du denn wirklich ‘ne eins Komma null in Deutsch?«
Sie nickte kleinlaut.
»Dufte!«
»Toff!«
»Leute, Leute!«, zog Johanna die Aufmerksamkeit auf sich. »Ich hab die Note gesehen, schwarz auf weiß! Ich kann‘s bezeugen!«
»Bombastisch!«
»Na ja«, beschwichtigte sie. »Dafür war Mathe nur ‘ne Zwei komme acht und von Geschichte will ich gar nicht erst anfangen…«
»‘Ne Zwei Komma acht in Mathe…« René lachte ungläubig. »Ich hatte ‘ne Drei Komma sechs!«
»Warum machst‘n du dich eigentlich immer so schlecht, Eda?«
Darauf sah sie Jörg an. »Ach, ich weiß ja nich‘. Es gibt immer irgendwen, der besser is‘ als ich.«
»Ja klar, aber…«
René reichte ihr einen noch gänzlich neuen Stängel. »Nimm! Den hast du dir verdient!«
»Besser nicht«, wehrte sie erschreckt ab. »Wenn meine Mutter das mitkriegt…«
»Macht sie dir immer noch Schwierigkeiten?«
Sie schaute ihrer Freundin in die Augen. »Jeden Tag. Deshalb bin ich doch hier.«
Johanna seufzte.
»Und wir sind für dich da!«, sagte Jörg. Johanna und René stimmten ihr bei.
»Es ist eh schon viel zu spät«, meinte sie. »Ich muss morgen raus!«
»Eh! Das kommt jetzt aber flott.«
Eda war aufgestanden und hatte nach ihren Schlüsseln gegriffen, die auf einem Regal unter Renés Beatles-Poster im XXL-Format lagen.
»Warte, ich komm noch mit zur Tür!«, sagte ihre Freundin.
»Danke euch!«
»Kein Thema!«
Alsbald standen die beiden vor der Garage. Der silberne Käfer parkte vor der Einfahrt.
»Du rufst an, wenn was is‘ ?!« In der Dunkelheit konnte sie nur unklar die Züge ihrer Freundin erkennen. Doch sie nickte und sah ihr dabei in die Augen.
Johannas Hand strich ihr sanft über den Rücken mit dem Blick in Richtung des Wagens.
Zuneigung… Eda verspürte eine Erleichterung in ihrer Brust.
»Und Jakob hat dir den wirklich den ganzen Sommer ausgeliehen?«
Der Blick war auf den Käfer gerichtet. Sie nickte stolz. »Ja, den ganzen August.« Ein zufriedenes Lächeln lag auf ihren Zügen.
»Puh, das ist echt…«
»…dufte, ja.«
Einen Moment lang blieben die beiden Mädchen wortlos vor dem Käfer stehen.
»Was sagt deine Mutter eigentlich dazu?«
»Sie weiß nichts davon«, schüttelte sie unmittelbar den Kopf. »Ich park weiter draußen, kurz vor‘m Wald.«
»Und wie machst du ihr das klar? Ich mein, du arbeitest ja. Wie lautet die offizielle Ausrede, wie du da hinkommst?«
»Na, mit dem Fahrrad!« Sie grinste. »So wie ich auch zur Schule kam.«
»Das glaubt sie dir? Das ist schon ein Stück zum Fahren, nö?«
Eda zuckte mit den Schultern. »Ja, am andern Ende der Stadt. Zur Schule waren‘s drei, vielleicht vier Kilometer. So sind‘s gleich mal sieben oder acht, jap.«
Johanna nickte.
»Auf der anderen Seite… ich hätt‘ schon einiges mehr auf ‘er Hand am Ende vom Monat, wenn ich doch lieber ohne–«
»Eda!«, unterbrach sie sie. »Du hast verzichtet, seitdem ich dich kenn‘! Den kleinen Komfort wirst du dir doch noch gönnen dürfen. Wie lang arbeitest du noch? Vier Monate?«
Sie schüttelte den Kopf. »Bis Ende Februar, Anfang März, wenn das Sommersemester losgeht. Du weißt ja, da sind die NCs ‘n wenig tiefer gesetzt.«
»Ja ja«, nickte sie, »schon klar… Aber dann arbeitest du ja den ganzen Winter über, oder? Da kannste unmöglich mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit fahren.«
»Zur Schule ging‘s ja auch…«
Johanna blickte sie ungläubig an, so als sähe sie eine religiöse Selbstgeißlerin vor sich.
Eda fuhr leise fort: »Aber so ‘ne Karre bei Jakob zu leihen is‘ billiger als eine zu kaufen. Müsste ich ihn selber anmelden, auf meinen Namen versichern, dies und das und haste nich‘ gesehen …ich will‘s mir gar nicht ausmalen. –Heh! Was grinste denn jetzt so?«
»Ich glaub, er mag dich.«
Sie schaute zur Seite weg. Hoffentlich konnte man in der Dunkelheit ihre Wangen nicht sehen.–
»Auf jeden Fall nicht auf die Art, wie du das jetzt meinst.«
»Woher willst‘n du das wissen?«
»Er hat ‘ne Freundin. Schon vergessen?«
»Was hat das damit zu tun?«
»Na, ‘ne ganze Menge! Nö?«
»Ach Kleine!«, seufzte ihre Freundin und legte ihr den Arm um die Schulter. »Ich mag dich!«
Ihre Stimme klang anschmiegsam. »Ich mag dich auch, Hanna!«
Einen Moment lang schauten die beiden Mädchen in den Mond, der an diesem glasklaren Sternenhimmel diesmal so gut zu sehen war. Eda löste sich schließlich wieder. »Ich wünsch dir was, ja!«
»Ja, Eda, ich dir auch!« Joe war wie aus einem Tagtraum wachgerüttelt. »Komm gut heim!«—
Eda wachte auf. Das Licht brannte noch. Sie hatte sich noch nicht einmal umgezogen. Schlaftrunken taumelte sie zum Lichtschalter und schließlich zurück ins Bett, wo sie sich nur die Hosen auszog und sich in ihrer Flower-Tunika zur Seite drehte; ihre beiden Hände unter ihr Gesicht gelegt. Eda atmete ein paar Mal tief durch.
»Keine Angst«, sagte sie sich. »Nächste Woche wird schon nich‘ so schlimm…«
In Wahrheit war sie sich dessen nicht sicher und versuchte darum an einen schönen Moment zu denken. Zum Beispiel an die Tage, wenn sie nach Hause kam, ohne von ihrer Mutter oder Schwester beschimpft zu werden. Doch es gab in Wahrheit nur eine Art von Erinnerung, die ihre Brust aufatmen ließ: ihr Vater.
»Vati, wo bist du bloß?« Eine Träne lief ihr über die Wange. »Vati…«
Seit fast vier Jahren hatten sie sich nicht mehr gesehen. Inzwischen war es August 1963.
In dieser Nacht träumte sie von ihm.—
øøø
»Wie hättest du dieses Leben gelebt,
ohne ein kleines bisschen zu verderben?
Hast du je einen Handwerker
im weißen Hemd gesehen?«
Zwei
Es war einmal im Herbst des Jahres 1951. Einer der letzten warmen Tage im September ging zur Neige, als die Sonne in Richtung Horizont wanderte und das Firmament in einen roten Schleier hüllte. Es war ein schöner Abend. Eine Blaskapelle spielte inmitten des kleinen Dorfes ein Lied, während ein Greifvogel majestätisch über die Häuser segelte. Ein Ruf der Freiheit kam über den Schnabel des stolzen Tieres, der hinaus über die weiten Landstriche der Wiese erschallte, dem nahen Waldrund entgegen, wo ein kleines Mädchen inmitten des hohen Grases einen Baum umarmte. Unsägliches Glück lag auf den zarten Zügen des Kindes, dessen Arme kaum den breiten Stamm umgreifen konnten. Ein Kranz aus Blumen schmückte ihr edles Haupt und langes braunes Haar wallte an ihrem weißen Kleid herunter. Sie drückte ihr Gesicht an die dunkle, warme Rinde und spürte Heimat und war so unsäglich dankbar in diesem Augenblick.—
In der Ferne ertönte der Kirchturm. Sechs Glockenschläge drangen bis in die Lichtung vor, wo sogleich die Augen des Mädchens zu funkeln begannen. Ihre Lippen öffneten sich und die weißen Zähnchen waren zu sehen. Auf dem Kindermund hob sich ein schelmisches und erwartungsvolles Lächeln ab. Woran musste sie gerade denken?—
Sodann löste sie ihren Griff und rannte durch das hohe Gras dem Dorf entgegen. Die bunten Blumen auf der Wiese streiften ihre Knöchel, bis hinauf zu den Knien; weiterhin mit dem unbekümmerten Lächeln auf ihren Lippen.
Sie erreichte das Dorf, wo die Musik immer lauter wurde. Die flinken kleinen Füße gingen über den Kopfstein der Straße, am Marktplatz vorbei, wo die Blaskapelle spielte. Einige wohlige Blicke trafen das Mädchen, welches schier unermüdlich an der Kirche vorbeieilte. Der Duft von Blumen und Kaffee kam ihr auf der Straße entgegen. Dazu der Klang von kleinen Vögelchen, die wohlklingend von den Dächern zwitscherten. Aus einem Fenster blickte eine Magd, die einen Teppich ausschüttelte. Sie begann zu lachen, als sie das Nachbars-Mädchen erkannte.
»Hallo Eda!«, grüßte sie.
Doch Eda schien den Gruß nicht gehört zu haben, denn sie hing an einem Gedanken fest.—
Der Geruch von Kartoffelsuppe stieg ihr in die Nase, als sie in die Stube kam. Aus der Küche her ertönte der sanfte Gesang ihrer Mutter.
»Hallo Kleines!«, sagte sie, als die zarte Gestalt ihrer Tochter unerwartet in der Tür stand und die Mutter anlächelte.
»Willst du schon mal den Tisch decken, Eda?«
Das sanfte Haupt antwortete mit einem Nicken. Von der hohen Theke nahm sie sechs Teller und Besteck, welches sie auf den Esstisch stellte und sortierte.
»Darf ich draußen warten, bis Vati kommt?«
Die Mutter gewährte mit einem Nicken bei geschlossenen Augen.
Froh begab sich Eda hüpfend wieder vor die Tür, wo sie sich auf der Eingangsstufe niederließ. Hockend stützte sie die Arme in ihre Schenkel und legte das Kinn auf ihre Hände.
Eda kam aus einer Arbeiterfamilie. Sie hatten nie viel Geld und doch führten sie ein schönes und zufriedenes Familienleben.—
Schließlich waren Motorengeräusche zu hören, die ihre Aufmerksamkeit weckten. Ein gelber Personenbus bog in die Straße ein. Wieder das Funkeln in ihren Augen und sie war auf den Beinen.
Das Fahrzeug hielt an und ein junger Mann stieg aus.
»Vati!«, rief Eda und sprang dem Mann in den Arm. Dieser konnte gerade noch rechtzeitig reagieren und seine Tochter im Sprung auffangen.
»Na, mein Himmelslicht!«, lachte er. »Warum denn so sehnsüchtig heute?«
Ein amüsierter Blick des Fahrers, der gleich den Wagen wieder in Gang setzte und mit den anderen Arbeitern weiterfuhr.
Die Blicke der beiden trafen sich; die braunen, geduldigen Augen des Vaters und die königsblauen Augen der Tochter, die vor Freude strahlten.
›Himmelslicht‹, dachte Eda, die sich darunter nichts Richtiges vorstellen konnte, doch jedes Mal ein einzigartiges Gefühl von Schutz und Höhe empfand.
»Wollen wir reingehen?«, fragte der Vater freundlich.
Eda nickte.
Inzwischen waren die Großeltern zu Tisch gekommen. Sie grüßten Eda und den Vater bei ihrem Eintreten. Die Mutter brachte den Topf mit der Suppe, während Edas Schwester Ortrud an Mutters Rockzipfel hing.
»Hallo Liebling!«, grüßte die Mutter den Vater und küsste ihren vom Staub eingehüllten Ehemann auf den Mund.
Die Schwester machte leise »Bäh!«, während sich Eda nach einem kurzen Blick verständnisvoll abwandte. Daraufhin setzte sie sich neben ihren Großvater auf die Eckbank, der ihr behutsam durchs Haar streifte.
»Du hast ja Ungeziefer auf dem Kopf!«, lachte er und zeigte ihr den kleinen Marienkäfer. »Du bringst ja alles Mögliche von draußen mit ins Haus, Eda!« Er schloss mit einem unbekümmerten Lachen.
Es neigte sich die Großmutter nach vorn, um an ihrem Gatten vorbei ihre Enkelin betrachten zu können. »Hat Eda sich denn schon auf Zecken abgesucht?«
Da nahm sie ihre Beine auf die Sitzfläche und rieb sie oberflächlich ab. Dann blickte sie ihre Großmutter an und nickte schelmisch. Ihr Blick wechselte zu ihrem Vater, der schmackhaft an der Suppe roch und mit einem zufriedenen Lächeln seine Frau ansah.
Nachdem Eda rasch ihren Teller ausgegessen hatte, schlüpfte sie unter dem Tisch hinweg. Sie setzte sich vor die Hintertür, um sich den Sonnenuntergang anzusehen.
Die Familie hatte einen kleinen Garten, der für die Aufzucht einiger Gemüsesträucher reichte, doch Edas wahres Reich war die große Landschaft hinter dem Haus; die Wiesen und Wälder.—
Im Frühjahr und Sommer konnte sie nichts und niemand im Haus halten – außer vielleicht ihr Vater, wenn er von der Arbeit kam. Nun, nach dem Abendessen verbrachte sie gewöhnlich noch etwas Zeit im Garten oder vor dem Haus, ohne allzu weit hinauszugehen. Nach einer Weile hörte sie leise Schritte hinter sich. Ihr Vater kam hinzu und setzte sich neben sie auf den Treppenstein. Für eine Weile schauten die beiden schweigsam dem Sonnenuntergang entgegen, bis er schließlich zu sprechen begann.
»Freust du dich schon auf die Schule?«, fragte er munter.
Eda senkte den Kopf und zupfte still an den Blütenblättern eines Gänseblümchens, das vorhin noch ein Teil ihres Haarkranzes gewesen war.
»Mach dir keine Sorgen!«, sprach er schließlich und legte sacht seinen Arm um seine Tochter. Nach einer Weile kamen ein paar Worte über ihre Lippen.
»Ich mag nicht in die Schule. Ich mag lieber draußen mit den Blumen und Tierchen spielen.«
Ihr Vater atmete heiter aus.
»Das kann ich verstehen.«
Nach einer Weile setzte er hinzu: »Aber nichts bleibt ewig, so wie‘s ist. Alles ist Veränderungen unterworfen.«
»Ich mag keine Veränderungen…«
»Aber Veränderungen müssen nichts Schlechtes bedeuten. Veränderungen sind auch was Gutes. Sie gehören zum Leben. Sie bringen dich voran!«
»Ich bin jetzt glücklich…«, raunte sie. »Genau jetzt!«
»Das«, sagte er betont, »wird sich hoffentlich nie ändern.« Er schloss mit einem Lächeln.
»Ist das echt so, wie alle sagen?«
»Was denn, mein Himmelslicht?«
»Dass man in der Schule sitzen und gehorchen muss?«
Der Vater schluckte. »Du wirst noch genug Zeit dazu haben, draußen in der Natur zu spielen, da bin ich mir sicher.«
Eda schüttelte den Kopf. »Das meine ich nicht… Ich hab gehört, dass die Schule echt langweilig ist und man immer aufpassen muss, ob man mag oder nicht.«
Der Vater runzelte die Stirn. Schließlich sagte er: »Die Schule hat auch gute Seiten. Du kommst mit anderen Kindern zusammen, lernst Lesen und Schreiben.«
Eda nickte lustig. »Hm, ich kann lesen!«
»Wirklich?«, scherzte der Vater. »Heimlich geübt, was?«
»Ich hab schon das ganze Dschungelbuch durchgelesen!«, sagte sie stolz.
»Ah ja? Wann denn das?«
»Als du bei der Arbeit warst und draußen schlechtes Wetter war!« Sie hob dazu das Kinn.
»Ich kann dir sogar den allerersten Satz vorsagen!«
»Na dann…«
Eda räusperte sich.
»Nun bringt der Weih die dunkle Nacht,
Und »Mang«, die Fledermaus, erwacht.«
»Sehr schön!«, lobte er seine Tochter. »Und wie geht‘s weiter?«
Beinahe zeitgleich auf die Frage begann Eda vorzusagen:
»Der Stall birgt alles Herdentier,
Denn bis zum Morgen herrschen wir!
Die Stunde stolzer Kraft hebt an
Für Prankenhieb und scharfen Zahn.
Jagdheil! und kühn gehetzt, gerafft:
Das Dschungelrecht ist jetzt in Kraft!«
Vater und Tochter sagten gemeinsam das Gedicht auf, bis schließlich hinter ihnen Edas Schwester auftauchte.
»Na, Ortrud!«, sprach ihr Vater und wollte den freien Arm um seine andere Tochter legen, doch Ortrud wehrte sich dagegen. Stattdessen gab sie Eda einen Tritt in den Rücken.
»Hey, was soll das?«, fuhr er auf. Eda sagte nichts, sondern gab beim Stoß ein leises Raunen von sich.
»Was soll das?«, fragte er erneut. »Was ist in dich gefahren, Kind?«
Ortrud erhob die Stimme zu einem Vorwurf: »Papa soll nicht immer nur mit Eda spielen!«
»Setz dich doch zu uns!«, bat er sie freundlich. »Keiner wird hier bevorzugt; weder Eda noch Ortrud noch eure Mutter.«
Widerwillig, aber schweigend tat Ortrud, wie ihr geheißen wurde. Doch es war ruhig. Kein Wort wurde mehr gewechselt. Der Vater brach die Stille, in dem er sprach: »War heute etwas zwischen euch zwei?«
»Ne, Eda is‘ doch immer draußen bei den Reh‘n.«
Der Vater zuckte mit den Schultern, als hinter ihm die Mutter auftauchte. »Hagen, Schatz, hast du kurz einen Moment?«
Dieser nickte. »Natürlich, Maria.«
Ein enttäuschter Blick Ortruds verfolgte den sehr rasch aufgestanden Vater, während Eda mit dem Finger über einen der Backsteine strich, die zu einer Treppe vor der Tür aufgestellt waren. Danach betrachtete sie ihren Finger, als wollte sie wissen, ob er sich durch die Berührung rot gefärbt hatte. Sie bemerkte den Blick ihrer Schwester, den sie schließlich teilte. Eine Art Missgunst lag auf den Zügen der Vierjährigen, die ihre Beine schaukeln ließ. Mit ruhigem Blick beobachtete Eda ihre Schwester und wirkte dabei ganz und gar bedacht, so als würde sie ihre Gedanken lesen und gleichzeitig die eigenen vor Ortrud abschirmen. Schließlich streckte sie ihr die Zunge heraus.
»Du darfst nicht so eifersüchtig sein!«, wandte sie ihren Blick von ihr ab.
»Ich bin nicht eifersüchtig!«
Eda schwieg und schaute in die Ferne. Mit ihrem Blick war es, als schweife ihre Seele zurück über die weiten Landstriche, wo die Wälder lagen, wo die Wiesen und Heiden im Winde wogen. Was war die Schule für ein Ort, wo es keine Tiere, keine Pflanzen gab, mit denen man sich leise unterhielt? Doch ohne zu sprechen, ohne zu flüstern. Eda war gespannt auf die Schule, doch auch ein Unwohlsein schwang in diesem Empfinden mit. Warum verstand keiner, dass sie wunschlos glücklich war? Ja, es war notwendig, es war ein Muss, doch was gab es bloß, das sie nicht auch genauso gut zu Hause lernen konnte? Mutter konnte kochen und wusste, wie der Haushalt zu führen war, Großmutter konnte backen und wusste, wie man näht. Eines Tages, wenn Eda älter wäre, würde sie ihr beibringen, wie man die Nähmaschine benutzte. Wie man mit Nadel und Faden umging, das wusste Eda schon. Genauso, wie man laut Großvater Karten las und sich beim Wandern nicht verlaufen konnte. Sicher konnte Opa ihr auch beibringen, wie man in der Werkstatt arbeitet. Vielleicht eines Tages auch, wie man rechnet. Alles andere lernte sie von Vati. Er konnte lesen und schreiben und wusste so viele interessante Dinge, wenn sie mit ihm alleine war; vor allem aber draußen im Wald. Doch eines wollte er ihr nicht sagen, eines, das auch Opa, Oma und Mutti nicht verraten wollten. Ihre Augen weiteten sich. Vielleicht würde sie in der Schule erfahren, was »der Krieg« ist?! Jeder sprach davon, aber keiner wollte es erklären. Es hieß stets nur »der Krieg«. Danach wurde es still und niemand wollte mehr ein Wort darüber verlieren. Vater hatte einmal nach einem langen Seufzer gesagt: »Krieg ist etwas Scheußliches.« Mehr hatte sie nicht aus ihm herausgebracht. Der Wald ist etwas Schönes. In der Schule gibt es keinen Wald. Ist Schule daher Krieg? Ist Krieg also ein Wort, das alles das beschreibt, was scheußlich ist? Streit, Eifersucht, Erkältungen? Ja, so musste es sein! Toiletten waren Krieg! Genau! Wobei… das konnte nicht ganz stimmen. Sirenen! Eda dachte an die Sirenen, die jeden Samstag angingen. Die Antwort war immer, dass man prüfen wollte, ob diese noch täten, damit sie im Ernstfall funktionierten. Doch was war dieser Ernstfall? Auch darauf hatte sie nie eine aufklärende Antwort erhalten. Hatten Sirenen und Krieg etwas miteinander zu tun?
Plötzlich wurde Eda aus ihren Gedanken gerissen. Opa hatte das Radio eingeschaltet und sich in die Stube gesetzt. Eda schaute zu ihrer Rechten. Sie war also so sehr in ihre Gedanken vertieft gewesen, dass sie gar nicht bemerkt hatte, wie ihre Schwester hineingegangen war und nun auf Opas Schoß saß.
Vom Radio her ertönte muntere Blasmusik, bis schließlich ein paar Minuten später Großmutter, Mutter und Vater sich in die Stube setzten und auf die Nachrichten warteten. Die Neue Deutsche Wochenschau eröffnete mit lauter Musik. Eda bemerkte im Augenwinkel, wie Ortrud zu den Noten schaukelte. Auch Großvater saß mit einem Schmunzeln da. Nun erklang die Stimme des Sprechers:
»Bundespräsident Heuss kam zu den Berliner Festwochen in die Vier-Sektoren-Stadt. Zehntausende haben sich vor dem Berliner Rathaus, dem Sitz des freien Berliner Senats, eingefunden, um der Enthüllung einer Friedrich-Ebert-Büste durch den Bundespräsidenten beizuwohnen. Professor Heuss sagte: ›Wir wollen das Bild Eberts wieder ins Licht rücken.‹
Auf dem Messegelände am Funkturm wurde der internationale Autosalon 1951 eröffnet. Dreihundert Firmen schickten ihre besten Spitzenfabrikate. Besondere Beachtung fand eine deutsche Volkswagen-Limousine für den Kaiser von Abessinien.—«
»Abessinien?«, rief Ortrud dazwischen und auch Eda zog ein verwirrtes Gesicht, nur dass dies keiner sehen konnte.
Wieder die Stimme des Nachrichtensprechers, während die Musik anschwoll: »Das Gesicht des modernen Kraftwagens!«
»Wir brauchen«, sprach Großmutter, »einen Fernseher!« Sie gluckste zum Schluss und von Opa war ein bewilligendes Schmunzeln zu hören.
»Das kulturelle und gesellschaftliche Ereignis der Berliner Festwochen war die Eröffnung des neuen Schiller-Theaters, das als modernstes deutsches Schauspielhaus gilt und mit der größten Bühne Europas ausgestattet ist. Beethovens Neunte Symphonie unter Wilhelm Furtwängler war die festliche Ouvertüre.« Erneut schwoll die Musik an.
Beethovens Neunte Symphonie…, dachte Eda schwerfällig nach.
»Dann wurde in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste Schillers Wilhelm Tell aufgeführt. Hier einige Szenen.«
Nun waren laute Töne zu hören, die Eda nicht recht einordnen konnte; wohl war das keinem in der Familie möglich, ohne ein Bild zu sehen, doch die lauten Geräusche ließen Unbehagen in Eda aufkeimen. Es klang, als würden in einem Streit Gegenstände geworfen werden, während Männer wild durcheinanderschrien. Schließlich wechselte die Geräuschkulisse zu einem neuen Musikstück.
»In San Francisco wurden…« Eda hörte nicht länger hin. Ihr Blick war wieder in die Ferne geschweift, wo sie die letzten Augenblicke des Sonnenuntergangs beobachtete. Nur noch eine Verdichtung von rotem Licht am Horizont war zu sehen auf bleiernem, tiefblauen Grund. Musste nicht der Mond auf der anderen Seite des Hauses nun aufgegangen sein? Eda setzte sich in Bewegung und eilte unter gleichgültigen Blicken der anderen in die Küche. Durch das Fenster hindurch wollte sie gen Osten blicken, doch konnte wegen den vielen Häusern den Horizont nicht sehen. Kurz enttäuscht, doch sogleich wieder munter, kam sie zurück in die Stube.
Opa sprach: »Ja ja, so ist das.«
»So ist was?«, fragte Ortrud und schaute ihren Großvater keck von unten an. Sie saß noch immer auf seinem Schoß.
»Ach!«, machte er zur Antwort. »Das sage ich nur immer so. Das weißt du doch!«
Die Kleine gab ein Lachen von sich.
»Nun, die Musik von damals…«, begann Großmutter, »damals, als die Sendung noch Deutsche Wochenschau hieß, also noch nicht Neue Deutsche Wochenschau, ja, da gefiel mir die Musik noch ein wenig besser.«
Vater gab eine leise Antwort von sich, während er das Kinn auf seine Brust legte: »Das war wohl auch das Einzige, das besser war.«
»Ja ja!«, erwiderte sie. »Mehr will ich ja auch nicht gutheißen, Hagen!«
Eda, die lauschend im Türrahmen stand, konnte sich der Frage nicht enthalten und sprach: »War das noch im Krieg?«
Plötzlich war es still. Es folgten erschreckte Blicke, die nicht recht wussten, was sie ansehen sollten. Nur Vater schaute seine Tochter mit warmen und vertrauensvollen Augen an.
»Ja«, sagte er ruhig, ohne den Blick von ihr zu lassen.
Ihr schelmisches Lächeln verwandelte sich danach in eine enttäuschte Miene. Im Anschluss ließ sie entrüstet die Schultern sinken.
Großvater sprach: »Irgendwann musst du es ihr sagen, Hagen.«
Er bejahte. »Ja. Irgendwann.«
Darauf nahm sie eine stramme Haltung ein. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, um danach wieder zu entspannen.
»Warum nicht jetzt?«
Die Blicke waren nun ihr gewidmet. Auch Mutter wandte sich entsetzt in ihrem Sessel um, dessen Rückenlehne in Edas Richtung zeigte.
»In der Schule werde ich das nämlich sowieso fragen!«
»Eda?« Ihr Vater hob erwartungsvoll das Kinn. Als sie ihm in die Augen sah, ergänzte er: »Setz dich!« Die Stimme klang weder wütend noch erfreulich. Sie klang ernst und doch bewusst. Eda tat wie ihr geheißen wurde und sie setzte sich neben Hagen auf das Sofa.
»Mein Himmelslicht«, begann er und seine warmen Augen sahen in die ihren. »Es gibt manche Dinge, die du noch nicht verstehst, die deine junge Seele noch nicht verkraftet.«
Eda schluckte. Der Gedanke gefiel ihr nicht. Er war wie etwas Fremdes, das von außen in sie eindringen wollte. Doch sie fühlte auch, wie dieses Etwas nicht an sie herankommen konnte. Sie fühlte sich sicher; ihr Vater war bei ihr.—
Nach einer Weile der Stille ergriff Eda das Wort. »Und… was ist dann Krieg?«
Hagens Blick traf den Marias, dann atmete er tief durch.
»Ich werde es dir erzählen, wenn du älter bist.« Dabei sah er seiner Tochter tief in die Augen. »Versprochen!«
Ein Moment verging, in dem Eda regungslos seinen Blick erwiderte. Woran dachte sie gerade? Schließlich nickte sie. »Verstehe.«
»Aber du musst dir keine Sorgen machen. Der Krieg ging vor sechs Jahren zu Ende.«
Mutter zog Edas Aufmerksamkeit mit einem heiteren Lächeln auf sich. »Und dann kamst du zur Welt.«
Eda lachte. »Weil ihr froh ward, dass der Krieg fertig war?«
Opa gab ein Glucksen von sich. Edas Blick wurde daraufhin wieder nachdenklicher.
»Wie kam ich denn zur Welt?«
»Na der Storch!«, rief Ortrud. »Der Storch, du Dummkopf!«
»Ortrud!«, schalt ihre Mutter sie.
Abseits davon zuckte Vater mit den Schultern. Ein Grinsen lag auf seinen Lippen und Eda schaute ihn erwartungsvoll an. »Na ja, so wie die Kinder rauskommen, kommen sie auch irgendwie rein.«
Ein Schmunzeln lag auf Opas Mund, Oma räusperte sich und Mutti kniff die Augenbrauen zusammen. Doch Eda gab sich zufrieden.
»Und… und…«
»Eda!«, mahnte ihre Mutter gereizt. »Würdest du bitte?«
Opa wehrte ab. »Nein, nein, lass das Kind schon fragen, sonst wird nichts aus ihr.«
Eda freute sich über die Bemerkung und konnte das Lächeln nicht unterdrücken, als Großvater ihr obendrein zuzwinkerte.
»Also… äh«, stammelte sie, um wieder zurück zu ihrer Frage zu kommen. »Was ist Beethovens neunte Symphonie?«
Es war still im Raum geworden. Doch diesmal, weil man nicht wusste, wie man die Frage beantworten sollte.
»Eine Symphonie«, begann Opa, »ist ein Musikstück.«
Doch Oma unterbrach ihn:
»Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium.«
Sie stoppte. »Das ist Beethovens Neunte.«
»Ein Gedicht?«, fragte Eda.
»Nein«, sagte Opa. »Eine Symphonie! Das ist ein Musikstück, das über eine Stunde geht und aus vier Sätzen besteht. Und einer davon, der vierte Satz, der letzte Satz, der enthält Schillers Ode an die Freude. Und die fängt so an, wie deine Großmutter gerade angedeutet hat.«
»Schiller…«, nuschelte Eda.
Nun neigte sich ihr Vater wieder zu ihr. Er sprach betont: »Das lernst du alles in der Schule, mein Himmelslicht!«
Und Eda begann zu lächeln. »Jetzt will ich doch in die Schule gehen!«
Der Rest am Tisch lachte.
»Ja ja, eine reine Kinderseele ist mit nichts auf dieser Welt vergleichbar«, lachte Großvater, mit den Händen auf dem Bauch gefaltet.
»Ja, ja«, machte Großmutter. »Unsere Eda ist schlau! Das hab ich aber schon von Anfang an gesagt! Es dünkt mir immer, sie interessiert sich nicht für das, was gesprochen wird, und doch hört sie ganz genau zu. Man muss nur darauf achten, wenn sie still da hockt; dann horcht sie nämlich!«
Eda wurde rot, doch erschrak beim Blick ihrer Schwester.
»Ortrud ist auch schlau!« Eda war bemüht, lauter zu sprechen als sonst, damit sie sich trotz ihrer zarten Stimme im Gelächter Gehör verschaffen konnte.
»Aber selbstverständlich!«, lachte Oma und kniff der Kleinen in die Wange, was ihren wütenden Blick auf Eda noch verstärkte. Edas Ohren wurden heißer, als sie verstand, dass es damit noch schlimmer gemacht hatte. Das puttenartige Gesicht mit den blonden Locken starrte seine ältere Schwester zornig an. Eda versuchte es mit einem sanften, mitleidvollen Blick, der jedoch vergebens an Ortrud zerschellte.—
»So!« Maria klopfte sich auf die Beine. »Schlafenszeit, Kinder!«
Eda musste unwillkürlich das Gesicht verziehen, sodass sie für kurze Zeit abgelenkt war.
»Doch doch, immer wenn es am schönsten ist!«, wiederholte Mutter und war zusammen mit Großvater aufgestanden, der Ortrud an den Händen in Richtung Kinderstube geleitete.
Ein sehnsüchtiger Blick von Eda fiel auf ihren Vater, der wortlos mit einem kurzen Blick verstand und ihr folgte. Sie ging voraus, doch spürte ihren Vater dicht in ihrem Rücken, während Großvater und Ortrud lustig vorauswatschelten.
An der Bettkante sah sie tief in die Augen ihres Vaters, der ihr mit seinem Blick das Signal gab, sie nicht ganz zu verstehen. Es war etwas wie Angst, das in ihr lag, doch sie verstand selbst nicht, was und warum sie derart fühlte.
»Eine Gute-Nacht-Geschichte?«, fragte er und sah dabei auch Ortrud an.
Eda nickte begeistert. »Nein, nein«, sagte sie sogleich. »Die Ode an die Freude!«
»Ach herrje!«, kratzte er sich am Kopf. »Ich versuch‘s!«
Daraufhin räusperte er sich und sagte die Verse gesanglos auf:
»Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt.
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.«
Obwohl Eda kaum ein Wort verstanden hatte, fühlte sie eine große Freude — das einzige Wort, das sich ihr eingebrannt hatte. Sie lächelte verträumt, als Vater zu Ortrud ging, um ihr Gute Nacht zu sagen. Anschließend winkte er beiden, als seine dunkle Gestalt in der Tür stand, wo das Licht von draußen her in den dunklen Raum fiel. Die Tür schloss sich und Eda drehte sich zur Seite.
Die Ode an die Freude, dachte sie erneut. Schiller, Beethoven… Krieg.—
Ihr Gemüut wurde betrübter.
»Ortrud?«, sagte sie kurz vor dem Einschlafen. »Ich hab dich gern!«
Doch eine Antwort blieb aus.
øøø
Drei
Der schöne Traum war zu Ende. Eda erwachte und war zurück im Hier und Jetzt. Ihre Hände lagen auf ihrem Gesicht, nachdem sie ihre Tischlampe angeknipst hatte. Es war dreißig Minuten nach fünf, als ihr Wecker klingelte. Würde sie sich jemals daran gewöhnen, um diese Zeit aufzustehen?
Oh ja, wie sie es bereits geahnt hatte, sie bereute es, bis spät in die Nacht aufgeblieben zu sein. Doch Jammern war nun fehl am Platz, schließlich war es ihre eigene Entscheidung, sich lieber durch einen langen Tag zu quälen, als ihrem Geist ausreichend Ruhe zu gewähren; und derweil war erst Montag.—

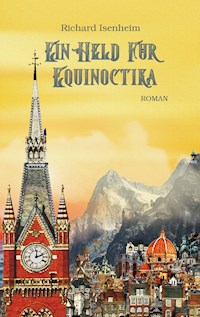
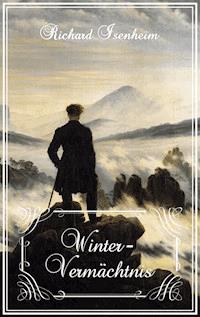













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












