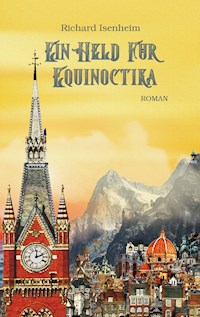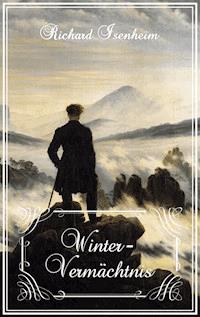
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Es war einmal im Herbst
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1980. Einige Zeit nach Jamies Tod sieht sich sein Freund, der Psychiater Doktor Spiegelthal, nicht mehr in der Lage, seinen Beruf länger auszuüben. Seiner Schuld bewusst, stellt er sich dem Gesetz und wartet auf das juristische Urteil, während er den Entschluss fasst, die Praxis aufzugeben und ein neues Leben zu beginnen. Im Wien der 80er Jahre, zwischen Hochkultur und Rockmusik, schreibt Spiegelthal als Journalist für eine psychologische Fachzeitschrift. Die Arbeit führt ihn zurück an die Universität, wo er vergeblich nach Antworten auf seine Fragen sucht. Auf seiner Seelenwanderung durchläuft er einen tiefen Reifungsprozess, der ihn nach neuen Ansätzen streben lässt; nicht zuletzt durch die Begegnung mit einer jungen Psychologie-Studentin, die ihn für seine Artikel bewundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Richard Isenheim wurde 1997 in Bietigheim-Bissingen geboren, dessen historische Altstadt beim Schreibprozess maßgeblichen Einfluss nahm. Im Großraum Stuttgart verbrachte er die ersten vierzehn Jahre seines Lebens, bis er mit seiner Familie in den Landkreis Sigmaringen zog. Dort beendete er die Realschule, um anschließend ein technisches Gymnasium zu besuchen. Schon im Alter von dreizehn Jahren begann Isenheim mit der Schreiberei. In seinen Geschichten stehen tiefe Charakterwandlungen, wahre Freundschaften und die Höhen und Tiefen des Lebens im Vordergrund.
Mein Dank
an die Familie Gall
und Hillermann
für die Unterstützung.
Ich wünsche viel Freude beim Lesen!
Ihr
Richard Isenheim
»Erst unter den Hammerschlägen des Schicksals,
in der Weißflut des Leidens an ihm,
gewinnt das Leben
Form und Gestalt.«
Viktor Frankl
Inhaltsverzeichnis
III. AKT
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Siebenundzwanzig
Epilog
III. AKT
Eins
Dr. Spiegelthal legte den Notizblock zur Seite. Konzentrierte Züge umspielten sein Gesicht und ließen auf geistige Arbeit schließen, als wäre er voll und ganz in einen Gedankengang versunken. Es war ein vielversprechender, doch gleichermaßen verkrampfter Anblick.
»Geister?—«
Auf seinem Gesicht blitzte etwas wie Unbehagen auf, als ihm dieses Wort zu Ohren kam. Sein Blick wanderte in betrübter Miene nach links zu seiner Patientin, die dort auf dem Sofa lag und erzählte. Seine linke Hand, die soeben noch entspannt auf der Armlehne des Sessels ruhte, ging hoch zu seinem Kinn, wo sie vor seinem Mund ihre neue Haltung einnahm.
Die Stimme der Patientin erhob sich zu einer Rechtfertigung: »Sie werden mich für verrückt erklären, doch ich kann nur erzählen, was ich gesehen habe.«
Seitens des Psychiaters kam eine beschwichtigende Antwort: »Schon recht, Frau Milan, dazu habe ich Sie schließlich auch gebeten. Und um Ihre Bedenken zu beruhigen, ich halte Sie keineswegs für verrückt. Allgemein erkläre ich niemanden für verrückt, allerhöchstens für therapiebedürftig, gnädige Frau.«
Es trat eine kurze Pause ein.—
»Nun, Sie sagen, es wäre Ihnen Ihre tote Nichte begegnet, zu der sie eine tiefere Beziehung hatten. Die Begegnung war in einem Traum, nehme ich an?«
Die Antwort ließ einen Moment auf sich warten, so als würde die Frau überlegen, ob sie fortfahren sollte oder nicht. »Nein«, sagte sie vorsichtig. »Gerade das ist es ja. Gerade deshalb bin ich hier. Es war helllichter Tag.«
»Aber es war kein Tagtraum, oder?«
»Nein, kein Traum. Glauben Sie mir! Auch kein Tagtraum.«
»In Ordnung, ich wollte nur sicher gehen, Frau Milan. Aber erzählen Sie weiter. Was ist bei der Begegnung passiert?«
»Na ja, meine Nichte – sie hieß Nadia – stand mir gegenüber. Sie war eine Lichtgestalt! Wunderschön und freundlich. Und plötzlich wurde alles warm und meine Sorgen schienen vergessen zu sein.«
Spiegelthal schluckte belegt. Die Patientin wurde mit jedem Wort schneller und emotionaler.
»Sie sah genauso aus wie sie immer aussah. Vielleicht noch ein wenig schöner. Und, und ich glaube, sie wollte mir etwas sagen. Sie sprach nicht, aber sie wollte mir irgendetwas mitteilen. Vielleicht, dass es ihr gut geht und ich mir keine Sorgen um sie machen muss, nachdem sie bei ihrem Unfall … um‘s Leben kam.—«
Die Patientin kam zum Ende. Spiegelthal wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass sie ausgesprochen hatte: »Und… das bereitet Ihnen Sorgen?«
»Hm«, seufzte die Frau. »Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Und ich hätte es mir denken können. Er hat gesagt, ich bin verrückt. Danach habe ich mich nicht getraut, meiner Schwester, also Nadias Mutter davon zu erzählen. Ich hatte Angst, dass sie ausrasten würde. Ich glaube, ich bin verrückt. —«
Spiegelthal schüttelte den Kopf, wohlwissend, dass sie es nicht sehen konnte. »Sie sind nicht verrückt.«
Ein erleichtertes Durchatmen. »Das tut gut…«
»Wir haben die Angewohnheit«, erklärte er fortführend, »alles für verrückt zu erklären, was wir nicht verstehen.«
»Und verstehen Sie mich?«
Gerade wollte er »nein« sagen, doch sagte stattdessen: »Ja und nein.«
Sie wandte sich ein Stück zu ihm. »Das soll heißen?«
»Nun, Frau Milan«, und er wollte beinahe aufstehen, da er im Gehen besser erklären konnte, »Sie sind nicht die Erste, die von derartigen Wahrnehmungen berichtet. Ich kann Ihnen nur die eine Antwort geben, die mir logisch erscheint – Sie stehen in starker emotionaler Abhängigkeit zu ihrer verstorbenen Nichte. Wenn Sie die Augen schließen und Bilder sehen, sind diese zwar meistens wieder weg, wenn Sie sie öffnen, aber in manchen seltenen Fällen scheint sich das Bild, das Sie in Ihrem Kopf sehen, mit dem zu vermengen, das ihr physisches Auge sieht. Es sind im Prinzip Theta-Wellen, die sich da mit dem elektromagnetischen Licht überlagern, welches auf Ihre Netzhaut trifft.«
Ein Ausdruck von Unverständnis seitens der Patientin: »A ja … Das verstehe ich jetzt nicht…«
»Nun«, dachte Spiegelthal nach, um es in andere Worte zu fassen, »das Bild in Ihrem Kopf hat sich so sehr eingebrannt, dass Sie es noch sehen können, wenn Sie die Augen öffnen. Sie kennen sicher das Gefühl, wenn Sie von einem Traum aufwachen und nicht gleich wissen, was in Ihrer Wahrnehmung Realität und was Traum ist. Dabei versucht das Gehirn sich wieder an den Wachzustand anzupassen. In Ihrem Fall ist das ähnlich.«
»Das heißt, ich bin verrückt…«
»Nein«, wehrte er wieder ab. »Ihr Unterbewusstsein versucht eben einmal den Tod ihrer Nichte zu verarbeiten und dabei versucht es damit abzuschließen. Andere Menschen verdrängen es einfach.—«
Die Patientin schwieg.
»Es gibt viele Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben und die meisten gehen stillschweigend darüber hinweg, weil sie eben –wie Sie– Angst haben, für verrückt erklärt zu werden. Eigentlich ist das ein unbewusster Prozess Ihrer Seele, sich von Dingen beziehungsweise Menschen zu lösen. Im Prinzip eine Art selbst gemachtes Placebo.«
»Seele?«, warf sie fragend ein. »Warum sprechen Sie von der Seele?«
»Warum?«, begann er zu erklären, »weil sich Seele und Psyche quasi schenken. Das Wort Psyche kommt aus dem Griechischen ›psyché‹, was übersetzt nichts anderes als ›Seele‹ bedeutet. Die Psychologie heißt demnach ›Seelenkunde‹. Wir Psychologen fühlen uns nur manchmal zu wissenschaftlich, um das Wort Seele zu benutzen, obwohl es eigentlich das gleiche bedeutet.«
»Was ist die Seele?«, war die nächste Frage.
Er hatte es erwartet.
»Das kann keiner so genau sagen.«
Wieder ein überfordertes: »A ja… «
»Genau!«, fuhr er rasch fort. »Und solange Sie nicht dauerhaft geisterhafte Erscheinungen sehen, brauchen Sie sich auch keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil. Sie hatten doch Glück! Ihre Erscheinung gab Ihnen ein Gefühl von Wärme.«
»Das heißt«, hakte sie nach, »dass alles in Ordnung mit mir ist?!« Damit setzte sie sich auf und blickte ihn an.
»Na ja, Sie kamen mit dem Vorwand zu mir, verrückt zu sein«, erklärte er. »Meine Diagnose als Arzt ist, Sie sind nicht verrückt. Alles normal!«
Die Frau senkte den Kopf. »Alles normal…«
Der Redeschwall des Doktors ging fort: »Manche Menschen verarbeiten Verluste auf diese Weise, andere auf eine andere Weise und noch andere wiederum… gar nicht!—« Mit diesem Satz bremste er sich selbst aus. Es waren nun drei Monate vergangen, seitdem Jamie sich das Leben genommen hatte. Das Grau seiner Iris verlor an Leuchtkraft. Schnell schüttelte er den Kopf. Die Patientin zu seiner Linken stammelte: »Und dafür habe ich jetzt vier Monate gewartet…«
»Nun, Frau Milan«, erklärte er der sichtlich verwirrten Frau, die zwischen Verwunderung und Verwirrung herumschwankte, »ich kann Ihnen nur sagen, wie ich Ihre Problematik als Arzt einstufe. Seien Sie doch froh über meine Diagnose!«
»Ja, ja«, stammelte sie noch immer schwer nachdenklich. »Schon gut.«
Da begleitete er seine Patientin zur Tür. Spiegelthal wiederholte seine Worte, doch mit weniger Euphorie und ernsterer Stimme: »Machen Sie sich keine Sorgen. Wir Menschen erklären alles für verrückt, was wir nicht verstehen. Das gebe ich Ihnen auf den Weg, gnädige Frau.«
Mit einem Nicken durchquerte sie die Tür. Spiegelthals Gehör wartete auf den Moment, wenn das Schloss einrastete, dann gab er sich seiner mentalen Entwaffnung hin. Mit einem tiefen Atemzug sank er ein Stück nach vorn, mit der Hand strich er sich über die Stirn, während die Mittagssonne auf sein Profil schien. Kaum hatte er die Augen geschlossen, dachte er an Jamie und die unabgelöste Schuld, die er trug. Diesen Fall mit der Frau, die ihre tote Nichte sah, konnte er nicht annehmen. Schon einmal hatte er versagt. Nicht noch einmal wollte er diesen Fehler begehen. Doch sein Gewissen pochte unaufhörlich gegen die Innenseite seiner Brust. Er hatte in Kürze seine Überlegungen der letzten Monate zusammengetragen, um die Frau ruhig stimmen zu können. Was wusste er schon, wie diese Art von Psychose zu heilen war! Am besten hielt er seine Finger raus, bevor er Schaden anrichten konnte. Diese Begegnung hatte ihn wieder zurück zu Jamie geführt und zurück zu dem Entschluss, diese Praxis zu schließen. Eine Weile verging, bis er sich seinem nächsten Patienten widmen wollte. Er goss sich einen Schluck Whisky ein, der ihn auf andere Gedanken bringen sollte. Anschließend trat er aus dem Sprechzimmer. Noch immer wirkte sein Gesichtsausdruck, als wäre er geistig nicht im Diesseits. Es war ein merkwürdiger Anblick, der sich der Sekretärin bot. Doch sein Interesse war nicht ihr gewidmet; sein Kopf neigte sich ins Foyer, während der Körper in der Tür verweilte.
»Der Nächste, bitte!«
Im Gesicht der Sekretärin änderte sich etwas. Die müden, fast gar desinteressierten, Augen leuchteten geschwind auf, die Brauen wanderten höher und der Mund öffnete sich zu einem kleinen Spalt. Sie musterte ausgiebig das Bild, das der Doktor abgab. Erst nachdem ein wenig Zeit vergangen war, begann sie zu sprechen: »Das war der letzte Patient für heute.«
Der nachdenkliche Ausdruck ihres Arbeitgebers blieb noch einen Moment bestehen, danach blickte er herüber. Leichte Verwunderung brachte er sodann zum Ausdruck: »Der Letzte für heute?«
Sie nickte.
»Aber es ist doch noch nicht mal drei?«
»Ja, aber Sie haben mich dazu angewiesen, keine neuen Termine mehr zu vereinbaren.«
Daraufhin kratzte er sich am Hinterkopf. »Ja, das hab ich. Tatsächlich. Entschuldigen Sie meine Zerstreuung…«
Sie schüttelte beschwichtigend den Kopf. Es folgte ein Moment der Stille.
»Dann«, sprach Spiegelthal, »können Sie gehen. Ich brauche Sie heute nicht mehr.« Mit diesen Worten wandte er sich ab. Er blickte nun zur Fensterseite des Sprechzimmers. Vom Marktplatz her fiel warmes Sonnenlicht herein. Spiegelthal schloss die Augen, als hoffte er, das Licht würde die Bilder seines Freundes ausbrennen; wenn nicht das, so zumindest mit Gegenlicht überstrahlen. Keines davon geschah. Er öffnete und schloss die Augen einige Male, doch Jamies Illusion war nur in seinem Kopf. Sein Bild hatte sich ihm eingebrannt.
Hinter ihm stand seine Sekretärin; die Jacke bereits angezogen, die Tasche um die Schulter gehängt, bereit zum Aufbruch. Er bemerkte ihren Blick und drehte sich zu ihr um. »Ja?«
Ihr Mund war in diesem Moment schmal, ihre Augenbrauen zuckten nach oben. »Sie wissen, dass ich morgen nicht mehr hier sein werde?!«
Nun war es Spiegelthal, dessen Mund sich einen Spaltbreit öffnete. »Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man arbeitet…« Und kaum hörbar fügte er hinzu: »Wenn man nur noch seine Arbeit hat.–« Kaum waren die Worte ausgesprochen, sträubten sich seine Nackenhaare. Dasselbe hätte auch von Jamie sein können.
Sein Gegenüber gab vor, ihn überhört zu haben. Sie fragte nicht weiter nach. Dagegen Spiegelthal: »Haben Sie bereits eine neue Arbeit gefunden?«
Die Sekretärin schnaubte leise. »Was braucht Sie das zu kümmern?«
Erschreckt ging sein Oberkörper ein Stück zurück.
»Entschuldigen Sie!« Sie senkte den Kopf. »Das hätte ich nicht sagen dürfen.«
»Nein, entschuldigen Sie mich, Fräulein Förster!«, sprang er ein. »Ich bin untröstlich. Doch ich muss tun, was ich tun muss. Keine neuen Patienten, bevor ich nicht meine eigenen Dämonen bekämpft habe, verstehen Sie?«
Sie nickte. »Ich verstehe Sie, Doktor– glauben Sie mir.«
»Ja, ich glaube Ihnen«, antwortete er auf die Floskel.
Nach einer Weile fuhr er fort: »Wissen Sie, ich habe den Wahnsinn gesehen. Nicht irgendeinen, sondern einen, den ich selbst angerichtet habe. Was, wenn ich schon einmal derartige Fehler begangen habe? Was, wenn ich sie noch einmal begehe?«
Frau Förster versuchte vergeblich eine Antwort zu geben. Er konnte ihr ansehen, wie sie nach Worten rang. Er wollte ihr helfen und griff ein: »Sie brauchen mir nicht zu antworten; das war eine metaphorische Frage, Fräulein Förster.«
Doch sie wollte es versuchen: »Ich bin kein Arzt, Doktor, aber ich denke, Sie machen im Moment genau das durch, was jeder von uns durchmacht, wenn er einen Freund verloren hat, oder jemand, der ihm nahe steht.«
Spiegelthal richtete seinen Blick auf die junge Frau. Mit aufforderndem Nicken bat er sie fortzufahren.
»…Wir machen uns Vorwürfe und fragen uns, ob wir den Tod irgendwie hätten vermeiden können. – Ja, ich war nicht dabei. Aber nachdem ich seit ein paar Jahren für Sie arbeite, glaube ich nicht, dass Sie ein schlechter Mensch sind, Herr Spiegelthal. Ich sehe ja, wie viel Mühe Sie sich mit jedem Ihrer Patienten geben.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, Fräulein Förster, Sie haben Recht. Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern in den meisten Fällen gut gemeint.«
Sein Einwurf klang einleuchtend. Frau Förster schwieg.
»Ich wollte Sie nicht unterbrechen«, sagte er; die Hände zu einem Pardon erhoben, »doch ich muss feststellen, dass Sie nicht dabei waren, als mein Freund starb. Ich muss mich schließlich an die Schweigepflicht halten. Ich habe schon einmal die Schweigepflicht verletzt.«
»Sie haben Recht, Doktor. Es macht keinen Sinn sich darüber zu unterhalten. Nicht mit Ihrer Sekretärin.«
Seufzend verzog er den Mund. »Ich habe in Ihnen nie eine Tippmamsell gesehen, Fräulein Förster; es ist nur, dass Sie nicht wissen, was geschehen ist. Keiner außer mir weiß es genau. Ich hätte die gleiche Antwort auch jedem anderen gegeben.«
»Und ich fühle mich nicht angegriffen«, erwiderte sie freundlich. »Aber Ihre Bescheidenheit hat mir immer gefallen, Doktor.«
»Ich gebe mein Bestes«, beschwichtigte er.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute.«
Mit einer leichten Verneigung erwiderte er: »Dasselbe wünsche auch ich Ihnen, Fräulein Förster.«
»Und…«, fügte sie über die Schulter hinzu, »ja, ich habe Arbeit. Bei einem Augenarzt ganz in der Nähe.«
Spiegelthal nickte zufrieden. Ihm kamen zwei Namen ins Gedächtnis, doch er wollte nicht nachfragen.
»Und Sie, Doktor? Wie wird es weitergehen?«
»Ich? Nun…«, antwortete er nachdenklich. »Ich werde für eine Zeitung arbeiten. Ein akademisches Magazin für Medizin und Wissenschaft. Der Verlag hat seinen Sitz in Wien, wohin ich mich in wenigen Wochen begeben werde. Möglicherweise werde ich damit meine Läuterung finden.«
Frau Förster lächelte freundlich. Er erwiderte das Lächeln. »Nun.«
»Machen Sie‘s gut!«
»Auf Wiedersehen!«
Spiegelthal blieb noch eine Weile reglos stehen. Danach begab er sich vor die Tür zum Briefkasten. Dort betrat er das dunkle Gässchen, welches zum Eingang des Hauses führte. Er warf einen Blick nach links, wo sich die Müllsäcke stapelten. Nur Weniges würde er mit nach Wien nehmen. Vieles hatte er gespendet und verkauft. Trotzdem war eine Unmenge an Müll angefallen.
Rechterhand führte das Gässchen zum Marktplatz, auf dem täglich großes Treiben herrschte. Bei sonnigen Tagen saßen die Leute in den umliegenden Cafés. Gerade heute, da der Frühling sich zum ersten Mal blicken ließ, war die Altstadt stark besucht. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Tourismus wieder blühte und die so schon engen Straßen kaum noch begehbar wären. Spiegelthal würde die Stadt vermissen und eigentlich zog es ihn heute nach draußen, doch er hatte noch einiges zu regeln. Es bot sich an, dass der morgige Donnerstag ohne Patienten war.—
Er öffnete den Briefkasten, nahm die Post heraus und ging damit zurück in die Praxis. Ohne Weiteres legte er den Stapel auf den Tisch und trat nachdenklich ans Fenster. Die Cafés quollen beinahe über und der Marktplatz war überlaufen. Doch trotz des Sonnenscheins empfand Spiegelthal keinen Grund zum Frohsinn. In drei Jahren hatte er Jamie nie so gut verstanden wie jetzt. Das Gefühl von Schuld und Trennung war ihm erst jetzt wirklich bewusst geworden. Doch er musste sich zu allem Übel obendrein eingestehen, dass er sich in manch einen Patienten, der an Verlustschmerzen gelitten hatte, in Wahrheit kaum hineinversetzen konnte. Unter Umständen war es bei anderen Patienten mit anderen Erkrankungen genau dasselbe gewesen. Doch genau wusste er es nicht. Seufzend drehte er sich mit dem Rücken zur Fensterbank, sodass sein Blick in den Raum fiel. Das Sofa und der Sessel wirkten an diesem frühen Feierabend wie verwaist. Er wusste nicht, ob er sie jemals wieder benutzen würde; denn er konnte es nicht zulassen, noch einmal zu versagen. Nicht so, wie er es an Jamie und Eda getan hatte. Immer wenn er die Augen schloss, sah er die beiden vor sich. Vor allem aber Jamie. Das Gesicht, das er zog, bevor er sich die Waffe in den Mund steckte. Freilich, Jamie Winter war erlöst. Die Kugel hatte seinem Leben ein rasches Ende bereitet. Ein lauter Schuss, ein kurzer Schmerz, ein wehes Ende. Die Seele wurde dem Leib entrissen, so schnell, dass sie keine Zeit mehr zum Aufschrei hatte. Der leblose Körper war von der Wucht der Kugel jäh nach hinten gerissen worden, wo er rücklings in das nasse Gras eintauchte und im Regen liegen blieb. Das entseelte Gesicht starrte mit weit aufgerissenen, wie vom Wahnsinn erfüllten, schreckbefleckten Augen in die schier endlose Leere des Firmaments, an dem in dieser Nacht kein einziger Stern zu sehen war; nicht einmal ein einziger!
Welcher Unfriede war in das angstzerfurchte Antlitz eingeprägt, als hätte es Todesqualen gelitten? Welcher Schrecken löste dieser Anblick in demjenigen aus, der es ansehen musste? Mitleid und Trübsal würde es auslösen, den Wunsch, der Tote möge in Friede ruhen. Einen Frieden als letzten Gnadenakt dieses zerstörten Lebens, der doch so sehr im Widerspruch zu dem Leid stand, der ihm ins Gesicht geschrieben war. Wenn der Totengräber ein sanftes Lächeln von Anmut und Würde daraus formen würde, so wäre es eine Maske, um ebendiese wogende Unruhe zu verbergen, die aussah, als hätte die Seele sie mit ins Jenseits genommen. Eine Maske, die den Verbliebenen, doch nur ihnen zuliebe, aufgesetzt war. Jede Spur von Ruhe und Frieden christlich-abendländischer Philosophie wäre damit vom Gegenteil zerborsten. Sah ein Lebender eine Leiche, dachte er nur an den eigenen Tod; und nur das allein löste die Angst und all den Spuk in ihm aus.
Jamies letzter Gedanke, das letzte Gefühl, ein Gefühl erweichender Liebe, von Geborgenheit und Erlösung, süßlich herbeigeflehter Leere einer verzagten Seele. Der eine Wunsch, explosionsartig ohne Klang und Farbe in Rauch aufzugehen, ohne jemals existiert zu haben. Doch das Gesicht tiefer seelischer Psychose!
Tod und Sterben, ein Kontrast wie Licht und Schatten. Mit weihevoller Verklärung gefülltes Nichts und elendiges Krepieren, das sich wie stählerne Gitterstäbe undurchdringbar dazwischen stellte.
Die Umstehenden sahen nur wenig von diesem Anblick, da die Nacht ihre großen Hallen geöffnet hatte. Allein er, Jamies Psychiater und Freund Doktor Spiegelthal, hatte den letzten Moment in nächster Nähe mitansehen müssen. Das Blut war ihm ins Gesicht gespitzt. Sein eigenes blass und verstört. Das schillernde Weiß war mit weinroten Punkten betröpfelt. Keine Bewegung, kein Ton. Kein Muskel wagte es sich zu bewegen. Selbst die Gedanken waren plötzlich geronnen und die Gefühle vom Schock überlagert, der sich wie eine schwere Betonmauer auf ihn legte. Spiegelthal wollte schreien, sich wehren und um sich schlagend um Hilfe rufen und war verdammt! Jeglicher Ton war bis zur völligen Stille heruntergedämpft.
Spiegelthal fuhr sich über das Gesicht, als wische er sich das Blut von den Wangen. Sein Blick fiel auf Zeige- und Mittelfinger.
Erst nach Minuten des Schweigens lösten sich die Worte: »Was habe ich getan!«
Er wiederholte sie einige Male. Erst jetzt nahten sich andere Gedanken an ihn heran und durchzogen die dämmrig-geistige Entrückung. Und noch immer der Vorwurf: »Was habe ich getan!«
Auch jetzt, da einige Monate vergangen waren, wiederholte er die Frage: »Was habe ich getan!« Äußerlich hatte er weiter gearbeitet, doch innerlich hatte er Jamies Leid nachempfinden müssen. Er verstand ihn nun. Er verstand das Gefühl, nichts mehr auf Erden zu haben. Er hatte seine Berufung verloren, wie Jamie Eda verloren hatte. Doch Spiegelthal verlor in dieser Nacht nicht nur einen Freund. Seit der Beerdigung hatte er Francis nie wieder gesehen.
Ach, wie schön waren ihre jungen Zwanziger! Wie herrlich war die Zeit, in der die Drei ein unbekümmertes Jünglingsalter führten! Er dachte gerne zurück; an die sechziger Jahre. Das erste Autofahren, die 68er-Bewegung, die Beatles und das Rebellieren gegen die vergreiste Gesellschaft. Ja! Sein Geist schwelgte zurück in diese wundervolle Zeit. Er hatte studiert, promoviert und seine Praxis eröffnet. Francis hatte ihm diese dreistöckige Wohnung über ein paar Kontakte organisiert. Über einen Kredit und den Zuschuss seiner Eltern hatte er sie erworben. Nun war der Kredit zurückbezahlt und der Traum nach gerade einmal zehn Jahren zu Ende. Er seufzte. Die bittere Realität konnte nicht weggeträumt werden. Dass Spiegelthal alle diese Züge von Jamie annehmen musste, gefiel ihm nicht. Doch das Schlimmste war das psychologische Wissen darum. Er konnte von außen auf seine Psyche sehen, doch er konnte nichts daran ändern. Er wusste, was womit verknüpft war, doch konnte das Unbewusste nicht bewusstmachen. Er konnte sein Ich nicht stärken, so wie er es in seinem Studium um Sigmund Freud gelernt hatte. Er konnte sich selbst nicht therapieren. Sollte er sich von einem anderen therapieren lassen? Nein! Das würde nichts helfen. Er wusste es; denn er zweifelte an seinen eigenen Methoden. Alles, was er für gültig empfunden hatte, war nun ein Haufen Asche, eine Fata Morgana; sein Streben nichts als blinder Ehrgeiz.
Was hatte Francis ihm gesagt, als sie im Streit auseinandergingen? Die Seele des Menschen ist kein Apparat, wie die Psychologen es sich so kinderleicht vorstellten. Nicht der Verstand konnte Wunden heilen. Selbst ein Bettler, der intellektuell nie über das schriftliche Dividieren hinausgekommen war, aber gut zuhören konnte, wäre eine bessere Hilfe als ein Psychologe. Damals wollte er Francis nicht glauben. Nun fühlte er, wie der Zweifel in ihm überhandnahm. Er konnte es nicht weiter unterdrücken. Seine Eitelkeit bröckelte, sein jahrelang angeeignetes Verstandeswissen zerbarst an sich selbst; an ihm, an seiner eigenen Psyche!–
Spiegelthal erschrak. Musik riss ihn aus seinen Gedanken. Von draußen her ertönte ein unwohlklingendes Lied, so unschön, dass er ans Fenster herantrat, um hinauszusehen. Am Marktplatz hatte sich eine Gruppe schmuddelig gekleideter Jugendlicher mit einem Radiorekorder breitgemacht, von dem eine Art Hip-Hop-Song lief. Der Hit war mit einem solch fürchterlichen Beat hinterleget worden, dass Spiegelthal mit einem verkrampften Blick das Fenster schloss. Er verstand die Musik der späten Siebziger nicht mehr. Seit seiner Jugend schwor er zwar auf Elvis Presley und die Beatles, doch die Musik der letzten zehn Jahre wollte er nicht mehr begreifen. Erst seit ein paar Jahren verstand er seine Eltern, die ihm damals exakt das gleiche Unverständnis entgegengebracht hatten. Zu Spiegelthals Unglück war der Beat noch immer gut zu hören. Zu gerne hätte er etwas hinausgerufen, doch er befürchtete, man würde ihn nicht ernstnehmen; im Gegenteil. Er wusste sich allerdings anders wie zu helfen. Ein verschmitztes, verräterisches Lächeln formte sich auf seinem Gesicht, als er das soeben geschlossene Fenster wieder öffnete. Daraufhin legte er Wagners Walküre auf den Plattenspieler, schmiss den Motor an und schloss den Verstärker an. Mit hochgelegten Füßen genoss er nun die Musik. Wenig später war von draußen her nichts mehr von dem Ghettoblaster zu hören. Als er zurück ans Fenster trat, lachte er leise, aber schadenfroh.
»Mit euren eigenen Waffen geschlagen, was?«.
Alsdann kippte er das Fenster und tauschte Wagner mit Beethovens Neunter aus. Die Nadel setzte er weiter in die Mitte, um in etwa den vierten Satz zu treffen. Tatsächlich hatte er den ruhigen Teil mit den Streichern getroffen, die zum ersten Mal in der Symphonie das Thema spielten. Unverzüglich war er wieder ruhiger geworden. Sein kurzer Anflug von Enthusiasmus war wieder verstummt. Oft hatte er mit Jamie diese Töne gehört. Das letzte Mal an einem späten Abend, als er mit ihm über seinen Traum gesprochen hatte. Jamie hatte den Termin verpasst und Spiegelthal ihn daraufhin mit dem Auto abgeholt. Er dachte daran, wie dies die letzte Sprechstunde war, in der Jamie noch klaren Sinnes war. Er hatte dort auf dem Sofa gelegen und Spiegelthal im Sessel, wo er auch jetzt wieder Platz nahm. Seither hatte er den Götterfunken nicht mehr gehört. Es war an der Zeit, wie er empfand, als die anschwellenden Töne Freude und Glückseligkeit in ihm wachriefen. Zuerst die stumpf klingenden Bässe, dann setzten die Blechbläser ein. Zuletzt eine Männerstimme. Wärmestöße breiteten sich von seiner Mitte aus durch den ganzen Körper. Er konnte schwören, dass ein Geruch von Zitrone in der Luft lag. Der Chor sang weihevoll Schillers Ode an die Freude. Die Musik baute Spannung auf und kündete das Thema an.
Froh!
Froh
wie seine Sonnen
seine Sonnen fliegen
Froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen,
wie ein Held
zum Siegen.
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen,
wie ein Held zum Siegen.
Freudig,
freudig,
freudig,
wie ein Held zum Siegen!
øøø
Zwei
Ein Brief der Staatsanwaltschaft erreichte ihn am Morgen danach. Nun, nachdem er solange gewartet hatte, war er völlig unvorbereitet.
»Endlich!«, flüsterte er, doch begab sich ohne Hast wieder nach drinnen. Im Arbeitszimmer öffnete er den Brief. Die fettgedruckten Worte am Ende des Briefes erregten seine Aufmerksamkeit. »… wird das Strafverfahren somit ohne Folgen eingestellt.«
Spiegelthal war verwirrt. Er hatte alles erwartet, aber nicht das. Das Strafverfahren wird eingestellt – ohne jegliche Folgen? Er wollte den ganzen Brief lesen, um sich zu vergewissern. Doch zuvor ließ er Revue passieren.
Nach seiner Selbstanzeige hatte das städtische Polizeipräsidium die Strafanzeige ohne Vernehmung an die nächste Staatsanwaltschaft weitergegeben. Nach langem Schriftverkehr und einigen Vernehmungen wurde ein zweiter Psychologe eingeschaltet, der Spiegelthals Vorgehen auf seine Richtigkeit hin überprüfen sollte. Im Brief stand nun: »Weiterhin ergibt sich aus der Vernehmung, dass im Fall des als geistig gestört einzustufenden James Winter eine korrekte Zwangseinweisung zum Schutz der Umwelt und des Betroffenen selbst getroffen worden ist.«
Das musste ein Irrtum sein! Spiegelthal hatte Gewalt gegen Jamie angewandt. Er hatte Fehler auf Fehler begangen und Jamies Tod doch nur dadurch herbeigeführt. Jetzt stellt man das Ermittlungsverfahren restlos gegen ihn ein? —
Er musste mit einem Anwalt telefonieren. Sein Freund Randolf Gläser kannte sich in diesen Angelegenheiten aus. Am Abend würde er ihn anrufen. Doch es verging ein Tag, bis der Rückruf kam.—
In der Zwischenzeit begann er damit, die ersten Umzugskartons zu packen. Während des Tages hörte er die ganze Breitseite seiner Rock Rock ‘n‘ Roll LPs rauf und runter. Am Abend des Folgetages ließ er sich mit einem Glas Rotwein auf dem Sessel nieder. Mit einigen Klaviersonaten von Debussy ließ er den Tag ausklingen. Müde geworden, schloss er die Augen. Er schlief ein, während die Platte schließlich durchlief. Schließlich klingelte das Telefon. Er zuckte hoch. In seinem Sessel hörte er beide Telefone; sowohl das in der Praxis als auch jenes in seinem Arbeitszimmer oben in der Wohnung. Der Plattenspieler gab parallel dazu ebendieses Geräusch von sich, wenn eine Platte durchgelaufen war. Er entfernte geschwind die Nadel und taumelte schlaftrunken zum Schreibtisch hinüber.
»Praxis Doktor Spiegelthal, guten Abend.«
Vom anderen Ende der Leitung kam ein Lachen: »Hab ich dich etwa geweckt?«
»Randolf?«, gab er als Gegenfrage zurück.
»Ja. Du hast mich gestern Abend angerufen…«
»Das stimmt!«, gab er zurück. »Ich brauche deinen juristischen Rat.«
Der andere lachte. »Ach so, gibt es irgendwelche Probleme?«
»Nun, nicht direkt«, wich er zunächst aus. »Ich habe ja seit Ewigkeiten auf den Brief von der Staatsanwaltschaft gewartet. In der Zwischenzeit sind ja Wochen vergangen, in denen ich ewig viel hin- und herschreiben musste.«
»Ja und weiter?«
»Gestern Morgen kam der Brief.«
»Und?«
»Und das Strafverfahren wird somit ohne Folgen eingestellt.«
»Das ist doch gut! Freu dich!«
Spiegelthal seufzte. »Ja, ich bin froh… eigentlich, aber ich versteh nicht, warum ich ungeschoren davonkomme.«
»Warum du ungeschoren davonkommst? Das fragst du?«, kam es mit einem Lachen aus dem Hörer. »Ist das irgendwie von Interesse?«
»Ich habe einen Toten zu verantworten, Rand! Also nicht, dass ich scharf darauf wäre, bestraft zu werden, aber das hier kann einfach nicht sein.«
»So hört es sich aber gerade für mich an«, erwiderte er mit einem Räuspern.
Spiegelthal schwieg. »Schau mal!«, und er nahm das Telefon zu seinem Sessel hinüber. »Ich habe einen Freund versucht zu therapieren. Wie kann jemand behaupten, der einigermaßen denken kann –ja, ich konnte das damals nicht– dass das gut gehen wird?«
»Und?«, unterbrach ihn der Anwalt. »Es gibt kein Gesetz, das dir verbietet einen Freund zu behandeln. Im Gegenteil, als Arzt hast du einen hippokratischen Eid geleistet–«
»Ja, ich kenne den hippokratischen Eid!«
»Ja, und darin heißt es, dass du die Pflicht hast jeden Menschen zu behandeln, egal wie deine persönliche Beziehung zu ihm ist.«
Spiegelthal schwieg.
»Wie wurde das eigentlich in deinem Schreiben begründet?«
Er stand auf, um nach dem Brief zu suchen. »Darin hieß es, dass ich als ausgebildeter und nachweislich studierter Arzt selbst zu beurteilen hätte, welcher Art von Fall ich mich annehmen möchte und welchen nicht.« Er begann vorzulesen: » ›Jedwede private beziehungsweise persönliche Befangenheit hat der Arzt selbst zu beurteilen und abzuwägen. Sollte er darin einen Konflikt oder ein Potenzial eines zukünftigen Konflikts vermuten, der ihn als Fachmann in seiner Arbeit beeinträchtigen könnte, so kann von ihm erwartet werden, dass er Maßnahmen zur Überwindung dieses Konflikts trifft und in die Wege leitet.«
»Genau!« Kaum hatte er geschlossen, erhielt er diese Antwort.
»Genau?«
»Ja, genau so denke ich das auch. Warum soll der Staat darin eingreifen, welche Menschen du als Patienten annimmst?«
Spiegelthal strich sich nervös das Stirnhaar zur Seite. »Das meine ich doch gar nicht.«
»Doch, genau das meinst du!«, widersprach sein Gesprächspartner. »Dir geht es darum, dass der Staat dich dafür bestraft –was ich noch immer nicht verstehe, wie man so etwas wollen kann–, dass neben deiner geschäftlichen Beziehung auch eine private zu deinem Patienten bestanden hatte. Wie in dem Brief steht, heißt es, dass du das selbst abwägen musst. Es gibt kein Gesetz, das dir verbietet, ein geschäftliches Verhältnis –und das ist eine Therapie aus juristischem Standpunkt ja auch– mit einem Freund oder Bekannten aus freiem Entschluss einzugehen.« Nach einer Weile fügte er hinzu: »Ich meine, was erwartest du? Ein Staat, der dir vorschreibt, mit wem du Handel treiben darfst und mit wem nicht? Bist du so naiv? Bist du derart sozialistisch im Denken?«
»Du teilst wirklich harte Worte aus«, erwiderte Spiegelthal.
Der Anwalt stieß ein verständnisloses Lachen aus. »Ja, aber so ist es doch!«
»Nun, das mag sein!« Dabei stand er auf und ging auf dem Teppich umher. »Aber ist es auch ganz unbedenklich und rechtlich völlig lupenrein, dass ich einen Unfall als Selbstmord bezeichnet habe und meinen Patienten damit in den Wahnsinn getrieben habe?«
Ein kurzes Schweigen, dann die Antwort: »Das war doch ein Trugschluss, nicht? Ein Trugschluss ist ohne niederen Beweggrund. Meines Wissens nach hast du doch auch gesagt, dass die Polizei dich in deiner Annahme bestätigt hat. War es nicht so?«
»Ja, weil ich es ihnen nahegelegt habe und man sich auf mich verlassen hatte. Ich war schließlich der Arzt, ich kannte Eda und ihre gesundheitliche Verfassung.« Er klang verzweifelt. Entrüstet setzte er sich wieder.
»Trotzdem! Trugschlüsse gibt es überall. Bei der Polizei und bei Ärzten. Wie viele Fehldiagnosen gibt es auf der Welt? Wie viele jeden Tag? Willst du etwa jeden Arzt zu Rechenschaft ziehen, der eine Fehldiagnose gemacht hat? Wo wären wir dann?«
Spiegelthal ging nicht darauf ein. »Die Polizei hat den Fall nicht einmal weiter untersucht. Klar, es war Weltuntergangswetter und man hatte viel zu tun, aber wäre ich nicht dazwischen gewesen, dann wäre der Unfall vielleicht als solcher anerkannt worden.–«
Gläser widersprach: »Und für … für Jamie, hieß er nicht so?«
Spiegelthal bejahte.
»Was ist mit ihm? Was hätte er gedacht? Er hat seine Frau wohl am besten gekannt. Würdest du an einen Unfall glauben? Ein Selbstmord wird nur dann als solcher bezeichnet, wenn es ganz klar ist. Jeden Tag gehen zig Selbstmorde als Unfall durch, Spiegelthal.«
Die Diskussion wurde aussichtslos, Randolfs Argumente zu stark.
»Glaubt du, das hätte alles besser gemacht?«
»Mein Gewissen vielleicht…«
Wieder war das kurze Lachen zu hören. »Ich glaube dir, dass du dir Vorwürfe machst. Wer würde das nicht? Aber sieh ein, dass du nichts verbrochen hast.«
»Selbst die Sache mit der Klinik hat man mir nicht angerechnet«, klagte er weiter. »Ich hätte dem Pflegepersonal bessere Anweisungen geben müssen. Sie hätten besser vorbereitet sein sollen. Vielleicht wäre Jamie dann nicht ausgebrochen. Ich habe ihn doch geradezu provoziert.« Seine Stimme schwoll an: »Ich habe ihn gedemütigt! Ich hegte Groll gegen ihn! Ich–«, die Worte blieben ihm im Hals stecken. »bin ein schlechter Mensch…«
Ein Moment der Stille, bis Randolf antwortete. »Du klingst wie ein Lamm, das freiwillig zum Opferaltar gebracht werden will. Das klingt für mich wie Weltschmerz, den du da trägst. Aber du bist unschuldig. Auch nicht aus menschlicher Sicht. Deine Fehler waren menschlich, und ein Mensch bist du eben nur. Nicht mehr und nicht weniger. Aber du hast mich nach meiner juristischen Beurteilung gefragt. Das ist sie: Du bist unschuldig!«
»Na ja«, sagte er dann. »Nicht ganz. Weil ich Jamie dazu aufgefordert habe mit dem Auto zu fahren, obwohl er keinen Führerschein hatte, gibt man mir eine saftige Geldstrafe und Punkte in Flensburg.«
»Also, dann freu dich doch darüber!«
Spiegelthal antwortete vorwurfsvoll: »Danke für den Sarkasmus.«
»Ja, es tut mir ja Leid!«, entschuldigte er sich. »Es ist mir einfach nur ein Rätsel, wie jemand geradezu nach einer Strafe sucht! Aber sag: Was würde es dir nützen, wenn man dir eine Geldstrafe aufbrummst? Wirst du dadurch selig? Wird die Schuld dadurch gesühnt? Hast du auch nur irgendwas damit wieder gut gemacht? Gibt es noch Angehörige? – Gibt es jemanden, der an dem Tod von Jamie besonders zu leiden hat? Gib ihm das Geld! Tu etwas Praktisches! Biete deine Hilfe direkt am Krisenherd an! Der Staat veruntreut dein Geld nur.«
»Das mag stimmen.« Damit schloss er leidvoll die Augen. Für einen Moment vergaß er, dass noch jemand am Telefon war.
»Bist du noch da?«
»Äh, ja!« Er schüttelte sich wieder wach, doch die Augen waren schwer.
»Wie wird es weitergehen?«, wollte sein Freund wissen. »Das letzte Mal hast du ja erwähnt, du würdest deine Praxis schließen. Bleibt es dabei?«
»Ja«, antwortete er. »Es steht fest.«
»Verstehe…«
»Vor ein paar Tagen«, begann er zu erzählen, »kam eine Frau zu mir, die Geister sah.«
Der andere schwieg zunächst, als hoffte er, Spiegelthal würde das Gespräch weiterführen. »Da bist du der Fachmann für. Ich kann dir dabei nicht helfen.–«
Spiegelthal betrachtete sich selbst in der Spiegelung des Fensters. Seine Lippen wirkten ausdruckslos, das Gesicht war bleich. Neben ihm war der Sessel, in der rechten Hand das Schnurtelefon. »Der Fall geht mir nicht mehr aus dem Kopf«, erklärte er. »Auf der anderen Seite hat er mich darin gestärkt, einen neuen Beruf zu ergreifen. Bevor ich mich wider an die Geister anderer heranwage, muss ich zuerst meine eigenen bekämpfen.«
»Verstehe.«
Übergangslos wechselte er das Thema. »Und dir? Dir geht es gut?«
»Mir?«, schmunzelte er. »Mir geht‘s gut!«
»Deiner Frau?«
»Ihr geht‘s auch gut.«
»Gut…«
Wieder wurde es still. Der Anwalt ergriff das Wort: »Kann ich dir sonst noch behilflich sein?«
Spiegelthal schüttelte den Kopf, auch wenn er wusste, dass sein Freund es nicht sehen konnte. »Nein, das ist alles. Danke für deine Zeit!«
»Bitte! Gern geschehen.«
Spiegelthal blieb kurz angebunden, denn er war nachdenklich geworden.
»Gute Nacht!«, sagte er bald.
»Danke, ich wünsch dir was!«
Spiegelthal legte auf, sank in seinen Sessel zurück und schloss die Augen. Doch nun konnte er nicht mehr schlafen. Das Gespräch hatte ihn zu sehr aufgewühlt. Doch als er in jener Nacht in endlose Monologe versank, musste er sich eingestehen, dass sein Freund Recht hatte. Wie hätte er seine Schuld durch Geldstrafen gesühnt? Wie durch Freiheitsentzug? War es nicht sogar Ablasshandel, auf den er sich einlassen wollte? Spiegelthal dachte nach. Konnte er durch das Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden, so wäre es für ihn eine symbolische Ablösung seiner Schuld. Auch wenn ihm das als Erklärung für sein Verlangen erschien, blieb er weiterhin dabei, dass es nichts anderes als Ablasshandel wäre. Warum hatte er überhaupt so lange gegen Randolf argumentiert, warum sich so sehr in seine Rolle hineingesteigert, als müsse er seine Ansichten um jeden Preis verteidigen? Es musste ein neuer Wind wehen, also öffnete er das Fenster. Die kalte Nachtluft kam herein in das stickige Zimmer. Vielleicht würde er so besser schlafen können. Mochten seine Gedanken in die Ferne ziehen und ihn in Ruhe schlafen lassen.–
øøø
Das Haus stand leer, die Koffer waren gepackt. Spiegelthal stand in seinem alten Sprechzimmer. Ein karger Anblick ergab sich ihm, spätestens nachdem sein Sessel vom Umzugsdienst hinausgetragen worden war. Nun, da es so weit war, kam die Frage auf, ob er nicht hätte bleiben sollen. Doch die Entscheidung stand fest. Dachte er daran, doch noch umzukehren, wurde der Zweifel stärker und er wusste, dass er richtig handelte.
»Passen Sie auf den Plattenspieler auf!«, wandte er sich um. »Er hat einmal meinem Vater gehört.«
Wortlos nahm der Arbeiter den Karton mit sich. Die noch übriggebliebenen Schallplatten nahm Spiegelthal selbst und nutzte die Gelegenheit dem Vorauslaufenden zu folgen.
Auf der Türschwelle erwartete ihn der Kommissar.
»Kornelius!«, begrüßte er den unerwarteten Besucher.
Der Kommissar stand stramm und richtete seine Jacke. »Doktor!«
Mit einer Geste wies er ihn darauf hin, gleich zurück zu sein. Er stellte den Karton vor den zu beladenden LKW und kehrte um.
»Nun?«, begann er. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Es ist also wahr!«, begann der Kommissar theatralisch. Spiegelthal zog die Stirn in Falten.
»Ich kann Ihnen nicht recht folgen. Was ist wahr?«
»Sie sind ein Mann, der Wort hält. – Sie verlassen uns!«
Ob Kornelius Stormer bewusst solche vorwurfsvollen Worte wählte, um ihn zu einer Rechtfertigung zu drängen?
»Ich kann mein Leben so nicht weiterführen, Kornelius.« Spiegelthal ging auf Blickkontakt, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. Sein Gegenüber blieb ruhig, die Hände weiter an der Weste.
»So nachvollziehbar ich es auch finde, dass Sie gerne dem Vorbild des Vogelstrauß folgen würden und den Kopf in den Sand stecken möchten, wollte ich Sie zum Bleiben ermutigen, Herr Doktor!«
Spiegelthal stutzte bei der Bemerkung. »Verstehen Sie überhaupt meinen Ansatz, Herr Kommissar?«
»Ihren Ansatz?« Er kam näher. »Ich verstehe ihn sehr gut. Sie sind auf die Nase gefallen und wollen ihre sieben Sachen packen und sich aus dem Staub machen. – Spiegelthal, bei allem Respekt, wir brauchen Sie und was tun Sie? Sie laufen Ihrer Verantwortung davon!«
Dieser nahm den Schlagabtausch an und wechselte die Haltung. »Meine Verantwortung gilt meinem Beruf und meinen Patienten. – Und im Moment sehe ich mich nicht der Lage, ja, ich zweifle daran, ob ich jemals in der Lage war, meine Arbeit dem höheren Ziel zu widmen.« Er bemerkte den Blick eines Arbeiters, der hinter ihm zur Tür herauskam. Spiegelthal stellte sich tiefer in die Gasse und senkte die Lautstärke. »Wissen Sie, ich habe mein Leben der Wissenschaft gewidmet, mein ganzer Ehrgeiz aber meiner Eitelkeit. Das, was zwischen mir und James Winter vorgefallen ist darf kein zweites Mal paissieren.«
»So wählen Sie Ihre Patienten zukünftig weiser!«, schlug der andere vor. »Ich zweifle wegen dieser einen Sache nicht an Ihrer Kompetenz und andere tun es auch nicht. Sie haben ein paar Fehler begangen, na und? Das geschieht uns dauernd. Nicht, weil wir alle unfähige Leute bei der Polizei sind, sondern weil Irren menschlich ist. Wenn ich jedes Mal den Beruf aufgeben würde, nur weil ich einen Trugschluss begehe–«
»Das tut gar nichts zur Sache!«, widersprach er. »Oder sind bei Ihnen infolge eines Fehlers jemals andere umgekommen? Haben Sie Menschenleben damit zerstört oder jemanden in den Wahnsinn getrieben?«
»In den Wahnsinn treiben, tun Sie sich selbst, seitdem Sie mir diesen Brief geschrieben haben.«
»War es denn falsch, ehrlich zu sein?«
Stormer schüttelte den Kopf. »Ein Fehler wäre es, den Doktorgrad abzulegen.«
Spiegelthal ging zur Offensive über. »Haben Sie meine Anzeige überhaupt geprüft, Herr Kommissar oder ohne Weiteres an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet?«
»Das war keine Anzeige«, widersprach Stormer, »sondern ein Seelenkonflikt, der Ihnen zu Kopf gestiegen ist. Sie hatten nicht genug Abstand zu sich und Ihrer Arbeit. Wahrscheinlich hätten die Kollegen von der Staatsanwaltschaft auch nichts, was Sie ihnen vorwerfen könnten.«
Spiegelthal schnaubte verächtlich. »Meinen Sie, dass es auch nur ein Seelenkonflikt ist, jemanden ohne Fahrerlaubnis durch die Stadt fahren zu lassen?«
»Nein!«, bejahte auch Stormer. »Das ist eine Ordnungswidrigkeit und zeugt von Verantwortungslosigkeit.«
Spiegelthal antwortete mit einer Geste, die dem Ausspruch »Da sehen Sie!« gleichkam.
»Und gerade diese eine Sache«, sprach er mit den Fingern neben der Schläfe, »ziehen Sie auf, als würde alles andere davon abhängen. Weil Sie in diesem einen Punkt Anerkennung vor dem Gesetz finden, halten Sie sich daran fest und flüchten sich wie hinter eine Säule, wenn Ihnen alle anderen Argumente nicht mehr helfen.«
»Ich erwarte kein Verständnis«, wehrte er mit einem Schlenker mit der Hand, bereit sich abzuwenden.
»Spiegelthal, sehen Sie sich doch an! Sehen Sie! Spiegelthal! – Kain!« Damit zog Stormer seine Aufmerksamkeit auf sich. »Sie sind talentiert, jung, bodenständig! Schauen Sie sich doch den Großteil der Ärzte an! Diese aufgeblasenen, abgehobenen Schnösel. Von all denen sind Sie am nüchternsten geblieben. Von allen sind Sie mir mit Abstand am liebsten, Doktor!«
»Ich bedanke mich für die recht herzlichen Worte.«
»Sehen Sie! Sie tun es wieder!«, sprach er weiter auf ihn ein. »Wegen einer persönlichen Sache wollen Sie alles an den Nagel hängen, was Sie aufgebaut haben. Das Leben ist nicht zu Ende. Sie können doch Sühne begehen, indem Sie Ihre Arbeit von nun an besser machen, von nun an richtig. Wenn Sie jetzt aufgeben, haben Sie verloren – dann haben Sie verloren – erst dann!«
»Das ist richtig!«, antwortete er über die Schulter. »Wenn ich es an einer persönlichen Angelegenheit beenden würde, wäre es sicher falsch.«
Stormer hatte die Hände von sich gestreckt und war leicht in die Knie gegangen. Seine Lippen bewegten sich, als glaubte er, kurz davor zu sein, sein Gegenüber überzeugt zu haben.
»Doch ich gebe auch nicht auf.«
Die grauen Augen Spiegelthals blickten abermals in die des Kommissars.
»Ich gehe weder ins Asyl, noch stecke ich den Kopf in den Sand. Ich gehe diesen Weg, weil er mir richtig erscheint. Wie ich es einem Freund erklärt habe, erkläre ich es Ihnen. Bevor ich mich den Dämonen irgendeines anderen annehmen kann, muss ich zuerst meine eigenen bekämpfen.«
Das soeben noch zuversichtliche Gesicht des Kommissars wurde entrüstet. Die angespannten Züge fielen in sich zusammen.
Mit dem Rücken zu ihm gewandt, fuhr Spiegelthal fort. Die Sonne fiel so auf ihn, dass er einen langen Schatten warf.
»Kornelius?«, fragte er ihn. »Schauen Sie manchmal noch in die Sterne?«
Dieser zog Grübelfalten. »Ich glaube, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz, Doktor.«
Spiegelthal nahm einen tiefen Atemzug. »Es ist uns Menschen doch so leicht gemacht! Wir brauchen nur nach oben zu schauen, um zu erkennen, wie klein wir doch eigentlich sind.«
»Ach ja!«, warf er ihm mit hörbarem Groll hinterher. »Dann muss ich also zurücknehmen, was ich Ihnen gerade gesagt habe! Gehen Sie doch in die Schmollecke, wenn Sie glauben, damit Stärke zu zeigen! Wissen Sie was, Spiegelthal? Sie sind ein elender Feigling!«
»Ich schmolle gar nicht«, gab er ruhig zurück. »Sind es nicht Sie selbst, der mit einem Rückschlag nicht umgehen kann? Sie sind doch gekommen, um mich hier zu behalten, damit Sie sich keinen neuen Psychologen suchen müssen. Wir wissen doch beide, dass es keine persönlichen Beweggründe sind, die Sie antreiben, sondern Bequemlichkeit und Eigennutz!«
Stormer war zu ihm vorgekommen. Auf seinem Mund zuckte zornig ein Muskel.
»Und weil Sie diesmal nicht der Herr in der eigenen Stadt sind, hegen Sie einen Zorn gegen mich, Sheriff! Ja, ich untergrabe Ihre Autorität, doch auch das musste einmal gesagt sein.«
Danach bereitete er sich auf einen verbalen Angriff vor. Zu seiner Verwunderung schien sich nichts davon zu bewahrheiten.
»Gut!«, sprach Stormer. »Leben Sie wohl!« Mit diesen Worten zog er ab. Es war genau wie mit Francis. Wieder stand er alleine da, im Streit zurückgeblieben. Er trat auf die schärfsten Steine ohne Unterlass, doch er tat es für die Überzeugung. War er deshalb nicht schon einmal auf die Nase gefallen? Doch als er erneut Revue passieren ließ, fühlte er, dass er das Richtige tat.
»Das ist der Letzte!«, hörte er es hinter sich sagen.
»Gut!«, antwortete ein anderer.
Spiegelthal machte sich bereit, das Kommando zu geben, das Inventar in Richtung Wien zu schicken. Zuvor vergewisserte er sich, dass auch alles aus der Wohnung genommen war. Vom Wohnzimmer aus warf er noch einen letzten Blick auf den historischen Marktplatz.
»Auf Wiedersehen, meine Heimat!«
øøø
Spiegelthal hievte das Garagentor hoch und es zeigte sich ihm sein Juvaquatre. Das große schwarze Auto war in die Jahre gekommen, den Beititel Oldtimer hatte der Renault erst vor einem Jahr erhalten. Er hatte immer gehofft, dass sein Auto ihn überleben würde, damit er es einmal als Sachwert vermachen konnte, doch nach dem Unfall war er froh, dass es nicht sein Grab geworden war. Auch wenn der Wagen nach seiner Reparatur noch fahren konnte, war die Karosserie auf der linken Seite verbeult. Sofern das Auto noch eine Weile intakt bliebe, so war sein Wert zumindest stark gesunken.
Als der Motor schwerfällig startete, nahm er den Umweg durch die Altstadt. Noch einmal wollte er sich von seiner Heimat verabschieden. Er fuhr an dem Grundstück vorbei, wo früher einmal das Haus seiner Eltern gestanden hatte. Heute gehörte es zu einem Neubaugebiet, das momentan mit gleich aussehenden Häusern bebaut war. Weiter fuhr er durch die kleine Einbahnstraße, wo Jamie und Eda gewohnt hatten. Mit einem Berg voll Schulden war sein Freund in den Tod gegangen. Nun war das Grundstück in den Besitz des Schuldners übergangen; sprich in den Besitz der Stadt. Spiegelthal hatte erfahren, dass das Haus versteigert werden sollte. Vor nicht so langer Zeit war das Vorhaben laut geworden, dieses Gebiet dem Erdboden gleichzumachen und stattdessen ein Industriegebiet entstehen zu lassen, doch das Gesetz hielt dagegen, da einige Häuser unter Denkmalschutz standen. Spiegelthal war froh darum und so prägte er sich das Bild gut ein, denn er wusste nicht, wann und ob er je zurückkehren würde.—
Seine Fahrt sollte einen weiteren Umweg machen. Anstatt die dicht befahrene Bundesstraße auf die Autobahn zu nehmen, fuhr er durch den Wald, um noch einmal den Unfallsort zu passieren. Inmitten einer starken Linkskurve ging es weit den Hang hinunter, dem Fluss entgegen. Endlich war eine Leitplanke angebracht worden, um einen dritten tödlichen Unfall zu vermeiden. Der Ort löste Grauen in ihm aus, wie es bei Jamie gewesen sein musste, nachdem Eda hier ihren Tod gefunden hatte. Ein Moment der Unachtsamkeit und eine nasse Straße hatte ihren Käfer ins Schleudern gebracht, wie es den seinen aus der Straße geworfen hatte. Dass er aus der anderen Richtung gekommen war, hatte ihm das Leben gerettet und die fürchterliche Erkenntnis gebracht, dass Edas Tod kein Selbstmord gewesen war. Ein Unfall —bei diesem Gedanken lief es ihm kalt den Rücken herunter. Unendlich froh war er, dass er diesen Ort nun für immer verlassen konnte. Doch dieses eine Mal noch hatte er das Grauen über sich ergehen lassen, um es danach hinter sich zu lassen.—
Seine Route führte durch das Ruhrgebiet, am Rhein entlang und eine kurze Zeit durch den Schwarzwald. Es war nicht die kürzeste Strecke, aber vermutlich die schönere. Drei Zölle lägen auf der direkten Route durch den Osten. Der erste vor Magdeburg, der zweite nach Dresden beim Übergang in die Tschechoslowakei und der letzte bei Österreich vor Wien. Doch die Strecke bot ihm schöne Landschaftseindrücke von Mittel- über Süddeutschland bis hin zu Österreich. Die Fahrt dauerte beinahe zehn Stunden.
Vorbei an Koblenz, entlang am Rhein, ging es dahin, als er den Ruhrpott hinter sich ließ. Da war das breite Wasser, das im Licht der Sonne kräftig schimmerte. Kleine Ortschaften waren am Ufer erbaut worden, Felder und Wälder schlossen sich an. Jedes Dorf, so klein es auch war, schien mit den ewig langen Zugschienen verbunden zu sein. Während dieses Stücks schien die Sonne besonders stark. Als er Heidelberg passierte, zogen einige Wolken auf. Die Landschaft wurde bergiger und waldiger. Es war der Schwarzwald, südwärts von Karlsruhe, der wieder diese gewaltige Schönheit zeigte. Auch hier waren märchenhafte kleine Ortschaften in den Mulden angebracht, umgeben von hohen Bergen. Die Häuser waren weit auseinander gelegen, als gäbe es keinerlei Platzmangel, wie es in Städten der Fall war. Ein Traktor fuhr auf einem Waldweg seinem Feld entgegen und wieder führten die Gleise durch dieses Gebiet. Als er eine Schlucht überquerte, befuhr er eine Brücke im Bau eines Viadukts in schwindelerregender Höhe.
Es war etwa siebzehn Uhr, als er in Wien eintraf. Der Weg vom Stadteingang bis zum Haus dauerte noch eine gute Stunde, die auf den starken Verkehr zurückzuführen war. Schließlich stand er vor einem großen alten Haus, wo er im elften Stock seine neue Mietwohnung beziehen würde. Der Umzugswagen war bereits vor ihm eingetroffen. Der Fahrer murrte, über eine Stunde gewartet haben zu müssen. Auch der Vermieter war bereits eingetroffen. Mehr als entschuldigen konnte er sich nicht und er wies auf den Verkehr und erklärte, dass er einen weiten Weg hinter sich hatte.
Während die Kartons und Möbel hochgetragen wurden, erklärte der Hausbesitzer alles um das Haus und die Umgebung, wo es die nächsten Supermärkte gab und dass die Wohnung eine ausgesprochen gute Wahl war. Sein neuer Wohnsitz befand sich im neunten Bezirk Wiens, dem Alsergrund, welcher nahe an der Altstadt und den schönen Orten Wiens lag. Als der Vertrag unterschrieben und das Inventar hoch getragen war, bezog Spiegelthal sein neues Zuhause.
Ein schmaler und kurzer Flur führte ins Wohnzimmer der Zweizimmer-Wohnung, von wo er einen schönen Blick auf die Stadt hatte. Links von der Wohnungstür war das Bad und rechts vom Wohnzimmer die Küche mit zwei Türen. Die zweite Tür mündete in einen Gang, der zur Stube dazugehörte und in ein weiteres Zimmer führte, das er zum Schlafen benutzen wollte.
Den Sessel ließ er auf Anweisung in Richtung Küche ausrichten, seinen kleinen Röhrenfernseher diesem gegenüber und das Sofa unter das Fenster. Neben dem Fernseher ging es in die Küche. Die Ecke, die links von der Küchentür gelegen war, wurde von seinem Schreibtisch genutzt. In die leere Ecke stellte er den Plattenspieler neben das Sofa. Dieser war das Erste, was er noch vor allem anderen aufbaute und in Betrieb nahm. Da er in Wien war, ließ er Mozart laufen. Während die Zauberflöte spielte, begann er sich einzurichten. Die wenigen Dinge, die er mitgenommen hatte, füllten die fünfzig Quadratmeter voll und ganz aus. Nun war er froh, dass er vieles hergegeben hatte.
Gegen einundzwanzig Uhr ging er aus, um ein warmes Essen zu bekommen. Obwohl er müde war, nutzte er die Gelegenheit, die nah gelegene Einkaufsmeile zu durchqueren. Die Eindrücke gefielen ihm wie alles, das er in den wenigen Stunden von Wien schauen durfte. Schon an diesem Abend fiel ihm die gemütliche Art der Bevölkerung auf, wo er doch ein schnelllebiges Wandeln in einer Großstadt erwartet hatte. Außerdem waren die Wiener freundlich und zuvorkommend, was mancher Urlauber zu Spiegelthals Bedauern gar nicht erfuhr, wenn er sich bei seinem Aufenthalt ausschließlich bei den Touristenattraktionen aufhielt. Doch ein Zeichen der österreichischen Mentalität war eindeutig die Sauberkeit der Straßen. Nicht wie in Deutschland, wo der Müll häufig stehen und liegen gelassen wurde, schienen sich die Wiener häbiger an so manche Sitte zu halten. Der Eindruck gefiel ihm. Außerdem ging kaum ein Bürger bei Rot über die Straße, selbst dann, wenn kein Auto kam.
Zum Abendessen ging er in eine Gaststätte mit typisch österreichischer Küche ganz in der Nähe seines Appartements und bat um eine typisch wienerische Spezialität. Die Wirtin bot ihm ein Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch an und erklärte auf seine Verwunderung hin, dass nur Kalbfleisch für ein echtes Wiener Schnitzel verwendet werden dürfe. Alles andere wäre höchstens ein Schnitzel Wiener Art.
Wahrlich, Spiegelthal kannte Wien noch nicht. Im Nachhinein war er erschreckt über das Risiko, das er eingegangen war. Nur einmal, um die Wohnung zu besichtigen, war er hergekommen. Die wenigen Eindrücke hatten ihm gefallen, doch mehr als auf der Fahrt zum Haus und wieder zurück hatte er nicht gesehen. Doch das Risiko hatte sich gelohnt. Spiegelthal begann Wien zu lieben. In den ersten Tagen klangen immer wieder Jamies und Franks Worte in seinem Kopf: »Sei einfach mal spontan!«
øøø
Drei
Bereits am Tag danach beschloss er die Stadt zu erkunden. Er besorgte sich einen Reiseführer und stieg in einen der Touristenbusse für die Stadtrundfahrten. Die Tour ging um die fünf Kilometer lange Ringstraße, welche das historische Zentrum Wiens einschloss. Die schier erschlagende Größe und Weite mancher Bauten zwang ihn auf die Knie. Ständig wiederholte sich der Kuppelbau-Stil und immer wieder tauchten tempelähnliche Paläste auf, die der griechischen Architektur nachempfunden waren; zumindest der der Renaissance. Der Sprecher erklärte, dass nicht nur der Adel, sondern auch reiche Unternehmer und Industrielle den Bau von derartigen Prachtbauten im neunzehnten Jahrhundert in Auftrag gegeben hatten und bewohnten.
Am Hundertwasser-Haus endete die Linie. Spiegelthal verließ den Bus, um sich den Ort näher anzusehen. Er betrat eine Art Fußgängerzone, die mit Kopfstein gepflastert und völlig uneben war. Eine ganze Hausfassade bestand aus schiefen, farbigen Rechtecken, ganz nach dem Stil Hundertwassers. Zwischen der Fassade führte ein nach innen abgerundeter Torbogen in einen Innenhof mit Garten. Überall wuchs Grün; waren es Topfpflanzen an der Hauswand oder Bäume im Hof und auf dem Gehsteig.
Weiter hinten traf er auf eine rote Londoner Telefonzelle, die ihm ein Schmunzeln entlockte.
Später stieg er einer anderen Linie zu. Dort wurde erklärt, dass die Donau vier Mal durch Wien fließe. Einmal als Fluss und einmal als trockengelegter Kanal, genannt die Alte Donau. Dementsprechend gab es eine Neue Donau sowie einen weiteren Donaukanal, der an die Leopoldstadt anschloss, die von Wienern als zweiter Bezirk bezeichnet wurde.
Es gab dreiundzwanzig Bezirke in Wien. Alle trugen einen Namen, wurden allerdings meist mit ihrer Nummer benannt. Bei einem Blick auf den Reiseführer erkannte er, imselben Bezirk wie Sigmund Freud zu wohnen, der berühmt berüchtigten Berggasse neunzehn.
Die Linie ging über den Donaukanal, weg von der Ringstraße in einen Bereich, in dem es vorwiegend moderne Gebäude gab. Der Stadtführer bat einen Blick nach draußen zu werfen, wo die Wände des Kanals von Graffiti besprüht waren. Die Straßenmaler seien ein Zeichen für die jüngere Generation, die vor allem in der Umgebung der Donauinseln anzutreffen sei. Dort gab es eine Menge Cocktail-Bars und Bootsanlegestellen; ein Teil der Stadt, welcher von älteren Menschen weniger besucht wurde. Anschließend wendete der Bus, bevor das Industriegebiet begann.
Im Laufe der Tage besuchte Spiegelthal das überfüllte Schloss Schönbrunn, das geradezu von Touristen eingerannt wurde, sowie den Park vor dem Schloss Belvedere und die vielen Parkanlagen, die in Wien besucht werden konnten; kilometerlange Fußwege zum Spazierengehen, Gelegenheiten auf Bänke zu sitzen und die städtische Natur zu genießen. Doch überall fehlte es weder an Pflege noch an prunkvollen Brunnenanlagen, die in den Parks betrachtet werden konnten.
Spiegelthal erfuhr über das Leben des Kaisers Franz Joseph und seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern, die ihm zuvor nur als Kaiserin Sisi aus den Romy Schneider-Filmen berühmt war.
Der Kaiser war für seine konservative Art bekannt. Doch obwohl er Technik gehasst hätte, ließ er eine kaiserliche U-Bahn bauen, die er notgedrungen einmal in fünf Jahren benutzte, als Zeichen, dass er sich für den Fortschritt einsetze. Später wurde die U-Bahn zur zivilen Nutzung freigegeben. Das Parlament der Wiener, welches bewusst einem griechischen Tempel als Vorbild der Demokratie nachempfunden war, wurde zum Dorn im Auge des Kaisers, der selbst lieber absolut regieren wollte.
Sisi starb nicht in jungen Jahren, wie er angenommen hatte. Sie ließ sich lediglich nicht mehr malen, nachdem sie die Fünfunddreißig erreicht hatte. An ihrer Schwester Statt wurde sie die Gemahlin des Kaisers, doch zog sich vom politischen und gesellschaftlichen Leben zurück, nachdem sie gemerkt hatte, wenig für Solcherlei übrig zu haben. Doch das Volk der Ungarn, das stets von Österreich in den Schatten gedrängt worden war, hätte sie so sehr interessiert, dass sie die Sprache erlernte und somit großes Ansehen unter den Ungarn erlangte.
Sie starb, als sie von einem italienischen Attentäter mit einer Stricknadel erstochen wurde, der eigentlich das Ziel hatte, den Kaiser zu ermorden, doch stattdesen ergriff er die Gelegenheit, die Kaiserin zu töten.
Das Kunsthistorische Museum gegenüber der kaiserlichen Hofburg wurde zu einem Ort, den Spiegelthal mehr als nur einmal besuchte. Die Ausstellung von präparierten Tieren war auf der einen Seite bedauerlich, doch auf der anderen Seite eine Gelegenheit Raubtiere von Nahem zu betrachten. Am meisten faszinierte ihn die Architektur; die in die Höhe strebenden Kuppeln mit ihren detail-verliebten Verzierungen und Wandmalereien, von denen es so viele in Wien zu sehen gab.
Auf der Suche nach dem Zentralfriedhof führte es ihn fälschlicherweise in den elften Bezirk, der bereits von der U-Bahn-Station aus nicht einladend aussah. Später erfuhr er, dass der Simmering in etwa mit dem East-End von London zu vergleichen war. Zwar war das Wohnen dort besonders günstig, aber weniger preiswert. Zu seinem Erstaunen fand er dort eine grüne Insel inmitten ruß-geschwärzter Hausfassaden. Der wald-ähnliche Sankt Marxer Friedhof beinhaltete das Grab Mozarts in seiner Mitte. Der Name entsprach dem heiligen Markus und nicht Karl Marx, worüber er zuvor verwirrt war.
Auf einem Schild des Grabs wurde dem Besucher mitgeteilt, dass Mozarts Leiche nie gefunden wurde, nachdem sie vermutlich in einem Massengrab verscharrt worden wäre. Das Grab hatte vielmehr eine symbolische Bedeutung inne.
Schließlich erfuhr er, dass in der Berggasse neunzehn seit ein paar Jahren ein Museum geöffnet hatte, das Einlass bot in die Privatwohnung Sigmund Freuds. Rechter Hand des Hausgangs führte das Treppenhaus nach oben. Dem Alter des Gebäudes entsprechend war alles im Baustil des späten neunzehnten Jahrhunderts. Sein Blick verfing sich an einer runden Lampe, die am Treppengeländer angebracht war. Der Anblick löste eine Empfindung in ihm aus, die sich mit dem melancholischen Regenwetter verband.
Vor der Wohnungstür traf er auf zwei Touristen, die ebenfalls Einlass begehrten. Nach einer kurzen Wartezeit wurden sie von einem Herr an der Tür empfangen und hereingebeten. Spiegelthal bezahlte ein paar Schilling und betrachtete eingehend die Wohnung, in der die alten Möbel, Hut und Gehstock des Psychologen aufbewahrt und ausgestellt waren. Trotz aller Begeisterung musste er enttäuscht feststellen, dass das berühmte Sofa und die Couch in London standen, wo Freud seinen Lebensabend verbracht hatte. Er warf einen Blick durch das geöffnete Fenster zur Straßenseite hin. Er war angekommen in seinem neuen Zuhause.
øøø
Bei seiner Arbeit als Journalist für die wissenschaftliche Wochenzeitung wurde ihm bald klar, dass er von seinem Gehalt nicht leben konnte. Er arbeitete von zu Hause aus und die Zeit belief sich auf drei, höchstens vier Stunden am Tag. Bereits nach Abschluss seines Arbeitsvertrags suchte er nach einem ergänzenden Job, dem er nachgehen konnte. Von da an arbeitete er hier und da, aber immer dort, wo gerade Arbeit gesucht wurde. Zum ersten Mal in seinem Leben arbeitete er körperlich. Einmal als Verkäufer, ein anderes Mal in der Logistik, dann als Paketausträger oder im Empfang eines Hotels, während die Monate vergingen und sich sein psychischer Zustand zunehmend verschlechterte.—
Er besuchte im Rahmen seiner Artikel mehrfach die Woche Vorlesungen bei einem Professor der Psychologie, mit dem er sehr schnell eine freundschaftliche Beziehung pflegte. Auf die Frage, ob er schon immer als Journalist gearbeitet hatte, antwortete er stets mit ja. Anfangs, um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, später, da er befürchtete verspottet zu werden wegen seines beruflichen und sozialen Absturzes. Er war Siddhartha wie in der Erzählung von Hermann Hesse auf der Suche nach Weisheit und dem inneren Gleichgewicht. Sein Versuch Befreiung zu erlangen, in dem er sich selbst erniedrigte, zeigte keine Wirkung, sondern brachte ihn in eine tiefe Depression. Er versuchte sich selbst zu verstehen, versuchte sich zu therapieren, doch es funktionierte nicht. Spiegelthal führte ein Traumtagebuch, versuchte sich mit Musik zu heilen, machte Sport und ging aus. Er war soweit zu fragen, ob ein Psychologe überhaupt geheilt werden konnte. Alle Theorien verstehend, scheiterte er an der Anwendung.
Die Kultur blühte wie noch nie, das gesellschaftliche Leben schien einen Höhepunkt erreicht zu haben. Überall spielte Rock und Pop. Die Kinokassen boomten und die Unterhaltungsindustrie war noch gegenwärtiger geworden als in den Siebzigern. Doch all die Lebensfreude ging an ihm vorbei. Nach dem Winter kam der Sommer, nach dem Sommer kam der Winter. Doch egal, ob Schnee oder Sonnenschein, die Welt war kälter geworden. Irgendwann wusste er nicht mehr weiter und besuchte einen Therapeuten. Er wollte bewusst zu einem Psychotherapeuten und keinem Doktor, da er eine neue Art der Therapie suchte. Vielleicht halfen ihm neue Ansätze, die er selbst noch nicht kannte.