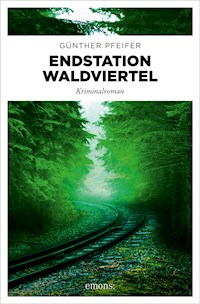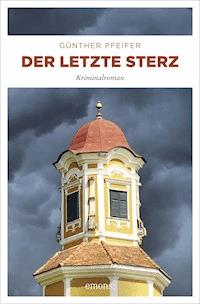
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein skurriler Kriminalroman aus der steirischen Idylle. 'Nicht Johann sollst du ehren, sondern Leuthold!' – Eigentlich ein schöner Satz. Aber mit Blut auf einen Sockel geschmiert wirkt er gleich etwas weniger schön. Und wenn auf dem Sockel statt der Statue des Erzherzogs Johann eine künstlerisch fragwürdige Betonfigur steht, ist das überhaupt nicht mehr schön. Und wenn in dieser Figur die Leiche eines Mannes steckt, dann gefriert einem leicht das Blut in den Adern. Hawelka und Schierhuber ermitteln und müssen bald auf einer steirischen 'Huabm' um ihr eigenes Leben fürchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Pfeifer wurde in Hollabrunn (Niederösterreich) geboren, lernte ein Handwerk und war jahrelang Berufssoldat. Seit seinem Wechsel in die Privatwirtschaft arbeitet er im Ein- und Verkauf. Er schreibt Beiträge für Magazine, außerdem Theaterstücke und Kriminalromane. Günther Pfeifer wohnt in Grund, einem kleinen Dorf im Weinviertel.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Montage aus rbiedermann/Depositphotos.com, shutterstock.com/Kirill Smirnov Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Lothar Strüh eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-405-6 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Prolog
7.Dezember
»Der Erzherzog«, sagte der Erzherzog, »hat ja die Steiermark geliebt.« Er warf einen Blick in die Runde. Niemand wagte es, wegzusehen. Wie die Kaninchen vor der Schlange, dachte Hawelka.
»Der Erzherzog«, fuhr der Erzherzog fort, »hat sich um die schöne Steiermark auch sehr verdient gemacht.« Wieder schienen seine stechenden Augen jeden Einzelnen zu fixieren. Obwohl das gar nicht geht, dachte Hawelka. Zumindest nicht alle gleichzeitig.
»Der Erzherzog«, hob der Erzherzog jetzt die Stimme, »ist für die Steirer ein Heiliger!« Niemand verzog eine Miene. Obwohl es eine tödliche Gefahr bedeutet hätte, Hofrat Zauner mit seinem Spitznamen anzureden, wusste dieser mit Sicherheit, dass er seit gut zwanzig Jahren hinterrücks nur »Erzherzog« genannt wurde.
»Den Erzherzog-Johann-Jodler singen dort schon die Kinder«, behauptete jetzt der Erzherzog, der mit Vornamen Johann hieß. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Wenn einer, nur ein Einziger der Beamten ein leises Schnaufen vor unterdrücktem Lachen hätte hören lassen, wäre die ganze Versammlung in hysterisches Gelächter ausgebrochen, wie ein Haufen pubertierender Knaben. Und dann…
Aber das passierte nicht.
»Und jetzt ist er gestohlen worden, der gute Erzherzog«, setzte der Erzherzog fort. »Nicht er persönlich, aber seine Statue vor einer Kapelle bei Stainz. Und damit der Sockel nicht so leer ist, haben die Raubersbuben einen anderen draufgestellt. Der ist aber nicht aus Stein, und aus Bronze ist er auch nicht. Der ist aus Fleisch. Aber weil das Fleisch schwach ist, hat man ihn ein bisserl mit Gips verziert. Einem Wanderer ist das trotzdem aufgefallen, dass sich der Erzherzog so verändert hat, und da hat der Wanderer dann die Kollegen angerufen. Und siehe da, wie die den Gips herunten gehabt haben, ist es dem Mann darunter gar nicht so gut gegangen, weil der doch schon ein paar Tage tot war. Und das ist kein Wunder, weil wenn man kein Blut mehr im Körper hat, dann ist das nicht g’sund. Der Amtsarzt hat gemeint, dass man ihm die Kehle durchgeschnitten hat und dann mit dem Kopf nach unten aufgehängt, damit er schön ausblutet wie eine Sau. Oder sagen wir, wie ein Saubär– weil’s ja ein Mann war. Vorher zumindest. Nachher nicht mehr, weil sie ihm da was weggeschnitten haben, vielleicht weil er es eh nicht mehr gebraucht hat, vielleicht aber auch, weil die Gipsfigur dann so komisch ausgeschaut hätt. Wie dem auch sei, der Erzherzog ist weg, und die Leich ist da. Und auf den Sockel haben die noch einen schönen Spruch gemalt– irgendeine Sauerei.«
»Aber das ist doch was für die Grazer Kripo«, warf Henk ein. Die anderen atmeten auf. Endlich durfte man sich wieder bewegen, ohne sofort die Aufmerksamkeit des Alten auf sich zu ziehen. Übrigens war der Einwurf keine Heldentat von Henk, als Dienstältester und einer der erfolgreichsten Ermittler bei der Wiener Kriminalpolizei konnte er es schon einmal wagen, eine dienstliche Frage zu stellen. Auch wenn grundsätzlich niemand vor den Launen von Hofrat JohannP. Zauner gefeit war. Und tatsächlich…
»Halten Sie mich für einen Polizeischüler, der die Zuständigkeitsbereiche nicht weiß?«, raunzte er Henk an. »GlaubenS’, dass ich mit dem ganzen Club da nur plaudern will, weil mir so fad ist? Dass ich in der Nacht z’Haus sitz und mir überleg, welche Raubersg’schichten aus die Bundesländer ich erzählen soll, damit meine Leut froh und munter bleiben?«
Jüngere Beamte, die den Erzherzog noch nicht so gut kannten, hätten jetzt den Fehler gemacht, das Gesagte für eine Art Witz zu halten und pflichtschuldig zu lachen, um sich anzubiedern. Das wäre grundfalsch gewesen.
»Und vom steirischen Tourismusverband bin ich auch nicht, dass ich Werbung mach für Stainz. Aber da gibt es die…«
Hawelka schaffte es, den Monolog des Alten kurz auszublenden und die Möglichkeiten abzuwägen. Er kannte Zauner und hatte sofort durchschaut, worum es hier ging. Irgendeine Personalknappheit in der Steiermark, irgendeine ministerielle Weisung in Wien, irgendeine Unvereinbarkeit… es war ja auch ganz egal, hier ging es darum, dass sich in Kürze ein oder zwei Beamte in die Steiermark aufmachen mussten, und der Erzherzog traf gerade die Auswahl.
»…weil wenn der Landeshauptmann mit der Ministerin telefonieren muss, dann beneidet ihn niemand. Ich sag Ihnen etwas, mich werden Sie nicht schlecht über Frauen reden hören. Das ist nicht meine Manier. Ich hab den größten Respekt vor die Frauen. Gehabt. Bis ich die kennengelernt hab. Ich hab mich gefürchtet, wenn die gegrinst hat. Obwohl ich mich sonst nicht fürchte, weil ich war im Krieg1, und da…«
Hawelka rechnete sich gute Chancen aus, davonzukommen. Normalerweise veranstaltete Zauner nämlich kein Casting, sondern schickte einfach ihn und seinen Partner Schierhuber dorthin, wo es ungemütlich war. Aber dass er diesmal alle versammelt hatte, ließ hoffen. Außerdem hatte sich soeben Henk unabsichtlich empfohlen.
»…ist mir wurscht, weil die Politiker mir im Mondschein begegnen können, und im Mondschein kriegen sie dann einen wunderbaren Eindruck von meinen edleren Körperteilen, und den Eindruck, den habens’ dann noch lange im Gesicht. Und wenn es so schön heißt: ›Dann halte auch die andere Backe hin‹, dann zier ich mich nicht, und das ist dann wieder ein neuer Eindruck.«
Die Tatsache, dass Hawelka und Schierhuber nicht automatisch ausgesucht worden waren, deutete auf einen wichtigen Fall hin, wo es nicht nur darum ging, wegen eines personellen Engpasses auszuhelfen, sondern darum, einen Fall von großem öffentlichen Interesse prestigeträchtig zu lösen. Hawelka atmete auf. Da kamen sie ohnehin nicht in Frage. Nicht weil er und sein Partner so schlechte Kriminalisten waren, sondern weil ihr Chef ihnen das nicht zutraute. Die Rangordnung beim Dezernat für Gewaltverbrechen und Mord in Wien war vom Erzherzog, bereits kurz nachdem er die Welt erschaffen hatte, in Stein gemeißelt worden, und keinem vernünftigen Wesen wäre es eingefallen, sie anzuzweifeln.
»Aber da gibt es noch etwas. Befehle. Und ein Befehl ist ein Befehl, und auch wenn das bei der Frau Ministerin Weisung heißt, ist es trotzdem ein Befehl. Auch wenn sie sonst keine Ahnung von irgendwas hat– was ein Befehl ist, weiß sie schon, das hat sie gleich als Erstes gelernt, und jetzt hamma den Befehl…«
Der Erzherzog war die Nummer eins, dann kam lange nichts und dann Gott, das war klar. Dann folgten die gewöhnlichen Sterblichen, und da war Henk der Erste unter Gleichen. Ein ruhiger Mann mit natürlicher Autorität, intelligent, erfahren und abgebrüht. Außerdem einer der wenigen, der den beiden spätberufenen Kriminalpolizisten Hawelka und Schierhuber von Anfang an korrekt und kollegial begegnet war, während die meisten anderen die zwei eher belächelt hatten, als sie, die als uniformierte Polizisten am Land Dienst gemacht hatten, sich nach Kursen und Prüfungen zur Wiener Kriminalpolizei versetzen ließen.
»…aber so nicht! Ich bin ein seelensguter Mensch, der jeden Spaß mitmacht, aber bei so was mach ich nicht mit, weil das gegen die Menschenwürde ist.«
Der Erzherzog hatte sich warmgeredet. Die Befehlsausgabe würde sich also noch hinziehen. Hawelka schaltete wieder auf Stand-by und betete zum hundertsten Mal die interne Rangordnung herunter. Eine Art masochistische Meditation. Also Henks Stellung war klar, und daran gab es ja auch nichts auszusetzen, weil Henk okay war. Nimmervoll, ein junger Offizier, der gleich nach Henk gereiht war und dem der Erzherzog erstaunlich selten die Leviten las, war auch zu Recht ganz vorne mit dabei. Aber die anderen? Sojka, der allgemein nur »Cowboy« genannt wurde und ständig selbst mit einem Bein im Kriminal stand? Dienstaufsichtsbeschwerden, Untersuchungsverfahren, Zwangsurlaube, ständige Versetzungen von einem Dezernat zum anderen, ewig lange Krankenstände– trotzdem war er nicht loszubekommen. Er betrachtete den Polizeidienst nur als Zweitjob zu seinen eigentlichen Geschäften, von denen er offensichtlich gut leben konnte. Schütz hingegen war ein junger, übereifriger Kollege, der hervorragend im Internet recherchieren konnte. Leider betrachtete er aber die Ermittlungen im Außendienst als eine Art Computerspiel, und da kam es schon einmal vor, dass die Projektile der Warnschüsse nur so durch die Gegend flogen. Außerdem liebte er vorläufige Festnahmen, die meistens nicht gerechtfertigt waren, wodurch er den Anwälten der Verdächtigen geradezu perfekt in die Hände spielte.
»Und da sag ich dann: ›ZiehenS’ sich warm an, weil die Nacht wird immer kälter und die Nacht in der Weststeiermark besonders. Aber damit das kein Polizeiausflug wird, mit Haussulzjausen und Kernöl und einer Schilcherverkostung, werden mir nicht alle ins Deutschlandsbergische reisen, sondern nur zwei von Ihnen, weil die anderen braucht unser schönes Wien, damit die Pülcher da nicht übermütig werden und sich jetzt im Winter schon einen Lenz machen.‹«
Gleich würde es so weit sein, gleich würden die Namen genannt werden. Hawelka ging die Liste weiter durch. Pollmann hatte hundertfünfzig Kilo (bei einer Körpergröße von eins siebenundsiebzig), Gerlitz war ein Prolet, wie er im Buche stand, und stellte sich bei den Ermittlungen so blöd an, dass die Fälle regelmäßig durch andere nachbearbeitet werden mussten. Hohlstein dagegen hatte es mit den Frauen, und dadurch brachte er sich immer wieder in Schwulitäten.
»Und jetzt schau’n wir einmal, wer die glücklichen Gewinner sind. Da strahlen die Gesichter wie unterm Christbaum bei der Bescherung. Henk!«
Hawelka hätte jubeln können. Nicht weil er schadenfroh war (zumindest nicht mehr als andere), eigentlich hätte es ja auch nicht Henk treffen sollen, sondern irgendeinen… Sojka zum Beispiel oder Gerlitz. Aber ihm war trotzdem zum Jubeln zumute. Endlich einmal hieß es nicht »Hawelka und Schierhuber«. Endlich einmal in Wien bleiben und eigene Ermittlungen abschließen können. Vielleicht mit der Aussicht auf einen größeren Fall. Abends mit Schierhuber zum »Reznicek« gehen und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Das war nach seinem Geschmack.
»Die große Ziehung wird der Henk vornehmen, weil der Henk jetzt einmal vier Wochen Häuptling spielen darf, und ich sag: ›Habt Acht, rechts um, in den Urlaub marsch!‹«
Den Anwesenden blieb der Mund offen stehen. Sie kannten den Erzherzog in seiner Kanzlei, hinter seinem Schreibtisch sitzend. Sie kannten den Erzherzog im Besprechungsraum, sie alle gemeinsam zur Sau machend. Sie kannten den Erzherzog in unterschiedlichen Büros, sie einzeln zur Sau machend. Sie kannten den Erzherzog die Gänge durchschreitend und Angst und Schrecken verbreitend. Den Erzherzog im Urlaub kannten sie nicht.
Später, als alles vorbei war, wurde das Auskunftsbüro Berlakovic mit näheren Recherchen beauftragt und fand Folgendes heraus: 1993 hatte der Erzherzog seine Kanzlei im Morddezernat bezogen und von seinem gesamten Urlaubsanspruch zwei Wochen konsumiert. Eine um die Weihnachtszeit herum (wo ohnehin keiner da war und nur der Journaldienst einen Notbetrieb aufrechterhielt), und die zweite, in Form mehrerer Fenstertage, übers ganze Jahr verteilt. Der Einfachheit halber hielt er die folgenden zwanzig Jahre an dieser Regelung fest. Zwei Wochen am Stück hatte er noch nie in Anspruch genommen. Drei waren sowieso undenkbar. Jetzt aber hatte er »vier« gesagt!
Und weil ihn die offen stehenden Münder seiner Knechte offenbar langweilten, beendete Hofrat Zauner an dieser Stelle die Audienz abrupt und marschierte mit den väterlich-kollegialen Worten »Henk! Übergabe Kanzlei! Stunde!« aus dem Besprechungsraum. Henk selbst hatte die Eröffnung offenbar völlig unvorbereitet getroffen, und er unterbrach die Dienstbesprechung für eine Viertelstunde.
Sie gingen hinaus zum Rauchen.
»Krebs!«, diagnostizierte Gerlitz. »Das kommt so schnell, bei meinem Onkel war das genauso. Werdet’s sehen, in drei Monaten graben wir den Alten ein.« Er spuckte aus und schnorrte sich eine Zigarette von Pollmann.
»Das glaub ich nicht«, meinte Schütz, der zwar nicht rauchte, aber wegen des Gemeinschaftsgefühls dabeistand. »Ich glaub, dass der Krebs sich vor dem Erzherzog fürchten würde, wahrscheinlich will er nur einmal–«
»Erzherzog!«, wieherte der Cowboy. »Ich hab geglaubt, ich brunz mich an, wie er auf einmal vom Erzherzog Johann zu reden anfängt! Brenzlige Situation, Boys! Wenn da einer gelacht hätte, wäre er vom Alten persönlich gehenkt worden.«
»Ja«, stimmte Pollmann zu, »das war knapp. Aber irgendwas muss doch los sein, dass er jetzt auf einmal seinen Urlaub nimmt, oder?«
»Na was?«, sagte Hohlstein. »Eine Frau steckt dahinter. Was sonst?«
»Na, bist du auch noch von wo?«, fragte Gerlitz und schüttelte den Kopf. »Der ist doch weit über sechzig, und ausschauen tut er wie zwischen Tod und Verwesung. Den schaut doch keine an, der kann ja nicht einmal mehr pemp–«
»Das ist egal, hinter solchen Aktionen steckt immer eine Frau«, beharrte Hohlstein.
»Yeah«, bekräftigte der Cowboy, »wenn bei einem das Hirn plötzlich aussetzt, dann, weil das Blut woanders ist.«
»Blödsinn, ich sage euch, dass er krank ist. Der geht sich sicher operieren lassen. Aber bestimmt schneiden die ihn auf und machen gleich wieder zu, weil’s sinnlos ist. Ich kenn solche Fälle.«
Hawelka und Schierhuber hatten sich nicht am Ratespiel beteiligt, sondern nur stumm geraucht, und nun dämpften sie aus und gingen dorthin, wo stets alle Rätsel gelöst wurden: zum Auskunftsbüro Berlakovic.
Das Auskunftsbüro war über fünfzig, zweimal geschieden und wechselte die Haarfarbe im Monatstakt. Mit Vornamen hieß das Auskunftsbüro Herta. Sie teilte sich das Zimmer mit drei Frauen, die sie an Kindes statt angenommen hatte. Sicher, eigentlich waren es Kolleginnen und Mitarbeiterinnen im Administrationsbüro des Morddezernates. Aber die Berlakovic führte ihre Abteilung eben wie eine Familie, jede von ihnen hatte ihre Rolle, und sie war die Mutter.
Als Hawelka und Schierhuber eintraten, zeigte sich das gewohnte Bild: In der rechten hinteren Ecke saß die Forstner, bearbeitete ihre Tastatur mit beängstigendem Tempo und schenkte ihrer Umgebung keinerlei Aufmerksamkeit. Meist erledigte sie die Schreibarbeit für die gesamte Abteilung und war dafür von allen Kommunikationsaufgaben freigestellt. Ihr gegenüber saß Janne Frischauf und wühlte in den Akten. Sie grinste die beiden an und fragte, wo die Topfengolatschen so lange blieben.2 »Wie lange wollt ihr uns noch hungern lassen? Die Herta fällt mir bald vom Fleisch.« Das dröhnende Lachen, das daraufhin einsetzte, kam von der telefonierenden Chefin selbst, der es nicht das Geringste ausmachte, dass am anderen Ende der Leitung ein hoher Ministerialbeamter war, der nun mit einer mittleren Vertäubung zu kämpfen hatte.
»Ich fall nicht vom Fleisch, ich bin ein elfenhaftes Wesen, das nur vom Glockenblumentau leben kann. Ich brauche keine Kalorien, nur die Liebe«, flötete sie und reckte ihre mollige Figur auf dem ächzenden Drehstuhl.
»Das wissen wir«, bestätigte Hawelka ernsthaft, »gell, Sepp?« Schierhuber nickte, ohne die Miene zu verziehen.
»Was?«, fragte das elfenhafte Wesen jetzt in den Hörer. Offenbar hatte die Gegenstelle einen Kommentar zu ihrem letzten Satz abgegeben. »Herr Doktor, Sie sind ja ein ganz Schlimmer!«, rief sie aus, was den Angesprochenen offenbar zu Höchstleistungen der Verbalerotik animierte, denn gleich darauf ertönte das berühmte ordinäre Berlakovic-Lachen, und mit den Worten »Mir wird so heiß, ich kann gar nicht weiterreden« legte sie auf. »Vierundsechzig und brunftig wie ein Siebzehnjähriger«, erklärte sie den Anwesenden. »Zumindest mit dem Mundwerk, sonst wird sich da nicht mehr viel abspielen. Aber schön für ihn, wenn er’s glaubt.«
Dass derartige Gespräche bei der Berlakovic keine Seltenheit waren, lag zum Teil daran, dass sie im Laufe ihrer nahezu dreißig Dienstjahre praktisch in jeder Abteilung des Innen- und des Justizministeriums bekannt wie ein bunter Hund geworden war. Der Begriff »netzwerken« war noch nicht erfunden, als es die Berlakovic in dieser Disziplin schon zur Meisterschaft gebracht hatte. Dass sich im hauptsächlich von Männern dominierten Polizeiapparat eine Frau, die deftige Zoten schätzt3, beliebt macht, ist logisch. Für die Recherchen des Auskunftsbüros war diese Eigenschaft von ihr jedenfalls Gold wert.
»Apropos vierundsechzig und brunftig«, hakte Hawelka ein, »ich wollte dich was fragen–«
»Nein, Pepi, ich hab Migräne«, unterbrach die Berlakovic, was Janne Frischauf in helles Lachen ausbrechen ließ. »Außerdem bist du noch gar keine vierundsechzig.« Schierhuber grinste, die Forstner tippte mit leicht nach unten gezogenen Mundwinkeln und zuckte mit keiner Wimper.
»Ich nicht«, sagte Hawelka, »aber der Erzherzog. Es geht die Mär, dass ein Frauenzimmer hinter seinem plötzlichen Langzeiturlaubswunsch steckt. Vier Wochen! Andere wieder sagen, dass er Krebs hat. Wir wollen jetzt von dir die ganze Wahrheit hören. Und wenn uns diese Wahrheit gefällt, dann können wir über die Topfengolatschen reden.«
Wären er und Schierhuber in Ballettröckchen eingetreten, die Wirkung hätte nicht stärker sein können. Die Frischauf stieß einen kleinen Schrei aus, der nie um eine Antwort verlegenen Berlakovic fiel die Kinnlade herunter, und, was vielleicht das bedeutendste Ereignis war, die Forstner hörte auf zu tippen und sah den Sprecher fassungslos an.
»Häää?« Das kam dreistimmig.
»Das gibt’s nicht«, entfuhr es Hawelka ungläubig. »Sagts nicht, ihr habts das nicht gewusst.«
Aber das Undenkbare war eingetroffen. Das Auskunftsbüro war ahnungslos! Alle Anwesenden starrten auf Herta Berlakovic, als hätte sie, die Allwissende, absichtlich etwas vor ihnen geheim gehalten. Was selbst bei sehr derben Witzen nie vorkam, trat ein: Sie wurde feuerrot.
»Ich… das gibt’s nicht, keine Ahnung… der Erz… Urlaub? Er hat kein Wort gesagt… kein Urlaubsformular abgegeben, nichts… ich…«
»Also keine Topfengolatschen«, stellte Schierhuber fest.
»Wo habts ihr das her?«
»Er selber hat es gerade verkündet. Der Henk soll ihn vertreten. Jetzt brodelt natürlich die Gerüchteküche«, erklärte Hawelka.
»Da kümmer ich mich drum«, sagte das Auskunftsbüro energisch. Sie hatte sich wieder im Griff. »Das krieg ich raus, was da dahintersteckt. Und wenn’s das Letzte ist, was ich tu.« Sie stürzte ans Telefon, um weiß Gott wen anzurufen. Nur zögernd begann die Forstner wieder zu tippen, die Frischauf schüttelte immer noch den Kopf. Hawelka und Schierhuber zogen ab, um zu Henks Einsatzbesprechung zu gehen.
Im Besprechungszimmer summte es wie in einem Bienenstock. Zu den Kriminalisten hatten sich ein paar Uniformierte gesellt, auch Schreibkräfte aus anderen Abteilungen waren hinzugekommen. Die Meinungen gingen stark auseinander, momentan tendierte die Mehrheit zu der Überzeugung, dass ein gewaltiger Lottogewinn hinter dem erzherzoglichen Urlaub steckte. Verworfen hingegen wurde die Theorie, dass sich der Alte schön gemächlich auf die Pension vorbereitete. Die notwenigen Dienstjahre dazu hatte er schon lange.
»Den Gefallen tut uns das alte Pferd sicher nicht«, behauptete Sojka, und die meisten nickten.
Henk trat ein, und die Zaungäste zogen ab. Die anderen setzten sich und verstummten überraschend schnell.
»Fragts mich nicht, ich weiß gar nichts«, begann Henk. »Ich bin genauso überrascht wie ihr, und wie es aussieht, müssen wir jetzt alle miteinander ein bisschen improvisieren. Offene Fälle haben wir alle, und dass die Arbeit nicht weniger wird, brauch ich euch nicht zu sagen. Dadurch, dass mich der Erz… dass mich Hofrat Zauner zu seinem Stellvertreter auserkoren hat, muss ich mich jetzt dafür freispielen und zwei, drei von meinen Geschichten auf euch aufteilen. Näheres kann ich euch am Nachmittag sagen, wenn ich einen provisorischen Plan hab. Ich bitte euch um Kollegialität, damit wir da nicht im kompletten Chaos versinken. Charly?«
Der angesprochene Sojka, der Kaugummi kauend aus dem Fenster gesehen hatte, zuckte zusammen.
»Glaubst du, du kannst deinen geplanten nächsten Krankenstand ein paar Wochen verschieben? Ich wär dir echt dankbar.« (Der Cowboy meldete sich mit schöner Regelmäßigkeit krank und kündigte das meist Tage vorher lautstark an. Gesund pflegen ließ er sich bevorzugt im »ClubO.«.)
Henk ist spitze, dachte Hawelka, er redet dem Cowboy gut zu, appelliert vor der ganzen Truppe an seine Kollegialität und baut so sanften Druck auf. Auch die Anrede hat er sicher bewusst gewählt. Der Erzherzog sagt einfach »Sojka«. Ohne sonstige Attribute, wie Dienstgrad, Vorname oder »Herr«. Das kann sich nur er erlauben, bei jedem anderen würde Sojka sofort protestieren. »Cowboy« gefällt ihm zwar, weil er sich ja als solcher fühlt, aber das wäre in diesem Fall zu unpersönlich. »Karl« ist sein richtiger Vorname, aber den hasst er; ihn damit anzureden wäre kontraproduktiv. »Charly« hingegen klingt lässig amerikanisch, und Sojka liebt alles Amerikanische. (Privat fuhr er einen auf Hochglanz polierten amerikanischen Polizeiwagen aus den Sechzigern, genannt »die heilige Cow«. Schon allein dadurch hatte er viele Sympathisanten im Rotlichtmilieu.) Henk stellte damit eine besondere Beziehung zwischen ihnen her, und wie es aussah, traf er genau den richtigen Ton.
Tatsächlich schien der Cowboy verhandlungsbereit: »Okay, Hank, that’s alright, ich helf euch ein bisschen, die Herde auf die Weide zu treiben, aber du weißt, mein Ziel ist die Frühpension und dann: Ab nach Vegas!« Er grinste. Henk nickte ernsthaft, als würde er den großspurigen Spruch als eine Art Urlaubsansuchen in seinen Dienstplan aufnehmen.
Henk ist spitze, dachte Hawelka noch einmal, Henk ist fair, Henk ist gerecht. Henk wird nicht automatisch den Sepp und mich in ein steirisches Nest schicken, nur weil wir vom Land kommen, über fünfzig sind und hier von Anfang an belächelt wurden.
»Meine zwei größten Sorgen sind momentan die Theatergeschichte, weil uns da die Presse im Nacken sitzt, und die Amtshilfe in der Steiermark«, fuhr Henk fort.
Nimmervoll, korrekt wie immer, hob die Hand, Henk erteilte ihm durch Kopfnicken das Wort. »Ich glaube, dass ich Hochgatterer noch diese Woche festnageln kann. Falls ich genug für eine Verhaftung habe, ist der Abschluss dieser Ermittlungen nur noch Formsache. Zwei, drei kleinere Sachen können warten, das heißt, ich könnte dir die Theatergeschichte abnehmen.«
»Das wär mir eine große Hilfe, Stefan.«
Henk ist fair, dachte Hawelka wieder, es war wie ein Mantra. Er wird sich auch daran erinnern, dass der Sepp und ich den Leponov-Fall tadellos gelöst haben. Und das war keine von den üblichen Geschichten, wo ein Besoffener einen anderen erschlägt oder eine gequälte Ehefrau ihrem Mann Rattengift ins Essen mischt. Das war eine große Sache, und wir waren super.
Henk sah in die Runde. »Da bleibt jetzt vorläufig nur noch die Dienstzuteilung zu klären.«
Henk weiß auch, dass wir eine andere Dienstauffassung haben als der Cowboy– oder Pollmann oder Gerlitz–, sagte sich Hawelka. Da braucht er uns hier und nicht in einem Nest in den Wäldern.
»Hofrat Zauner hat mir da freie Hand gelassen, und ich habe mir kurz eure laufenden Fälle angesehen; wirklich Zeit hat keiner, das weiß ich eh.«
Soll er den Hohlstein in die Steiermark schicken, der kann dann dort den Gemeindestier spielen, das gefällt ihm sicher.4 Und der Schütz kann in den Wäldern auf alles schießen, was sich bewegt, dachte Hawelka.
»Ich weiß, dass keiner von euch will, trotzdem frag ich: Gibt es Freiwillige?« Keiner zeigte auf. Henk seufzte. Dann sagte er: »Okay, dann ist das wohl die erste Entscheidung, die ich treffen muss, und irgendjemand wird mich dafür verfluchen.«
Bürgerversammlung
7.Dezember
»Was sind das für Leute?«, schrie der Kommunist. »Die sind doch nicht immer dagesessen und haben getafelt wie die Fürsten, oder? Die haben doch leiser geredet– früher, oder? Ganz leise! Oder nicht? Da haben Sie noch kein buntes Auto mit zweihundertPS vor der Tür gehabt und sich brav in die vierte Reihe gesetzt. Die hättet ihr doch nicht angeschaut, früher. Oder euch gar an einen Tisch gesetzt mit ihnen. Hat sich das jetzt so geändert? Ist es schon so weit? Schon wieder so weit? Werden jetzt die ehrlichen Arbeiter ignoriert? Versteckt? Haben wir nichts mehr zu reden? Lasst ihr euch mit diesen Frauenverprüglern und Kridamachern ein?5 Wollt ihr gut Freund sein mit denen?«
Er war keine eins siebzig. Trotzdem hätten ihn nicht einmal die Gössl-Buam bändigen können. Man bemerkte es schon bei der ersten Begegnung. Der Blick. Die Augen. Das Glitzern.
»Da lasse ich mich hineinstechen. Da! Da lass ich mich hineinstechen, wenn ich je im Leben ein Glas trink mit so einem. Habt ihr alle keine Ehre mehr im Leib? Ich bin ein einfacher Arbeiter. Maurer seit dreißig Jahren. Aber ich lasse mir meine Ehre nicht nehmen! Und die Wahrheit nicht schön anmalen. Was wahr ist, muss wahr bleiben!«
»Komm, Hannes, lass gut sein, das bringt doch nichts. Wir können ja über alles reden, aber da herumschreien, das ist–«
»Ja. Sicher. Leise sein. Das könnt euch so passen. Leise sein oder noch besser: Hände falten, Goschen halten! Und wenn’s wirklich nicht anders geht, dann zumindest so leise reden, dass jeder bequem weghören kann. ›Was hat er da gesagt übers Schmiergeld? Ich hab’s nicht richtig hören können. Wie? Frau verdroschen? Wir haben den Fernseher immer recht laut. Was? Einen in den Ruin getrieben? Da hab ich was gelesen, aber gehört habe ich nichts Näheres.‹ So seids ihr. Genau so. Und ein Unfall ist ein Unfall, auch wenn das Kind dabei gestorben ist. Und jetzt will er euch ein Touristenparadies einreden. Den Wald weg und die Schneise her und den Skilift her und die Hütten her und die Hotels her und alles.«
Sie saßen im neuen Gemeindesaal. Insgesamt waren rund hundert Leute gekommen. Bis auf die üblichen Zwischenrufer hatten nur Gautsch, der Bürgermeister und der Mensch vom Tourismusverband geredet. Vor acht Minuten hatte der Kommunist das Wort ergriffen, und wer ihn kannte, wusste, dass der Abend gelaufen war.
»Die haben uns erzählt, dass das Wohlstand für die ganze Region bringt. Arbeitsplätze schafft. Neue Impulse setzt. Und was man denen sonst noch auf ihren Gehirnwäscheseminaren beigebracht hat. Und ihr glaubts denen. Alles glaubts ihr denen. Aber ich frag dich, Bürgermeister, warum mieten wir uns nicht alle gemeinsam einen Autobus, jeder zahlt ehrlich seinen Teil, und wir fahren nach Tirol? Oder nach Kärnten? Warum fahren wir nicht dorthin und schauen uns das selber ganz genau an? Und reden mit den Leuten. Mit den Kellnerinnen, mit den Liftwarten, mit den Maurern, mit den Verkäufern, mit den Holzhackern. Warum nicht? Hören wir uns doch an, wer reich wird, wenn so ein Tourismusgebiet einmal gut läuft. Oder wie es ist, wenn es einmal nicht so gut läuft. Warum fahren wir da nicht einmal hin?«
»Du kannst eh hinfahren, ich bleib da«, rief irgendein Witzbold dazwischen. Wahrscheinlich ein Zugezogener, der den Kommunisten noch nicht kannte. Im Saal wurde es mit einem Schlag ruhig.
»Ah! Du möchtest dableiben. Gut. Aber ein bisschen mitreden möchtest du schon, oder? Ich glaub, ich kenn dich noch gar nicht. Sei doch so lieb und stell dich einmal vor. Weil, wenn du schon den Mund aufmachst, hast du der Versammlung doch sicher einiges zu sagen. Stimmt’s?«
»Nein, brauch ich gar nicht. Du redest eh genug«, versuchte der Witzbold abzuwiegeln.
»Aber du bist doch sicher ein gescheiter Mann!«, rief der Kommunist aus, »da bleib ich gern ein bisschen still und hör dir zu.« Er ging zwischen den Reihen durch, bis er direkt neben dem Zwischenrufer stand. »Herhören! Einer unserer Mitbürger hat etwas zu sagen. Er ist nicht nur gekommen, um blöd dazwischenzuquatschen, sondern hat sich Gedanken über die Sache gemacht, wegen der wir heute hier sind. Er hat sich informiert, hat Vor- und Nachteile abgewogen, und jetzt will er beweisen, dass er keiner ist, der glaubt, dass der Strom aus der Steckdose kommt und das Essen vom Supermarkt. Also bitte.« Er reichte dem Mann das Funkmikrofon, das er vom Rednerpult genommen hatte, mit so entschiedener Geste, dass der andere automatisch zugriff. Der Kommunist selbst hatte es nicht verwendet, seine Stimme war auch unverstärkt noch bis in den letzten Winkel des Saales gedrungen.
»Also ich finde, dass du da übertreibst mit dem ganzen Tamtam. Die Tourismusgebiete woanders sind doch eine Einnahmequelle, oder? Und Wälder haben wir genug. Und wie du über den Herrn Gautsch herziehst, ich meine, ich kenn ihn nicht gut, aber ich weiß, dass er als Unternehmer auch Arbeitsplätze da in der Region geschaffen hat und… also sooo schlecht geht es uns ja auch nicht, oder? Wer g’scheit arbeitet, der kann auch davon leben, oder? Das ist meine Meinung.« Er gab das Mikrofon zurück und setzte sich wieder. Etliche applaudierten anerkennend. Gautsch hatte ein halblautes »Bravo« hören lassen. Der Sprecher sah zufrieden aus– immerhin hatte er etwas gesagt.
»So, das ist einmal ein klares Wort. Das ist eine Meinung, die respektiere ich, auch wenn ich sie nicht teile. Aber das ist ja vielleicht, weil ich nur ein einfacher Maurer bin.«
»Maurer« stimmte. »Einfach« stimmte nicht. Der Kommunist war auf vielen Gebieten bestens informiert und belesener als die meisten im Saal. Die größte heimische Bibliothek im Ort hatte er. Nicht der Pfarrer oder einer der Lehrer. Der Bürgermeister sowieso nicht. Jetzt trug er das Mikrofon wieder nach vorne und legte es auf das Rednerpult. Er selbst blieb daneben stehen, schob die Hände in die Hosentasche und begann etwas leiser als zuvor: »Ich danke dir, dass du uns deine Meinung mitgeteilt hast. Das zeigt, dass du dich mehr traust, als nur dazwischenzurülpsen. Sicherlich, du hättest dich vorstellen sollen, dann wüssten wir, mit wem wir es hier zu tun haben, aber das kannst du ja nächstes Mal nachholen. Aber wie ist das mit dem Inhalt, Freunde, mit dem Inhalt von seinen Argumenten? Die Skigebiete sind eine Einnahmequelle. Das stimmt, und da lass ich mich hineinstechen, wenn ich das je bestritten hab. Aber reden wir doch darüber, für wen die Skigebiete eine Einnahmequelle sind! Für wen? Ha? Für die Mali-Tant mit ihrer Mindestpension? Für den Goll Toni, der zusätzlich zur Arbeit auf seiner Landwirtschaft noch nebenher ins Sägewerk gehen muss, weil es sich sonst nicht ausgeht? Für mich vielleicht gar? Oder eher für den Liftbetreiber, der schon zwanzig Lifte in Österreich rennen hat? Oder für die Hotelkette, die natürlich schneller, größer und besser bauen kann als unsere Wirten? Oder für den Herrn Gautsch, der vor ein paar Jahren ein paar Hektar Wald günstig gekauft hat und sie dann, wenn sie einmal umgewidmet sind, um das Zigfache verkaufen wird?«
Im Saal wurde wieder gemurmelt. Selbst die, denen er auf die Nerven ging, hatten Respekt vor dem Kommunisten, und etliches von dem, was er gesagt hatte, stieß auf Zustimmung.
Gautsch selber saß mit mildem Lächeln vorne neben dem Bürgermeister und schüttelte ab und zu leicht den Kopf. Ihr kennts doch den Kommunisten, schien seine Haltung zu sagen. Man muss ihn reden lassen, dann ist er glücklich. Er hatte es von Anfang an vermieden, zu dessen mehr oder weniger offenen Anschuldigungen Stellung zu nehmen, das hätte der Sache zu viel Gewicht verliehen. Aber der Bürgermeister wurde langsam ungeduldig. Er war von Haus aus ein nervöser Typ. Jetzt erhob er sich.
»So, lieber Hannes, du weißt, dass ich dich und deine offenen Worte sehr schätze, sehr schätze. Ja. Und es gehört zu meinem Demokratieverständnis, dass da herinnen jeder seine Meinung sagen kann, wie er will. Dafür ist so eine Bürgerversammlung ja auch da. Auch da. Aber ich bitte dich, die Redezeit zu beachten, weil vielleicht andere auch noch was zu dem Thema sagen wollen. Sagen wollen.«
»Ich hab gar nicht gewusst, dass wir eine Redezeit ausgemacht haben«, staunte der Kommunist. »Aber nur für den Fall, dass das so ist, habe ich vorhin ein bisserl mitgestoppt. Also: Der Herr Sowieso von der Errichtungsgesellschaft hat sein Projekt vorgestellt, in– wart einmal– da hab ich’s: siebenundzwanzig Minuten. Dann warst du, lieber Bürgermeister, dran und hast fünfzehn Minuten gesprochen, dann hat der Herr Baumeister Gautsch gute zwanzig Minuten referiert. Alles schön und gut. Ich habe bisher keine zehn Minuten zu euch geredet, und dann war ja da noch die geistreiche Wortmeldung von dem Bürger von vorhin, das muss man fairerweise von meiner Redezeit abziehen. Ich bin nicht vorbestraft und in dieser Gemeinde ordentlich gemeldet. Und ich bin Steuerzahler und ein freier Bürger dieses Landes. Deshalb wirst du mir doch die gleiche Redezeit wie euch allen zugestehen.«
»Steuerzahler« stimmte. Der Kommunist war der einzige Handwerker weit und breit, den niemand zu einem sogenannten Pfusch überreden konnte.6 Er bestand auch bei seinem Arbeitgeber darauf, dass alles buchstabengetreu nach Gesetz ging. Arbeits- und Ruhezeiten, Ausbezahlung der Überstunden, der Zulagen und so weiter. Trotzdem rauften sich die Baufirmen in der Gegend um ihn. Er war nicht nur ein exzellenter Handwerker, der filigranste Stuckdecken ebenso renovieren konnte, wie er tragfähige Kellergewölbe aufmauerte, sondern auch ein Arbeitstier– wobei der Ausdruck »Vieh« zu seiner zupackenden Art besser gepasst hätte.
»Da müss’ ma halt den Kommunisten holen« war ein bekannter Standardseufzer der Firmenchefs, wenn ihnen ihre Poliere ein aussichtsloses Baustellenproblem schilderten. Und dann rückten sie an beim Haus des Kommunisten. Schöntun brauchten sie ihm nicht, so viel hatten sie gelernt. Er wollte ein offenes Wort und gute Entlohnung. Drei- bis viermal im Jahr wechselte er so den Dienstgeber. Niemals während einer laufenden Baustelle. »Ich lass keinen im Stich« sagte er. Seine Wechsel trug ihm auch keiner nach, konnte doch schon in zwei, drei Monaten die umgekehrte Situation eintreten. So wechselte er vonA zuB, dann vonB zuC und dann wieder zuA. Im nächsten Jahr kam eine FirmaD aus der Nachbargemeinde dran und dann wiederB.
Bei der Firma, die ihn gerade unter Vertrag hatte, musste man sich fortan keine Sorgen mehr machen. Der Kommunist stand, wenn es sein musste, auch bis ein Uhr nachts auf der Baustelle, der Kommunist fand auch in Regen und Schnee etwas zu tun, der Kommunist stellte eine Mauer in zwei Drittel der Zeit eines erfahrenen und motivierten Kollegen auf. Im Lauf der Jahre hatte er so ganz ordentliche Summen verdient, und eigentlich hätte er gut leben können. Allerdings behielt er von dem Geld nur einen bestimmten Teil, den er sich nach einem nur ihm bekannten Schlüssel ausgerechnet hatte. Den Rest teilte er auf diverse Wohltätigkeitsorganisationen auf. Angeblich war es mehr als die Hälfte der Summe, die auf seinem Lohnzettel stand.
»Sind wir großzügig, vergessen den siebenminütigen Überzug von dem Herrn Liftbetreiber und sagen, zwanzig Minuten ist die Redezeit. Sind wir weiter großzügig und sagen, ich hab nicht zehn, sondern fünfzehn Minuten geredet, dann bleiben nach Adam Riese immer noch fünf Minuten, die ihr mir zuhört. Daher will ich mich nicht länger aufhalten, sondern gleich zum Punkt kommen: Am Bürger vorbeizuregieren hat sich noch nie ausgezahlt, zumindest nicht lange, das lehrt uns die Geschichte. Raubbau an der Natur zu treiben hat sich auch noch nie ausgezahlt, zumindest nicht lange, das lehrt uns die Natur selbst. Und daher frage ich euch: Wollt ihr dieses »zumindest nicht lange« als Chance nehmen, vielleicht– vielleicht!– ein paar gute Jahre zu haben und zu hoffen, dass ihr dann eure Schäfchen ins Trockene gebracht habt, wenn eine Katastrophe kommt? Eine Revolution, ein Erdbeben oder viel trivialer: einfach eine Flaute im Tourismusgeschäft, weil keiner mehr Geld hat, ein Vermögen für eine Liftkarte und Hotelzimmer hinzublättern? Oder wollt ihr dieses »zumindest nicht lange« als Warnung nehmen? Als Gelegenheit, umzukehren und euch für einen langen Weg, einen unbequemen Weg zu entscheiden? Einen Weg allerdings, der noch euren Enkelkindern und Urenkeln nützt? Der Erzherzog Johann hat vor fast zweihundert Jahren–«
»Geh, jetzt lass doch die alten Adeligen aus dem Spiel, das ist mir jetzt zu fad!«, schrie einer dazwischen, den das Bier mutig gemacht hatte.
»Gleich jodelt er uns was vor!«, brüllte ein anderer. Es entstand Unruhe im Saal. Zwischenrufe für und gegen weitere Ausführungen des Kommunisten flogen hin und her, und bald lag eine unangenehme Stimmung in der Luft. Eine Schlägerei kündigte sich an. Für sachliche Argumente schien niemand mehr zugänglich. Der Bürgermeister versuchte vergeblich zu beschwichtigen. Umsonst. An eine vernünftige Diskussion war nicht mehr zu denken.
Ankunft
8.Dezember
Sie fuhren in Richtung Süden. Seit Baden hatte Schierhuber kein Wort mehr gesprochen. Hawelka dachte nach.
Komisch, dachte er, dass ich zu viel weiß, denke ich nie, aber dass ich zu viel denke, das weiß ich. Er seufzte.
Dabei ist ja gegen Denken grundsätzlich nichts einzuwenden, dachte er weiter. Es tut nicht weh, geht meistens leise vor sich, und die entstehende Umweltbelastung hält sich in Grenzen. Mein Problem ist nur das zielgerichtete Denken. Ich denke zwar viel, aber es ist mehr so ein Dahindenken– mal dieses, mal jenes und dann wieder ganz was anderes. So kann man doch nicht denken!
Momentan dachte er an Henk. Der hatte sie nach der allgemeinen Befehlsausgabe in sein Büro geholt.
»Josef, Sepp«, hatte er gesagt und sie nacheinander fest angesehen. »Setzts euch bitte. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr seids die, die immer drankommen, und das ist eine Sauerei vom Erzherzog. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit erhofft und gemeint, dass ich den Gerlitz da runterschick. Am besten mit dem Cowboy oder mit dem Hohlstein. Das wäre mir auch lieber, weil ich euch da in Wien gut brauchen könnte. Auf jeden Fall besser als die zwei. Ehrlich. Aber die Geschichte da unten, wir können uns da nicht blamieren. Und wenn ich die, sagen wir, etwas unzuverlässigeren Kollegen da bei mir in der Nähe hab, dann kann ich sie im Auge behalten. Aber in der Steiermark? Wer passt auf die auf? Und wenn wir da etwas verpatzen, haben wir nicht nur Nachrede und Gelächter von den dortigen Kollegen zu erwarten, sondern der Erzherzog reißt mir den Schädel ab, wenn er zurückkommt. Verstehts ihr?«
Alles hatten sie verstanden. Es hatte ja auch ganz logisch geklungen. Glücklich waren sie trotzdem nicht gewesen. Mit hängenden Köpfen waren sie ins Auskunftsbüro geschlichen, um sich mit Kaffee und mitfühlenden Worten (denn auch das konnte die Berlakovic) trösten zu lassen.
Er hat seine Entscheidung zwar erklärt, dachte Hawelka, er hat sich sogar bei uns entschuldigt, aber das Ergebnis ist dasselbe: Wir fahren. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, weil man auf den Erzherzog wenigstens eine richtige Wut haben und ihn verfluchen kann, ihn und seine Ungerechtigkeit. Auf Henk konnte man nicht einmal richtig böse sein, und so blieb die Wut im Bauch stecken.
Jetzt wandten sich die Gedanken seinem Partner zu. Schierhuber fuhr gut hundertsiebzig und hatte dabei immerhin zwei Finger ins Lenkrad eingehängt. Anfangs hatte Hawelka so etwas nervös gemacht, später hatte er sich daran gewöhnt, mittlerweile machte es ihm fast gar nichts mehr aus. Die leise aus den Boxen kommende Marschmusik störte ihn mehr.
Sie hatten den gleichen Vornamen. Zur besseren Unterscheidbarkeit nannte Schierhuber ihn Josef, und er nannte seinen Partner Sepp. In der Dienststelle rief man sich ohnehin meist nur mit Nachnamen. Nur die Berlakovic, die Frischauf und die Sommer nannten Hawelka manchmal Pepi. Ein Kosename, der zu Schierhuber nicht gepasst hätte. Der Mann war Zwettler.7 Seine Kennzahlen waren: Zwei Meter fünf groß, hundertachtunddreißig Kilo schwer, Schuhgröße zweiundfünfzig. Riesenpranken und ein gewaltiger Bierbauch rundeten das Gesamtkunstwerk ab. Er redete nicht viel.
»So ein Navi ist eigentlich eine geniale Erfindung«, sagte Hawelka, um die Marschmusik zu übertönen.
»Ja«, sagte Schierhuber.
»Du gibst den Zielort ein und musst dir für den Rest der Fahrt keine Gedanken mehr machen«, plauderte Hawelka weiter.
»Ja«, sagte Schierhuber. Sein Gesichtsausdruck blieb unbeteiligt.
»Wäre das vor fünfzig Jahren in einem Science-Fiction-Roman vorgekommen, hättest du gelacht, wenn jemand gesagt hätte, dass du bald selber mit so was fährst.«
»Ja«, sagte Schierhuber. Die Tachonadel zeigte hundertachtzig. Zum hundertsten Mal fragte sich Hawelka, woran sein Partner so dachte, wenn er schwieg. Aber obwohl sie sich durchaus gut verstanden und mittlerweile ein perfekt eingespieltes Team waren, wusste er, dass er das nie erfahren würde.
Übrigens war Schierhuber keineswegs auf den Mund gefallen– im Gegenteil. Er konnte mühelos ein ganzes Wirtshaus unterhalten oder eine große Gesellschaft aufmischen. Er kannte unzählige Witze und Anekdoten, die er lautstark zum Besten gab, wenn es die Situation erforderte. Er konnte Gstanzln singen und schlüpfrige Reime vortragen. Unter der Leitung des bewährten Kapellmeisters Josef Schierhuber hatte bei der letzten Weihnachtsfeier das gesamte Morddezernat den sogenannten »Instrumenten-Kanon« gesungen. Aber das waren Ausnahmen. Meist blieb er einsilbig.
»I wüll wieda ham!«, sang er jetzt unvermittelt.
»Ja«, sagte Hawelka mit einem Seufzen. »Ich auch, das kannst du mir glauben.«
»Nein«, antwortete Schierhuber. »Nicht deswegen. Deswegen!« Er deutete auf das Hinweisschild, an dem sie soeben vorbeirasten. »Fürstenfeld«, konnte Hawelka gerade noch lesen.
»Ach so.«
Schierhuber nahm die Ausfahrt nahe am Limit. Dass die Reifen nicht quietschten, lag nur an der niedrigen Temperatur. Es war Anfang Dezember und relativ frisch.
Hawelka konnte dieses »I wüll wieda ham!« aus tiefster Seele nachempfinden. Wieder zählte er sich in Gedanken die Gründe auf, warum er es hasste, außerhalb Wiens zu ermitteln:
Erstens waren Wiener in Restösterreich nicht wahnsinnig beliebt.
Zweitens waren Polizisten in ganz Österreich nicht wahnsinnig beliebt.
Drittens waren Kriminalpolizisten, die in fremden Zuständigkeitsbereichen ermittelten, bei ihren dortigen Kollegen nicht wahnsinnig beliebt. Genau auf deren Hilfe waren sie aber angewiesen, weil sie sonst ungleich länger brauchten, um jede noch so kleine Information herauszubekommen.
Viertens genoss Hawelka die Anwesenheit der Frauen im heimischen Auskunftsbüro.
Fünftens ging ihm in der Fremde das Wirtshaus »Zum Reznicek« in der Nähe des Franz-Josef-Bahnhofs ab, wo Schierhuber und er stets ihre Abende ausklingen ließen.
Sechstens fehlte ihm seine Wohnung mit dem gut gefüllten Kühlschrank, dem Flachbildfernseher und den CDs von den Dire Straits und Gerry Rafferty.
Siebtens hasste er Hotel- oder Gästezimmer.
Achtens hasste er es überhaupt, sich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen zu müssen. Am liebsten wäre er immer im vertrauten Territorium geblieben, immer mit denselben Akteuren und den gleichen Handlungen aller Beteiligten. (Ist das jetzt eine Alterssache?, fragte er sich. Wird man jenseits der fünfzig automatisch so? Bin ich zu unflexibel?)
Neuntens war es am Land immer kälter als in der Stadt und in höher gelegenen Regionen ohnehin. Er hasste Kälte.
Zehntens spürte er einen gewissen Erfolgsdruck, und Hawelka war kein Mann, den Druck motivierte.
Vierzig Minuten später fuhren sie in Stainz ein und stellten den Wagen vor dem Gemeindeamt ab. Die Berlakovic hatte angeboten, ihnen ein Zimmer zu reservieren, aber das hatten sie dankend abgelehnt. Sie wollten sich vor Ort ein Bild machen, die verschiedenen Unterkünfte in Augenschein nehmen und dann selbst entscheiden. Mit Fernbuchungen hatten sie schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Das Gemeindeamt hatte zu, von einer Polizeistation war weit und breit nichts zu sehen. Sie gingen ins erste Wirtshaus am Platz und bestellten Kaffee. Schierhuber nahm Jägermeister statt der Milch. In der Ecke saßen Holländer oder Belgier und unterhielten sich lautstark. Ab und zu kam einem ein Wort bekannt vor.
»Wir suchen die Polizeistation«, redete Hawelka die Kellnerin an.
»Hier ist keine. Nur in Bad Gleichenberg«, antwortete sie mit ausländischem Akzent.
Wahrscheinlich aus Slowenien, überlegte Hawelka. Er hatte Hinweisschilder gesehen, die Grenze musste ganz in der Nähe sein. Aber hatte die Berlakovic nicht gesagt, dass sie am Posten von Stainz eingewiesen würden?
»WauswoitsneiisbaideGschmiertn?«, knödelte einer der Holländer. Es klang aggressiv. Vielleicht glaubte der Mann, Hawelka hätte die Kellnerin belästigt.
»Everything okay. No problem«, beschwichtigte er. Automatisch hatte er Englisch gesprochen, wie er es oft mit Ausländern tat. Er wollte nicht in die typische Du-nix-verstehen-müssen-lernen-Sprache verfallen, die man oft automatisch von Fremden übernimmt, in der Annahme, dass sie einen dadurch besser verstehen. Außerdem, dachte er, begibt man sich mit der Weltsprache auf ein neutrales Territorium und spielt seine Überlegenheit nicht so aus. Meistens können dann beide gleich schlecht Englisch, und das ist dann eine sprachliche Begegnung auf Augenhöhe.
»Jeitztredarahnoenglisch!« Der Holländer war keineswegs beschwichtigt.
»Passt schon, Hansi, ist gut«, beschwichtigte die Kellnerin. Offenbar war der Holländer schon bekannt, und ebenso offenbar verstand er auch ein paar Brocken Deutsch. Hawelka wurde langsam wütend.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte er jetzt langsam in korrektem Hochdeutsch. »Kein Grund, sich aufzuregen. Verstehen Sie?«
»WülmidervaoarschnderklaneBlade? JeitztredarwiaFeansea. SichakummtarausWeandogeitmaeihschoderFeitlindaTauschnauf!« Er machte Anstalten, sich zu erheben. Auch sein Zechgenosse schien durchaus angriffslustig.
Offenbar hatten die beiden Schierhuber beim Hereinkommen nicht ausreichend gemustert und ihn jetzt, lässig in seine Ecke der Wirtshausbank hingelümmelt, nur als etwas plumpen Teddybären taxiert, der kein Wort herausbrachte.
Zweieinhalb Sekunden später stand der Teddybär bei den Stänkerern, hatte seinen Dienstausweis auf den Tisch geknallt und machte etwas, das Hawelka nur aus Wilhelm-Busch-Geschichten kannte: Er zog die Köpfe der beiden mit je einer Hand an den Ohren Richtung Ausweis. Die holländischen Oberkörper folgten ganz von alleine.
»Polizei«, sagte Schierhuber leise. »Alles klar?«
»Joollasklorlosmiausdudalkmiasanehgaunzstad«, murmelte der eine unterdrückt, und ein noch unterdrückteres »AhleckmidoinArsch« kam vom anderen.
»Schön sprechen!«, mahnte Schierhuber, dann steckte er den Ausweis wieder ein und trat an die Theke, um zu zahlen. Mehrere Jägermeisterfläschchen wechselten den Besitzer. Sie traten vor das Wirtshaus. Hier würden sie sich nicht einquartieren, das war klar. »Seit wann verstehst du Holländisch?«, fragte Hawelka.
»Das waren Südoststeirer«, antwortet der andere. »Die reden so.«
Hawelka war beeindruckt. Aber das mit der fehlenden Polizeistation machte ihm Sorgen. Er zückte sein Handy.
»Bad Gleichenberg? Das ist ja ganz woanders!«, rief das Auskunftsbüro. »Wo seids ihr denn?«
»Stainz.«
»Das gibt’s nicht. Ich… Warte einmal… Stainz? Nur Stainz? Oder steht da noch was dabei?«
»Stainz bei Straden.« Hawelka konnte sich dunkel an einen Wegweiser erinnern.
»Aaaaahhh!« Das war das berühmte Berlakovic-Lachen. »Hasenpfötchen, euch kann man aber wirklich nirgends hinschicken! Dort seids ihr falsch, völlig falsch. Setzts euch ins Auto und gebt Deutschlandsberg ins Navi ein. Das ist in der Weststeiermark. Dort ist das richtige Stainz.«
»Oh Sch–«
»Ja, ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben.«
»Sag einmal. Herta, weißt du schon was vom Erzherzog?«, fragte Hawelka schnell, um abzulenken. Und damit traf er voll ins Schwarze. Das Selbstbewusstsein verschwand augenblicklich aus der Berlakovic’schen Stimme.
»Nein! Das ist ja gerade das Arge. Nichts. Absolut nichts. Kaum dass ihr gefahren seids, hat er uns einen Antrag auf den Tisch geknallt, und weg war er. Dem Henk hat er nichts verraten, und alle meine Kontakte sind ratlos. Ich glaub, diesmal hab ich versagt.«
»Muss er in seiner Position nicht den Urlaubsort angeben, für Notfälle?«
»Normal schon. Aber du kennst ja den Alten, der pfeift sich um solche Vorschriften überhaupt nichts. Und wer will dem schon mit Disziplinarmaßnahmen kommen?«
»Na dann, große Meisterin«, schloss Hawelka das Telefonat, »bis bald einmal. Wir haben in der Weststeiermark zu tun.«
Während sie einstiegen, sah Schierhuber ihn fragend an.
Gautsch
8.Dezember
»Frag nicht, sondern pack!«, befahl Gautsch. Mailing nickte. »Ja«, sagte sie und begann, die Koffer, die er aus dem Keller geholt hatte, zu reinigen. Aus Gautschs Handy ertönte eine Jagdfanfare, und er nahm ab.
»Was? Nein. Was? Ja. Was? Nein. Macht der Grünberger. Was? Nein. Bin in zwei Stunden weg. Was? Ja. Urlaub. Was? Thailand. Ja. Wegen der Mailing. Ja. Was? Nein. Ihre Eltern. Ja. Leben noch. Ja. Große Familienfeier. Was? Drei, vier Wochen. Ja. Der Grünberger. Nein. Geht schon. Der macht das. Was? Ja. Griaß di!« Er legte das Handy weg und begann, Wandersocken und lange Unterwäsche aus dem Schrank zu holen und auf dem Tisch aufzustapeln. Mailing war mit der Kofferreinigung fertig und schickte sich an, die Stapel im größten Koffer zu verstauen.
»Nein, nicht da rein«, rief Gautsch, »die nehm ich in den Rucksack. Leg die wieder auf den Tisch. Auf Tisch legen!« Er war ziemlich nervös.
»Ah, Rucksack«, nickte Mailing und räumte den Koffer wieder aus.
»Leg Zeug einfach auf Tisch. Lass es da liegen, das räum ich dann selber… Liegen lassen! Tu du nur… packen! Verstehst du? Sachen packen!« Je nervöser er wurde, desto mehr verfiel er ins Ausländerdeutsch.
»Ja, packen«, sagte sie und holte ihre warme Wäsche.
»Nein!«, schrie Gautsch jetzt. »Nicht diese… Nicht die warme Wäsch packen! Kurze Hose. T-Shirt. Bikini packen. Sommerg’wand packen! Diese dalassen.« Er riss ihr den Stapel mit Skiunterwäsche und Rollkragenpulli aus der Hand und warf ihn auf das Sofa.
»Aber Gautsch auch packen warme Wäsch.« Schön langsam verstand Mailing ihren Mann nicht mehr. Das lag zu einem Gutteil an ihren bescheidenen Deutschkenntnissen. Englisch konnte sie wesentlich besser. Aber das wiederum verstand Gautsch kaum.
»Warme Wäsch für Gautsch! Für mich, ja. Für Mailing, nein! Mailing fährt… Du fährst nach Thailand– mit Flieger. Also, du fliegst heim. Zu Eltern, Familie. Ja?«
»Ja?«
»Ja.«
»Aha.«
»Aber Gautsch… ich meine, ich fahre nicht nach Thailand.«
»Nein?«
»Nein.«
»Aha.« Sie nickte. So weit war alles klar. Sie nahm ihre Wintersachen, trug sie zurück zum Kasten und begann, sie sorgfältig einzuordnen. Dann holte sie leichtere Bekleidung heraus und trug sie zu Gautsch, der in großer Eile Winterbekleidung in den großen Rucksack stopfte.
»Diese G’wand packen?«
»Ja, diese. Diese gut«, sagte er, ohne richtig hinzusehen. Eine Weile packten sie beide schweigend. Dann konnte Mailing ihre Neugierde nicht länger bezähmen.
»Wohin gehst du, Gautsch?«
»Was?«
»Mailing fliegt Thailand. Aber Gautsch nicht Thailand.«
»Nein, nicht Thailand.«
»Aber wohin?«
»Das geht dich… Also, das ist… das kann ich dir nicht sagen.«
»Aha.«
»Ja.« Er holte Konservendosen aus der Küche. Es waren zu wenige. Er fluchte. Mailing überlegte noch.
»Warum?«
»Warum was?«
»Warum nicht sagen?«
»Weil das ist… ich kann… Zu gefährlich! Verstehst du? Zu gefährlich für Mailing. Also, für dich, meine ich. Ich muss weg. Mailing auch muss weg.« Er sah sie prüfend an. War das angekommen? Sie nickte.