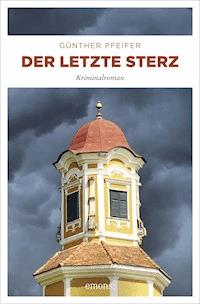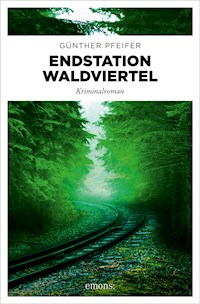
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Skurril, charmant und unglaublich witzig. Die Fahrt mit der Waldviertler Schmalspurbahn ist ein äußerst romantisches Erlebnis. Doch als ein Mensch von der Dampflok überrollt wird, ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. Der Tod des beliebten Mannes ist ein Rätsel, weswegen Hans "G'schaftl" Huber, umtriebiger Hansdampf in allen Gassen, eine Privatinvestigation startet, sehr zum Missfallen des unpopulären Dorfsheriffs. Aber an den wortkargen Waldviertlern beißt sich selbst Huber die Zähne aus – bis eine alte Sage aus der Region Wirklichkeit zu werden scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Pfeifer wurde in Hollabrunn geboren, lernte ein Handwerk und war Berufssoldat. Er schreibt für Magazine, außerdem Theaterstücke und Kriminalromane. Günther Pfeifer lebt in Grund, einem kleinen Dorf im Weinviertel.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Vladimir163rus/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-734-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Gewidmet allen Aktivisten, Mitgliedern,
Sponsoren und sonstigen Unterstützern des Waldviertler Schmalspurbahnvereins (WSV).
Endstation Mexiko
Als er zu sich kam, herrschte ringsum absolute Finsternis. Es war laut, unglaublich laut. Als ob ein Sturm brausen würde, dazu kam ein gewaltiges Stampfen und Rattern und Zischen. Alles um ihn herum vibrierte, schwankte, hüpfte, schlingerte. Und er mit, als wäre er mit dem Boden verwachsen. Der Lärm nahm zu. Dann kamen die Schreie.
***
Mit einem Mal verlangsamte sich die Fahrt extrem, die Bremsen kreischten, und bald darauf kam der Zug mit einem mächtigen Ruck zum Stehen. Die Kinder reckten die Hälse aus den Fenstern, und einige beugten sich über die schwarzen Geländer der Plattformen zwischen den Waggons, um zu sehen, was passiert war. Vorne stampfte die Lok verhalten am Stand weiter, ließ zischend Dampf ab und stieß kleine Rauchwölkchen aus. Unter den jugendlichen Spähern, den immer besorgten Eltern und den sonstigen Eisenbahnfreunden begann sogleich die ebenso eifrige wie lautstarke Ursachenforschung.
»Was ist los?«
»Ich weiß nicht – ich seh nix.«
»Ist da eine Station?«
»Ich seh nix!«
»Wieso sind wir stehen geblieben?«
»Ich weiß nicht!«
»Vielleicht ist was passiert! Vielleicht ist uns ein Reh reingelaufen!«
Wie auf Kommando zückten alle ab dem Alter von sechs Jahren aufwärts die Handys und stürmten in Richtung der Ausgänge. Die Profis, die statt der handlichen Telefone ihre Spiegelreflexmonstren in Anschlag gebracht hatten, begannen fluchend die 300er Teles abzunehmen und wühlten in ihren Fototaschen nach 18-55ern für den Nahbereich. Bei einem vom Zug fein filetierten Reh ist ein 300er völlig fehl am Platz.
Dabei war die Reh-Hypothese mehr als gewagt. Die Dampflok 298.207, von Bedienpersonal und Schmalspurbahnfreunden gerne salopp als Zweinullsiebener bezeichnet, kam unter Volldampf auf eine Höchstgeschwindigkeit von fünfunddreißig Kilometern pro Stunde. Mit fast vollem Wassertank, gut gefülltem Tender und den fünf Waggons schaffte sie die Steigung im Langegger Wald mit gerade einmal zwanzig Kilometern pro Stunde. Dieses Tempo entspricht dem eines Durchschnittsradfahrers, wenn er ein wenig engagierter in die Pedale tritt. Ein von solch einem Zug erwischtes Reh hätte also überaus langsam, ja geradezu gebrechlich sein müssen und außerdem schwerhörig, da die Zweinullsiebener bergauf einen Höllenlärm machte und kilometerweit zu vernehmen war. Aber möglicherweise war das Tier ja auch depressiv und hatte Suizidabsichten gehegt.
»Nicht aussteigen, da gibt’s keine Haltestelle!«
»Aber da steigt einer aus!«
»Das ist der Heizer, der sieht nach, was los ist.«
»Wo ist das Reh?«
»Ich weiß nicht, ich seh nichts.«
»Der geht in den Wald.«
»Mama, geht der Mann Lulu?«
»Vielleicht ist das Reh nur verletzt und in den Wald gelaufen …«
»So ein Blödsinn, wenn der Zug drüber ist, dann ist das nur mehr Rehgulasch, und zwar unter dem dritten oder vierten Waggon.«
»Er kommt wieder!«
»Mit einem Reh?«
»Nein, mit einem Schwammerl! Der hat ein Superschwammerl gefunden!«
»Haha, ein Wahnsinn, wir sind wegen einem Schwammerl stehen geblieben. Dabei hängt doch auf der Plattform ein Schild: ›Aussteigen und Schwammerl brocken während der Fahrt verboten‹1.«
»Er ist eh nicht während der Fahrt ausgestiegen, wir sind eh stehen geblieben.«
»Haha, diese Waldviertler!«
»Papa, darf ich auch Schwammerl suchen gehen?«
»Nein, setz dich jetzt wieder nieder, wir fahren sicher gleich.«
Als schließlich alle Kinder eingesammelt, alle Fotos geschossen und alle Sprüche losgelassen worden waren, pfiff der Schaffner in seiner schmucken Uniform durchdringend, rief: »Bitte alle einsteigen, Zug fährt ab.«
Der Heizer stieg auf die Lok, hielt triumphierend nochmals den Pilz in die Höhe, dann pfiff die Lok und setzte sich unter größten Anstrengungen wieder in Bewegung. Planmäßig gab Paschinger gleich am Anfang Volldampf, und die Räder der Lok drehten durch. Der Zug kam nicht von der Stelle. Die Videomacher hätten wer weiß was dafür gegeben, die durchdrehenden Räder von der Seite zu filmen. Schließlich schob der Zug unter dem Gejohle der Kinder fast zwei Kilometer zurück, bis die Steigung moderater wurde, nahm Anlauf und donnerte schließlich erfolgreich durch den Langegger Wald hinauf. Die Leute lachten, und etliche begaben sich in das »Waldviertler Jausenwagerl«, um die Sondereinlage gebührend zu feiern.
Auf dem Führerstand der Lok grinsten sich der Heizer und sein Chef an.
»Wo hat er denn das Prachtexemplar her?«, schrie Paschinger, der Lokführer, um sich gegen den Lärm der jetzt unter Volldampf stehenden Lok durchzusetzen.
»Keine Ahnung! Sicher wieder aus irgendeinem Supermarkt, und die kriegen sie wahrscheinlich aus Serbien«, gab der Huber Hans zurück und begann Kohle in das hungrige Maul der Feuerbüchse zu schaufeln. Mittlerweile hatte der Zug schon wieder auf fast zwanzig Kilometer in der Stunde beschleunigt.
»Irgendwann einmal kriegt er auch im Supermarkt keine, und dann kann er eines aus Plastik aufstellen«, prophezeite Paschinger und kontrollierte routiniert den Kesseldruck.
Diese Befürchtung kam nicht von ungefähr. Seit vor vielen Jahren einmal ein riesenhafter Steinpilz neben der Strecke förmlich darum gebettelt hatte, mitgenommen zu werden, war das »zufällige« Erblicken eines Schwammerls und die gekonnt inszenierte Bergung desselben ein sorgfältig gepflegtes Highlight jeder Ausfahrt.
Leider war nicht jedes Jahr ein Schwammerljahr, und in den schon seit Jahren viel zu heißen und zu trockenen Ferienmonaten Juli und August war auch im sonst so schwammerlreichen Waldviertel nicht einmal die Chance auf verkümmerte Eierschwammerl, von Steinpilzen ganz zu schweigen. Um dennoch nicht auf die Einlage verzichten zu müssen, hatte man vereinsintern beschlossen, dass bei jeder Fahrt ein Schwammerl zu verstecken sei.
Zunächst war jedes Vereinsmitglied einmal drangekommen, in letzter Zeit war es fast nur Hannes Dangl, dem der Arzt Bewegung und viel frische Luft verordnet hatte, der die »Zufallsfunde« aus irgendeinem Supermarkt besorgte und vor jeder Fahrt versteckte.
»Plastikschwammerl sind stillos«, brüllte der Huber Hans über das Fauchen der Lok dem Lokführer zu. »Wenn uns da wer draufkommt, ist das ein Imageschaden, das können wir nicht brauchen.«
Wie immer wusste der G’schaftlhuber etwas zum Thema zu sagen, wie er eigentlich zu jedem Thema etwas zu sagen wusste. Er kümmerte sich zwar um vieles, wovor sich andere drückten, aber manchmal konnte er einem mit seiner Art doch ziemlich auf die Nerven gehen.
Der Lokführer kam nicht mehr dazu, zu antworten. Und die Fahrgäste, die sich im Speisewagerl darüber unterhielten, dass der Zug laut Fahrplan bald nach »Mexiko« käme, hatten ein gemeinsames Déjà-vu2-Erlebnis:
Mit einem Mal verlangsamte sich die Fahrt extrem, die Bremsen kreischten, und bald darauf kam der Zug mit einem mächtigen Ruck zum Stehen. Die Kinder reckten die Hälse aus den Fenstern, und einige beugten sich über die schwarzen Geländer der Plattformen zwischen den Waggons, um zu sehen, was passiert war. Vorne stampfte die Lok verhalten am Stand weiter, ließ zischend Dampf ab und stieß kleine Rauchwölkchen aus. Unter den jugendlichen Spähern, den sofort besorgten Eltern und den sonstigen Eisenbahnfreunden begann sogleich die ebenso eifrige wie lautstarke Ursachenforschung.
»Was is jetzt los?«
»Is was passiert, Luise?«
»Glaub ich nicht.«
»Vielleicht jetzt ein Reh?«
»Geh, sicher nicht!«
»Na, hat er wieder ein Schwammerl entdeckt, der Heizer?«
»Oder is es doch ein Reh?«
»Kannst du was sehen, Peter?«
»Schau einmal vor, Valerie!«
»Verdammt, jetzt hab ich gerade das 28-55er wieder eingepackt!«
»Komm schnell da weg, Lotte!«
»Geh, wieso, sie soll doch auch –«
»Und wenn es doch ein Reh ist?«
»Moritz, siehst du was?«
Aber Moritz sah nichts, und es war auch kein Reh gewesen. Leider auch kein Schwammerl.
Vorne auf der Lok starrten sich Paschinger und Huber leichenblass an. Die Notbremsung war das eine gewesen, aber jetzt abzusteigen und nachzusehen, ob das, was man vor sich gesehen hatte und das sich jetzt unter dem vierten Waggon befinden musste, tatsächlich das war, was man befürchtete – das war noch mal eine andere Sache. Und natürlich dachten sie an die Leute hinten im Zug!
»Die Leut, die Leut müssen drinnenbleiben«, krächzte Paschinger. Huber Hans nickte.
»Am besten, sie schauen auch nicht aus dem Fenster oder von der Plattform, da sind ja Kinder dabei!«
Huber Hans nickte nochmals, aber dann sagte er: »Das kannst ihnen schlecht verbieten, umso neugieriger sind sie, und dann steigen sie vielleicht erst recht aus.«
»Was ist los?« Auf der Leiter, die zum Lokführerstand hinaufging, tauchte Ableidinger auf, der heute Schaffner war.
»Ich glaub, da ist einer gelegen.«
»Was? Auf den Schienen?«
»Ja. Nach der Kurve. Keine Chance zum Stehenbleiben. Ich hab eh gleich gebremst, aber –«
»Scheiße!«
»Ja.«
»Wieso liegt da wer?«
»Keine Ahnung, wir haben den ja nur drei, vier Sekunden gesehen. Vielleicht … vielleicht war’s ja eh nix.«
»Nix?«
»Na«, übte Huber sich in Zweckoptimismus, »vielleicht war das nur eine Puppe, verstehst du, ein Lausbubenstreich oder so …«
»Nein.« Paschinger murmelte vor sich hin, durch das Zischen der Lok war er kaum zu verstehen, »das war schon das, wonach es ausgesehen hat. Ein Mensch. Das hab ich … bei so was täuscht man sich nicht.«
»Glaubst du, ein Selbstmörder?«
»Ich weiß nicht. Was machen wir? Einer muss nachschauen. Hast du was gesehen, wie du vorgekommen bist?«
Ableidinger schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin ja vom ersten Waggon abgestiegen. Wenn es so ist, wie ihr sagt, dann liegt er ja weiter hinten, oder?«
Paschinger setzte sich auf den Boden, zog die Knie an und verbarg sein Gesicht in den Händen. Huber Hans holte geistesgegenwärtig seine alte Feldflasche mit kaltem Pfefferminztee hervor und gab sie dem Lokführer. Während der trank und sich hoffentlich bald wieder unter Kontrolle hatte, ergriff Ableidinger die Initiative.
»Ich geh durch die Wagen und sage, dass wir ein kleines technisches Problem haben und die Leute doch bitte sitzen bleiben sollen. Währenddessen schaust du nach, okay?«
Huber nickte. »Wir treffen uns am Zugende«, setzte er noch hinzu.
»Halt die Stellung, Peter«, sagte er zu Paschinger, der den Tee mittlerweile ausgetrunken hatte, »bleib da ruhig sitzen und atme tief durch, ich komme dann und erzähl dir, wie es ausschaut.«
Dann stieg er hinter Ableidinger die Leiter hinab, und während dieser durch den Zug marschierte und das Märchen vom kleinen technischen Defekt verbreitete, sah er unter den Waggons nach. Er konnte nicht verhindern, dass er immer langsamer wurde, je weiter er nach hinten gelangte. Über ihm beugten sich die Kinder aus den Fenstern, und er überlegte fieberhaft, wie er sie dazu bringen konnte, sich hinzusetzen. Den meisten war langweilig, und das taten sie auch lauthals kund. Ein Zug, der nicht fährt, ist nur halb so lustig. Bestenfalls.
»Ich seh, ich seh was, was du nicht siehst, und das ist … rot.«
»Ist es im Waggon oder draußen?«
»Draußen.«
»Ist es der Stein dort neben dem Schild?«
»Nein.«
»Ist es … aber da ist nichts Rotes mehr draußen.«
»Doch.«
»Ich seh nichts.«
»Doch! Dort!«
Huber, der auch in die angezeigte Richtung geschaut hatte, erstarrte. Dann stürzte er geistesgegenwärtig vorwärts, hob den blutigen Kopf auf und verbarg ihn unter seiner Arbeitsjacke.
Frau Wirtin
Das Wirtshaus »Zur Liesl« war keineswegs das größte in Heidenreichstein. Übrigens auch nicht das modernste. Und eigentlich auch nicht das populärste. Hochzeiten, Taufen, Firmungen – kurz Feiern aller Art – wurden hier nicht abgehalten. Dazu fehlten die Räumlichkeiten, das Personal, vor allem aber der – ähm – Glamourfaktor, den junge Brautleute ihren meist im SUV vorfahrenden Freunden gerne bei der sogenannten »Location« präsentieren. Allerdings stimmt es auch nicht ganz, dass gar keine Feiern hier abgehalten wurden. »Die Schmalspurfreunde«, der örtliche Trägerverein des Schmalspurbahnbetriebes im Bereich Heidenreichstein–Alt-Nagelberg (und retour), hielten hier alljährlich die Generalversammlung, die Weihnachtsfeier und ein Treffen zum Saisonbeginn ab. Bei solchen Gelegenheiten wurde der alte Saal aufgesperrt und im Winter drei Tage vorgeheizt.
Ansonsten war die Wirtin nicht gewillt, irgendwelche Extratouren zu machen. »Das zahlt sich nicht aus« war eine ihrer Lieblingsantworten, wenn ein übereifriger selbst ernannter Ratgeber ihr wieder einmal vorschlug, was sie alles modernisieren, verbessern und ausbauen könnte.
Sie hatte vor einigen Jahren die Toiletten auf den neuesten Stand gebracht, hatte in der Küche allerlei elektrische Helferlein einbauen lassen, aber Gaststube, Extrazimmer und der (ziemlich kleine) Saal sahen noch genauso aus wie in den 1960ern. Holzboden, Holzlamperie, Holzverkleidung der Schank und der Kühlgeräte – ein nikotingelber Anstrich aus Ölfarbe und solide Tische samt ebensolchen Eckbänken.
Es gab keine Spielautomaten, keine Jukebox, keine »Happy Hour«, somit lag der Altersschnitt der Gäste bei deutlich über fünfzig. Es gab zwei Biersorten (eine vom Fass und eine in der Flasche), roten und weißen Schankwein (sonst keinen), Cola und ein Himbeerkracherl sowie Mineralwasser. Kaffee und Tee (schwarz, Pfefferminz oder Hagebutte) rundeten dieses überreiche Getränkeangebot ab. Im Winter ließ sich die Wirtin dazu überreden, STROH-Inländer-Rum für den Tee ins Angebot aufzunehmen. Ansonsten schenkte sie ein paar selbst gebrannte und unter der Schank versteckte Schnäpse aus und am Finanzamt vorbei. Sonstige Spirituosen gab es nicht. Essen à la carte gab es schon gar nicht (von Toast und Frankfurter abgesehen). Denn zum Essen gab es genau das, was es zum Essen gab3. Liesl Lang beschloss es am Vorabend, schrieb es vor dem Schlafengehen auf die schwarze Tafel vor ihrem Wirtshaus und konnte sicher sein, dass am nächsten Mittag die Gaststube voll war.
Denn egal, was die Wirtin kochte – es war hervorragend. Liesl Lang war einfach eine verdammt gute Köchin, und dass sie hauptsächlich sogenannte Hausmannskost und Waldviertler Spezialitäten zubereitete, schmälerte den Genuss keineswegs. Das sprach sich herum. Etliche Jahre lang waren Spione aus Gasthöfen, Hotels, Golfresorts und sonstigen Tourismus-Hotspots in das kleine Wirtshaus gekommen, hatten die Nase ob des Angebotes, der Ausstattung, des Zustandes der Gaststube und eines halben Dutzends anderer »unverzeihlicher Fehler« beim Führen eines Gastronomiebetriebes gerümpft und bei sich gedacht, dass sie den Weg umsonst gemacht hatten.
Dann hatten sie gegessen.
Dann hatten sie nachgedacht.
Dann hatten sie der Wirtin ein Angebot gemacht, das diese nicht ablehnen konnte. Ganz bestimmt nicht. Niemals! Keine halbwegs vernünftige Inhaberin einer Bruchbude wie dem Wirtshaus »Zur Liesl« konnte ein Angebot ablehnen, das sie plötzlich zur Chefköchin des Golfresorts »Waldviertel Royal« machte. Ebenso wie niemand die Stellung des Chefkoches im Hotel »Imperial Waldviertel« ablehnte.
Liesl Lang lehnte ab.
»Entschuldigung, Frau Lang, die Summe, die ich Ihnen genannt habe, die haben Sie aber schon verstanden, gell? Und das war netto, das heißt bar auf die Hand, vierzehn Mal im Jahr, gell!«
»Ja, hab ich verstanden.«
»Entschuldigung, dann hab ich etwas nicht verstanden, gell. Was spricht dagegen, dass Sie nächste Woche die Bruchb– Ihr Gasthaus zusperren und zu uns kommen, Frau Lang?«
»Ich will nicht.«
»Oh!«
Nach einigen Monaten hatte sich auch das herumgesprochen, und es wurden keine lukrativen Stellenangebote mehr an die Wirtin herangetragen. Auch den wohlmeinenden Rat vieler Bekannter und Gäste, doch ein Kochbuch zu schreiben, befolgte sie nicht.
»Da bin ich mein eigener Herr, da schafft mir keiner was an, und zum Leben hab ich genug, mir geht nichts ab, alles andere zahlt sich nicht aus«, wie sie ihren Stammgästen versicherte.
Apropos Stammgäste, dies waren zumeist ältere, alleinstehende Herren, die es gewohnt waren, dass sie ihr Mittagsmahl pünktlich um zwölf bekamen, alles andere hätte eine gefährliche Abweichung von der Routine bedeutet und wäre einer mittleren Krise gleichgekommen.
»Ihr Alten brauchts eure Rituale wie die kleinen Kinder. Gott sei Dank muss ich mich nur darum kümmern, dass ihr anständig essts, und mir nicht auch noch den Zirkus antun, euch ins Bett zu bringen«, pflegte die Wirtin zu seufzen, wenn wieder einmal ein Stammgast eine Abweichung von der Norm bekrittelte. Natürlich wurde daraufhin in der Runde gejohlt und gepfiffen, und viele der alten Herren schwangen sich zu ungekannten Höhen der Verbalerotik auf.
Liesl Lang war zwar bereits »in reiferen Jahren«, hatte aber eine durchaus anregende Ausstrahlung und verfügte nebenbei über einen sehr weiblich gerundeten Körper. Kein Wunder also, dass sich die gute Frau immer wieder mit mehr oder weniger schmeichelhaften Komplimenten und Anträgen konfrontiert sah.
Aber die Liesl lehnte ab.
Die Jobangebote ebenso wie die Ehe-, Liebes- und zeitlich begrenzten Zärtlichkeitsangebote aller Art.
Die Liesl lehnte stets ab. Bei den Beziehungsangeboten übrigens mit einem ganz ähnlichen Wortlaut wie bei den Jobangeboten (und meist auch mit derselben Antwort des Abgewiesenen): »Ich will nicht.«
»Oh!«
Und auch die Erklärung für Stammgäste und sonstige Bekannte hörte sich verdächtig bekannt an.
»So bleib ich mein eigener Herr4, da schafft mir keiner was an, und zum Leben hab ich genug, mir geht nichts ab, alles andere zahlt sich nicht aus.«
So weit, so gut, aber Männerphantasien sind zwar äußerst vielfältig und gehen in alle möglichen Richtungen – nur in eine nicht: Für eine gesunde Männerphantasie ist der Gedanke, dass eine Frau – »noch dazu so ein Vollblutweib wie die Liesl« – keinen Mann haben/brauchen/wollen könnte, einfach nicht vorhanden. Also muss die Lösung woanders liegen, also muss es einen Mann geben, also weiß die Wirtin ihren Teilzeitsexualkameraden einfach nur sehr gut geheim zu halten und zu verstecken. Sehr durchtrieben, die Liesl. Und er, der Hund, natürlich auch. Aber hier sind die Männerphantasien dann doch wieder in ihrem Element, und weil ältere, alleinstehende Herren viel Zeit haben, begann man die Wirtin genau zu beobachten. Und weil Männerphantasien auch immer mit einer gehörigen Portion Eifersucht angereichert sind, begann man sich bei der Gelegenheit auch gleich gegenseitig zu beobachten.
Denn eines ist klar: Wenn eine Wirtin vormittags einkauft und dann ungefähr ab zehn kocht, damit das Essen pünktlich um zwölf auf den Tisch kommt, und wenn diese Wirtin dann am Nachmittag zwei, drei Stunden zu hat und am Abend ab fünf wieder offen, bis Mitternacht oder länger, und auch an ihrem Ruhetag manchmal in Heidenreichstein und Umgebung gesehen wird – dann kann diese Frau kein Verhältnis in, sagen wir, Linz oder Wien oder auch nur in Gmünd haben. Somit bleibt eigentlich nur ein Einheimischer, der ein falsches Spiel spielt. Abends sitzt er mit den anderen am Stammtisch, isst, trinkt, spielt Karten und rätselt in der Runde lautstark, wer es denn nun sei, der die Liesl glücklich macht – und hernach, wenn alle heimgegangen und die Fenster des Wirtshauses erloschen sind, schleicht er sich durch den Garten, um hinterher die halbe Nacht … Oder sogar die ganze Nacht? Nein, sie waren doch alle nicht mehr die Jüngsten … Also eher doch nur eine halbe Stunde mit der Wirtin herumzuturnen.
Eine Zeit lang war also das Heimgehen vom Wirtshaus eine komplizierte Angelegenheit. Man gähnte, murmelte etwas von einem harten Tag und zahlte alsbald. Danach verließ man das Wirtshaus, um sich in sicherer Entfernung zu postieren. Nachdem fast alle Stammgäste dasselbe taten, waren die Verstecke in der Umgebung bald überfüllt. Man trat sich gegenseitig auf die Zehen und blieb unsicher: War dieser oder jener Zechkumpan nun deshalb nicht zur Liesl eingestiegen, weil man ihn »erwischt« hatte, oder wollte er tatsächlich auch nur beobachten? Nach ein paar Wochen wurden die erfolglosen nächtlichen Observationen langweilig, und die Männerphantasien beschränkten sich wieder auf das Naheliegende, sprich die körperlichen Vorzüge der Liesl und die eigene Leistungsfähigkeit, die man an den Tag legen würde, sollte sich die spröde Wirtin doch noch entschließen, und so weiter …
Aber bleiben wir doch bei der eingangs erwähnten Routine, nach der das Essen pünktlich um zwölf auf dem Tisch steht. Das galt selbstverständlich auch am Sonntag, und wenn zwei, drei Portionen übrig blieben, dann konnten entweder Ausflügler, die sich am Nachmittag noch »Zur Liesl« verirrten, oder Stammgäste, die am Abend der Hunger packte, etwas abhaben. Wenn nichts überblieb, dann nicht. Aber für eines sorgte die Liesl immer: Die wackeren »Schmalspurfreunde«, die am Sonntag ihre Tour fuhren und vor lauter Vorheizen, Fahren, Erklären, Für-Fotos-Posieren, Remisenverschließen et cetera erst gegen Abend heimkamen und dann natürlich müde und hungrig waren – die bekamen immer etwas ab, denn deren Portionen waren schon reserviert und wurden niemals verkauft – und wenn der Bundespräsident persönlich bei der Liesl erschienen wäre.
Mit den Zugbesatzungen war erst nach sechs zu rechnen, bis dahin waren sie eingespannt, aber dann kämen sie so sicher wie das Amen im Gebet. Umso erstaunlicher war es, dass sich schon um eins der erste Schmalspurfreund blicken ließ.
»Hast du heute keinen Dienst gehabt? Habts ihr getauscht, oder was is los, dass du schon ins Wirtshaus darfst?«, fragte die Liesl den Eintretenden verwundert.
»Ich brauch an Schnaps«, antwortete Wadlegger, der eigentlich immer im Bahnhof werkelte und gar nicht gut aussah.
»Na, wenn’s sein muss, muss’s sein«, antwortete die Wirtin und schenkte ein. Wadlegger leerte das Glas und machte eine Geste, die »Mehr« bedeutete. »Es is was passiert«, sagte er und sah die Wirtin in stummer Verzweiflung an. Diese schenkte erneut ein und wartete ab, was kommen würde.
»Sie haben einen derführt5.«
»Was? Wer? Mit dem Zug derführt?«
»Ja. Tot.«
»Aber … das gibt’s doch nicht! Mit dem Zug kannst doch nicht einmal einen Schneck derführen. Wo is denn das passiert?«
»Vor Aalfang, der Huber Hans hat mich angerufen, vom Handy.«
Liesl Lang sah auf die Uhr. »Aber in Aalfang müssen s’ ja schon um elf gewesen sein, jetzt ist es eins, was haben –«
»Es war eh um elf, wo sie ihn derführt haben. Eh um elf, aber dann haben sie erst einmal auf die Polizei warten müssen, und die haben dann den Habersam angerufen.«
»Warum denn den Habersam?«
»Na, weil der Busse hat. Die Polizei und der Ableidinger sind mit den Leuten aus dem Zug nach Mexiko gegangen, und dort hat sie der Habersam dann in den Bus eingeladen und zu uns am Bahnhof gebracht, die haben ja alle die Autos da stehen gehabt, und da hat der Habersam sie alle hergebracht, und jetzt sind sie alle heimgefahren oder was weiß ich wohin.«
»Na und die unseren? Der Huber, der Paschinger, der Ableidinger?« Kein Zweifel, wenn man Wirtin ist und seit jeher Weihnachtsfeier, Generalversammlung und Saisonauftakt der »Schmalspurfreunde« ausrichtet, dann kennt man den Verein, den Fahrplan und den Dienstplan der Akteure.
»Die sind alle noch beim Zug, weil die Polizei ja die Spuren sichern muss und weiß der Teufel.«
Der dritte Schnaps wurde eingeschenkt.
»Und wie ist das mit dem Derführten? Hat den wer gekannt?«
»Das war schwer, sagt der Huber Hans, weil ja die Lok und vier Waggons über den Körper drüber sind, aber das Ärgste ist, dass der mit dem Hals auf der einen Schiene gelegen sein muss, und da hat’s ihm den Schädel abgetrennt!«
»Geh, hör auf!«
»Ja, und der is ein paar Meter weiter weg gelegen, blutüberströmt, aber der Huber Hans sagt, trotzdem kann man irgendwie was erkennen, er meint, es könnt der Dangl Hannes sein!«
Und genau an dieser Stelle von Wadleggers Erzählung geschah das Unglaubliche. Liesl Lang, Inhaberin des Wirtshauses »Zur Liesl«, eine gestandene Frau Mitte fünfzig, seit Jahrzehnten an Herrenwitze, Stammtischgespräche und mehr oder weniger verhaltensauffällige Männer gewöhnt, stieß einen kleinen Schrei aus – und fiel mitten in der Wirtsstube in Ohnmacht.
Von dem Moment an brauchte die Männerphantasie vom Wadlegger natürlich keine Kapriolen mehr zu schlagen, um zu erraten, wer denn der geheime Liebhaber der Liesl war – Pardon, gewesen war.
Eine Seele von Mensch
Dieser Lärm! Er wollte sich die Ohren zuhalten, konnte sich aber nicht bewegen. Absolut nicht! War das ein Traum? Wo war er hier? Vor sich sah er nur Dunkelheit – nein, das stimmte nicht, es war Nacht, aber dennoch konnte er jetzt vor sich etwas erkennen. Gleise, Schwellen, Schotter – kein Zweifel, das war eine Bahntrasse. Schmalspur!
***
»Ich hab nicht nachgedacht, überhaupt nicht nachgedacht, einfach hin, den Schädel genommen, wie er war, und schwups unter die Jacke damit, gar nicht nachgedacht.«
»Na ja, das ist ja auch kein Wunder, dass du da nicht nachdenkst, und das war sicher besser, wie wenn da alle Leute … und die Kinder vor allem!«
»Ja, eh, wahrscheinlich hab ich das eh instinktiv wegen der Kinder gemacht, damit die so was Grausliches nicht sehen müssen, aber instinktiv, verstehst du, gedacht hab ich das sicher nicht, das war – na ja, instinktiv wahrscheinlich.«
Huber Hans, der von schlecht gelaunten Zeitgenossen in Abwesenheit gerne »G’schaftlhuber« genannt wurde, wiederholte sich zum ungefähr achten Mal.
»Ja«, sagte Ableidinger, »aber der Polizei hat das Instinktive gar nicht gefallen. Die hättet ihr hören sollen! Gerade, dass sie ihn nicht verhaftet haben, den Hans.«
»Das kann ich mir vorstellen, das hört man ja eh immer wieder, bei solchen Sachen soll man nichts angreifen, alles so lassen, wie es ist, und so weiter, wegen der Spuren halt«, wusste Wadlegger, der unglaublich angespannt wirkte. Auch das war kein Wunder, einerseits wollte er natürlich von der Zugsbesatzung alle Details erfahren, andrerseits suchte er nach einem Weg, den anderen sein spezielles Detail zu der Sache groß zu präsentieren. Das war allerdings nicht ganz leicht, weil die Liesl Lang, mittlerweile wiederhergestellt, immer in der Nähe war, und auch wenn sie in der Küche verschwand, war die Zeit zu kurz, um der Runde genüsslich die Identität ihres mutmaßlichen – inzwischen leider verstorbenen – Liebhabers zu enthüllen.
»Und wie ich dann wieder vorne auf der Lok war und den Schädel abgelegt hab«, schilderte Huber zum wiederholten Male, »da trau ich mich erst gar nicht, dass ich ihn richtig anschaue, aber ihr kennts das ja, irgendwie kann man dann doch nicht anders als hinschauen, und dann seh ich …«, er nahm einen Stärkungsschluck und schüttelte den Kopf, »… dann seh ich, dass es der Dangl ist. Der Dangl! Ausgerechnet der Dangl!«
Liesl Lang verschwand in der Küche und rumorte mit den Töpfen. Als die örtliche Polizei und die Spurensicherung des LKA Niederösterreich die Reste des Opfers geborgen und weggeschafft, gefühlte tausend Fotos geschossen und Dutzende Zeugenaussagen aufgenommen hatten, war der Zug endlich freigegeben worden. Paschinger, der einen Schock erlitten hatte, konnte ihn allerdings nicht mehr nach Heidenreichstein steuern, er war zuerst von einem Arzt und dann von einer Psychologin des LKA betreut und mittlerweile zur Beobachtung ins Horner Krankenhaus eingeliefert worden. Huber hatte extra Koppensteiner angerufen, der auch die Prüfung hatte, und ihm die Lage erklärt. Dieser war dann schleunigst nach Mexiko gekommen – so hatten sie den Zug dann heimgebracht. Dann gemeinsam die Nachbereitung durchgeführt (eine Dampflok dreht man nicht einfach ab und stellt sie in die Remise). Jetzt saßen praktisch alle »Schmalspurfreunde« bei der Liesl und besprachen den Unfall.
»Ein Unfall! Ich meine, ein unglaublicher, ein furchtbarer, aber ein Unfall! So was gibt es. Ein Unfall. Was willst du da machen?«
»Nichts kannst du da machen.«
»Gar nichts!«
»Eh. Gar nichts kannst du da machen.«
»Aber so ein Pech musst du einmal haben, dass du genau so auf die Gleise fällst, dass der Kopf so liegt, dass dir die Maschine den Kopf abtrennt. So ein Pech hast du nicht oft.«
»Das fängt ja schon damit an, dass du so ein Pech haben musst, dass du stolperst, oder sagen wir, dass dir schlecht wird, und du wirst ohnmächtig, und dann fällst du so deppert, dass dein Kopf genau –«
»Ich kann es mir überhaupt nur so vorstellen«, erklärte Ableidinger, »der Dangl hat sein Schwammerl versteckt, mit dem Fahrrad, wie immer. Und dann ist er gemütlich seine Runde fertig gefahren, und bei Mexiko hat er sich gedacht, da schaut er sich einmal die Gleise beim Waldausgang an. Ihr wissts doch, letzte Woche haben wir doch geredet, weil der Paschinger gesagt hat, da war so ein komisches Ruckeln. Und wir haben doch geredet, dass wir uns das bei Gelegenheit anschauen.«
»Stimmt«, sagte Koppensteiner.
»Ja«, nickte Huber Hans.
»Und da wird er halt ein Stück auf der Strecke gegangen sein, und dann – zack – wird ihm schlecht, und er fällt zusammen und – na ja«, schloss Ableidinger.
»Ausgerechnet der Dangl«, seufzte Biedermann. »Eine Seel von einem Menschen.«
»Ja, das war er«, bestätigte Huber.
»Stimmt.«
»Auf jeden Fall.«
»So isses.«
Mehr oder weniger beeilten sich alle, Biedermann beizupflichten. Aber anders als sonst üblich waren das keine Anstandsfloskeln nach dem Motto: »Über die Toten nichts Schlechtes«, Hannes Dangl war tatsächlich ein überaus beliebter Mann gewesen. Man würde weit gehen müssen, um jemand zu finden, der Dangl nicht gemocht hatte.
In jedem Verein gibt es Tausende Aufgaben zu erledigen. Bei den »Schmalspurfreunden« waren es noch mehr! Die Gleisanlagen mussten untersucht und gewartet werden, entlang dieser gehörte immer wieder abgeholzt, gemäht und am Unterbau Schotter aufgebracht. Die Zuggarnituren waren naturgemäß alt und anfällig, stets musste an den Waggons herumgeschraubt und gestrichen werden, ständig gab es etwas auszubessern, zu reparieren, zu reinigen und zu pflegen. Nicht zuletzt musste der Fahrbetrieb organisiert und durchgeführt werden, dazu kamen dann unzählige administrative Aufgaben und Beziehungspflege zu Partnern und Sponsoren. Kurz, die Arbeit nahm kein Ende.
Und wie überall gab es natürlich besonders beliebte, weil prestigeträchtige Arbeiten. Eine der besten zum Beispiel war, bei den Fahrten als Schaffner zu agieren. Man war ein Star der Kinder, wenn man mit einer echten alten Schaffnerzange kleine Löcher in die Kartonkarten machte. Das war schön. Und wenn man die Kleinen dann auch in eine Karte zwicken ließ, erntete man manch dankbaren Blick einer feschen jungen Mutti, und das war fast noch schöner. Außerdem prestigeträchtig war es, als Heizer dabei zu sein, als Fahrdienstleiter den Zug abzufertigen, am Büfett zu arbeiten und als Techniker mit dem Hammer herumzugehen und prüfend gegen die Räder der Lokomotive zu schlagen. Der absolute Star jeder Ausfahrt war natürlich der Lokführer, das war klar. Meistfotografiert, meistbewundert und meistbeneidet, da waren die vielen Arbeitsstunden zur Restaurierung, Reparatur und Wartung der Maschine leicht vergessen.
Aber die vielen, vielen undankbaren Arbeiten! Die meisten im Winter, lange bevor die Saison losgeht. In kalten Garagen und Hütten, oft auch im Freien! Da ist es kein Wunder, dass der eine oder andere oft ein wenig mürrisch ist oder sich nach einiger Zeit wieder vom Verein verabschiedet.
Hannes Dangl aber war nicht so gewesen. Er hatte sich wirklich eingebracht und war sich für keine Arbeit zu schade gewesen. Hatte geputzt, geschrubbt, geholfen, wo er gebraucht wurde, und murrte auch nicht, wenn er wieder einmal nur »niedere« Hilfsdienste zugeschanzt bekam, statt in einer schmucken Schaffneruniform herumstolzieren zu dürfen.
Stets gut gelaunt, meistens breit grinsend, was er sich wegen seiner auffallend schönen Zähne auch im fortgeschrittenen Alter noch leisten konnte (manche Frauen behaupteten, er hätte geradezu ein Zahnpastawerbungslächeln), oft pfeifend und singend, hatte er immer alles gemacht, was gerade anfiel. Da er schon in Pension gewesen war, alleinstehend und viel Zeit hatte, waren seine Verdienste um die »Schmalspurfreunde« beträchtlich.
»Eine Seel von einem Menschen«, beteuerte Höller gerade wieder, und die anderen nickten.
»Und wie geht die Sache jetzt weiter, werden wir weiter fahren dürfen?«, fragte Biedermann niemand Bestimmten in der Runde.
»Hab ich schon gefragt«, antwortete Huber wie aus der Pistole geschossen. Natürlich! Er wäre nicht der Huber Hans gewesen, wenn er sich, Schock hin oder her, nicht sofort den ermittelnden Beamten vorgestellt und über den weiteren Fahrplan verhandelt hätte.
»Nachdem das ja nichts mit dem Zug zu tun gehabt hat, ich meine, mit einem technischen Gebrechen oder so, ist die Strecke nach dem Ende der Spurensicherung wieder freigegeben worden, und unserem Fahrbetrieb kommender Woche steht nichts im Wege. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Leben muss ja weitergehen. Es ist zwar furchtbar, was dem Dangl passiert ist, grade ihm, so einer Seele von einem Menschen, aber wir müssen ja auch an die Zukunft denken. An den Verein, an die Schmalspurbahn, an die Gäste, die Kinder. Nächste Woche fahren wir wieder!«
Ringsum wurde beifällig genickt. Dann fragte Biedermann: »Und der Paschinger? Wird der wieder?«
»Aber sicher«, antwortete Huber, »ganz sicher. Wirst sehen, in zwei Tagen ist er wieder auf dem Damm, und am Wochenende fahren wir wieder mit Dampf. Der lässt doch sein Baby nicht alleine.«
»Ich glaub auch«, bekräftigte Koppensteiner. »Alles wird wieder gut.«
»Nur der Hannes nicht«, ließ sich jetzt die Wirtin ein wenig heiser vernehmen.
»Nein, der nicht«, seufzte Ableidinger, der immer noch die Schaffneruniform trug. Eine Weile herrschte düsteres Schweigen. Dann stellte Biedermann die entscheidende Frage.
»Und wer wird uns jetzt die Schwammerl verstecken?«
Der Dolmetscher
Ungefähr vierundzwanzig Stunden nachdem die Schwammerlversteckproblematik im Wirtshaus erörtert worden war, fuhr ein Tesla Richtung Heidenreichstein. An Bord befand sich ein etwas ungleiches Paar, das sich seit einer guten halben Stunde durch hartnäckiges Schweigen auszeichnete. Die Frau am Steuer trug ein perfekt sitzendes, sündteures Businesskostüm (dunkelgrau mit hellgrauen Nadelstreifen), rote Pumps und dezenten, deshalb aber um nichts preiswerteren Schmuck und eine Hochsteckfrisur. Zusammen mit der äußerst geschmackvollen Brille ergab das ein Outfit, das jeder Managerin zur Ehre gereicht hätte. Aber auch einer zukünftigen Polizeipräsidentin.
Genau das war übrigens auch das Ziel von Frau Dr. Philippa Limbach. Sie war im noblen Wiener Gemeindebezirk Döbling aufgewachsen, hatte mit Auszeichnung maturiert, ihr Jus-Studium in der Mindestzeit absolviert (Abschluss summa cum laude) und durchlief soeben den praktischen Teil der Polizeiarbeit beim LKA Niederösterreich als leitende Kriminalbeamtin. Ihre Beliebtheitswerte in der Kollegenschaft waren – nun ja – ausbaufähig. Sie selbst legte auch gar keinen großen Wert darauf, ein besonders herzliches Verhältnis zu irgendjemandem von der Dienststelle zu pflegen. Am allerwenigsten aber zu dem Mann neben ihr.
Dieser war ein paar Jahre jünger als sie, hatte eine strubbelige Frisur und war lässig, um nicht zu sagen nachlässig gekleidet. Turnschuhe, Jeans und ein T-Shirt ließen Andreas Hajdusic eher wie einen Schüler oder Studenten als wie einen Ermittler aussehen. Was den beiden allerdings gemeinsam war, war eine zutiefst herzliche Abneigung gegeneinander. Schon als die Limbach am frühen Abend aus der Bereitschaft zunächst ins LKA gerufen wurde und dort erfuhr, mit wem sie sich ins Waldviertel aufmachen sollte, hatte sie umgehend den niederösterreichischen Polizeichef angerufen.
»Nicht mit dem Trottel«, hatte sie gesagt.
»Frau Kollegin, ich weiß ja ihre direkte Art zu schätzen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.«
»Nicht mit dem Trottel.«
»Und die Polizeiarbeit ist erst recht kein Wunschkonzert, weil es hier um Teamwork geht.«
»Nicht mit dem Trottel!«
»Und dann ist es so, Frau Kollegin, Sie sprechen zwar hervorragend Englisch, Französisch und Spanisch, soweit ich weiß, aber Ihr Deutsch beschränkt sich auf Hochdeutsch, was ja auch in Ordnung ist, aber im Waldviertel, da könnte es ein wenig schwierig werden, weil die Einheimischen gerne reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, und dann kann es zu gewissen – Verständigungsschwierigkeiten kommen. Und zufällig ist der Hajdusic in Gmünd aufgewachsen, soll heißen, er versteht den Dialekt dort oben und hat aufgrund seiner Herkunft schnell eine Vertrauensbasis zu den Leuten aufgebaut. Betrachten Sie ihn doch einfach als eine Art Dolmetscher.«
»Nicht mit dem Trottel!«
Die Limbach war ein wenig laut geworden, und Magister Bischof, der Polizeichef, der sonst eher ein umgänglicher Vorgesetzter war und bisher seine Abneigung gegen sie ganz gut kaschiert hatte, wollte keine weitere Diskussion mehr.
»Das ist ein Befehl, Frau Dr. Limbach. Ihr Partner bei dieser Ermittlung ist der Hajdusic.« Dann hatte er aufgelegt.
Der Dolmetscher selbst hatte den Polizeichef nicht angerufen. Er hatte sich nur im Kollegenkreis über die Zuteilung zur Limbach beschwert. »Wenn ich die nur seh, krieg ich schon Schädelweh. Und jetzt soll ich mit der ins Waldviertel? Wie komm ich dazu? Wer zahlt mir das Schmerzensgeld? Schon alleine die Fahrt dauert fast zwei Stunden!« Aber es hatte nichts geholfen, jetzt saß er neben der Limbach und überlegte, wie er es anstellen könnte, ihren Tesla zu fahren.
Natürlich war das kein offizieller Dienstwagen, das Landeskriminalamt Niederösterreich stellte auch leitenden Beamten bestenfalls Wagen der sogenannten »gehobenen« Mittelklasse zur Verfügung, und der Tesla Modell S mit Sonderausstattung und einem Preis jenseits der hunderttausend Euro war definitiv kein Mittelklassewagen (auch kein noch so gehobener).
Aber Frau Dr. Volltrottel Limbach, die angschwammerltste6 Tussn zwischen Scheibbs und Nebraska, hat anscheinend zu viel Marie7 am Konto und leistet sich daher einen Wagen um einen Preis, um den andere ein Haus kaufen. Und weil ihr die Dienstwagen der Polizei zu minder sind, führt sie ihn auch im Einsatz Gassi und fährt wie eine gesengte Sau, damit sie mir zeigt, wie toll sie ist, dachte Hajdusic. Und natürlich würde sie sich lieber die Füße abhacken, als mich auch einmal mit ihrem Spielzeug fahren zu lassen. Und genau da werde ich ansetzen. Warum das eine oder das andere? Warum nicht beides? Den Wunsch mit den Füßen kann ich ihr erfüllen! Im Waldviertel gibt es genug Holz, und da wird sich ja wohl auch eine Hacke finden lassen. Zur Not tut’s auch eine Säge … Nein, natürlich nicht, ich bin ja nicht blöd und geh wegen der in den Häfen8, außerdem würde sie mich dann z’fleiß9 nicht fahren lassen, ich werde es ganz anders machen. Ein Unfall. Klar! So wie die Sache, die wir da untersuchen müssen – nur anderes Ende, nicht den Kopf auf die Gleise, sondern die Füße und – »Ups! ’tschuldigung, Frau Doktor, so ein blöder Unfall, der Rettungshubschrauber kommt gleich, keine Angst, ich bring derweil Ihren Tesla sicher heim. Soll ich mich gleich um den Umbau kümmern, die Pedale weg, meine ich, weil Sie doch ab jetzt fußfrei sitzen?« Bei diesen schönen Gedanken grinste Hajdusic über das ganze Gesicht und lehnte sich gleich viel entspannter im Ledersitz zurück. Philippa Limbach sah es aus den Augenwinkeln.
Ich möchte zu gerne wissen, was diesen Schnösel so amüsiert, überlegte sie. Wenn er glaubt, gleich etwas besonders Witziges von sich geben zu müssen, um die Atmosphäre aufzulockern, dann wird er eine Überraschung erleben. Ich werde nämlich nicht reagieren. Ich lache nicht über Trottelwitze. Und falls er mir gar ein Kompliment machen will, was ich nicht glaube, weil er das Benehmen einer Wildsau hat und offenbar schlechte Manieren für eine Art Qualitätskriterium für echte Kerle hält, aber trotzdem: falls er mir ein Kompliment machen will, dann wird er die nächste Überraschung erleben, weil ich nicht reagieren werde, schon gar nicht geschmeichelt, weil es zwar pure Schmeichelei ist, von einem spätpubertierenden Beamten der unteren Gehaltsstufe, dessen unmittelbare Vorgesetzte ich jetzt bin und dessen höchste Chefin ich in – sagen wir – fünf, sechs Jahren sein werde, Komplimente zu bekommen, aber es ist eine berechnende Schmeichelei, um nicht zu sagen Speichelleckerei.
Und wenn die Füße ab sind, dann kümmern wir uns um die Hände, dachte Hajdusic. Vielleicht muss sie ja in einem dieser verstellbaren Spitalsbetten liegen. Wenn das von der Hochstellung in die Waagrechte zurückgeht und man leichtsinnigerweise nicht auf die Hände aufpasst, schrecklich, was da alles passieren kann.
Wahrscheinlich träumt der Tölpel davon, mich ins Bett zu kriegen, für ihn ein besonderer Kick. Genau! Das will er. Sex mit einer Vorgesetzten, die bald die höchste Beamtin im Land sein wird. Ist ungefähr so, wie wenn ein Schuljunge davon träumt, mit der Lehrerin zu schlafen. Ein ekelhafter Gedanke! Aber eher würde ich diesem Idioten sein Ding abschneiden, als das zuzulassen.
Aber vielleicht ist ja das alles gar nicht nötig. Vielleicht führt ja eine Spur auf die Blockheide. Wackelsteine! »Schauen Sie doch einmal, Frau Doktor, da unten hat sich etwas bewegt, ich glaube, da liegt etwas unten, ja, greifen Sie zu! Was? Der tonnenschwere Stein hat sich bewegt, und jetzt ist Ihre Hand eingeklemmt? Das ist ja furchtbar! Warten Sie hier, ich hole schnell Hilfe. Nicht weglaufen, gell!«
Hajdusic steigerte sich mit immer größerem Vergnügen in seine Phantasien hinein. Knapp daneben überlegte die Limbach kurz, ob sie ihn nicht mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung loswerden könnte. Es bedürfte gar keiner großen Falle, sie könnte es einfach behaupten. Aussage gegen Aussage. Wem würde wohl eher geglaubt, einer Topjuristin aus bestem Hause oder einem verhaltensoriginellen Jungbeamten?
Mittlerweile waren sie am Städtchen Horn vorbeigefahren, und die Straße stieg leicht an. Das Korn auf den Feldern wurde vom Abendrot golden gefärbt, aber während in weiten Teilen des Burgenlandes und Niederösterreichs die Ernte bereits in vollem Gang war, würde man im Waldviertel noch ein paar Wochen Geduld brauchen, überhaupt oberhalb des Brunner Berges, der nicht umsonst »die Wild« heißt und den die Limbach mit gut hundertvierzig Sachen hinaufglühte. Mittlerweile hatte sie die Klimaanlage auf Maximalleistung gedreht, in der Hoffnung, dass sich Hajdusic mit seinem T-Shirt vielleicht eine Lungenentzündung holen würde. Ihr selbst machten Luftzug und Kälte weniger aus, außerdem trug sie Bluse und Blazer, war also wesentlich besser gerüstet. Die Idee mit der angeblichen sexuellen Belästigung hatte sie schon wieder aufgegeben. Um glaubhaft zu wirken, müsste sie sich als Opfer inszenieren, und Frau Dr. Philippa Limbach war nicht für Opferrollen geschaffen.
»Wildhäuser«, stand auf einem Schild neben der Straße, und die Limbach war nicht sicher, ob das ein Ortsname oder eine Warnung vor einer illegal errichteten Siedlung sein sollte. Nach dem Berg waren die Wälder näher an die Straße herangerückt, und die von der bereits untergegangenen Sonne noch beleuchteten Wolken sorgten für ein mysteriöses Licht.
Vielleicht hilft aber auch Psychologie, überlegte Hajdusic, der erbärmlich fror, aber sich sicherlich nicht die Blöße geben würde, die Döblingtussi zu bitten, die Klimaanlage auszuschalten oder ihn seine Jacke aus der Reisetasche holen zu lassen. Vielleicht werde ich sie einfach psychologisch fertigmachen. Eine Spukgeschichte inszenieren. Wenn wir ein paar Tage dort sind, wird sie vielleicht einmal in der Nacht Stimmen hören. Oder wir müssen eine Spur verfolgen, nach Einbruch der Dämmerung kann das sehr unheimlich werden, vielleicht werden wir durch die Umstände getrennt, und sie verirrt sich im Wald oder im Heidenreichsteiner Moor. Das wäre bestimmt sehr leiwand10. Die blöde Kuh stöckelt durchs Moor, und ich sorg für ein paar seltsame Lichtspiele und grunz wie eine Wildsau, und sie brunzt sich vor Angst an. Oder die Natur tut einmal ihre Pflicht, lässt sie langsam, aber sicher im Moor versinken, und im Laufe der nächsten Jahre vermodert sie und wird zu wertvollem Humus und ist auch einmal für etwas gut.
Um der Wahrheit Ehre zu geben – und auch Andreas Hajdusic wusste das im Grunde seines Herzens –, Philippa Limbach war keine Frau von der ängstlichen Sorte. Möglich, dass er sie im Moor verschwinden lassen konnte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor Gespenstern in die Knie ging, war äußerst gering. Eher würden die Spukerscheinungen vor ihr Reißaus nehmen. Momentan jagte sie den Tesla auf das in der Abenddämmerung liegende Waidhofen an der Thaya zu, und wenn sie etwas fürchtete, dann nur, dass ihre Phantasie nicht ausreichte, um Hajdusic bald loszuwerden, ohne physische Gewalt anwenden zu müssen.
Auf jeden Fall werde ich ohne ausdrücklichen Befehl dort oben nicht einmal ein Wörtchen sagen. Nichts. Nada. Nothing. Rien.
Ich werde mit dem Trottel dort oben überhaupt nicht reden. Keine Bitte, kein Befehl. Es wird auch keine Besprechungen oder sonst was geben. Er wird mir hinterherdackeln und genau das darstellen, was er ist. Ein Beiwagerl.
Aber nicht nur alleine ihr Begleiter sorgte für schlechte Laune bei der Limbach. Auch insgesamt gesehen war dieser Fall nicht ihr Fall. Sie rekapitulierte kurz die Fakten. Am Vortag war irgendein älterer Mann von einem Museumszug überfahren worden. Unfall, bestenfalls Selbstmord, hatten die Uniformierten vor Ort gedacht. Aber eine amtsärztliche Untersuchung hatte etwas Interessantes zutage gebracht. Bevor der Mann von der Lokomotive und den nachfolgenden Waggons überrollt worden war, hatte jemand ihm K.-o.-Tropfen verabreicht. Erst dann war er auf den Gleisen so abgelegt worden, dass der herannahende Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und ihm den Kopf abtrennte. Somit wurde das Landeskriminalamt informiert und eine Mordermittlung in Gang gesetzt.
Das war noch nicht das Problem der Limbach. Gegen Mordermittlungen war nichts einzuwenden. Aber diese würden keinerlei Publicity bringen. Es fehlte der Glamourfaktor. Bei diesem alten Mann handelte es sich um keinen Spitzenpolitiker, Opernstar oder Filmschauspieler. Er war nicht einmal Industrieller! Zu einer Pressekonferenz über die Ermittlungen würden drei Tageszeitungsreporter und vier Lokalreporter erscheinen, möglicherweise ein pickeliger Junge von einem Waldviertler Webradio mit dem Handy als Aufnahmegerät, und Fernsehsender würden ohnehin durch Abwesenheit glänzen. Sollte sie diesen Fall auch in kürzester Zeit auflösen, woran sie nicht zweifelte, so war das für ihre weitere Laufbahn ungefähr so nützlich, wie wenn sie ihre Klopapiermarke wechselte.
Sie wollte schon einen Frustschrei loslassen, als ihr einfiel, dass sie ja nicht alleine im Auto war. Außerdem war Jammern und Klagen unwürdig. Etwas für Verlierer und Schwächlinge. Sie hingegen war stark und würde sich in jeder Situation wieder aufzurichten und selbst zu motivieren wissen. Positiv denken! Krise als Chance verstehen! Aktiv werden!
Genau! Denn wenn ich die Gelegenheit wenigstens dazu nützen kann, diesem Trottel hier ein grobes Dienstvergehen mit anschließendem Disziplinarverfahren anzuhängen, und damit erreiche, dass er mir nie, nie, nie wieder zugeteilt wird, dann hat die Sache vielleicht doch ihr Gutes.