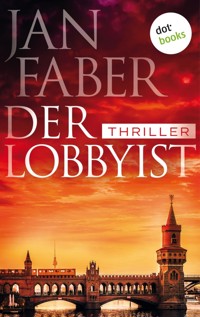
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Spinnennetz der Macht kann Vertrauen tödlich enden: Der erschreckend aktuelle Politik-Thriller »Der Lobbyist« von Jan Faber als eBook bei dotbooks. Verfolgt, verraten, aber nicht einzuschüchtern … Die junge Russin Tatjana Lossowa ist am Ziel ihrer Wünsche. Nach einer internationalen Ausbildung arbeitet sie nun in Berlin für den Chef eines großen deutschen Energiekonzerns. Doch dann gerät sie in das Fadenkreuz einer Verschwörung, deren Ausmaß jeden Albtraum übertrifft: Ihr werden geheime Unterlagen über den Ölmagnaten Aleksander Lewtuschenko zugespielt, der als skrupelloser Lobbyist berüchtigt ist – und zu allem bereit, um jeden aus dem Weg zu räumen, der eine Bedrohung für ihr darstellen könnte. Während die unsichtbare Schlinge um ihren Hals immer enger wird, muss Tatjana alles daran setzen, die ganze Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen … und ahnt nicht, was sie damit heraufbeschwört! Die Hybris der Superreichen, die Schattenseiten des Kapitalismus und die Brutalität, die hinter polierten Fassaden herrscht: Der neue Insider-Roman vom Autor des SPIEGEL-Bestsellers »Kalte Macht«. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Lobbyist« von Politik-Insider Jan Faber ist ein ebenso schnell getakteter wie erschreckender Thriller über jene Mächte, die unser aller Leben lenken. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Verfolgt, verraten, aber nicht einzuschüchtern … Die junge Russin Tatjana Lossowa ist am Ziel ihrer Wünsche. Nach einer internationalen Ausbildung arbeitet sie nun in Berlin für den Chef eines großen deutschen Energiekonzerns. Doch dann gerät sie in das Fadenkreuz einer Verschwörung, deren Ausmaß jeden Albtraum übertrifft: Ihr werden geheime Unterlagen über den Ölmagnaten Aleksander Lewtuschenko zugespielt, der als skrupelloser Lobbyist berüchtigt ist – und zu allem bereit, um jeden aus dem Weg zu räumen, der eine Bedrohung für ihr darstellen könnte. Während die unsichtbare Schlinge um ihren Hals immer enger wird, muss Tatjana alles daran setzen, die ganze Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen … und ahnt nicht, was sie damit heraufbeschwört!
Die Hybris der Superreichen, die Schattenseiten des Kapitalismus und die Brutalität, die hinter polierten Fassaden herrscht: Der neue Insider-Roman vom Autor des SPIEGEL-Bestsellers »Kalte Macht«.
Über den Autor:
Jan Faber ist ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich ein Autor, der in den den zurückliegenden zwei Jahrzehnten beratend und strategisch für mehrere hochrangige Regierungsmitglieder sowie für weitere bedeutende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft tätig war. Er pflegt Kontakte in alle politischen Lager und hat in diversen deutschen Leitmedien publiziert
Bei dotbooks veröffentlichte Jan Faber bereits den Thriller Kalte Macht.
***
Dieses Buch ist ein Roman. Das Beschriebene hat sich so nicht wirklich ereignet. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen waren aber aufgrund der Natur der Sache nicht immer vermeidbar. Sie sind nicht beabsichtigt, aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfasst.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2019
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Page & Turner / Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Royalty Stock Photos HQ und shutterstock/J. M. Image Factory
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-908-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Lobbyist an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jan Faber
Der Lobbyist
Thriller
dotbooks.
Wenn der Mensch zu viel weiß, wird das lebensgefährlich. Das haben nicht erst die Kernphysiker erkannt, das wusste schon die Mafia.Norman Mailer
In the spider-web of facts, many a truth is strangled.Paul Eldridge
Wir sind in unserem Netze, wir Spinnen.Friedrich Nietzsche
Prolog
St. Petersburg, 15. Mai 2012
Der Junge hatte sich gemausert. Aus dem schmächtigen Musterschüler war ein Meister geworden. Bald würde er in den größten Konzertsälen der Welt spielen, Millionen verdienen, die Frauen würden ihm zu Füßen liegen. Lewtuschenko hätte es ihm nicht zugetraut. Nicht wirklich. Nicht nach dem Tiefschlag, der ihm vor zwei Jahren widerfahren war. Dass der Junge sich so schnell wieder aufrichten und zu alter Form zurückfinden würde. Ach was, alte Form: Er war in eine ganz andere Liga vorgestoßen. Fast sah es aus, als hätte die Niederlage, die der junge Mann im Privaten erlebt hatte, ihn überhaupt erst befähigt, so zu spielen.
Aleksander Petrowitsch Lewtuschenko lehnte sich zurück und lauschte anerkennend. Ja, im Grunde hatte Nikolai Arkadjewitsch Lossow alles ihm zu verdanken. Dass er hier in den ehrwürdigen Hallen des Konservatoriums an einem Steinway-Flügel saß. Dass er in wenigen Tagen ein großes Konzert geben würde. Das hätte es so nicht gegeben. Nicht ohne das Tal der Tränen, durch das der junge Lossow gegangen war. Nun spielte er auf dem Klavier so virtuos, wie Lewtuschenko mit Menschen spielte. Kein Zwischenton, keine Nuance waren ihm unbekannt.
Der Pianist unterbrach sein Spiel und schlug mehrmals dieselbe Taste an. Er machte sich eine Notiz, fuhr fort, unterbrach erneut und stand schließlich auf, um die Probe zu beenden. Für einen Moment schien es Lewtuschenko, als blickte er zu ihm herauf, doch von der Bühne aus war der Platz auf dem Rang kaum erkennbar: Lewtuschenko saß im Schatten und beobachtete, ohne gesehen zu werden. Es war seine bevorzugte Position. Dennoch verließ er den Raum und lief hinunter zu den Garderoben. Man kannte ihn hier, niemand würde ihn auf dem Weg hinter die Bühne aufhalten. Genau genommen kannte man ihn überall, zumindest in Russland. Und nichts hielt ihn auf.
Nikolai Lossows Garderobe lag am Ende eines Flurs, der längst einmal wieder gestrichen gehört hätte. Von fern hörte Lewtuschenko den Künstler zetern: »So kann ich nicht spielen. Der Flügel ist völlig verstimmt.« Offenbar telefonierte er. »Bringen Sie das in Ordnung, sonst kann das Konzert nicht stattfinden. Ja. Gut. Do swidanja.«
»Guten Tag, Nikolai Arkadjewitsch.«
Der Musiker wandte sich um und blickte verblüfft in Lewtuschenkos Gesicht. »Was wollen Sie hier, Aleksander Petrowitsch?«
»Ich möchte Ihnen gratulieren. Sie spielen großartig. Ich freue mich, dass Sie so erfolgreich sind.«
Nikolai Lossow schwieg und musterte den Eindringling misstrauisch. »Woher wissen Sie, dass ich hier bin?«
»Ich bin Vorsitzender der Stiftung, Nikolai Arkadjewitsch.« Lewtuschenko lehnte sich lässig an den Schminktisch und zündete sich eine Zigarette an. »Und der größte Spender des Konservatoriums.«
»Schön, dass Sie sich auch für gute Dinge engagieren«, sagte der Pianist.
»Ausschließlich, Nikolai Arkadjewitsch, ausschließlich!« Der ungebetene Besucher nickte ernst und sah ihm mit einem Blick in die Augen, der so durchdringend war, dass es den jungen Mann schauderte. »Aber manchmal braucht man Hilfe.«
»Sie brauchen Hilfe?«
»Nicht ich, Nikolai Arkadjewitsch. Aber Ihr Vater. Und ich werde ihm nicht helfen können, wenn Sie mich nicht dabei unterstützen.«
Instinktiv wich der junge Mann einen Schritt zurück. »Was wollen Sie damit sagen? Ist mein Vater in Gefahr?«
»Sagen wir so: Er ist es nicht mehr, wenn Sie mir die Dokumente geben.«
Nikolai Lossow schluckte, wandte sich ab, sah sich selbst im Spiegel und in seinem Gesicht das Gesicht seines Vaters. Die Dokumente. »Welche Dokumente?«
»Denken Sie darüber nach, Nikolai Arkadjewitsch. Aber denken Sie nicht zu lange.«
***
Berlin, 12. Mai 2012
»Haben Sie das gelesen, Plöger?«, polterte Wirtschaftsminister Schneider und warf seinem Referatsleiter den Stapel von Blättern mit so viel Zorn und Empörung vor die Füße, dass sie noch im Flug auseinanderfielen und sich als schlampiger Haufen auf dem Boden des Büros verteilten. Schneider saß an seinem Arbeitsplatz, wie üblich mit den Füßen auf einer Kante des Schreibtischs.
»Was gelesen, Herr Minister?«, entgegnete Plöger und sammelte die Papiere auf. Mit einem Blick stellte er fest, dass es eine aktuelle Pressemappe war.
»Seite fünf oder sechs. Heilige Scheiße, wie konnten Sie das nicht checken?«
Plöger blätterte hektisch durch den völlig aus der Reihe gebrachten Stapel. Seite fünf. Schwere Vorwürfe gegen Öl- und Gaskonsortium. Ein Artikel von Vera Beliani. Plöger brauchte nur mit einem schnellen Blick darüber zu gehen und wusste Bescheid. »Haben wir gecheckt, Herr Minister«, erklärte er. Er bemühte sich auch gar nicht, Schneider klarzumachen, dass das Problem nicht in seinen Kompetenzbereich gehörte. Dergleichen war dem Minister kategorisch egal.
»Und? Was haben Sie unternommen?«
»Nichts. Wir sehen keine Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu tun. Der Artikel ist nicht einmal in die Hauptausgabe gekommen. Und die Moskovskaija Gaseta liest doch sowieso kaum jemand.«
»Plöger! Wenn unsere Leute dieses Geschmiere ausgraben, dann graben es die anderen erst recht aus.« Schneider nahm seine Zigarre aus dem Aschenbecher, zog daran, stellte fest, dass sie ausgegangen war, warf sie angeekelt zurück und setzte sich gerade auf seinen Stuhl, die Arme wie ein Preisboxer auf die Schenkel gestützt. »Dass die Beliani so etwas schreibt, ist ja nichts Neues. Die schmiert ständig irgendwelches defätistische Zeug gegen den Kreml zusammen. Was mir Sorgen macht, ist der ›Experte‹, den sie da zitiert. Meinen Sie, den gibt es?«
Plöger zuckte die Schultern. »Dürfte nicht schwer sein, einen zu finden, der sich kritisch zu den Umweltschäden in dem Geschäft äußert.«
»Umweltschäden, Plöger. Umweltschäden. Achten Sie auf Ihre Sprache, Mann.«
»Solche Artikel wird es immer geben«, erklärte Plöger und legte den Stapel Blätter behutsam auf den Schreibtisch vor Schneider. »Das können wir gar nicht verhindern.«
»Und wenn wir auf die Gutachter ein wenig Einfluss nehmen?«
»Gutachter?«
»Wir haben doch sicher ein Umweltgutachten angefordert. Sonst könnten wir uns an dem Projekt doch gar nicht beteiligen.«
Plöger schluckte. Es dauerte einen Augenblick, bis er sagte: »Haben wir nicht. Es gibt kein Umweltgutachten. Nicht für den russischen Teil der Unternehmens. Was da vor Ort in Sibirien geschieht, das geht uns nichts an. Das sind sozusagen innere Angelegenheiten.« Plöger räusperte sich. »Die würden uns ziemlich aufs Dach steigen, wenn wir ihnen sagen wollten, wie sie ihr Geschäft zu betreiben haben ...«
»Aber unsere Unterstützung wollen sie. Wir haben wirklich kein Umweltgutachten?«
»Wie gesagt, nur für die Pipeline an sich.«
»Und wir haben unsere Unterstützung zugesagt?«
»Ja, Herr Minister.«
»Das ist ein schwerer Verfahrensfehler, Plöger.«
»Aber Sie haben doch gesagt ...«
»Ich bin froh, dass ich nichts davon weiß, Plöger. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Lassen Sie mich allein.«
Der Referatsleiter wandte sich um.
»Ach, Plöger?«
»Ja, Herr Minister?«
»Sorgen Sie wenigstens dafür, dass dieser sogenannte Experte die Klappe hält. Und überlegen Sie sich was, das die anderen potenziellen Kandidaten, die sich über irgendwelche Umweltfragen oder sonstige Details auslassen könnten, auch überzeugt.«
Plöger nickte. »Natürlich, Herr Minister. Ich bin sicher, unsere russischen Partner haben für solche Fälle ein paar gute Ideen.«
Schneider lachte. »Das gefällt mir an Ihnen, Plöger, Sie haben Galgenhumor. Aber Sie haben sicher recht, ja, da werden unseren Freunden in Moskau bestimmt ein paar sehr überzeugende Argumente einfallen.«
Er nahm die Pressemappe zur Hand und seufzte. Warum konnte diese Geschichte nicht einfach glattgehen? Warum mussten immer, wenn etwas vorwärtsging, die Bremser und Schlechtmacher aus ihren Löchern kriechen und es torpedieren? Und dann noch die Mitteilung aus der Branchenpresse. Die schlechteste News zum ungünstigsten Zeitpunkt:
energie-news.de, 11. Mai 2012
Neues Gasfeld in der Nordsee entdeckt: Marktwert von über 280 Milliarden Dollar vermutet
London/Hamburg. Das britisch-deutsche Konsortium Euro Gas and Oil EGO meldet den Fund eines ausgedehnten Gasfelds in der Nordsee. Bohrungen auf der Grenze der Hoheitsgebiete haben sich als äußerst ergiebig erwiesen. Es wird mit einem Explorationswert von bis zu 170 Milliarden US-Dollar gerechnet. EGO verfügt über Lizenzen zur Ausbeutung bis 2046. Der Aktienkurs hat nach Bekanntgabe des Funds zeitweise um mehr als 12 Prozent zugelegt. Beobachter gehen davon aus, dass EGO durch die neue Quelle zu den großen Öl- und Gasunternehmen des Kontinents aufschließt. An dem Konsortium sind neben der britischen PUK (Petroleum United Kingdom) auch die deutschen Energieversorger EnEX und Energon beteiligt. cc
Ja, es war eine eherne Weisheit: Wenn Scheiße im Anflug war, dann kam sie immer als Haufen.
1
St. Petersburg, 17. Mai 2012, 23:50 Uhr
Er hatte es gewusst. Der Umschlag sah völlig neutral aus. Nichts wies auf etwas Außergewöhnliches hin – außer der Tatsache selbst, dass der Umschlag vor seiner Tür lag. Mittlere Größe. Keine Aufschrift. Kein Adressat. Jemand musste damit gerechnet haben, dass er ihn hier entdecken würde. Er und niemand anders. Mit zitternden Fingern nahm Arkadi Michailowitsch Lossow die Sendung auf und wog sie in seiner Hand. Er spürte, wie sein Kreislauf beinahe kollabierte, musste sich am Türstock festhalten. Warum auch immer, dieser Umschlag – das war ihm vom ersten Augenblick an klar gewesen und schrie ihn nun geradezu an –, dieser Umschlag war mehr als eine Nachricht. Er barg für ihn das nackte Grauen.
Keuchend sperrte Lossow die Tür auf, bemüht, kein Geräusch zu machen, das seine Frau wecken könnte. Die Wohnung lag im fahlen Licht einer kühlen Frühlingsnacht vor ihm, schwarz hoben sich die Möbel im Zwielicht ab. Unter der Tür blieb er einen Atemzug lang stehen und lauschte. Aus dem Treppenhaus drang ein Geräusch zu ihm herab, das ihn innehalten ließ. War der Bote noch im Haus? Und wenn er es war, sollte er ihn stellen? Oder vor ihm fliehen?
Es war das Glück. Er hatte es gewusst. So viel Glück zog immer Strafe nach sich. Es gab kein Glück, das nicht gesühnt werden musste. Nicht für ihn. Am ganzen Leib zitternd drückte Lossow die Tür hinter sich ins Schloss. Dann ging er schweren Schritts durch den Flur geradeaus in die Küche, wo unter dem Fenster der Fontanka-Kanal vorbeizog. Er streifte die Gardinen zurück, sodass etwas mehr Licht hereinfiel, ließ sich auf seinen Stuhl am Esstisch sinken und legte den Umschlag vor sich auf den Tisch. Er war so nüchtern, dass es schmerzte. Die vage Leichtigkeit, in die ihn der Wodka versetzt hatte, den er auf dem Nachhauseweg noch getrunken hatte, war weggeweht. Sein Hirn pochte gegen die Schädeldecke, sein Mund war völlig ausgetrocknet. Arkadi Michailowitsch Lossow brauchte zwei Versuche, den Umschlag zu öffnen. Als er es endlich geschafft hatte, wünschte er sich, es wären zehn Versuche gewesen.
***
Berlin, Haus der Bundespressekonferenz, 18. Mai 2012
Während drinnen noch die Vertreter von Wirtschaft und Politik beisammenstanden, Füllfederhalter austauschten, sich ablichten ließen und auf die Häppchen warteten, hastete Tatjana Lossowa aus dem Gebäude und winkte – allerdings vergeblich – nach einem Taxi. Sie nestelte ihr Handy aus der Tasche, um den nachmittäglichen Termin für ihren Chef, Michael Wörner, ein letztes Mal zu bestätigen. Es ging um ein Hintergrundgespräch mit dem russischen Handelsattaché – ein Heimspiel für Tatjana, die auch die Bemerkungen verstand, die sich die Russen nebenbei zuraunten. Kurz überlegte Tatjana, ob sie sich auf Russisch vorstellen sollte oder auf Deutsch, da tönte ihr plötzlich Tschaikowskis Leitmotiv aus Schwanensee entgegen, ihr Klingelton, und im Display leuchtete das Bild ihrer Mutter auf.
»Hallo, Mama! Ich bin gerade in Eile.«
Für einen Moment schien es, als sei die Leitung tot. Es herrschte völliges Schweigen, dann plötzlich ein Schluchzen, dass Tatjana Lossowa glaubte, das Herz müsse ihr stehen bleiben. »Mama, was ist los? Was ist denn los?«
»Dein Vater ist nicht nach Hause gekommen«, antwortete Irina Lossowa schließlich, als sie sich hinreichend im Griff hatte. »Er ist nicht gekommen.«
»Und du machst dir Sorgen, es könnte ihm etwas zugestoßen sein?«
»Ja, Kind, natürlich.«
»Vielleicht hat er einen alten Freund getroffen, und sie haben gefeiert. Vielleicht ...« Doch Tatjana Lossowa wusste, dass sie nur versuchte, eine möglichst glaubwürdige Lüge zu finden. Ihr Vater war immer nach Hause gekommen. Wenn er nicht auf Geschäftsreise war, dann geschah es niemals, dass er über Nacht wegblieb. Er verkehrte weder in fragwürdigen Etablissements, noch unterhielt er gar eine Liebschaft oder zog mit Kumpanen bis zum Morgengrauen und darüber hinaus durch die Petersburger Nacht. »Hast du die Polizei angerufen?«
»Die Polizei? Ach Tatjana, die Polizei. Die haben ihn doch geholt.«
»Die Polizei hat Papa geholt? Warum denn das?«
»Ich weiß es nicht.« Wieder schluchzte Irina Lossowa und brauchte einige Zeit, um ihrer Gefühle Herr zu werden. »Ich weiß es nicht«, presste sie erneut hervor. Doch sie wusste, womit das Verschwinden Arkadi Michailowitsch Lossows zu tun hatte. Da drüben lag es. Dort auf dem Küchentisch. Sie wagte nicht hinzusehen. Nein, sie würde auch nicht mehr hinsehen. Und sie würde Tatjana nichts sagen. »Ich wollte nur hören, dass es dir gut geht, mein Kind. Das wollte ich nur wissen.«
»Mama ...«
Plötzlich schien ihrer Mutter ein Gedanke zu kommen: »Wo bist du, Tatjana?«
»In Berlin. Morgen muss ich nach Italien.«
»Du kommst nicht nach Russland?«
»Das schaffe ich leider nicht, Mama. Ich kann versuchen, dass ich am Wochenende ...«
»Nein, Kind! Nein. Komm nicht. Bleib, wo du bist. Bleib irgendwo. Aber komm nicht hierher, hörst du? Und triff dich mit keinem Russen, ja? Versprichst du mir das?«
»Ähh, Mama? Wie kann ich dir versprechen, keinen Russen zu treffen? Ich weiß doch heute nicht, wer morgen in einer internationalen Konferenz sitzt.« Abgesehen davon, dass sie in wenigen Stunden einen Termin in der Botschaft der Russischen Föderation hatte. »Was ist denn los, Mama? Und was war mit der Polizei? Warum haben sie Papa geholt? Mama ...?«
Sie waren getrennt worden. Ratlos stand Tatjana Lossowa auf der Straße vor dem Haus der Bundespressekonferenz, das Smartphone in der Hand. Sie fühlte sich merkwürdig fremd in Berlin, obwohl sie die Stadt seit Jahren kannte. Doch nach St. Petersburg, London, Brüssel und – wenn auch nur sehr kurz – Dortmund, war die deutsche Hauptstadt die fünfte Stadt in kaum sechs Jahren, in der sie ihre Zelte aufschlug. Vielleicht hatte sie einfach ihre Wurzeln verloren. Sie merkte erst beim dritten oder vierten Läuten, dass ein neuer Anruf hereinkam. »Mama?«
»Nett, dass Sie mich so nennen, Tatjana«, sagte Wörners Stellvertreter Hannes Klinger. »Meeting in einer halben Stunde. Schaffen Sie das?«
»Stellt sich die Frage?«
»Nein. Seien Sie einfach da.«
Sie drehte sich um die eigene Achse, entdeckte ein Taxi und hob den Arm. Doch der Wagen war besetzt – oder der Fahrer sah sie nicht. Jedenfalls bog er in den Schiffbauerdamm ein. »Mist.« Auch in der entgegengesetzten Richtung konnte sie kein Taxi ausmachen, überhaupt war die Straße leer. Stattdessen sah sie auf dem Gehweg einen Mann auf sich zukommen. Sie sah, wie er sich unruhig umblickte. Sie sah, dass von der anderen Straßenseite ein anderer Mann über die Fahrbahn lief. Hätte sie die Wege der beiden berechnet, sie wäre exakt im Schnittpunkt gewesen. Und doch erkannte sie nicht, dass sie das Zielobjekt war. Vor allem der junge Mann im Trainingsanzug, der die Fahrbahn überquerte, schien völlig mit seinem Handy beschäftigt und gar kein Auge für sie zu haben. Als er – zwei Schritte vor ihr – plötzlich aufsah, da war es zu spät, um auszuweichen. Der kräftige Mann im dunklen Mantel, der den Gehweg genommen hatte, rammte ihr seine Schulter in die Seite, der andere machte eine Art Ausweichmanöver, berührte sie kaum. Alles ging so schnell, dass Tatjana es für einen dummen Zufall hätte halten können, für ein beiläufiges Aneinandergeraten, wie es manchmal eben geschieht, wäre ihr nicht im gleichen Augenblick bewusst geworden, dass ihr Handy weg war. Noch während sie mit den Armen ruderte, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden, spürte sie die plötzliche Leere in ihrer Hand.
»Hey!«, rief sie. Der bullige Typ, der direkt auf sie zugekommen war, wechselte gerade auf die andere Straßenseite, der Junge im Trainingsanzug verschwand im gleichen Moment um die Ecke. Sie hatte die Wahl, wem sie folgen sollte, und entschied sich für den Jungen. Schnell konnte sie sein, aber an körperlicher Stärke würde ihr der Bulle um ein Vielfaches überlegen sein. Trotz Pumps war sie mit wenigen Sätzen an der Ecke und sah die Luisenstraße hinunter. Der Junge hatte sich inzwischen eine Kappe aufgesetzt und versuchte, sich so unauffällig wie möglich zu geben. Er war schon ein ganzes Stück voraus und wagte es sogar, an einem Hauseingang stehen zu bleiben und sich eine Zigarette anzuzünden. Dabei blickte er sich um und entdeckte, dass Tatjana hinter ihm her war. Sofort warf er die Zigarette weg und sprintete los.
Tatjana hatte keine Chance. Der Abstand vergrößerte sich sekündlich. Sie stoppte, riss sich die Pumps von den Füßen, stopfte sie – bereits wieder im Laufen – in ihre Tasche und stürzte hinterher. »Nicht mit mir, Junge«, knurrte sie.
Der Abstand verkürzte sich. Der Dieb befand sich auf der Spreebrücke Richtung Wilhelmstraße, wo sich der Verkehr staute. Mit mehreren flinken Schritten wechselte er die Seite, sodass Tatjana ihn zwischen den Wagen beinahe aus den Augen verloren hätte. Als sich ein Bus zwischen sie schob, schien sie ihn tatsächlich verloren zu haben. Sie blieb stehen, stützte die Hände auf die Schenkel und keuchte. Mit flackernden Lidern suchte sie die Straße nach ihm ab – und erspähte schließlich die Kappe weiter vorne, als ihr Träger sich hinter einen Lieferwagen duckte.
Tatjana schoss davon, nur um Haaresbreite entging sie einem anfahrenden Sportwagen. Der Fahrer knallte die Faust auf die Hupe und schrie ihr durchs geöffnete Fenster Beleidigungen hinterher. Doch sie nahm das alles nicht wahr, sondern konzentrierte sich allein auf den dunklen Punkt der Baseballkappe, der sich durch eine Gruppe Touristen schlängelte und auf den U-Bahnhof Brandenburger Tor zusteuerte. Als der junge Mann an zwei Polizisten vorbeikam, ging er so langsam, dass Tatjana ihn beinahe einholte. Sie hätte gern geschrien: »Hilfe! Ein Dieb!« Doch sie hatte keinen Atem mehr. Als er die Stufen zur U-Bahn hinabhastete, hatte sie die Wahl, sich den Beamten zu erklären oder ihn weiter zu verfolgen. Sie entschied sich für Letzteres. Hätte sie den Polizisten erklären müssen, worum es ging, wäre er verschwunden gewesen. So folgte sie ihm auf den Bahnsteig – um gerade noch zu sehen, wie er sich hinter der sich schließenden Tür der U-Bahn zu ihr umwandte, sie anschaute, entschuldigend die Achsel zuckte und dann ein Zeichen machte. Er hielt sich die Faust mit gespreiztem Daumen und kleinem Finger ans Ohr: Ruf mich an.
Sie spürte, wie ihre Beine nachgaben. Dieses Bild ... Für einen Augenblick fühlte sie sich so hilflos wie damals, als jenes Kind durch die halb vereiste Scheibe des Linienbusses auf sie geblickt hatte. Jenes Kind, das ihr Bruder gewesen war, Nikolai. Sie sah sein trauriges kleines Gesicht wieder vor sich und spürte, wie sich eine namenlose Ohnmacht durch ihre Eingeweide arbeitete. »Du Schwein!«, rief sie der U-Bahn hinterher und taumelte noch ein paar sinnlose Schritte, ehe sie keuchend stehen blieb und sich in ihr Schicksal fügte.
***
St. Petersburg, 17. Mai 2012
Die frostige Abendluft des Petersburger Frühlings begrüßte die Zuhörer des Konzerts, als sie sich gegen 22.30 Uhr aus dem Gebäude des Konservatoriums auf die Stufen zum Theaterplatz hin ergossen. Arkadi Michailowitsch Lossow atmete tief durch. Er spürte seinen Herzschlag. F-Moll. Schostakowitsch. Doch nun, da er sein beinahe kahles Haupt in die Abendluft reckte, fühlte er sich eher, als spielte sein Leben in C-Dur. Gewiss, es war nicht der Glasunow-Konzertsaal gewesen mit seinen Spiegeln und Lüstern, mit seinen Wandmalereien und all dem Prunk, sondern nur der eher schlichte Glinka-Saal mit seiner zwar guten, aber auch gnadenlosen Akustik. Und doch – oder gerade deshalb war es ein Triumph geworden! Nikolai Lossow, sein Sohn, hatte die Musikwelt begeistert. Heute war es noch der kleine Kosmos von St. Petersburg. Aber morgen schon würde in der Zeitung stehen, dass hier ein Stern im Aufgehen begriffen war, der wohl bald über dem ganzen Globus erstrahlen würde. Im Hinausgehen hatte er ein Gespräch zwischen den beiden härtesten Musikfeuilletonisten der Stadt aufgeschnappt. Wortfetzen nur, aber solche, die ihn mit tiefstem Vaterstolz erfüllten: brillant, von ungeheurer Konzentration, ein Pianist, der seine Hände versichern sollte.
Arkadi Michailowitsch Lossow dachte an die Jahre der Entbehrung. Für seinen Sohn. Für die ganze Familie. Die Lossows waren nicht mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Sie hatten sich alles hart erarbeiten müssen. Arkadis Vater war Eisenbahner gewesen. In Sowjetzeiten hatte das vollkommene Ausbeutung bedeutet, noch mehr als heute. Er selbst war der Erste aus seiner Familie, der es an die Universität geschafft hatte. Zuerst in Moskau, dann hier in Leningrad. Physik und Chemie. Schließlich Petrochemie. St. Petersburg wurde in der Zeit seines Wechsels aus dem Unibetrieb in die Privatwirtschaft zu einem der Zentren im Handel mit Rohstoffen, vor allem mit Öl und Gas. Spezialisten waren begehrt. Und endlich begann Arkadi Michailowitsch Lossow Geld zu verdienen. Er war stolz auf seinen Wohlstand.
Hatte Nikolai die ersten Jahre in der kleinen Zweizimmerwohnung üben müssen, täglich vier, später sogar sechs und acht Stunden lang, so waren mit dem Umzug in die Nähe der Philharmonie plötzlich ein eigener Flügel möglich geworden und ein Raum, in dem Musik nicht bedeutete, dass die restliche Familie sich völlig für Nikolais Zukunft aufgeben musste. Ja, sie hatten sich durchgekämpft, die Lossows. Und nun, endlich, hatten sie es geschafft: Er, Arkadi, war Direktoriumsmitglied bei GasNeft, einem der führenden Unternehmen im Ölgeschäft, einem Global Player. Tatjana, seine Tochter, hatte in London und Brüssel studiert und arbeitete heute für den Chef eines großen deutschen Energieunternehmens. Und sein Sohn war dabei, den Sprung an die Spitze der jungen Stars im Musikbusiness zu schaffen, zu einem Pianisten der ersten Reihe zu werden. Wie sehr er sich für ihn freute, gerade nach der Sache mit Georgia. Wie sehr er sich auch für seine Frau Irina freute, die so viele Entbehrungen hatte hinnehmen müssen und nun im Augenblick des Triumphs nicht die Nerven gehabt hatte, ihn zu begleiten.
Die Stadt fühlte sich unwirklich an an diesem Abend. Das Zwielicht der Dämmerung, das Schmatzen des Wassers im Gribojedow-Kanal, an dem er ein Stück weit entlangging, die Stimmen der abendlichen Passanten, die wie durch einen Filter zu ihm drangen. Sein Innen und das Außen mochten sich nicht verbinden. Immer noch schwang Nikolais perfekt intonierte Musik in jeder Faser seines Körpers. Glück. Das war es, was er fühlte. Reines Glück. Reiner als ein Russe in diesen Zeiten Glück empfinden durfte. Reiner, als er selbst es jemals zuvor empfunden hatte. Er hielt inne, um sich zu orientieren. Beschloss, am Kanal zu bleiben, obwohl das nicht der kürzeste Weg nach Hause war, querte dann den Nevskij-Prospekt und entschied sich, noch einen Wodka zu trinken oder zwei, ehe er den Abend beschloss. Irina würde längst schlafen, es bedeutete also keinen Unterschied.
Und so kam es, dass er schließlich erst gegen Mitternacht die Treppen zu seiner Wohnung an der Ital'janskaja ulica hinaufstieg, sich müde mit der einen Hand an das alte schmiedeeiserne Geländer klammernd, während er in der anderen den Schlüsselbund hielt, der ihm Zugang zu so vielen Gebäuden und Räumlichkeiten gewährte. Auf dem Fußabstreifer vor der Wohnungstür lag ein Umschlag.
***
»Entschuldigen Sie, dürfte ich bitte mal Ihr Handy benutzen?« Der junge Businessmann im mittelgrauen Anzug musterte die Frau, die barfuß vor ihm stand, mit zerzaustem Haar und verlaufenem Make-up, aber in offenbar erstklassiger Garderobe – wenn man von den Schweißflecken absah, die sich unter den Armen und auf der Brust bildeten.
»Alles in Ordnung?«, fragte er, halb besorgt, ob ihr etwas zugestoßen war, halb, es könnte ihm etwas zustoßen. Er blickte sich um, doch von Verfolgern war nichts zu sehen.
»Alles in Ordnung«, keuchte Tatjana und strich sich das nasse Haar aus der Stirn. »Ich müsste nur einmal kurz telefonieren. Bitte.«
Der Mann griff in sein Jackett und reichte ihr sein Handy. An seiner veränderten Körperhaltung erkannte sie, dass er darauf gefasst war, sie jeden Moment damit losrennen zu sehen – und dass er bereit war, sie nicht entkommen zu lassen. Sie lächelte ihm zu und setzte sich auf eine Bank, sodass er sich wieder etwas entspannte. Keine halbe Minute später hatte sie die Verbindung zu ihrem eigenen Handy hergestellt. »Das ging schnell«, meldete sich eine verdammt lockere Stimme. Falls es der Junge war, der es ihr geklaut hatte und damit durch halb Mitte gerannt war, hatte er immerhin Kondition. Mehr als sie. »Bring mir mein Handy zurück, du Arsch«, zischte Tatjana.
»Hey, das ist echt kein Grund, persönlich zu werden.«
»Okay. Entschuldigung. Hören Sie, dieses Handy ist sehr wichtig für mich. Ich gebe Ihnen zweihundert Euro, wenn Sie es mir zurückbringen. Und ich schalte keine Polizei ein.«
»Schauen Sie in Ihre Tasche«, sagte der junge Mann ungerührt. »Lesen Sie sich alles genau durch. Dann kaufen Sie sich ein Prepaid-Handy und rufen mich wieder an.«
»Hey, ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie mit meinem Handy überall aufspüren kann?«
»Sie nicht, Tatjana. Und die Leute, die das können, werden Sie besser nicht einschalten. In Ihrem eigenen Interesse.«
Ehe Tatjana nur ein Wort erwidern konnte, hatte der Junge sie weggedrückt. Hatte er sie mit ihrem Namen angesprochen? Verwirrt nahm sie ihre Tasche und öffnete sie.
»Mein Handy«, sagte der Businessmann und streckte ihr die Hand hin.
Tatjana nickte. »Klar. Danke.« Sie reichte es ihm und nahm einen großen Umschlag aus ihrer Tasche. Einen Umschlag, der vorher nicht darin gewesen war. In Blockbuchstaben stand darauf nur das Wort: »VERTRAULICH«.
***
St. Petersburg, 18. Mai 2012, 00:02 Uhr
Sie sah ihn am Fenster sitzen. Sein Körper bebte, doch er gab keinen Laut von sich. Zusammengesunken saß er da, die Arme unnatürlich vor dem Leib verkrampft, den Kopf gesenkt wie ein Fötus. Behutsam trat Irina Lossowa hinter ihren Mann und legte die Hände auf seine Schultern. Ein Schluchzen brach aus ihm hervor. Dann, nach scheinbar endlos langer Zeit, keuchte er rau: »Warum?«
»Warum was, Liebling?«, fragte Irina Lossowa, selbst längst den Tränen nah. »Was ist denn passiert?« Plötzlich sah sie den Umschlag, der vor ihm auf dem Küchentisch lag. Sie hatte ihn zuerst gar nicht bemerkt. Reflexartig griff sie danach, doch im letzten Augenblick zog sie die Hand zurück. Ein namenloses Grauen befiel sie. »Was ... ist ... das?«, stammelte sie, obwohl sie genau wusste, was es war. »Von wem stammt das?«
Arkadi Michailowitsch Lossows Kopf sank noch tiefer zwischen seine sonst so mächtigen Schultern, fast als fürchte er, vom Zorn Gottes getroffen zu werden. Er legte eine Hand auf den Tisch. Und als er sie wieder hob, lag dort ein Ring, ein schmaler goldener Herrenring. Von bösesten Vorahnungen befallen, nahm Irina Lossowa ihn zur Hand und betrachtete ihn. Es war ein Trauring. Sie musste ihn ans Fenster halten, ins kalte Licht der Laternen, um die Gravur auf der Innenseite lesen zu können. Doch sie hätte sie nicht lesen müssen. Sie wusste, was dort stehen würde: »Georgia 14.8.2011«.
»Nikolai«, flüsterte sie. Dann wurde ihr schwarz vor Augen.
***
Mit zitternden Fingern riss Tatjana Lossowa den Umschlag auf. Nach der Verfolgungsjagd fühlte sie sich angegriffen. Vielleicht hatte sie auch Unterzucker – außer einer Tasse schwarzen Kaffee hatte sie an diesem Tag noch nichts zu sich genommen. Wenn sie daran dachte, welche Informationen auf ihrem Handy waren und was jemand, der es darauf abgesehen hatte, damit anstellen konnte, wurde ihr ganz schlecht. Ein Stapel Papier kam zum Vorschein, obenauf ein Gesprächsprotokoll:
Aleksander Petrowitsch, Sie haben bei den jüngsten Gouverneurswahlen in Ihrer sibirischen Heimat nicht den Kandidaten des Kreml unterstützt. Warum?Es geht darum, welcher Kandidat die beste Politik für die Menschen macht. Es kann nicht darum gehen, welcher Kandidat am besten für den Kreml ist.Das klingt nicht nach dem Aleksander Petrowitsch Lewtuschenko, den man kennt. Vor einem Jahr haben Sie noch gesagt, ich zitiere: »Ivan Ludins Entscheidung ist immer meine Entscheidung.« Stehen Sie nicht mehr zu ihm?
Aleksander Petrowitsch Lewtuschenko. Schlagartig sah Tatjana sein Gesicht vor sich. Er war einige Male bei ihnen zu Gast gewesen, damals in Nischnewartowsk, hatte den Kindern Süßigkeiten mitgebracht, die ihr Vater hinterher stets weggeworfen hatte, als wären es vergiftete Geschenke. Bis zu jenem Abend, an dem er sich mit ihrem Vater in dessen Arbeitszimmer gestritten und dann grußlos die Wohnung verlassen hatte. Tatjana konnte sich noch gut an seinen kantigen, kurz geschorenen Kopf erinnern und an die schmale, lange Nase, seine stets etwas spöttischen Mundwinkel, den leicht herablassenden Blick, der in seiner Überheblichkeit durchaus auch etwas Attraktives an sich hatte. Aber vermutlich vermischten sich ihre Kindheitserinnerungen und das Bild, das sie später in den Medien von dem Mann gesehen hatte.
Ivan Ludin ist ein kluger Mann. Aber er wird nicht immer gut beraten.Das heißt, er macht Fehler?Jeder Mensch macht Fehler.Welche Fehler hat Ivan Ludin Ihrer Meinung nach gemacht?Er hat die wichtigsten Unternehmen des Landes in die Hände von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern gegeben. Diese Leute verstehen vielleicht etwas von Sicherheit, aber sie verstehen nichts vom Geschäft.Wie sollte Ludin die Unternehmen an Ex-Spione geben? Wir leben nicht mehr im Sowjetreich, die Wirtschaft ist in privater Hand.
Tatjana hielt inne. Lewtuschenko war einer der größten Profiteure der russischen Vetternwirtschaft. Ein Interview wie dieses – wenn es denn echt war – wäre tödlich für ihn. Womöglich nicht nur im übertragenen Sinn.
Die Wirtschaft ist nur so lange in privater Hand, solange der Kreml das will. Wer der Regierung nicht treu ergeben ist und ihren Zielen nicht folgt, dem werden Konzessionen entzogen, er bekommt Betriebsprüfungen an den Hals und der Staat entzieht ihm Aufträge der öffentlichen Hand.Das heißt, der Kreml lenkt aktiv die Wirtschaft nach politischen Interessen?Es sind sicher nicht nur politische Interessen dabei im Spiel.Sondern?Sondern auch wirtschaftliche.Können Sie mir ein Beispiel nennen, Aleksander Petrowitsch?Der Kreml finanziert den Staatshaushalt Jahr um Jahr mehr aus dem Rohstoffgeschäft. Er hat sich große Teile der Öl- und Gasindustrie einverleibt und exportiert unsere wertvollsten Ressourcen in einem unvorstellbaren Maß ins Ausland. In einem schädlichen Ausmaß. Eine Wirtschaft, die aus sich heraus wächst, ist auf Rohstoffe angewiesen. Doch wir bauen Pipelines und pumpen die Zukunft Russlands in alle Himmelsrichtungen.Das muss nicht wirtschaftlich unklug sein. Die Wirtschaft will auch finanziert sein. Ludin sagt, die Rohstoffe ermöglichen uns, eine moderne und effiziente Wirtschaft aufzubauen.Was die großen Konzerne tun, ist weder modern noch effizient. Nehmen Sie West-Way, das Lieblingsprojekt unseres Präsidenten. Um den Westen mit Gas zu versorgen und die Korruption des Kremls zu finanzieren, bluten wir einen riesigen Landstrich aus. Alles dort wird verseucht, die Menschen werden krank, es kann keine Landwirtschaft mehr geben. Sind die Öl- und Gashalden abgebaut, wird es dort nichts mehr geben als eine unbewohnbare Wüste und Millionen Menschen, die früh sterben.
Tatjana musste tief durchatmen. Lewtuschenko hatte recht. Warum auch immer, er sagte vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben die Wahrheit. Und Tatjana hasste ihn dafür. Sie wollte die Wahrheit nicht ausgerechnet aus seinem Mund hören.
Sie sprechen vom Distrikt Jamal-Nenzen. Haben Sie nicht selbst jahrelang gut an der Ausbeutung der dortigen Öl- und Gasvorkommen verdient?Sehr gut sogar. Und ich bin nicht stolz darauf. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Menschen haben eine solche Art von Wirtschaft nicht verdient. Der Kandidat der Opposition hat versprochen, höhere Standards an die Sicherheit der Förderung zu legen, den Bau neuer Förderanlagen mit strengen Auflagen zu versehen und möglichst gering zu halten. Deshalb unterstütze ich ihn.Aber brauchen die Menschen in Jamal-Nenzen denn nicht das Geld, das aus der Förderung stammt?Nein. In Jamal-Nenzen fehlt es nicht an Geld. Und würden die vorhandenen Förderanlagen effizienter arbeiten, dann flösse sogar noch mehr. Natürlich kommt es immer darauf an, das Geld auch richtig zu verteilen.Finden Sie nicht, dass sich das aus dem Mund eines Multimilliardärs heuchlerisch anhört?Ich stimme Ihnen zu, Vera Beliani. Doch wenn das ein einfacher Ölarbeiter sagt, hört niemand zu. Wenn das ein Multimilliardär sagt, dann kann es etwas bewirken. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt kluge Menschen, die dieses Business durch und durch kennen und die versuchen, eine Stimme der Vernunft zu sein.Sie sprechen von Leuten wie Arkadi Lossow, der sich gegen den Vorstand Ihres Konzerns gestellt hat und den man deshalb mundtot zu machen versucht?Es ist nicht richtig, dass man auf diese Leute nicht hört.Ist das der Grund, warum Sie auf Distanz zum Kreml gehen?Ich gehe nicht auf Distanz zum Kreml. Im Gegenteil: Ich hoffe und wünsche mir, dass dort wieder die richtigen Argumente gehört werden. Es darf nicht sein, dass eine Camarilla von korrupten Beamten die Geschicke einer ganzen Industrie lenkt, den Präsidenten und das ganze Volk belügt und unsere Zukunft verspielt. Was die Apparatschiks machen, ist nichts anderes als das, was die Zaren vor hundert Jahren gemacht haben: Sie nehmen sich alles und lassen nichts für das Volk Wenn Iwan Ludin das zulässt, ist er nicht besser als Iwan der Schreckliche.
An dieser Stelle brach das Interview ab. Tatjana merkte, wie sie die Luft angehalten hatte, und atmete tief durch. Wie wahrscheinlich war es, dass jemand, der genau wusste, wozu der Kreml imstande war, sich so offen gegen die Regierung stellte? Noch dazu jemand, der viel zu verlieren hatte. Lewtuschenko war einer der reichsten Männer Russlands. Wenn dieses Interview echt war, dann schwebte nicht nur er in Gefahr, dann schwebte auch ein unvorstellbares Vermögen in höchster Gefahr. Man würde ihm das nicht durchgehen lassen. Andererseits: Wer wusste, dass dieses Interview existierte? Und: Warum hatte man es ihr gegeben?
Tatjana konnte sich nur zwei Gründe vorstellen, warum das Interview gemacht worden war: Entweder war Präsident Ludin damit einverstanden gewesen, ja, hatte es womöglich sogar aus irgendwelchen politischen Schachzügen heraus inszeniert, oder Lewtuschenko hatte bereits die Gunst des Präsidenten verloren und versuchte nun sich zu rächen, vielleicht auch, das Blatt zu wenden – womöglich durch den Sturz Ludins? Standen schon andere bereit, ihn zu beerben? Männer, die im Sinne Lewtuschenkos agierten? Wer hatte hier wessen Schicksal in der Hand – Ludin Lewtuschenkos oder Lewtuschenko Ludins? Und die Journalistin, die das Interview geführt hatte, war hier am Ende nur ein Werkzeug in der Hand eines der beiden Männer? Es gab auf dem Planeten nicht viele Menschen, die mehr Fäden in der Hand hielten als Lewtuschenko, er war der Hintermann der Hintermänner, einer der einflussreichsten Männer überhaupt: die Lobby in Person. Was passierte, wenn einem Strippenzieher dieser Kategorie die Fäden entglitten?
Jedenfalls authentisch war das Gespräch, wie Tatjana beim Umblättern feststellte: Sie fand mehrere Fotos, auf denen Lewtuschenko mit der Journalistin abgebildet war: Vera Beliani. Sie war bekannt oder – je nach Standpunkt – berüchtigt. Kritisch. Unabhängig. In ständiger Lebensgefahr.
Am Bahnhof Zoo stieg sie aus der U-Bahn und lief die Treppen hoch ins Zwischengeschoss. Am dringendsten war jetzt, im Büro Bescheid zu geben und die Daten von ihrem Handy zu löschen. Sie sah sich um, entdeckte ein Internetcafé und suchte sich dort einen Platz möglichst weit hinten mit Blick zum Eingang.
Zwei Minuten später hatte sie ihren Server abgeräumt, ihre Passwörter geändert und dafür gesorgt, dass von ihrem geklauten Handy aus kein Zugriff mehr auf sensible Daten möglich war – schon gar nicht auf die E-Mails und auf das Intranet der Firma. Etwas erleichtert verließ sie den Shop, ohne den Kaffee angerührt zu haben, den sie sich im Vorbeihasten bestellt hatte. Fünf Euro hatte sie unter die Tasse geschoben.
Ein Prepaid-Handy. Für wen hielt sich dieser Verrückte eigentlich? Sie würde sich weder von ihm noch von irgendjemandem sonst sagen lassen, was sie kaufte und nutzte. Ganz in der Nähe entdeckte sie eine Reihe öffentlicher Fernsprecher. Ja, sie würde diesen Penner vom Münztelefon aus anrufen. Doch nachdem sie auch am dritten und letzten Apparat feststellen musste, dass er defekt war, fügte sie sich in ihr Schicksal und sah sich nach einem Handyladen um. So etwas musste es doch hier an jeder Ecke geben. Gab es auch. Doch erst im vierten Laden, einem ausgesprochen fadenscheinigen Import-Export-Shop mit einem sehr jovialen Libanesen hinter der Theke, fand sie auch ein Handy, das einen geladenen Akku dabeihatte – und für das sie nicht einmal ein Formular ausfüllen musste. Sie hätte nicht sagen können, wieso, aber aus irgendeinem Grund war sie darüber froh. Vielleicht lag es daran, dass sie sich ohnehin ganz nackt fühlte, nun, da jemand ihr Smartphone geklaut hatte und womöglich gerade in ihren Dokumenten, Bildern, E-Mails herumstöberte. Eine Mischung aus Wut und Scham kochte wieder in ihr hoch.
Mit zitternden Fingern gab sie die PIN ein, um ihr Prepaid-Handy zu aktivieren, und wartete. Inzwischen war sie auf dem Platz vor dem Bahnhof Zoo angekommen. Überall hasteten Menschen vorbei, die Autos stauten sich in alle Richtungen. Und gleich mehrere Männer starrten sie an. Ob sie sie für eine Prostituierte hielten? Oder waren es stumme Beobachter, die sie verfolgten? Sie musste schrecklich aussehen.
Mit einem wirren akustischen Signal zeigte ihr das Handy an, dass es am Netz war. Sie wählte die Nummer ihrer Mutter in St. Petersburg. Doch es meldete sich niemand. Auch beim zweiten Versuch hörte sie nur das ferne Läuten des Anschlusses des altmodischen Apparats, der im Flur der elterlichen Wohnung stand. Vielleicht wusste Nikolai mehr. Sie musste einen Augenblick nachdenken, um sich seine Nummer ins Gedächtnis zu rufen. Hätte sie ihr altes Handy noch gehabt, so wäre sie einfach auf »Kontakte« gegangen. Immerhin, sie hatte sich richtig erinnert – doch leider sprang nur die Mailbox an. »Nick, weißt du, was mit Papa los ist? Ruf mich bitte an. Ich mache mir Sorgen. Auch um Mama. Ich hoffe, du siehst meine neue Nummer im Display. Sonst schreib mir bitte so schnell wie möglich eine Mail. Bye.« Dann wählte sie die Nummer ihres geraubten Handys. Wenige Sekunden später hörte sie das Läuten am anderen Ende.
»Sie sind schnell.« Eine männliche Stimme.
»Das ist mein Job.« Ja, sie war genervt. Aber sie war auch neugierig geworden. Was für ein Spiel wurde hier gespielt? Und von wem?
»Und? Werden Sie uns helfen?«
»Helfen? Was sollte ich für Sie tun können?«
»Das wissen Sie genau. Lewtuschenko ist nur ein Stein in diesem Mosaik. Was wir brauchen, sind die Dokumente Ihres Vaters. Damit ist Ludin erledigt.«
»Und ich bin es auch.«
Plötzlich war es eine Frau, die am anderen Ende sprach – auf Russisch. »Ich glaube nicht, dass Sie so sind, Tatjana Lossowa. Ich glaube nicht, dass es Ihnen vor allem um sie Selbst geht. Nicht mit Ihrer Familiengeschichte.«
»Wer sind Sie?«
»Wir werden uns bald kennenlernen.«
»Hören Sie, ich weiß nicht, warum Sie mich in Ihre Spielchen hineinziehen ...«
»Das wissen Sie sehr gut, Tatjana Lossowa. Weil Sie Unterlagen mit tödlichem Inhalt haben. Und weil Sie an der richtigen Stelle sitzen. Und glauben Sie mir: Es ist kein Zufall, dass Sie dort sind. Wir haben Ihre Karriere sehr genau verfolgt. Sie war berechenbar wie die Flugbahn einer SSz6.«
»Und jetzt denken Sie, dass sie genauso zerstörerisch sein soll?«
»Alles, was ich will, ist, dass Sie die Papiere besorgen.«
»Wann werden Sie das Interview veröffentlichen?«
»Zum richtigen Zeitpunkt. Machen Sie sich darüber keine Sorgen.«
»Sie sollten sich Sorgen machen«, sagte Tatjana. »Was, wenn ich es ...«
»Sie werden es niemandem zeigen, Tatjana Lossowa. Es war nur für Ihre Augen bestimmt. Alles, was wir herausfinden und erreichen, muss gleichzeitig ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Nur so können wir vermeiden, dass die Wahrheit erneut unterdrückt wird. Sie steigen jetzt in ein Taxi und lassen sich direkt zum Hotel Ritz-Carlton bringen. Dort fragen Sie an der Rezeption nach Carlos. Ihm geben Sie den Umschlag für Zimmer 306. Und machen Sie keine Umwege. Wir wollen nicht, dass Ihnen etwas passiert.«
»Ich ...« Doch die Leitung war bereits tot. Tatjana wählte ihre eigene Nummer noch einmal, bekam aber nach mehrmaligem Läuten nur die Mailbox. Sie betrachtete die Häuser ringsumher. Sah sich die Autos an, die in der Nähe parkten. Musterte die Bettler, die Straßenverkäufer, die Kioske, ihre Besitzer und ihre Kunden. Aus einem Stehcafé gegenüber starrte sie ein Mann an, der von so dunkler Hautfarbe war, dass seine Augen zu leuchten schienen. Sie schüttelte den Kopf. Würde er sie beschatten, hätte er sie nicht so auffällig betrachtet. Sie überlegte nur einen kurzen Augenblick, dann ging sie auf den Taxistand zu und stieg in den ersten Wagen. »Ins Ritz-Carlton.«
Während das frühlingshafte Berlin vorbeiflog, nahm Tatjana das Interview hervor und machte mit dem Handy von jeder Seite eine Aufnahme. Sie ärgerte sich, dass sie kein besseres Modell gekauft hatte. Doch bei allen anderen Optionen hätte sie sich zumindest mit einigem Papierkram aufhalten müssen, und sie hätte warten müssen, bis die SIM-Karte freigeschaltet war. Sie fragte sich, wer sonst die Kunden des freundlichen Libanesen sein mochten. Waren es die Mitglieder der Berliner Russen-Mafia, waren es die Jungs aus irgendwelchen Kiez-Gangs, oder waren es bloß Leute, die so pleite waren, dass sie keinen normalen Handyvertrag mehr bekamen oder die keinen festen Wohnsitz mehr hatten?
Nachdem sie die Akte durchfotografiert hatte, rief sie im Büro an und erklärte der neuen Sekretärin, dass sie einen kleinen Unfall gehabt habe: »Nichts Dramatisches. Ich konnte nur leider nicht am Meeting teilnehmen. Und mein Handy ist kaputt, ich brauche bitte ein neues. Bis dahin bin ich unter dieser Nummer erreichbar, die Sie auf Ihrem Display sehen müssten.«
»Frau Lossowa?«
»Ja?«
»Sie haben den Termin in der Russischen Botschaft nicht bestätigt.«
»Richtig. 16 Uhr. Mein Handy, wie gesagt. Können Sie das noch rasch für mich erledigen?«
»Mache ich sofort.«
»Danke. Bis später.« Sie sah auf die Uhr. Kurz nach drei. Verdammt, das würde eng werden.
Das Ritz-Carlton tauchte vor ihnen auf. Riesig, imposant, hässlich. Mit ihrem letzten Geld bezahlte sie das Taxi, streifte das völlig zerknitterte Etuikleid so gut wie möglich glatt, band sich einen Pferdeschwanz und betrat das Hotel, dessen altehrwürdigem Namen man mit einem überladenen Gold- und Marmorambiente mehr schlecht als recht versucht hatte, gerecht zu werden. Sie war gelegentlich hier gewesen, wenn es diskrete Besprechungen mit internationalen Partnern gegeben hatte. Vor allem die Russen schätzten den Protz, auch den in den getäfelten und seidenquastenbehangenen Konferenzzimmern.
Am Empfang begrüßte sie ein Portier mit dem freundlichsten Lächeln. »Guten Tag, Madame. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich suche einen Herrn, von dem ich nur den Vornamen weiß. Er arbeitet hier. Carlos?«
»Aber natürlich, Madame. Einen Augenblick bitte.« Der Portier verschwand hinter dem Empfang, und keine zehn Sekunden später stand ein anderer, ebenso verbindlich-freundlicher, wenn auch etwas jüngerer Mann vor ihr. »Ja, bitte?«
»Ich habe hier etwas abzugeben«, sagte Tatjana und versuchte, sich das Gesicht des jungen Mannes einzuprägen. Dunkles Haar. Blaue Augen. Kräftige Augenbrauen. Er hätte Russe sein können. Oder Israeli. Womöglich war er beides. Sie reichte ihm das Kuvert. »Für Zimmer 306.«
»Sicher, Madame«, sagte Carlos und streckte seine Hand aus. Doch Tatjana zog den Umschlag zurück und schenkte ihm ein professionelles Lächeln. »Vorher hätte ich gerne eine Quittung«, sagte sie.
War da ein Zögern? Ein Blitzen in seinen Augen? Jedenfalls nickte der Portier ebenso professionell zurück, griff nach einem Stift, machte eine Notiz, setzte eine Unterschrift darunter und reichte ihr den Zettel, während er mit der anderen Hand den Umschlag entgegennahm. Er verschwand damit, als würde er ihn direkt in den dritten Stock bringen.
Tatjana wartete, doch er kehrte nicht wieder. Zimmer 306. In einem altmodischeren Hotel hätte sie jetzt den Schlüssel am Schlüsselbrett hängen sehen. Oder eben nicht. Und sie hätte gewusst, ob jemand auf dem Zimmer war. Sie widerstand dem Impuls, in den Fahrstuhl zu steigen und hinaufzufahren. Niemand würde ihr die Tür öffnen. Einen Augenblick stand Tatjana unentschlossen am Empfang, dann drehte sie sich um und setzte sich in die Lobby, um die Gäste zu beobachten. Oder all jene, die vorgaben, Gäste zu sein. Sie nahm ihr Billighandy heraus und wählte erneut ihre eigene Nummer. Diesmal meldete sich nicht die Mailbox, sondern die Frauenstimme von vorhin.
»Ich habe Ihre Unterlagen wie gewünscht abgegeben«, sagte Tatjana leise, während ihr Blick unablässig durch die Hotelhalle wanderte. Hatte jemand einen Anruf entgegengenommen? Nein. Wie auch? Die Frau würde nicht ausgerechnet hier auf sie warten.
»Ich weiß. Sie sind bereits wieder bei mir. Vielen Dank.«
»Sie sind hier im Hotel?«
»Wie? Ich? Gott, nein. Für wie naiv halten Sie mich?« War das ein Motorengeräusch gewesen? Einem Impuls folgend, stand Tatjana auf und ging zur Eingangstür. Sie sah eine Frauengestalt in ein Taxi steigen. Während die gläserne Hoteltür vor Tatjana aufglitt, zog die Frau die Taxitür hinter sich zu. Tatjana glaubte noch, eine Brille hinter der Scheibe glänzen zu sehen. Dann fädelte der Taxifahrer in den Verkehr ein und war so schnell weg, dass sie nicht einmal die Zeit hatte, auf die Idee zu kommen, wie in einem Mafiafilm mit einem anderen Taxi die Verfolgung aufzunehmen. »Wer sind Sie?«, fragte sie einmal mehr.
»Geben Sie gut auf Ihr neues Handy Acht«, sagte die Frau. »Und erzählen Sie niemandem, dass Sie Ihr altes vermissen. Dann können wir in Kontakt bleiben. Wie lautet Ihre PIN?«
»Sie glauben nicht im Ernst, dass ich Ihnen auch noch meine PIN verrate.« Tatjanas Blick fiel auf die Quittung, die sie immer noch in der Hand hielt: Passen Sie auf sich auf. Sie leben gefährlich. Sie spürte, wie eine ohnmächtige Wut sie erfasste.
»Wenn Sie sie mir nicht sagen, kann ich es nicht abschalten.«
»Es wird von allein ausgehen. Hören Sie ...« Tatjanas Stimme bebte. Sie hasste es, fremdbestimmt zu sein, sie würde sich das nicht bieten lassen. Sie würde ...
»Tatjana Lossowa«, sagte die Frau am anderen Ende der Leitung leise und scheinbar freundlich. »Ich kann Sie gut verstehen, und es tut mir leid, dass wir Sie so behandeln. Aber glauben Sie mir, wir meinen es gut mit Ihnen.«
»Sie kennen mich nicht. Und ich glaube Ihnen nichts.«
»Ich kenne Ihren Vater. Und er kann Hilfe brauchen.«
»Was wissen Sie über meinen Vater?«, keuchte Tatjana und spürte, wie ihre Augen feucht wurden.
»Sagen Sie mir die PIN«, wiederholte die Frau. »Ich muss Ihr Handy jetzt aus Sicherheitsgründen abschalten. Wenn ich es nicht wieder anschalten kann, können Sie keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen.«
Tatjanas Kopf fühlte sich an, als würde er platzen. Erst der Anruf ihrer Mutter. Dann der Vorfall auf der Straße. Dieses Gespräch, die Daten auf ihrem alten Handy, der verpasste Termin, der Ärger, den sie im Büro haben würde, diese ganze undurchsichtige Sache, in die sie sich hineingezogen sah, die Quittung, die verdammt noch mal keine Quittung war, Lewtuschenko, das Interview, ihr Vater ... »Siebzehnsechzehn«, sagte Tatjana zögerlich. Zumindest hatte sie alles gelöscht. Sie würden nichts mehr mit dem Gerät anstellen können.
»Gut. Sie erreichen mich jeden Tag zwischen 0:00 Uhr und 0:05 Uhr. Und vor allem: Passen Sie auf sich auf, Tatjana Lossowa.«
Fluchend steckte Tatjana ihr Handy weg. Dann atmete sie tief durch und ging wieder ins Hotel. An der Rezeption stand der Concierge, der sie zuerst begrüßt hatte. »Ich hätte gerne Carlos gesprochen«, sagte Tatjana, so freundlich, wie es ihr unter den Umständen möglich war.
»Haben Sie einen Nachnamen, Madame?«
Tatjana sog scharf die Luft ein. »Nein. Nur Carlos.«
»Meinen Sie einen Gast des Hauses?« Sein Lächeln war wie eine perfekte Maske.
»Ich meine den Mann, den Sie vorhin schon für mich geholt haben«, blaffte Tatjana und funkelte den Concierge wütend an. »Ihren Mitarbeiter.«
»Tut mir leid, Madame, aber wir haben hier keinen Mitarbeiter namens Carlos.«
***
Zum Glück lagen in Berlin die wirklich wichtigen Adressen nah beieinander. Die Strecke vom Ritz-Carlton zur Botschaft war ein Katzensprung, weshalb Tatjana pünktlich vor Ort war. Zeitgleich war sie mit Mike Wörner und den anderen eingetroffen. Das Sicherheitssystem der Russen war so paranoid wie das der Amerikaner, nur dass die Russen es mit noch mehr Lust an der Schikane auslebten. Während Wachmänner der US-Botschaft stets vorgaben, jede Unverschämtheit und jede Erniedrigung in den Dienst einer höheren Sache zu stellen – der Freiheit, der Demokratie oder der amerikanischen Sicherheit, was alles untrennbar miteinander verbunden war –, ritten die Russen Kontrolle und Bürokratie wie zu Sowjetzeiten und protzten mit ihrer Macht gegenüber dem Individuum, das gleichbedeutend war mit Dreck. Selbst Spitzenleute aus der Wirtschaft wurden in den Schleusen der Botschaft der Russischen Föderation bis auf die Unterhose durchleuchtet, als ginge es darum, sie beim Reinkommen daran zu hindern, tschetschenische Bombenleger unter dem Mantel zu verstecken und beim Rausgehen das Silberbesteck zu klauen. Genervt ließ Tatjana die Prozedur über sich ergehen. Immerhin hatte man zur Kontrolle der weiblichen Besucher eine Frau als Wachhund aufgestellt – ein Mannweib traf es wohl besser.
»Sie sprechen Russisch?«
»Ein bisschen«, log Tatjana.
»Woher kommen Sie?«
»Ich lebe in Berlin.«
Der lange, vor allem aber gelangweilte Blick besagte klar: Hör auf, mich zu verarschen, Mädchen. Tatjana räusperte sich. »Ursprünglich aus St. Petersburg. Wie unser Präsident.« Unschuldig blickte sie nach oben, wo in zehn oder zwölf Metern Raumhöhe eine faschistoid wirkende Kassettendecke prangte. Zu hoch für Kameras und Mikrofone, dachte Tatjana. Doch das war hier auch nicht nötig – die Sicherheitstechnik wurde so offen zu Schau gestellt, dass man sich vorkam wie in Guantánamo. Die Überwachungskameras saßen wie fiese schwarze Insekten in den Winkeln jedes Raumes und verfolgten mit leisem Surren die Bewegungen der Besucher und der Angestellten.
In einem Raum hinter der Sicherheitsschleuse befand sich die »Garderobe«. Es war allgemein bekannt, dass die Aufforderung »In diesen Schließfächern können Sie Ihre Taschen sicher verwahren« bedeutete: »Hier haben Sie sie zu lassen, eine Mitnahme ins Innere der Botschaft ist nicht vorgesehen.« Tatjana stopfte ihre Tasche in eines der Fächer, stellte einen Griff aufrecht hin und klappte einen zur Seite, arrangierte noch eine Falte in das weiche Leder und sperrte dann ab.
»Ihre Mobiltelefone bitten wir Sie auszuschalten und hier zu hinterlassen.« Der Sicherheitsmann, der der Garderobiere zur Seite gestellt war, deutete auf eine Metallkassette. Mit einem Murren drückte Mike Wörner den Aus-Knopf an seinem Smartphone, wartete, bis das Gerät heruntergefahren war, und legte es hinein. Die anderen taten es ihm gleich. Tatjana zögerte einen winzigen Augenblick, dann nahm sie die hintere Abdeckung ihres Billighandys ab, entfernte den Akku, verschloss es wieder und deponierte es zu den anderen Mobilgeräten. Es entging ihr nicht, wie sich die Augen des Sicherheitsmitarbeiters verengten. Sie schenkte ihm ein möglichst unbefangenes Lächeln und eilte hinter ihrem Chef die mächtige Marmortreppe in der Eingangshalle hoch. Ein weiteres Bild ihres Bruders stieg in ihr auf: So war sie damals die Treppe hinaufgelaufen, als Nikolai im Universitätskrankenhaus in St. Petersburg lag – damals noch Leningrad.
Die russischen Aufpasser übergaben die kleine Besuchergruppe um Dr. Michael Wörner an zwei weitere Botschaftsangestellte, die sie im ersten Stock erwartet hatten. Einer von ihnen trat einen Schritt vor und nickte ernst, aber höflich mit dem Kopf. »Guten Tag, Sie sind in der Botschaft der Russischen Föderation. Handelsattaché Braschatwili wird Sie gleich empfangen.«
Ein Georgier, dachte Tatjana. Wie Stalin. Wann immer sie auf Russen traf oder russische Einrichtungen besuchte, machten sich ihre Gedanken selbstständig, und stets konnte sie nur die dunkelsten Seiten sehen, ja, sie sah mehr, als es in Wirklichkeit zu sehen gab. Für Tatjana Lossowa hatte die alte Sowjetunion nie aufgehört zu existieren, sie nannte sich nur anders. Und wer an einem ganz normalen Tag wie diesem die Russische Botschaft besuchte, der konnte den Geist der kommunistischen Diktatur so lebendig spüren, dass es keinen Zweifel gab: Der Staat war untergegangen, doch das System hatte überlebt.
***
Als sie eine knappe Stunde später das Schließfach wieder öffnete, war alles wie zuvor: Ein Griff ihrer Tasche war hochgeklappt, einer zur Seite. Nur die Falte im Leder war an der falschen Stelle. Tatjana ließ sich nichts anmerken. Der Termin war das Desaster gewesen, das sie erwartet hatte: Mike Wörner und BraunTec waren für die Russen vollkommen uninteressant. Man hatte sie mit Allgemeinplätzen hingehalten, hatte von so gigantischen Projekten gesprochen, dass von vornherein klar war, dass sie nie realisiert würden. BraunTec als Partner in einem Joint Venture eines Nuklearparks in Ostsibirien: Während Mike weiter von einer goldenen Zukunft für seinen kränkelnden Konzern träumte, wussten alle anderen am Tisch, dass das Projekt so wahrscheinlich war wie eine gemeinsame Mars-Expedition.
Tatjana nahm die U-Bahn, stieg aber nach wenigen Stationen aus und ging den restlichen Weg zu Fuß nach Hause. Sie hielt es in dem beengten, dunklen Tunnel nicht länger aus. Ihre Tage waren lang, mit vielen Terminen und Konferenzen. Es war ein ewiges Hin- und Herhasten von einem Meeting zum nächsten, dazwischen das eilige Aktenstudium, die Organisation von weiteren Terminen und Rückruflisten, nicht zu vergessen der Flurfunk auf der Chefetage von BraunTec – alles war derart intensiv, dass es für zwei oder drei Leben gereicht hätte. Zugleich verflogen ihre Tage so schnell, dass es sich anfühlte, als käme sie bei all der Beschäftigung kaum zum Leben. Ein paar Schritte zu Fuß taten ihr gut. Doch wenn sie abends die Haustür aufsperrte, gähnte sie der leere Flur wie ein offenes Grab an, wie eine düstere Oase aus Stille und Einsamkeit.
»Guten Abend, Kindchen.«
»Guten Abend, Frau Wortmann.« Die alte Dame aus dem Erdgeschoss stand vor ihrer Tür und suchte offensichtlich den Wohnungsschlüssel. »Kommen Sie zurecht?«
»Danke, es wird schon gehen. Ist ja noch jedes Mal gut gegangen.«
Das weiße Haar steckte unter einem hauchdünnen Netz, wie Tatjana es nur in Russland gelegentlich gesehen hatte. Dass die alte Dame sie »Kindchen« nannte, verübelte sie ihr nicht – sie war im Übrigen ganz reizend und vor allem die Einzige, die Tatjana im ganzen Haus persönlich kannte. Alle anderen Hausbewohner kamen über einen kurzen Gruß nicht hinaus. Doch an diesem Tag wirkte Frau Wortmann, die unter ihr wohnte, besonders mitgenommen. Sie zitterte erkennbar.
»Sind Sie sicher?«
»Aber ja doch.« Frau Wortmann seufzte. »Etwas mehr Schlaf wäre gut gewesen.«
»Das macht das Wetter«, erklärte Tatjana mitfühlend. »Viele Menschen schlafen schlecht, wenn es so wechselhaft ist.«
»Na, ich denke eher, das war der Krach. Aber keine Sorge, ich nehme Ihnen das nicht krumm. Ich war auch mal jung, wissen Sie?« Dabei zwinkerte sie Tatjana schelmisch zu. »Solange Sie nicht jede Nacht eine Party feiern. Und vielleicht ...« Sie senkte die Stimme, als stünden hinter den anderen Wohnungstüren lauter lauschende Nachbarn. »Vielleicht laden Sie ja nächstes Mal keine Gäste ein, die mit Möbeln werfen.« Sie kicherte über ihren eigenen Witz und sagte gutmütig: »Kleiner Scherz. Oh, da ist ja mein Schlüssel. Also dann, Kindchen, einen schönen Tag noch.«
»Den wünsche ich Ihnen auch, Frau Wortmann. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.«
Tatsächlich konnten Partys für die Nachbarn ein Fluch sein, das sah Tatjana ein. Nur: Sie hatte nicht gefeiert. Und sie war in der letzten Nacht auch nicht zu Hause gewesen, sondern hatte bei Mike übernachtet. Voller Bedauern blickte sie der gebeugten Gestalt ihrer Nachbarin hinterher. Alt werden war kein Vergnügen. Hoffentlich wurde Frau Wortmann nicht dement. Tatjana mochte die alte Dame. Vielleicht sollte sie sie einmal auf eine Tasse Tee einladen.
***
Nikolai meldete sich nicht. Nicht am Nachmittag und auch nicht am Abend. Als Tatjana es später noch einmal bei ihm probierte und zum dritten Mal eine Nachricht mit ihrer neuen Nummer und der dringenden Bitte um Rückruf auf seiner Mailbox hinterließ, begann sie sich ernsthaft Sorgen zu machen. Wenn sie wenigstens ihre Mutter erreicht hätte. Komm nicht nach Russland, ging es ihr wieder und wieder durch den Kopf. Warum? Warum sollte sie nicht kommen? Was war geschehen? Wo war ihr Vater geblieben? Ihre ganze Familie schien von einem Augenblick auf den anderen wie vom Erdboden verschwunden. Niemand war erreichbar, niemand rief sie zurück. Sie schrieb Nikolai noch eine E-Mail, dann versuchte sie sich wieder auf ihre Arbeit zu konzentrieren.
In den nächsten Tagen standen wichtige Treffen in Italien und der Schweiz an, unter anderem eine Rede ihres Chefs Mike Wörner vor einer großen Runde von Top-Entscheidern. Ausgerechnet Mike hatte sich ein wirtschaftsphilosophisches Thema vorgenommen. Die gegensätzlichen Strömungen der Interventionisten und der freien Marktwirtschaftler. Sie hätte lachen können, wäre ihr gerade nicht so elend zumute gewesen. In Russland waren das keine gegensätzlichen Strömungen. Die freien Marktwirtschaftler waren zugleich die größten Interventionisten – und umgekehrt. Der Staat mischte sich überall dort ein, wo es Geld zu holen gab. Und die Wirtschaft spielte ganz oben im Kreml mit. Sie hatte dieses Thema bei so vielen Diskussionen am Esstisch verfolgt, dass sie Mikes Rede im Grunde aus dem Stegreif schreiben konnte. Ein Name war dabei immer wieder aufgetaucht. Tatjana googelte ihn: Auf russischen Websites war nicht sehr viel über ihn zu finden, was sie verwunderte, denn Lewtuschenko war zu einem der wichtigsten Wirtschaftsbosse aufgestiegen. Doch auf westlichen Internetseiten gab es unzählige Einträge. Gleich der erste Onlinebeitrag ließ Tatjana das Blut in den Adern gefrieren: »Der Mann, der über Leichen geht« – aus dem Independent und mit einem Foto, auf dem im Hintergrund niemand anders abgebildet war als Arkadi Michailowitsch Lossow, Tatjanas Vater.
***
»Hatte sie die Unterlagen dabei?«
»Leider nein. Nur belangloses Zeug.«
»Was ist mit ihrem Handy?«
»Sie hatte den Akku entfernt, wir konnten es nicht auslesen.«
»Sie konnten was nicht? Hören Sie, Hauptmann, ich erwarte, dass Sie über die nötige Ausstattung verfügen. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie keinen Strom für ein Mobiltelefon hatten.«
»Es war ein lächerliches billiges Ding, Herr Major. Damit hatten wir nicht gerechnet.«
»Nun, dann werden Sie sich eben auf andere Weise Zugang verschaffen.«
»Wir versuchen es bereits, Major. Aber so wie es aussieht, telefoniert sie nicht mit ihrer üblichen Nummer. Das Handy, das sie bisher benutzt hat, ist ausgeschaltet. Vielleicht ist es defekt.«
»Oder verschlüsselt?«
»Das können wir ausschließen. In dem Fall hätten wir Verbindung und könnten es bloß nicht lesen oder hören, was kommuniziert wird.«
»Dann beschaffen Sie sich die neue Nummer. Ich will wissen, was vor sich geht.«
»Wir sind schon dabei.«
***
St. Petersburg, 18. Mai 2012, 02:01 Uhr
»Arkadi Michailowitsch Lossow?«
Wenn sie gedacht hatten, sie würden ihn aus dem Bett holen, hatten sie sich geirrt. An Schlaf war nicht zu denken. Seit Stunden saß er mit Irina am Küchentisch. Nachdem sie über alles gesprochen hatten, waren ihnen die Worte ausgegangen, und sie hatten nur noch dagesessen, die Hände ineinandergelegt, zitternd. Beide. Jetzt drang aus der Küche gedämpft das Schluchzen Irinas. Der matte Lichtschein im grün gestrichenen Treppenhaus verlieh den beiden Männern eine Leichenblässe, die dem Anlass nicht angemessener hätte sein können.
»Ja?«





























