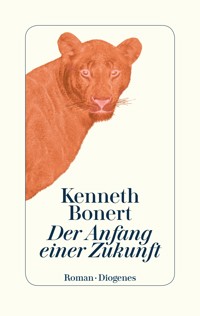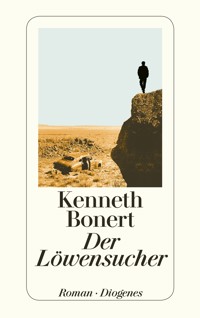
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine universelle Geschichte über einen jungen Menschen auf der Suche nach Erfolg und seinem Platz im Leben. Was steckt in dir? Hast du das Zeug dazu, im Leben ein Löwe zu sein? Isaac Helger, wilder, kluger Sohn jüdischer Einwanderer aus Litauen, ist hin- und hergerissen zwischen Tradition und Aufbruch. In den späten 1930er Jahren trifft er in seiner neuen Heimat Südafrika eine schicksalhafte Entscheidung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kenneth Bonert
Der Löwensucher
Roman
Aus dem Englischen vonStefanie Schäfer
Titel der 2013 bei Alfred A. Knopf, Kanada,
erschienenen Originalausgabe: ›The Lion Seeker‹
Copyright © 2013 by Kenneth Bonert
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag
Covermotiv (Ausschnitt):
Landschaftsfoto: Copyright © Scotia Luhrs/ Millennium Images, UK
Männliche Silhouette: Copyright © iStockphoto
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24369 7 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60457 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Für meine Eltern
Reisende, die von unserem Land dorthin gelangen, müde und erschöpft von der Unterdrückung und der Unbeständigkeit des Lebens, die uns an den Fersen kleben, können ihre Armut, ihr Elend, ihre Entwürdigung und Erniedrigung vergessen. In Afrika atmen sie ein neues Leben, ein Leben in Recht und Freiheit, ein Leben in Wohlstand und Ehre, denn dort gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Christen. Jeder Mensch kann gewissenhaft seiner Arbeit nachgehen und einen gerechten Lohn für seine Mühen erwarten.
Bericht aus Litauen in der hebräischenZeitschrift HaMelitz 1884, von N. D. Hoffman
[9]Inhalt
Gitelle
Ein Prolog[11]
Teil eins
Doornfontein[25]
Teil zwei
Lion’s Rock[325]
Teil drei
Greenside[649]
Rively
Ein Epilog[771]
Glossar mit Erklärungen
[11]GITELLE
Ein Prolog
Was auch immer jenseits der Seen und Wälder ihrer grünen Welt lag, war für sie dunkel wie die Nacht. Sie hatte nie eine Landkarte studiert, bis es an der Zeit war, für immer fortzugehen. Von da an fuhr sie unablässig wie eine Blinde mit den Fingerkuppen über etwas, das sie sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Dieses Unbekannte pulsierte in ihr wie ein zweiter Herzschlag. Ihr Dorf, auf der Karte nicht größer als ein Stecknadelkopf, lag näher an den Grenzen zu Polen und Lettland, als sie je geahnt hatte, ja ihr ganzes Land war nichts weiter als ein kleiner Holzspan in einer tosenden Welt. Es gab Salzmeere und Wüstenkönigreiche. Sie konnte sich nur an die Namen und die Farben auf der Landkarte halten, an sonst nichts.
Als sie auf dem Weg zum Dorf hinaus am Friedhof vorbeikamen, nuschelte der Kutscher Nachman: »A tayter nemt mir nit zurik vun besaylem« – ein Toter kehrt niemals aus dem Grab zurück. Das alte Sprichwort bedeutet: Was geschehen ist, ist geschehen, doch traf dieser Spruch aus Nachmans schiefem Mund die Situation keineswegs: Die Lebenden würden niemals zu diesen Gräbern am Ende der Milner Gass zurückkehren, neben der Quelle und neben Yoffes Mühle, wo zwischen den dunklen Bäumen der See silbrig hindurchschimmerte.
[12]Aus einer tiefhängenden Wolkendecke sprühte hartnäckiger Nieselregen, und alle trugen Galoschen, um ihre Schuhe vor dem Matsch zu schützen. Die schuppigen Birken knarrten und tropften, Kerzenflammen tanzten und flackerten. Ihre Tochter, das brave Mädchen, stand artig neben ihr, während Isaac, eingezwängt in seine kleine Jacke, an ihrer rechten Hand herumhampelte. Dieser Junge war von dem Moment an, als er sich mit einem Haarschopf so rot und glänzend wie frischgeschälte Karotten aus seiner Mutter herauswand, ein um sich tretender Wildfang gewesen, der mit bebenden Lippen so laut und viel schrie wie Zwillinge. Jetzt war er knapp fünf und kurz davor, um die halbe Welt zu reisen zu einem Vater, den er noch nie zu Gesicht bekommen hatte.
Gitelle forderte die Kinder auf, sich den Grabstein ihrer Großmutter anzusehen und kleine Steine daraufzulegen und ebenso auf die Grabsteine ihrer Urgroßeltern. Das musste reichen; dahinter erstreckte sich unter rauschenden Zweigen ein Gräberfeld von Generationen jüdischer Gebeine, fünf Jahrhunderte zurück, wenn nicht mehr. Gitelle befestigte ihren Schleier und wandte sich wieder den Lebenden zu – ihrem Tate Salman Moskewitsch, ihren Schwestern, Nichten und deren Männern. Flink wie ein Kätzchen entwand sich Isaac ihrer Hand und rannte davon. Doch Gitelle machte sich nicht die Mühe, ihm hinterherzurufen – bei ihrem Sohn konnte man sich heiser schreien, da brauchte man eine Leine, keine Worte. Drei seiner Tanten fingen ihn ein. Zwei weitere kamen auf Gitelle zu. Trudel-Sora nahm Rively auf den Arm und trug sie weg. Orli dagegen, die jüngste der Schwestern, mit üppigen Lippen und Hüften, [13]glatter olivfarbener Haut und – wie ihr dickes langes Haar – schwarzen, jetzt tränenglänzenden Augen, nahm Gitelle fest in die Arme und sagte mit einem Seufzer: »Ich glaube, du bist die Erste, die bei ihrem Abschied kein Taschentuch braucht.«
»Wundert dich das?«
»Nein, natürlich nicht.«
Gitelle nickte. Nach allem, was hinter ihr lag, nach all den Jahren, die sie schamvoll hinter dem Schleier zugebracht hatte und an ihrem eigenen Atem fast erstickt war, wären Tränen am heutigen Tag wirklich merkwürdig gewesen. Die Worte waren aus ihr herausgeblubbert wie Brei aus einem überlaufenden Topf – der Kummer, den sie an diesem Ort durchlebt hatte, sollte nicht auch noch ihren Abschied überschatten. Nein, niemals.
»Woran denkst du?«
»An die Zukunft«, sagte Gitelle. »Die Lebenden. Meinen Mann. Woran sonst?«
Orli lächelte breit, und ihre Zähne schimmerten wie weiße Flusskiesel in ihrem dunklen Gesicht. »Schwester, nicht jede ist so stark wie ein Baum.«
»So muss ich jetzt also sein?«
»So bist du immer gewesen.«
Orli hakte sich mit ihrem warmen, weichen Arm bei Gitelle ein und drückte sie fest an sich, während sie nebeneinander zwischen den Grabsteinen hindurch zurückwanderten. Ein tropfnasses Eichhörnchen reckte sich und starrte die Schwestern zitternd an. Gitelle sagte: »Hör zu. Wenn ich es kann, kannst du es auch. Verlier keine Zeit! Sei tapfer! Gib niemals auf! Ich musste siebenundzwanzig werden, [14]ehe ich meinen Abel kennenlernte, dabei hatte man mir prophezeit, dass eine wie ich niemals einen Mann finden würde. Und glaubst du etwa, er wollte gehen, nachdem wir Rively bekommen hatten? Männer sind faule Hunde. Ich musste ihn ständig antreiben, so dass es mich fast verrückt gemacht hat – leih dir Geld, tu was, wach auf! Und wie viele Jahre es dann noch gedauert hat, bis er tröpfchenweise gerade so viel Geld geschickt hatte, dass wir davon die Fahrkarten kaufen konnten… Doch schau, hier stehe ich und beklage mich nicht. Denn heute bin ich an der Reihe, heute ist mein Abschiedstag. Verstehst du, was ich dir sagen will, Orli? Denk an diesen Tag! Gib niemals auf. Lass dich nie entmutigen. Auch für dich wird der Abschied schneller kommen, als du denkst. Für euch alle. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns jemals wiedersehen. Und wir werden einander wiedersehen. Das müssen wir!«
Orli wischte sich mit ihrem freien Handrücken die Tränen von den Wangen. »Aber das mit dir und Abel war vorherbestimmt«, erwiderte sie. »Genau wie alles andere.«
Gitelle schnaubte, so dass der Schleier sich bauschte.
»Was?«
»Es gibt eine Vorsehung. Ihr beide seid der Beweis.«
»Der Beweis wofür?«
»Dass Jahwe die perfekte Ergänzung für uns erwählt, in jeder Generation wieder. Herz zu Herz, Wunde für Wunde, und jeder Schuh braucht seinen Fuß.«
Gitelle schwieg. Sie spürte den Blick ihrer Schwester auf ihr ruhen.
»Verzeih mir«, sagte Orli. »Der Vergleich mit dem Fuß und dem Schuh. Ich wollte damit nicht–«
[15]»Ach, Orli«, hauchte Gitelle in ihren Schleier. »Glaubst du wirklich, das macht mir etwas aus? Wenn du je erwachsen werden willst, liebe Schwester, solltest du diesen ganzen romantischen Mist vergessen. Es wird höchste Zeit!«
Draußen vor dem Friedhof graste das Pferd mit gestrecktem Hals auf der nassen Wiese. Nachman hatte den Kragen hochgeschlagen und das Kinn auf die Brust gelegt. Es gab eine Verzögerung, weil erst nach Isaac gesucht werden musste, der schon wieder weggelaufen war und kichernd irgendwo zwischen den Linden auf der anderen Straßenseite herumspielte. Zuerst würden sie zum Bahnhof von Obeliai fahren, dann mit dem Zug nach Libau an der Küste reisen. Gitelle hatte Gänsefederkissen für die harten Bänke auf dem Frachter und zahlreiche Zitronen als Mittel gegen Seekrankheit eingepackt: ein Rat derer, die ihnen vorausgegangen waren. Afrika. Sie versuchte, sich einen Ozean vorzustellen.
In Southampton bestiegen sie einen Union-Castle-Liniendampfer mit violettem Rumpf und zwei dicken Schornsteinen. Die Reise zur Südspitze des pistolenförmigen afrikanischen Kontinents dauerte zwanzig Tage, und an jedem einzelnen entdeckte Isaac einen weiteren Schleichweg, um die oberen Decks der ersten Klasse zu durchstreifen. Bei seiner Rückkehr ins Zwischendeck brachte er glasierte Törtchen, frischen Käse, Schweizer Schokolade und exotische, zuckersüße Früchte mit, wie Gitelle noch nie welche gesehen hatte. Wenn er nicht umherstreunte, raufte er mit anderen Jungen oder stellte den diensthabenden Offizieren ein Bein. Sein Meisterstück war, mit einer Leuchtpistole ein [16]Rettungsboot in Brand zu setzen. Die Crew nannte ihn einen Satansbraten, und der Kapitän hätte ihn beinahe einsperren lassen. Die Leute verstanden einfach nicht, dass Isaac nur mit etwas mehr kaych auf die Welt gekommen war, mit ein wenig mehr Lebensenergie, die in ihm sprudelte und sich überschäumend wie heiße Milch einen Weg ins Freie bahnte. Wenn Gitelle ihm abends im Bett das Gesicht mit einem feuchten Tuch abwischte, brachte sie ihn zum Stillhalten, indem sie ihm versprach, davon würden die Sommersprossen weggehen, und jeden Morgen rannte er aufgeregt zum Spiegel, um zu sehen, ob sie recht behalten hatte.
Kapstadt liegt in einer von salzigen Winden gepeitschten Bucht. Das Straßennetz zieht sich am Fuß eines oben abgeflachten Berges entlang. Überall flackerten Farben wie loderndes Feuer: blutrote Blüten, dornige Eruptionen von Zinnober, limonengelbe Streifen, die wie frisch aufgemalt die Felsen äderten. Die rote Sonne brannte auf der Haut wie Schmirgelpapier. Gitelle sah menschliche Wesen, die kohlrabenschwarz waren, andere schwarzteebraun oder ledriggelb; sie roch ihren fremdartigen Schweiß und ihre würzige Küche, hörte sie in verschiedensten Sprachen wild durcheinanderreden – eine seltsame Musik, bei der ihr das Herz an diesem überwältigenden Ort vor Angst in die Hose rutschte. Doch später sah sie Reihen hübscher, weißgetünchter Häuser mit Palmen in idyllischen Gärten am Ufer und hoffte im Stillen, dass Abel sie in einem ähnlichen Zuhause erwartete.
Johannesburg lag eine zweitägige Zugreise nach Norden entfernt, quer durch eine ausgedörrte Landschaft, die sie völlig unvorbereitet traf: die Kaktushügel, die [17]khakifarbenen flachen Einöden, der ferne dunstige Himmel, von dem die rote Sonne herunterbrannte wie der stechende Blick eines Wahnsinnigen.
Ihr Ehemann war noch derselbe wie zuvor, wenn auch rußverschmiert. Wie ein in Lumpen verpackter Edelstein. Er wohnte in einer armseligen Hütte im jüdischen Ghetto bei der Beit Street, das die Bewohner eigenhändig im Zentrum des Stadtteils Doornfontein errichtet hatten. Es war, als hätte sich ein ganzes armes litauisches Dorf in den kühlen Wäldern des Nordens auf Wanderschaft begeben, um im glühend heißen Staub des tiefsten Südens neue Wurzeln zu schlagen. Die Behausung bestand aus drei kleinen Zimmern hinter Abels Werkstatt, und im Hinterhof stand eine Wellblechhütte, in der eine mürrische Schwarze wohnte. Gitelle gab sich genau einen Tag lang den Zärtlichkeiten mit ihrem geliebten Mann hin, seinen langen Fingern, seinen sanften Augen – nicht mehr. Sie fragte:
»Wozu brauchst du die da?«
»Jeder hier hat so eine Schickse. Das ist üblich. Sogar ärmere Leute als wir haben eine.«
»Wozu ist sie gut?«
»Wozu sie gut ist? Sie macht sauber, sie kocht.«
»Saubermachen nennt sie das?«
Gitelle feuerte die Frau noch am selben Nachmittag und begann, Abel Helgers Schweinestall auszumisten, zu dem sein Leben verkommen war. Über die Zeit hatte sich der Dreck regelrecht ausgebreitet und den armen, schönen Mann überwuchert wie Unkraut, wenn sich niemand darum kümmert. Die Kinder halfen Gitelle, Wasser zu erhitzen und die Böden und Wände zu schrubben. Auch den rissigen [18]betonierten Hinterhof sparten sie nicht aus. Sie räumten das Zimmer der nichtsnutzigen Bantu-Frau leer (sie hatte nur das mitgenommen, was sie auf ihrer langen Heimreise tragen konnte), gossen Kerosin über die stinkende Decke und die fleckigen Gewänder und warfen die seltsamen Flaschen und Totems ins Feuer – Gegenstände, die verschrumpelten Insekten glichen und von denen Gitelle die Kinder wegscheuchte. Sie zog sich einen Handschuh über und trug sie mit spitzen Fingern und mit unter dem schwarzen Schleier gerümpfter Nase zu den Flammen.
Wo immer sie schrubbten, löste sich dicker Ruß, und wenn sie einen Teppich mit einem alten Tennisschläger klopften, wirbelten Wolken des schlohweißen Staubs auf, der von den nahegelegenen Minen herüberwehte und alles bedeckte. Gitelle öffnete die Fenster, um Licht und Luft hereinzulassen. Sie kaufte wohlüberlegt ein und kochte gutes koscheres Essen, herzhafte Suppen mit Markknochen und Graupen, gefilte Fisch und Cholent, Rindfleisch mit Backpflaumen, fettige Kartoffel-Latkes mit Schmand, Zimt und Zucker. Sie backte Sitnise-Brot, Razeve-Brot – Schwarzbrot und Roggenbrot – und zum Schabbes-Abend duftende Challah-Hefezöpfe, mit Eigelb bepinselt, damit sie golden glänzten. Ständig fegte sie, wischte den Staub von den Fensterbänken und achtete darauf, dass die Kinder vor dem Schlafengehen badeten, sich die Haare wuschen und zum Schluss die Zähne putzten, damit sie beim Lächeln weiß blitzten.
Es gab nur einen Bereich, in den sie nicht vordringen konnte, und das war die Werkstatt. Völlig chaotisch lagen Abels Sachen im Dreck herum. Dies war sein Männerreich. [19]Gitelle kontrollierte den Bereich, in dem sie die Kunden empfing, aber alles, was dahinterlag, der eigentliche Laden, blieb ein schmutziges Durcheinander. Schlimmer noch, dort versammelten sich auch jeden Tag (außer am Schabbes, wenn er in der schul war) Abels sogenannte Freunde. Diese Männer hatten sich auf ihn gestürzt wie ein Schwarm parasitenpickender Vögel auf den Rücken eines Nashorns, alles litauische Juden wie er, die meisten ebenfalls aus der Zarasai-Region. Sie schienen keinerlei Arbeit nachzugehen, und wie sollten sie auch, wenn sie den ganzen Tag in der Werkstatt auf ihrem toches saßen, aßen, tranken und dummes Zeug daherschwatzten. Sie schienen nur ein Thema zu kennen: Ihre Gedanken kreisten ständig um dahajm, jenes andere Land, diese versunkene Zeit. Diese krankhafte, muffige Rückwärtsgewandtheit irritierte Gitelle mehr als ihr Schmarotzertum.
Das Leben fand jetzt und in der Zukunft statt. Diese Männer waren wie lebende Tote. Abels frühere Einsamkeit entschuldigte ihre Anwesenheit; jetzt jedoch erwartete sie, dass er sie rauswarf. Doch Monate vergingen, und ihre ausgesuchte Unfreundlichkeit zeigte keinerlei Effekt, sie konnte auf die Begrüßungen der Freunde verächtlich grunzen und ihnen die Teller und Gläser hinknallen, wie sie wollte.
Es galt zu bedenken, dass die Männer Frauen hatten, denen sie auf der Straße begegnete, Frauen mit scharfen Zungen. In dieser Gegend beobachtete jeder jeden. Stets musste sie darauf achten, als gute Ehefrau ihres Mannes angesehen zu werden – das war schon fürs Geschäft unerlässlich, abgesehen davon, dass sie Abel niemals hätte erniedrigen oder blamieren wollen. Sie liebte ihren Mann. Also riss sie sich [20]hinter ihrem Schleier zähneknirschend zusammen, tat ihre Pflicht und betrat die Werkstatt nur, um die Männer in der Art und Weise zu bedienen, wie es von ihr erwartet wurde. Sie war schließlich die Neue an diesem Ort, ein Grünschnabel vom Schiff und der Gegenstand unerträglichen Mitleids auf der Straße, wo die Leute noch immer den Schleier anstarrten, noch immer traurige Gesichter machten und noch immer die Köpfe schüttelten, wenn sie ihr unverständliches Genuschel hörten. Sie wusste um die Gerüchte, wonach eine Krankheit sie furchtbar entstellt hatte. Und sie ließ die Leute reden.
Allmählich verlegte sie ihre Aktivitäten auch auf den Laden. Die Geschäfte ihres Gatten, Gott segne ihn, waren ein Chaos: erlassene Schulden, unbezahlte Rechnungen, Gratisarbeiten aus Mitleid für Jammerlappen. Gitelle brachte Ordnung in die Buchhaltung. Sie schrieb alles auf, und langsam, aber stetig begann Geld zu fließen. Wie ein Bullterrier hütete sie diese wachsenden Einnahmen vor dem Zugriff ihres Mannes und vor allem dem der Parasiten. Sie kaufte eine neue Geldkassette mit solidem Schloss und einem Schlitz im Deckel, so dass Geld hineingesteckt, aber nicht wieder entnommen werden konnte. Die Kassette blieb in ihrer Abwesenheit stets verschlossen; den einzigen Schlüssel trug sie an einer Kette um den Hals und verbarg ihn tief zwischen ihren großen Brüsten. Bald reichten die Ersparnisse für den Erwerb einer gebrauchten schwarzgoldenen Singer-Nähmaschine wie der, mit der sie in Dusat gearbeitet hatte. Gitelle richtete sich in der Dienstmädchenhütte im Hinterhof eine Nähstube ein, kaufte Stoffe von den Indern in der 14th Street in Vrededorp und begann, [21]Kleider zu nähen und zu verkaufen sowie für ein paar Schneider Änderungsaufträge auszuführen. Die Einkünfte aus der Änderungsschneiderei investierte sie in gebrauchte Gegenstände vom Markt auf der Diagonal Street oder vom Trödel. Hinter den Stoffballen verstaute sie gesprungene Vasen, wacklige Couchtische oder zerbrochene Bilderrahmen – lauter Kram, den keiner wollte. Wenn sie Zeit hatte, besserte sie die Sachen aus und verkaufte sie mit Gewinn, den sie rasch wieder in weiteren Trödel investierte.
Als sie genug gespart hatte, suchte sie einen Arzt auf, einen bekannten Chirurgen namens Graumann. Dieser Dr.Graumann untersuchte sie und versprach, den Grund für den Schleier zu beseitigen. Sein Honorar war für sie zu hoch, doch er bot an, ihren Fall für die Summe zu übernehmen, die sie erübrigen konnte. Diese Nachricht brachte Gitelle zum ersten Mal seit vielen Jahren dazu, laut zu weinen. So lange hatte sie den schrecklichen Schleier getragen, der ihre untere Gesichtshälfte bedeckte wie ein Krankenhausverband – die Spitzenbänder über die Ohren hinweg im Nacken gebunden, das untere Ende lose, damit sie ihr Essen und Trinken unter dem Schleier zum Mund führen konnte–, dass er zu einem Teil von ihr geworden war. Der Schleier brandmarkte sie als Kranke, wie eine Aussätzige. Ja, sie hatte Litauen hinter sich gelassen, doch noch hatte sie sich nicht von dem Schleier befreit, der sie in Gedanken für immer mit diesem elenden Land verband, dieser finsteren, erstickenden, hoffnungslosen Vergangenheit.
Sie ließ sich entgegen der Einwände Abels operieren, der befürchtete, der Eingriff könnte fehlschlagen. Doch alles lief so, wie sie es sich erhofft und wie Dr.Graumann es [22]versprochen hatte. Normal würde sie niemals sein, aber nach der Operation klangen ihre Worte so, wie sie sollten, und sie war bereit, ihr Gesicht jedem zu zeigen, der es ansehen wollte.
Nach ihrer Heilung verbrannte sie den Schleier im Hof, genau wie den Müll der Schickse. Sie spürte die reinigenden Strahlen der Sonne und die trockene heiße Luft auf Kinn und Lippen. Sie unternahm ausgedehnte Spaziergänge in den Straßen und ging umher wie alle anderen. Wenn Passanten sie anstarrten, starrte sie zurück, bis sie den Blick abwandten. Allmählich entwickelte sich in ihr das Gefühl, eine andere Person geworden zu sein, als sei sie in diesem Land ein zweites Mal geboren worden. Sie stand mit beiden Beinen im Leben und trat für ihre Rechte ein. Und erhob nun immer öfter und lauter die Stimme.
Unterdessen hatte sich die Situation mit den Männern in der Werkstatt jedoch eher noch verschlimmert. Sie waren ihr ständig im Weg, füllten das Haus und salbaderten über die alten Zeiten, die alten Geschichten, die alte Heimat – eine lähmende, tödliche Nostalgie.
Die Werkstatt war für sie ein Zufluchtsort, wie eine Opiumhöhle, in der sie gegenseitig ihre Erinnerungen inhalierten und ihre eigenen ausatmeten, während sie Abels Brandy schlürften und seine Speisen aßen. Dennoch fühlte Gitelle sich verpflichtet, sie weiterhin zu bedienen, ihrem Ehemann und ihrem Ruf als gute Ehefrau zuliebe, doch innerlich kochte sie vor Wut. Sie hatte sich verändert; jegliche Toleranz den Schmarotzern gegenüber war dahin. Ihre unterdrückte Wut fraß an ihren Nerven und verursachte ihr Magenschmerzen und Sodbrennen. Im Schlaf schlug sie um [23]sich, als plagten sie Alpträume, und morgens wachte sie mit Kieferkrampf und Kopfschmerzen vom nächtlichen Zähneknirschen auf.
Eines Tages war das Maß voll. Es hatte so kommen müssen. Gitelle war schon an der Küchentür, da rief einer von denen sie noch einmal zurück. Sie habe vergessen, seinen Aschenbecher zu leeren, sagte er. Mit seinen dreckigen, stinkenden Kippen. Aus Gewohnheit drehte sie sich um und wäre fast zu ihm gegangen. Doch dann – nein! – stieß sie die Tür mit der Schulter auf und eilte durch die Küche hinaus und über den Hinterhof (von dem kleinen Isaac, der hinter der Tür gelauscht hatte, nahm sie keine Notiz, spürte kaum, wie sie ihn zur Seite drängte). Unter den gebrauchten Sachen war etwas, das sie am Wochenende günstig in der Commissioner Street erstanden hatte und das ihr nun spontan in den Sinn gekommen war. Seltsam, sie hatte zunächst gezögert, den Gegenstand zu erwerben, weil er sich nicht leicht weiterverkaufen lassen würde. Und dennoch. Das Gewicht in ihren breiten Händen hatte den Ausschlag gegeben. Jetzt hob sie das Ding wieder auf und spürte Entschlossenheit durch ihren starken, gedrungenen Körper fließen. Sie drehte sich um und kehrte zurück ins Haus. Nichts und niemand hätte sie noch aufhalten können, nicht einmal sie selbst.
[25]TEIL EINS
[27]1
Skots sagt, Isaac habe komische weiche Fußsohlen. Mann, dauernd trete er sich Dornen oder Glasscherben rein, über die alle anderen einfach drüberlaufen. Er meint, das hänge irgendwie mit Isaacs merkwürdigem Haar zusammen, das aussehe wie geraspelte Möhren, und mit den Sommersprossen in seinem Gesicht, die man auf seinen weißen Wangen für Motorölspritzer halten könne. Und dazu diese lustigen, viel zu großen Shorts, die ihm nur nicht runterrutschten, weil sein Vater jede Menge zusätzliche Löcher in den Gürtel geknipst habe. Lachend sagt Skots, die weichen Füße könnten auch irgendwas mit Isaacs Haut zu tun haben, die schon beim kleinsten Sonnenstrahl krebsrot werde. »Guck dir mal deine Streichholzbeine an, Mann!«
Sie sitzen alle zusammen auf dem verdorrten Veld hinter Nussbaums koscherer Metzgerei und essen eine Taube, die Isaac mit seiner Schleuder von der Telefonleitung geschossen hat. Die anderen hatten alle danebengetroffen. Plötzlich halten alle die Luft an, und Isaac spürt, wie sie ihn anstarren. Er hört nichts mehr außer dem Lärm von der Beit Street, eine klingelnde, ratternde Straßenbahn, jiddische Rufe von den Obst-, Brot-, Kohlen- oder Eisverkäufern. Isaac dreht sich langsam zu Skots um. »Hey, Skots, willst du mich beleidigen oder was?«
[28]Skots scheint über die Frage nachzudenken und schabt mit den Zehen im Staub am Rand der Feuergrube, die sie mit den Händen gegraben und mit Tomatenkistenholz gefüllt haben. Inzwischen ist nur noch graue Asche übrig, gemischt mit Taubenknochen, Taubenfett und rauchenden, kokelnden Federn.
Isaac sagt: »Wenn du mich nicht beleidigen willst, dann halt gefälligst deine verdammte Fresse, Skots.«
Die anderen warten, und Isaac behält Skots im Auge. Vielleicht würde er so blöd sein und versuchen, sich auf ihn zu stürzen, wie neulich. Skots ist zwar größer und älter als er und hat Bizepse wie harte unreife Äpfel. Doch neulich hat Isaac seinen Daumen mit den Zähnen erwischt und zugebissen bis auf den Knochen, so dass Skots weinte wie ein kleines Mädchen und jammerte: »Ich geb auf, ich geb auf!« Isaac geht in die Hocke und neigt sich nach vorn.
Charlie schaut schnell und nervös von einem zum anderen. »Hey, hey, habt ihr das schon gehört?« Und er erzählt den anderen von einem Mann, der so verrückt, so moochoo im Kopf ist, dass er ganz schlimme Sachen gemacht hat, die er, Charlie, mit eigenen Augen gesehen hat.
»Was denn für schlimme Sachen?«, fragt Isaac und starrt Skots an.
Charlie will es nicht sagen, aber nachdem sie ihn bedrängt haben und er alles erzählt hat, wird Isaac heiß und übel. Seine Augen füllen sich mit Tränen, und die Kehle schnürt sich ihm zu. Skots ist ihm plötzlich egal und alles andere auch. Er steht auf. »Los, den knöpfen wir uns vor! Den kriegen wir, diesen fiesen Scheißkerl!«
Isaac rennt los, und die anderen folgen ihm, ohne zu [29]zögern. Sie laufen durch die Gasse an Nussbaums Metzgerei vorbei und in den Lärm und das Gedränge der Beit Street hinein, durch die auf Jiddisch schreienden Händler, die Pferdewagen, die klingelnden Fahrräder, die hupenden Packards und die Doppeldecker-Straßenbahn mit Wendeltreppe, die in der Mitte der Straße entlangrumpelt und blaue Funken von den Oberleitungen stieben lässt. An einer Hausecke stapeln sich Käfige mit gackernden Hühnern, und ein Stück weiter lädt der Eismann mit dicken Handschuhen schwere, mit Stroh isolierte Eisblöcke von seinem Pferdewagen. Auf Verkaufstischen reiht sich Gemüse, von Dovedovitz ertönt Sägen und Hämmern, von Katz, dem Klempner, blechernes Ting-Ting. In der angrenzenden Gasse glüht orangefarben die heiße Esse des Schmieds, und überall entlang der langen, überdachten Holzarkade sitzen Xhosa-Frauen auf ihren bunten Decken am Straßenrand und bieten ihren Nippes aus Elfenbein und Stinkholz feil. Im Schaufenster der Metzgerei hängen schwarze Laibe von eingesalzenem Biltong, und fette blaue Schmeißfliegen wimmeln auf den blutigen Sägemehlklumpen, die zusammen mit den stinkenden Pferdeäpfeln in die Gosse gefegt wurden. Jenseits der Beit Street, hinter den Geschäften, rennen die Jungen zwischen Reihenhäusern mit Wellblechdächern entlang. Hier wird es still; sie hören nur ihren eigenen Atem und das Klatschen ihrer Füße. Eidechsen wärmen sich auf gekalkten Mauern in der hellen Sonne. Die Jungen rennen, bis der Asphalt in hartgebackene Erde übergeht, pockennarbig von Schlaglöchern oder durchzogen von glitzerndem Glas. Hier, am Ende der Straße, liegt ein auf einer Seite offenes Viereck aus Wellblechhütten mit einem Wasserhahn mitten [30]in der Erde des Innenhofs, vor dem die Frauen mit lallenden Babys auf dem Rücken und klappernden Eimern in der Hand Schlange stehen. Männer sitzen auf Zeitungspapier in der Nachmittagshitze, Kinder balgen sich und schreien herum. Jemand spielt auf einer Gitarre mit Gummisaiten und einem Resonanzkörper aus einem Waschmittelkarton.
Die Jungen verlangsamen ihren Schritt. Isaac berührt die Steinschleuder in seiner Gesäßtasche, eine gute, die er aus einem Fahrradschlauch und einer soliden Astgabel gebastelt hat. Sie schießt hart und präzise. Er dreht sich zu Charlie um. »Wo ist er? Wohin müssen wir?«
»Wartet mal«, sagt Charlie. Sie beobachten, wie er in die hintere Ecke des Hofs läuft, wo eine Lücke im Wellblech klafft. Er blickt sich um und kommt kopfschüttelnd zurückgetrabt. »Er ist noch nicht da.«
»Lass uns zurücklaufen und hinten am Chains Park spielen.«
»Oder wir gehen den Inder ärgern.«
»Nein, wir bleiben hier«, entgegnet Isaac. »Wir warten, bis er kommt. Charlie, du hältst Ausschau.«
Sie trotten weiter bis zu einer Tür, an der Isaac Skots vorgehen lässt. Nach der Helligkeit draußen ist es drinnen dunkel, und sie sind plötzlich umgeben von Gerüchen nach mieliepapund saurem Urin. Dann erkennt Isaac den Tisch aus Kartons, bedeckt von einem Laken mit Erdbeermotiv und kleinen Brandlöchern. Auntie Peaches ist zu Hause: Sie gibt ihnen in einer alten Horlicks-Kaffeedose süßen Bohnenkaffee zu trinken. Zu Hause darf Isaac keinen Kaffee trinken, aber Mame wird es niemals spitzkriegen, wenn er hier welchen annimmt. Kaffee, um den Geschmack der [31]verbrannten Taube hinunterzuspülen. Er trinkt einen Schluck und reicht die Dose weiter. Ein böser Husten ist durch die Wellblechwand zu hören. Auntie Peaches piekt Isaac in den Bauch. »Und, wie geht’s dem kleinen Teufel, hm? Kleiner Satansbraten, kleiner Tunichtgut!«
Isaac rollt sich mit angezogenen Knien auf den Rücken und kichert. Er ist glücklich und fühlt sich geborgen hier in diesem engen, behaglichen Raum. Doch dann kommt Charlie und ruft auf Afrikaans: »Ouens, ouens, hy ist hier, die bliksem!« Jungs, Jungs, er ist hier, der Mistkerl!
Draußen brennt die Sonne ein weißes rundes Loch in eine vorüberziehende Wolke, als sie um die Ecke rennen und in die nächste Gasse einbiegen, wobei sie aufpassen müssen, nicht in Hundehaufen zu treten. Am Ende befindet sich der Müllplatz, der einmal eine Grube war, aber inzwischen zu einem kleinen Müllberg angewachsen ist. Davor steht der Verrückte.
»Das is’ Puppyman«, sagt Davey. »Das is’ der Puppyman!«
»Den kenn’ ich«, sagt Nixie. »Den ganzen Tag versucht er, seine Welpen zu verscheuern.«
Puppyman ist groß und trägt nichts als einen ärmellosen, löchrigen Kattunoverall, der ihm um den mageren Körper schlackert. Seine Kappe hat er in eine Gesäßtasche gesteckt, am Kopf hat er kahle Stellen, er trägt nur eine Socke, und an einem Schuh schlappt die Sohle. Er schwankt und hält eine kleine Flasche in einer Hand. Vor ihm auf dem Boden steht eine hohe Apfelkiste aus Pappe. Darin bewegt sich etwas. Puppyman bückt sich, holt einen kleinen weißen Hund mit schwarzen Flecken heraus, stellt ihn vorsichtig auf zwei [32]aufeinandergestapelte Backsteine und starrt auf ihn hinunter.
»Los, kommt!«, sagt Isaac. Doch sein Herz klopft wie wild in seiner Brust, und er spürt, dass die anderen ihm nur widerstrebend folgen. Puppyman wirkt immer größer, je näher sie kommen. Puppymans Gesicht ist so zerfurcht von Falten, dass sie wie mit dem Messer hineingeschnitten aussehen. Isaac spricht ihn an: »Hey, sorry, was machen Sie mit dem kleinen Hund?«
Puppyman braucht einen Moment, um klar zu sehen, und schaut blinzelnd auf Isaac hinunter: »Was geht’n dich das an? Willste den kaufen?«
»Wie viel?«, fragt Isaac.
»Ach, du hast doch eh keine Kohle, Kleiner. Los, verpiss dich. Voertsek!«
Der Welpe steht auf den Backsteinen und zittert am ganzen rundbäuchigen Körper. Dann hockt er sich hin, und ein Pipirinnsal läuft die Backsteine hinunter. Es stimmt, dass Puppyman aussieht, als hätte er sie nicht alle. Seine glasigen Augen sind gelblich und rotgeädert, als wären sie mit Netzen durchzogen. Er trinkt einen Schluck aus seiner Flasche und brabbelt irgendwelchen Blödsinn vor sich hin. Sein Atem stinkt nach Sprit. Einige seiner Haarbüschel sind mit Schmutz, Farbe und Gott weiß was verkrustet. Er hat rote, blasige Wunden auf einer Seite des Mundes und nicht mehr viele Zähne.
»He, Sie, Puppyman«, sagt Isaac. »Tun Sie bloß dem Hund nichts.«
»Ich bin der Puppyman«, sagt Puppyman. »Genau, das bin ich. Das stimmt.«
[33]Er dreht sich um, nimmt einen kurzen Anlauf, schwingt das Bein wie ein Fußballer: ein Grunzen, ein widerlicher Schlag wie mit einem Knüppel, das Hündchen quietscht nur kurz auf. Es fliegt in hohem Bogen durch die Luft, fällt auf den Müll, rollt und purzelt herunter und bleibt leblos und schlaff wie eine Stoffpuppe liegen. Puppyman hebt die Flasche, wischt sich über den Mund und brabbelt vor sich hin.
Isaac wird speiübel.
»Haut ab, ihr kleinen Mistkäfer«, sagt Puppyman. »Das is’ meine Ware, ich kann damit machen, was ich will.« Isaac starrt den Karton hinter Puppyman an. Ein zweiter Welpe bewegt sich darin, ein größerer. Puppyman dreht sich lallend zu Isaac um. Er ist riesengroß, seine Schultermuskeln treten hervor wie aus Holz geschnitzt, seine Ellbogen sehen aus wie Speerspitzen, und über die Unterarme winden sich Adern wie Schlangen.
Isaac hebt die Arme. Hinter ihm flüstert Nixie: »Hey, lass uns lieber abhauen. Der trinkt Brennspiritus, deswegen.«
Skots: »Der ist groß und völlig durchgeknallt.«
Charlie: »Der ist nicht richtig im Kopf. Plemplem geworden.«
Nixie: »Kommt, wir sagen es jemandem.«
»Issie? Hey, Issie, nein, nicht, Issie!«
Zu spät.
[34]2
Buxton Street Nummer 52, ein Eckhaus. Isaac bleibt vor der Tür stehen, und der Hund an der Leine aus Zwiebelsackjute setzt sich dicht neben ihn. Durch das Fenster bei der Tür sieht Isaac den Schreibtisch mit der Rechenmaschine, das große schwarze Auftragsbuch und die Geldkassette. Auf dem Wandkalender steht in roten Ziffern 1927 sowie JHB. Diese drei Buchstaben kennt Isaac schon, obwohl er noch nicht zur Schule geht. Sie bedeuten Johannesburg, also Joburg, wo sie wohnen. Er legt eine Hand an die spiegelnde Scheibe und schaut nach hinten in die Werkstatt, wo er nachts auf einem Feldbett schläft. Tate sitzt über seine Werkbank gebeugt, der linke Fuß steht auf dem Boden, den wehen Fuß hat er auf den niedrigen Hocker gelegt. Rings um ihn türmen sich Schachteln mit gebrauchten Uhren- und Weckerteilen: Federn, Zahnräder, Zifferblätter und Zeiger und auch winzige Messingtrichter, die hübsch klingen, wenn man sie mit einem Miniaturhämmerchen so klein, dass es auf den Nagel des kleinen Fingers passen würde, anschlägt. Auf dem Arbeitstisch sieht Isaac die längliche, halbkreisförmige Drehbank, die durch einen zur Acht gedrehten Riemen mit einem Elektromotor verbunden ist. Daneben stehen Ölfläschchen mit langen Tüllen, aus einem Schuhkarton quellen Lappen heraus. Tate verwendet [35]haarfeine Schrauben, zart wie Augenwimpern. Tate mit der Lupe, die stets vor seinem rechten Auge klemmt wie ein Geschwür. Tate – er repariert Zeit.
Doch als Isaac auf den weißen Hund hinunterblickt, ist ihm klar, dass es keinen Sinn hat, ihn auch nur zu fragen.
Hinter den Häusern verläuft eine lange Gasse. Nummer 52 liegt an der Ecke, an der die Gasse eine Kurve beschreibt und in die Buxton Street mündet. Von hier ist es nicht mehr weit bis zur Beit Street, wohin Isaacs Weg ihn führt. Der Rücken schmerzt ihn beim Gehen, genau in der Mitte, wo ihn die Flasche getroffen hat. Bestimmt bildet sich morgen ein großer blauer Fleck, wenn er nicht schon einen hat. Aber gut, er hatte ja Glück, dass der große Mann gestolpert und gestürzt ist. Isaac kann kaum glauben, was er getan hat – alles ging so schnell. Er hatte den Puppyman geschubst, sich den Hund geschnappt, war losgerannt, und als er sich umblickte, rappelte sich der Mann auf und warf die Flasche nach ihm. Isaac hatte sich geduckt, wurde aber im selben Moment hart getroffen. Zuerst spürte er gar nichts; der Schmerz kam erst später, nachdem er auf den Müllberg geklettert war und die anderen hinter ihm den Puppyman mit ihren Schleudern beschossen, um ihn abzulenken.
Er ist auf der anderen Seite des Müllbergs hinuntergerutscht, hat die Bahngleise überquert und ist über einen großen Umweg nach Hause zurückgekehrt. Ein paar Mal hat er angehalten, um den kleinen Hund trinken zu lassen und ihn in einer Pferdetränke zu waschen. So klein ist er, und er hört nicht auf zu zittern! Isaac bindet die Leine an einen Nagel in der Backsteinwand, legt seine Hand an die heiße kleine Brust und hört, wie das Herzchen [36]drinnen pocht und wummert. Du lebst noch. Ich pass auf dich auf.
Er geht allein weiter. Die Gasse beschreibt eine Kurve, und er gelangt seitlich um das Haus herum zu dem torlosen Eingang auf der Rückseite, nicht mehr als eine Lücke in der niedrigen Mauer aus zerbrochenen roten Backsteinen. Isaac bleibt stehen und beobachtet sie im Hinterhof, die kräftige, korpulente Frau mit den dicken Armen, die aus den kurzen Ärmeln ihres selbstgenähten Kleides herausragen. In einem Ärmel steckt ein Taschentuch. Sie hängt Wäsche auf, und bei dieser Arbeit treten die Muskeln ihrer Unterarme hervor. Ihr Mund hat den vertrauten verzerrten Ausdruck, denn über die eine Wange spannt sich grell rosafarbenes Narbengewebe bis zum Kieferknochen, wie geschmolzenes Kerzenwachs. Ihre Stirn ist breit und voller Sommersprossen wie seine; ihr fuchsrotes Haar, etwas dunkler als seines, trägt sie zurückgekämmt und mit Klammern glatt an den Kopf gesteckt. Ohne ihn anzusehen, fragt sie: »Nu, wo is die choljere?«
»Die wos?«, fragt er automatisch ebenfalls auf Jiddisch.
»Tu nicht so, du hast mich genau verstanden. Diese dreckige Cholera, die Töle, dieses Vieh, das uns alle in unserem eigenen Haus umbringt!«
»Aber das stimmt doch gar nicht!«
Ein Kichern: Rively steht in der Küchentür. Er deutet einen Faustschlag in ihre Richtung an, diese verdammte Petze! Sie muss ihn mit dem Hund draußen gesehen haben.
Jetzt schaut Mame ihn mit ihrem breiten lieben Gesicht an und schüttelt langsam den Kopf angesichts seiner Wut. »Mein kleiner Isaac«, sagt sie mit ihrem halben Lächeln, der [37]andere Mundwinkel durch die Narbe wie unten festgezurrt. Er rennt zu ihr, drängt sich an sie, spürt ihre breiten Hände auf seinem Rücken und ihren Kuss auf seinem Scheitel. »Du bist mein Schöner«, sagt sie, »nur du. Du bist mein Junge, mein Regenbogen, nicht wahr?«
»Mame, Mame! Ich habe ihn dir mitgebracht.«
»Bist du mein Kluger?«
Er hat seine kleinen Arme um ihre Hüften geschlungen, und sie umfasst mit den Händen seinen Hinterkopf. Die Wärme ihres weichen Bauches dringt durch ihre Schürze an seine Wange.
»Schon gut, Schatz. Komm, zeig mir, was du deiner Mame mitgebracht hast. Du bist doch mein Kluger.«
»Ja, Mame, ich bin dein Kluger.«
»Sag mir, welche zwei gibt es auf der Welt?«
»Die Klugen und die Dummen.«
»Richtig. Und zu welchen gehörst du?«
»Zu den Klugen, Mame, ich bin dein Kluger.«
»Komm, Kluger. Zeig ihn mir.«
Hand in Hand gehen sie zu dem Welpen, der mit hängender Zunge auf den Hinterbeinen sitzt.
»Er sieht durstig aus«, sagt Gitelle. »Wo hast du ihn her?«
»Ich habe gefragt und ihn geschenkt bekommen. Umsonst.«
»Auf der Straße hat ihn dir jemand einfach umsonst gegeben?«
»Ja, umsonst. Geschenkt.«
»Wer war das?«
Isaac antwortet nicht. Gitelle blickt zu Boden und stößt einen Laut aus, als wolle sie ausspucken. Isaac geht in die [38]Knie und streckt die Hand nach dem Hund aus, doch seine Mutter reißt ihn zurück. »Sies!«, zischt sie. »Pfui! Fass dir nicht an die Augen, da kann man blind werden davon. Jetzt müssen wir Wasser heißmachen und dich gründlich waschen.«
»Waschen?«
»Ein schmutziges Tier, von dem du nicht mal weißt, wo es herkommt. Davon bekommst du Warzen. Und Fieber.«
Isaac schüttelt den Kopf. Der Hund beobachtet ihn, sein Gesicht. Dann versucht er es bei Mame. Er wedelt mit dem Schwanz, hört aber gleich wieder damit auf.
»Zu Hause haben die pojer so einem Hund einen Stein umgebunden, ihn in den See geworfen und Schluss.«
»Nein!«
Sie dreht Isaacs Gesicht am Kinn zu sich und blickt auf ihn hinunter. »Was regst du dich so auf? Wenn ich, deine Mame, dir sage, du sollst das tun, würdest du gehorchen?«
»Nein.«
»Nejn?«
»Nejn.«
»Du gehorchst also deiner Mame nicht. Wenn du ja gesagt hättest, weil du ein guter Junge bist, hättest du ihn behalten dürfen.«
Isaac denkt darüber nach, kaut auf seiner Unterlippe und spürt, wie seine Augen feucht werden. »Doch, Mame, ich hätte gehorcht. Ich hätte es getan.«
»Jetzt erzähl mir bloß keine Geschichten! Es steht geschrieben: Tausend Wahrheiten können eine Lüge nicht auslöschen. Komm rein.«
Er wehrt sich, als sie ihn hereinziehen will, und bückt [39]sich hinunter. Der Hund winselt und leckt an seinen Fingerspitzen.
»Siehst du? Du hörst nicht, nicht mal auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Lass ihn!«
In seinem Flehen verfällt er ins Englische: »Oh, Ma, oh, Ma, bitte! Er ist nicht schmutzig. AuntiePeaches hat ihn mir geschenkt, und ich habe ihn gewaschen, schau, wie sauber er ist!«
Die Mutter erstarrt, als hätte sie einen Schlag bekommen. Dreht sich ganz langsam um. »Was hast du gerade gesagt?«
Sie gehen die belebte Beit Street und dann den langen, mit Wellblech überdachten Fußgängerweg entlang. Ma zerrt Isaac an der Hand hinter sich her, und der hält den kleinen Hund an der Leine. Am Ende des Blocks fragt sie: »Ist es hier? Das da drüben?« Doch Isaac bringt kein Wort hervor. Die Leute starren sie an. Mr.Epstein, der Schneider, kommt aus seinem Laden, das Maßband um den dürren Haus gehängt. Seine scharfgeschnittene Nase zuckt, und er tut so, als höre er nicht zu. Eine Straßenbahn rumpelt vorüber, auf der anderen Straßenseite fährt ein LKW mit verdreckten, auf Kohlesäcken sitzenden Arbeitern vorbei. Die Männer singen ein Lied auf Zulu, und eine Welle aus tiefen, rührenden und wehmütigen Tönen schwappt über den Verkehr hinweg. Vor Sidermans Kurzwarenhandlung wird Schmutz über den Bordstein auf die Straße gefegt.
Mame schüttelt seinen Arm. »Ist das der Laden oder nicht?«
Sie stehen vor dem Churu-Lebensmittelladen an der Ecke, und Isaac späht hinein. Hier stehlen er und seine [40]Kumpel Mandarinen, Cadbury-Schokolade und runde Kandis-Lutscher, die alle niggerballs nennen. Zu fünft fallen sie in den Laden ein, singen Spottlieder, um den Churu zu ärgern, und wenn er hinter ihnen herläuft, klauen die anderen die Sachen. Sie singen:
Lauf, Churu
Lauf, Churu
Kak banana
Zwei für’n Tickey
Kein bonsela!
Churu, das Schimpfwort für Inder, bringt den Ladenbesitzer jedes Mal zuverlässig auf die Palme, so dass er ihnen fluchend hinterherrennt. Mame wird allmählich auch ärgerlich. Warum musste er sie ausgerechnet zu diesem Laden führen? Er kam ihm eben als Erstes in den Sinn.
Jetzt schaut er hinein. Der Besitzer sitzt hinter der Theke; die dicken Augenlider in der tiefen Nachmittagssonne halb geschlossen, hebt er warnend die Fliegenklatsche. Isaacs Gesicht kennt er und nennt ihn den kleinen rothaarigen Nichtsnutz.
»Sie ist nicht da«, stellt Isaac fest.
»Wo ist sie denn dann?«, fragt Mame. »Weißt du, wo sie wohnt?«
»Nein, Ma.«
»Glaub ich dir nicht!«
»Ma, sie war hier, hier hat sie ihn mir geschenkt, ich…«
Er hält inne, weil er jemanden hinter seiner Mame sieht. Die Frau will zum Churu-Laden, dort kaufen sie und die [41]anderen manchmal ein. Er hatte nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen, doch nun überquert sie die Straße, und Mame dreht sich um und folgt seinem Blick. Es ist weder Auntie Peaches noch Marie. Es ist Auntie Sookie.
»Was guckst du so?«
»Ach, nichts.«
»Wen siehst du? Was?«
In dem Moment tritt er vor und winkt – er kann nicht anders. Auntie Sooki neigt den Kopf und legt eine Hand an die Stirn, um ihn im blendenden Gegenlicht erkennen zu können. Er ruft, automatisch im Coloured-Afrikaans: »Allo daar Auntie!«
Da erkennt sie ihn und hebt den anderen Arm. Mitten auf der Straße bleibt sie stehen und lässt die Fahrräder, Studebakers und Chevys an sich vorbeiziehen. Als sie weg sind, sieht er ihr breites Grinsen, und sie ruft mit heiserer Stimme: »Allo, Issy! Wie geht’s, mein Junge? Geht’s dir gut?«
Isaac will schon auf sie zulaufen, als seine Zähne aufeinanderschlagen und sein Kopf nach hinten gerissen wird. Mames Finger graben sich in seinen Arm, und dann stürmt sie so schnell von hier weg, dass sie ihn regelrecht hinter sich herschleift und der Hund am Strick aufjault, weil er nicht Schritt halten kann. Isaac denkt: nicht weinen, bloß nicht weinen! Mr.Epsteins Gesicht huscht vorbei, die neugierigen Augen weit aufgerissen.
Kurz darauf überqueren sie die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, als sei Stehenbleiben verboten. Mame behält das Tempo bei und verlangsamt ihre Schritte kein einziges Mal auf dem ganzen Weg nach Hause.
[42]Abendessen gibt es heute später. Isaac sitzt mit Mame in ihrem Zimmer. Die Tür ist geschlossen, und sie spricht leise, aber sehr energisch. Dabei umfasst sie sein Kinn, damit er ihr in die braunen Augen sieht. »Sag es noch mal«, befiehlt sie.
»Auntie Peaches hat mir den Hund geschenkt.«
»Die Mutter deines Freundes.«
»Sie ist Skots’ Ma. Beim Churu haben wir Auntie Sooki gesehen. Ich glaube, sie ist die Schwester von Auntie Maggie, von Charlies Ma.«
Ein tiefer Atemzug, ihre Brust hebt sich. »Jetzt hör mir mal gut zu. Diese Frauen sind nicht deine Aunties. Du hast richtige Tanten. Diese Frau ist eine Farbige!«
»Ich weiß, Ma, das hast du schon gesagt.«
»Hör zu. Farbig heißt: zur Hälfte schwarz. Kaffee im Blut. Wir sind Weiße. Wir sind Juden, aber hier sind wir Weiße. Wenn die Leute dich mit Farbigen sehen und hören, wie du von Aunties redest, die farbig sind, denken sie, dass wir vielleicht auch Kaffee im Blut haben. Verstehst du?«
»Ja, Ma.«
»Sag nicht immer nur: Ja, Ma. Hör zu. Wir sind Weiße wie alle anderen auch. Niemand darf glauben, wir hätten Kaffee im Blut. Das ist gefährlich, verstehst du mich?«
»Ja, Ma.«
Sie starrt ihn an, in ihn hinein, so lange, dass er anfängt zu zittern. »Wer ist dieser Skots?«
»Ich gehe manchmal zu ihm nach Hause. Wir spielen miteinander. Mit unseren Freunden.«
»Wo wohnt er?«
[43]»In den Yards.«
Ma schweigt lange. Ihr Atem pfeift ein wenig in der Nase. »Du gehst in die Yards? Gehst du zu ihnen nach Hause?«
Er zittert und will sie nicht ansehen, doch sie hat sein Kinn fest im Griff. »Sieh mich an, Isaac! Du darfst nicht zu diesen schmutzigen Leuten in den Yards gehen! Niemals! Du könntest getötet werden! Diese dreckigen Yards! Du bringst Krankheiten nach Hause, du ruinierst noch unsere Familie!«
Er hält es nicht mehr aus, die Tränen fließen, begleiten sein Schluchzen. Da zieht ihn Mame an sich, küsst ihn auf den Kopf, auf die Stirn. Ihre Lippen sind auf einer Seite rauh. »Mein guter Junge«, flüstert sie ihm ins Ohr, »mein guter, lieber Junge. Ich wünschte, du würdest deine richtigen Tanten kennen, es zerreißt mir das Herz, dass du deine eigenen Verwandten nicht kennst! Tante Trudel-Sora, Tante Orli, Tante Friedke, deinen Onkel Pinchus und deinen Onkel Schlayma, Tante Dwora und Tante Rochel-Dor. Deine Cousins. Die Familie, das Wichtigste auf der Welt.«
»Es tut mir leid, Mame«, schluchzt er auf Jiddisch. »Es tut mir so leid!«
»Ich weiß, mein Junge, mein Schöner.«
Sie zeigt ihm die Alben mit den Schwarzweißfotos, Bilder von Frauen, an die er sich nur noch verschwommen erinnert. »Das sind deine einzigen Tanten. Dein Vater, Gott segne ihn, hat niemanden mehr. Rede nie wieder von irgendwelchen anderen Aunties.«
Sie sitzt neben ihm auf dem Bett und blättert die steifen Seiten um. »Das ist Rochel-Dor. Das ist ihr Ehemann [44]Benzil. Das ist dein Großvater Salman, Friede seiner Seele. Er war der Metzger im Dorf und ein Thoragelehrter, weißt du noch? Das ist bei der Brücke…«
Sie lässt ihn den Finger unter jedes schwarzweiße Gesicht legen und fordert ihn auf, die dazugehörigen Namen zu sagen, die Namen der Onkel, Cousinen und besonders der Tanten.
»Orli. Friedke. Trudel-Sora.«
»Sag die Namen. Sprich sie laut aus.«
»Rochel-Dor. Dwora.«
»Eines Tages werden sie hier bei uns sein. Wir werden in einem Haus wohnen, und sie können bleiben, solange sie wollen. In unserem eigenen Haus werden wir selbst entscheiden, wer bleiben darf, nicht dieser elende kleine Schleicher von Greenburg, der jeden Monat nach seiner Miete giert, diese Pest von einem Menschen.«
»Ja, Mame.«
Tate klopft wieder an die Tür. »Gitelle, unsere Tochter hat Hunger. Ich habe Hunger.«
»Ich komme«, antwortet sie. »Gleich. Das hier ist wichtiger.«
Vom Küchentisch aus kann Isaac den Hund sehen. Er ist draußen neben dem Wassernapf angebunden, den er ihm hingestellt hat. Mame folgt seinem Blick, während sie dünne Scheiben Rinderbrust mit Kürbispuffern und Kartoffelbrei aufträgt. Rively stellt Tate eine Frage über Gott. Sie will wissen, ob Gott manchmal mit den Leuten in der schul redet. Tate nickt ganz langsam. »Ja, aber du musst gut zuhören können, denn Gott flüstert.« – »Hast du ihn gehört, [45]Tate?« – »Natürlich, ich höre ihn die ganze Zeit.« – »Wann, Tate?« – »Zum Beispiel heute bei der Arbeit.« – »Was hat er gesagt, was hat er zu dir gesagt, Tate?« – »Er hat gesagt, was er immer sagt, dass er auf uns aufpasst.« – »Warum redet er nicht mit mir, Tate?« – »Das tut er, aber du musst ganz ruhig sein, um ihn hören zu können. Meine Gedanken schweigen nur, wenn ich bete oder arbeite.« Er streckt die langen Finger in die Luft und wackelt mit ihnen wie ein Insekt, das auf dem Rücken liegt. Rively kichert. »Wenn meine Finger bei der Arbeit für mich sprechen, wird mein Herz still, und auch mein Kopf, und dann höre ich ihn manchmal flüstern. Es steht geschrieben, dass das Flüstern Gottes die Welt erhält. Das Flüstern liegt allem zugrunde, das Flüstern ist immer da, denn wenn es je verstummt, erlischt die Welt wie eine Kerze.« – »Tate, ich möchte ihn gerne flüstern hören!« – »Das wirst du, mein schönes Mädchen. Du musst nur ein gutes Herz haben und das tun, was du gern tust, mit einem guten Herzen. Dann hast du alles, was du auf der Welt brauchst.«
Mame schnalzt fast böse mit der Zunge, um Isaac daran zu hindern, aus dem Fenster zu sehen. Sie nimmt Platz, und alle fangen an zu essen. Nur Tate murmelt vorher den Segen, und Rively wartet zögernd, bis er geendet hat. »Geschmak number vun«, sagt Tate nach dem ersten Bissen. Geschmack Nummer eins: ein Zitat aus einem alten Witz über eine dicke Frau am Muizenberg-Strand, den Isaac nie verstanden hat. Mame überhört es und sieht Isaac unverwandt an. Sie beginnt, über die Klugen und die Dummen zu reden. Die Dummen, die arm und ohne Hoffnung wie Packesel leben, und die Klugen, die Erfolg haben wie [46]Mr.Jackman, der mit einem Karren auf der Beit Street begonnen hat und jetzt das größte Kaufhaus in ganz Afrika besitzt, einen ganzen Block hier in der Stadt. Daran können sich alle ein Beispiel nehmen. Die Klugen, wie die Männer, denen die Goldminen gehören. Mr.Barney Barnato sei ein armer Jude gewesen, der bei seiner Ankunft in Afrika nichts als Staub in den Taschen gehabt habe, und man denke bloß an Sammy Marks, die Joels, die Beits, Mr.Hersov und den großen Mr.Oppenheimer. »Jetzt sind sie die reichsten Männer der Welt! Jeder einzelne Diamant auf der Welt wandert durch ihre Hände und der größte Teil des Goldes.«
»Stimmt«, bestätigt Tate schmunzelnd, »aber ob sie auch so gut essen wie wir? Nein, bestimmt nicht. Und wie viele Paar Schuhe können sie auf einmal tragen? In wie vielen Betten können sie schlafen? Wie glücklich sind ihre Kinder?«
Mame schnalzt wieder gereizt mit der Zunge. »Für einen Klugen«, erwidert sie, »ist alles möglich. Für einen Dummkopf dagegen ist das Leben elend.«
Wenn sie so redet, weiß Isaac, dass sie gleich wieder mit dem Haus anfangen wird, dass sie ein Haus brauchen, oben in den Vorstädten im Norden, ein eigenes Haus für sich allein, das der Familie gehört, doch sie überrascht ihn. Sie lächelt ihr einseitiges halbes Lächeln und klopft mit dem Servierlöffel gegen die Schüssel mit dem Kartoffelstampf. »Nun, Isaac«, sagt sie mit ihrer tiefen, liebevollen Stimme, »sag uns: Wenn jemand ein schmutziges Tier loswird, das Krankheiten bringt, Futter kostet, stinkenden Dreck hinterlässt, den man jeden Tag wegräumen muss, das, Gott bewahre, Kinder beißen kann, gehört der dann nicht zu den [47]Klugen? Und wenn ein anderer dieses Tier aufnehmen muss, krank wird, den Dreck wegräumen und für das Futter bezahlen muss, ist dieser Mensch nicht ein Dummkopf? Nu, sog mir!«, drängt sie. »Sog mir der richtige emeß.« Sag mir die richtige Wahrheit.
»Ja, hey, Isaac!«, fällt Rively ein. »Sag es uns!«
Isaac schneidet seiner Schwester eine Grimasse, doch nach einer Weile sieht er ein, dass seine Mutter recht hat. Er schaut nicht mehr zum Fenster hinaus. Er will wie Mr.Jackman sein, der zu den Klugen gehört, und wenn Mr.Jackman keinen Hund hat, wie seine Mame immer sagt, dann will er auch keinen. Die Logik seiner Mutter ist so wasserdicht wie der violette Rumpf eines Union-Castle-Linienschiffs: Der Hund verursacht Ausgaben und Ärger, und man kann nichts mit ihm anfangen, im Gegensatz zu einer Kuh, die Milch gibt (wie die wunderschöne Kuh namens Baideluh, die sie zu Hause hatten und von der Tate immer erzählt). Man muss ein Kluger sein, und heute hat er gehandelt wie ein Dummkopf.
Draußen fängt der Hund an zu heulen, ein aufsteigendes Wuhuu, das in den höchsten Tönen abbricht und dann mit anschwellendem Winseln erneut beginnt.
»Siehst du?«, sagt Mame. »Siehst du, was er jetzt schon für Schwierigkeiten macht?«
Nach dem Abendessen gehen Isaac und seine Mutter zum Hund hinaus. Mames energische Bewegungen verraten, dass sie bereits einen Plan für ihn hat. Isaac sieht zu, wie sie die Leine von dem Haken an der Wand löst, doch als sie daran zerrt und der Hund mit hängendem Schwanz japst, [48]rennt Isaac zu ihm hin, kauert sich über ihn und drückt das warme kleine Wesen eng an sich. »Ich hab ihm noch nicht mal einen Namen gegeben.«
»Isaac! Reg mich jetzt bloß nicht auf! Geh mir nicht auf die Nerven! Sei brav!«
»Ich bin brav, Mame, ich bin brav!«
Als er aufblickt, sieht er sie mit schnellem Schritt zum Nähzimmer gehen. Plötzlich hat er Angst, dass es wieder endet wie bei den Sofahockern: O nein, sie macht es wie mit den Sofahockern! Er ruft, so laut er kann, lässt den Hund los und rennt mit ausgebreiteten Armen hinter ihr her. »Nein, Mame, nein! Tu’s nicht, Mame!«
Mame schaltet das Licht in der vollgestellten kleinen Hütte ein und dreht sich mit wildem Blick zu ihm um. »Warum gehst du mir auf die Nerven? Sei still.«
»Das darfst du nicht, Mame!
»Was darf ich nicht? Was schreist du so?«
Im Sprechen greift sie hinter einen abgesplitterten Klapptisch und zieht aus einem Versteck eine Flasche Brandy heraus, dann eine zweite. Isaac hört auf zu schreien und lehnt sich gegen die Wand.
»Was ist?«, fragt Mame. »Was hast du denn?«
Er antwortet nicht, sondern beobachtet wortlos, wie sie die Flaschen in Zeitungspapier wickelt, damit sie in ihrer Handtasche nicht klirren. Sie hängt die Tasche an ihren runden Arm und sagt mit vorgerecktem Kinn: »Vergiss deinen kleinen Freund nicht.«
Isaac dreht sich um, und da steht der kleine Hund und schaut ihm ins Gesicht. Mame kommt heraus, nimmt den Hundestrick und gibt ihn Isaac in die Hand. Als sie [49]losmarschiert, bleibt er reglos stehen. Sie hält inne und blickt zurück. »Isaac.«
Er folgt ihr und der Hund ihm. Beide mit hängenden Köpfen. Okay, oright, ja: Der Hund wird nicht bleiben. Isaac hat aufgegeben. Als er sie so zum Nähzimmer stürmen sah, weckte das die schreckliche Erinnerung an jenen anderen Tag, drastisch und real genug, um jeglichen Protest in ihm zu ersticken. Mehr noch.
Alte Teppiche über durchgesessenen, nach Rauch und Schweiß stinkenden Polstern auf einem Gestell: Das war das »Sofa« an einer Wand der Werkstatt gegenüber von Tates Werkbank. Für Isaac verkörperte es die Geborgenheit, die von den gebeugten Männern darauf ausging, von ihren angegrauten Gesichtern, den haarigen Händen. Er liebte es, ihnen zuzusehen, wie sie sich Chateau-Brandy einschenkten und mit ihren Taschenmessern eingelegten Fisch aßen oder fettige Stücke von Goldenbergs koscherer Fleischwurst oder von salzigen, knusprigen Biltong-Laiben abschnitten. Wie sie über die Artikel der überall verstreuten Zeitungen diskutierten. Wie sie ihm beibrachten, Klaberjass mit eselsohrigen Karten zu spielen, die Frauen in Badeanzügen zeigten (sie knallten die Karten hin und riefen dabei Schtoch! Yus! Menel!), und wie sie ihre ovalen türkischen Zigaretten rauchten, die sie in dem Kreis zwischen Daumen und Zeigefinger hielten.
Manchmal blickte Isaacs Vater von seiner Werkbank auf und murmelte einen Kommentar zu ihren schleppenden Debatten. Er sprach nie viel.
Feivel, der Simpel, hatte vorne eine Zahnlücke und [50]konnte so die Nase mit der Zungenspitze berühren. Kaplan beugte sich immer wieder zur Seite und spuckte schwarzen Glibber in eine Untertasse, die stets neben seinem linken Fuß stand. Mandelbaum hatte gar keine Zähne mehr und kaute nur mit dem Zahnfleisch, Erdnüsse und sogar Mames tejgluch – in Sirup getränkte, steinhart gebackene Krapfen–, wobei er Isaac zuzwinkerte und ihn zum Kichern brachte. Sie waren vom alten Schlag, und ihre rauhen Stimmen trugen ihm die Weisheit der engen Gassen zu aus vergangenen Zeiten und entschwindenden Orten. Ihre Hüte auf dem Hinterkopf, meisterten sie das Leben mit spitzen Ellbogen und pfiffen ahnungsvoll aus dem Mundwinkel. Schaben, Überlebende, die sich zu retten wussten. Immer zu einer kleinen, freundschaftlichen Rauferei bereit. Jede ihrer Geschichten endete mit einem Witz. Sie besaßen jene seltene Fähigkeit, über alles zu lachen, allem eine doppelte Bedeutung zu verleihen, die Isaac nie ganz zu fassen bekam, aber stets spürte. Und wenn sie lachten, warfen sie den Kopf zurück, und die Couch quietschte und ruckelte. Der furzende Ellenbogen, dieser Gauner. Yishi Strudz mit seinen Zaubertricks mit Taschentuch und Löffel. Der dunkle Leitener, dieser Kraftmeier, der mit einem Tropfen Schwitz an der krummen Nase Hufeisen verbiegen konnte.
Wenn sie lachten, fiel Isaac auf, dass ihre traurigen, verhangenen Augen sich nicht veränderten, die Gesichter fahl, die Tränensäcke geschwollen. Und immer endete das Lachen in einem Seufzer und einem Kopfschütteln. Dann begannen sie wieder, von dahajm zu reden, den alten Zeiten zu Hause. Den Wäldern und den Verwandten.
Isaac beobachtete sie, wie sie heißen Tee aus Gläsern [51]oder kleinen Schalen schlürften, wie Tee aus dem Hahn eines zerbeulten Messingsamowars auf rauchende Kohlen tropfte. In den dampfenden Gläsern schwammen ein Klecks Aprikosenmarmelade auf dem Boden und ein Zitronenschnitz an der Oberfläche. Die Art, wie sie die dampfenden Tassen zum Mund hoben, die vorsichtigen Schlürfgeräusche durch die gespitzten Lippen – je länger das Schlürfen, desto größer die Zufriedenheit–, dann der tiefe Seufzer, wenn der heiße Tee in den Magen rann. Überbleibsel aus einem Land, in dem es Schnee gab und die Finger in der Kälte steif wurden. Wo kam diese gebeugte Haltung her? Isaac kannte sie nur vom verschwimmenden Teil am Rande seiner fernsten Erinnerung. Irgendeine alte Welt, nach der sich ein Teil von ihm noch immer sehnte.
Die Sofahocker. Von ihnen ging eine intensive menschliche Wärme aus, und Isaac hätte den ganzen Tag vor ihnen sitzen können wie vor einem Kamin im Winter, wenn Mame nicht gewesen wäre. Und er wusste, dass sein Vater dieselbe Wärme spürte. Es war so viel besser, als allein zu arbeiten, einsam, nur in Gesellschaft des kalten Tickens der unumkehrbaren Zeit.
Sie gehen die Gasse hinunter. Eine Mutter, ein Junge und ein Hund. Die Nacht ist hereingebrochen, als wäre plötzlich ein Vorhang gefallen: die afrikanische Nacht. Ein Wind trägt Minenstaub heran, pudert die Wäsche an den schwankenden Leinen, bringt Mutter und Sohn zum Blinzeln und dazu, sich über das Gesicht zu wischen. Der Wind kratzt und zischt über die Wellblechdächer von Doornfontein. Der weiße Hund will nicht mitgehen, so dass Isaac hin und [52]wieder an dem Strick zerren muss. Es ist leichter, wenn er sich nicht umblickt. Sie trotten den ganzen Weg bis zur Eisenbahnbrücke. Der Bluterguss auf Isaacs Rücken schmerzt.
Seine Mutter sagt nichts. Sie blickt hinüber auf die andere Seite, während sie warten, und er beobachtet, ebenso schweigend wie sie, die vernarbte Seite ihres Gesichts.
Es geschah nicht aus heiterem Himmel; sie hätten alle gewarnt sein müssen.
War Isaac in der Küche, wenn sie von den Sofahockern zurückkehrte, die Arme voller schmutziger Teller und Tassen, um neues Essen für sie zu holen, hörte er, wie sie leise vor sich hin fluchte, so wild und böse, dass es ihn verunsicherte. Parasiten und faulen Abschaum nannte sie sie. Und wenn sie seinen Blick erhaschte, hielt sie ihm eine geflüsterte Predigt: Was sie genau mit »Parasiten« meinte, wie diese Sofahocker eines Tages das ganze Haus um sie herum wegfressen würden, so dass sie, die Familie, auf der Straße leben müssten wie halbverhungerte streunende Tiere, war das vielleicht richtig? Ob einer von denen dann auch nur einen Finger krumm machen würde, um ihnen zu helfen? »Sag es mir, würden sie das?« Isaac nickte daraufhin, aber er konnte sich wirklich nicht vorstellen, wie die Männer das Haus wegfressen würden. Wenn er an die Sofahocker dachte, war ihm nur zum Lächeln zumute, und sie taten ihm ein wenig leid mit ihren Tränensäcken und ihren wässrigen Augen. Schon allein der Gedanke an das Sofa gab ihm ein gutes Gefühl, und er lag gern auf den Schichten aus abgewetzten Teppichen mit ihrem intensiven, männlichen Geruch, dem einzig Weichen in der Werkstatt.
[53]Mame sagte ihm immer wieder, wie die Sofahocker Tates großzügige Geschenke und seinen arbeitsamen Fleiß ausnutzten, denn sein Vater sei ein Handwerker und Gentleman mit einem goldenen Herzen. Nur sei er allzu gut, zu gut für diese Welt. Er erkannte einfach nicht, was die Sofahocker der Familie antaten, weil der goldene Schein seines eigenen Herzens ihn blendete.
Wenn sie so sprach, verengten sich ihre Augen zu Schlitzen, und das Narbengewebe leuchtete feuerrot. Dann erwachte das gefährliche Tier in ihr. Isaac wusste, dass es immer da war, er stellte es sich wie eine Löwin vor, die in einem Sack gefangen war. Er wusste es, weil er an dem Tag in der Küche gewesen war, als sie endgültig genug von den Sofahockern gehabt hatte, genug! Keine Fleischwurst, keinen eingelegten Fisch und keinen Alkohol mehr für diese Blutsauger, diese schmarotzenden Termiten! Als sie an jenem Tag durch die Küchentür gestürmt kam, hielt Isaac sie für sie auf und sah zu, wie sie die Teller hinknallte und hinaus in den Hinterhof marschierte.
»Mame?«
Er beobachtete, wie sie ganz ruhig und bestimmt durch die offene Tür ins Nähzimmer trat und die gebrauchte Axt holte, die sie erst in der Woche zuvor gekauft hatte.
»Mame?«
Doch ihre Augen waren nur noch Schlitze, als würde sie schlafwandeln, und die Narbe leuchtete rot in ihrem Gesicht. Sie durchquerte die Küche, als wäre er gar nicht da. Von der Tür aus beobachtete er, wie sie sich vor den Sofahockern aufbaute. Sie hielt die Axt mit beiden Händen hinter ihrem Rock verborgen: eine seltsam scheue Haltung, [54]doch ihre Stimme war so tonlos und kalt, dass Isaacs Vater sofort von seiner Arbeit aufblickte, obwohl sie ganz leise sprach. Er wusste, was er wusste. Gnade denen, die es nicht wussten. »Jetzt ist Schluss«, sagte sie zu den Männern. »Das Lotterleben hat ein Ende. Raus hier.«
Doch sie ließen sich von ihr den Spaß nicht verderben. Schmulkin war an jenem Tag da, und er beugte sich nach vorn, um sie mit erhobenem Zeigefinger und einem zugekniffenen Auge zurechtzuweisen. Kaplan fragte, wo sein Aschenbecher blieb. Taych zeigte ihr eine leere Flasche, weil sie ihm eine neue bringen sollte. Einer rülpste, und ein anderer – zweifellos Ellenbogen – ließ leise einen fahren. Ihre Stimmen waren allesamt heiser und schleppend vom Alkohol und dem fettigen Essen, ihr Gelächter ein grobes, unrasiertes Poltern.
Nicht, Mame!, dachte Isaac. Lass sie, die armen, traurigen Sofahocker. Tu ihnen nicht weh, Mame!