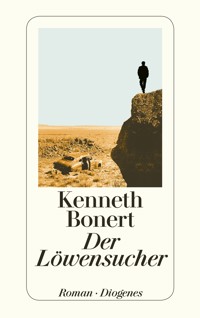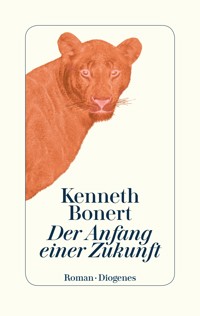
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martin Helger, 16, mogelt sich durch eine jüdische Eliteschule in Johannesburg, die sein im Schrotthandel reich gewordener Vater Isaac finanziert. Da bekommt die Familie Besuch aus den USA. Annie ist die ungewöhnlichste junge Frau, der Martin je begegnet ist. Offiziell ist sie Lehrerin in den Townships, undercover aber Anhängerin Mandelas, und sie reißt Martin mitten hinein in den gärenden Konflikt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kenneth Bonert
Der Anfang einer Zukunft
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für Nicole
»Es ist eine quälende Wahrheit, um nicht zu sagen eine Tragödie, dass die Geschichte einer Familie oder einer Nation nichts weiter als eine Folge von Echos ist. Alle menschlichen Muster wiederholen sich, alle kehren zurück, überlagern sich und repräsentieren, was bereits gewesen ist – nur die Art jeder Wiederholung variiert möglicherweise. Ein uralter Text mag von unterschiedlichen Akteuren neu interpretiert werden, doch das existentielle Drama liegt weiterhin zugrunde, so unverrückbar wie das Gestein des Ortes, an dem es sich vollziehen muss, wieder und wieder. Alles, was sich dem entgegenstellt, ist die schwache Waffe der Erinnerung, so zerbrechlich wie ein Gespinst aus Träumen.«
Aus: ›A Light for the Abyss‹ von H.R. Koppel
»La haine est le vice des âmes étroites, elles l’alimentent de toutes leurs petitesses, elles en font le prétexte de leur basses tyrannies.«
»Der Hass ist das Laster der kleinen Seelen; sie füttern ihn mit all ihren Nichtigkeiten und nutzen ihn als Vorwand für ihre Niedertracht.«
Aus: ›La Muse du Département‹ von Honoré de Balzac
Anmerkung für die Leserinnen und Leser
Hinweis an die Leser
Am Ende des eBooks befindet sich ein Glossar mit einer Erklärung zu südafrikanischen und jiddischen Wörtern sowie ihrer Aussprache.
Weder die Township Julius Caesar noch die Vorstadt Regent Heights sind auf dem Stadtplan Johannesburgs zu finden. Es handelt sich um fiktive Orte, die auf der Phantasie des Autors beruhen. Die in diesen Gegenden befindlichen Schulen, die Leiterhoff-Schule sowie die Wisdom of Solomon Highschool für Jungen, sind ebenfalls reine Erfindung. Es bedarf kaum noch der Erwähnung, dass auch die Personen, die diese fiktionalen Orte bevölkern, Phantasieprodukte des Autors sind, ebenso wie alle anderen Charaktere in diesem Roman.
Der Name
Sie sind hier! Mitten in der Nacht, mit ihren hohen Stiefeln und Maschinengewehren, ihren Stahlhelmen und Hunden an Ketten. Raus! Juden raus! Alle Juden raus! Schnell!!, brüllt jemand durch ein Megaphon. Ich reiße meine Tür auf und renne den Flur hinab, und sie fallen über unsere Gartenmauern wie riesige Schlangen. Es kracht, sie sind an der Haustür, Splitter fliegen umher, ein Vorschlaghammer zertrümmert die Mesusa am Türrahmen. Mein Bruder hat es rausgeschafft, aber er kniet in der Unterhose draußen auf dem Rasen im Scheinwerferlicht, die Hände hinter dem Kopf. Regen rinnt über sein gesenktes Gesicht. Jetzt hört man das Splittern von Glas aus dem Elternschlafzimmer, meine Mutter schreit, und ich drehe mich um und renne durch die Küche zur Hintertür. Der Garten ist leer. Ich muss nur den hinteren Zaun erreichen, darüberklettern und fliehen. Doch als ich den Türgriff berühre, erstarre ich.
Zaydi.
Sie sind noch nicht bis zu Zaydi vorgedrungen, zu seinem Zimmer am anderen Ende des Hauses. Die Megaphon-Stimme brüllt unablässig: Juden raus! Alle Juden raus jetzt!
Sie sind drinnen. Aber Zaydi. Ich muss zurück.
1
Ich spiele Slinkers wie immer, und dann passiert was Komisches – ich gewinne! Ich sammle Punkte rechts und links, ohne dass die anderen mich aufhalten können. Mein Herz hüpft wie ein Knallfrosch, und wann immer die Kappe meines polierten Jarman-Schuhs den Slink berührt, fliegt er genau dahin, wo ich ihn haben will. Ich fange an zu kichern wie ein Verrückter. Währenddessen sind Pats und Ari ganz still und ernst geworden. Sie sehen mich nicht an.
Slinkers ist ein Spiel, das wir selbst erfunden haben, eine Kombination aus Fußball, Billard, Golf und Schach. Aber es macht eine Million Mal mehr Spaß als jedes dieser Spiele, ich schwör’s. Es ist einfach das Beste, hey. Ich kann gar nicht erklären, wie gut. Eines Tages werden wir die Idee dazu verkaufen, und wenn die Leute es erst mal ausprobiert haben, wird es größer als Rugby, kein Witz. Ich und Ari Blumenthal und Patrick Cohen – ehrlich gesagt haben wir damit angefangen, weil die Schul so scheißlangweilig ist. Entweder man sitzt da und singt irgendwas auf Hebräisch, oder man steht nur rum, bis einem die Füße weh tun. Der dicke Rabbi Tershenburg leiert sein Blabla herunter. Es dauert Stunden, und danach gehen alle ins Foyer, und die Frauen mit ihren Hüten kommen von der Frauengalerie runter, küssen ihre Ehemänner, a gutn schabeß, und sammeln ihre Kinder ein. Dann strömen alle hinüber in den Kidesch- Saal, wo sie von Papptellern dünne, knusprige Kichel und Hering futtern und Cola und Fanta aus kleinen Flaschen in sich hineinschütten. Wir nicht. Unsere Familien gehen am Sabbat nicht in die Schul. Wir haben aber die Kronkorken dieser kleinen Flaschen gesammelt und die Oberseite wie verrückt auf den grauen Stufen draußen gerubbelt, wie um sie in Brand zu setzen, damit sie ganz silbern und glatt wurden. Wenn einer fertig ist, ist er ein Slink.
Während sich die Gemeinde im Foyer versammelt, warten wir drei mit Hummeln im Hintern, aber möglichst ohne uns etwas anmerken zu lassen, die Taschen voller Slinks. Sind die Leute alle weg, kommt der alte Wellness reingehumpelt, der Zulu-Hausmeister, und schaltet einen nach dem anderen die großen Bronzeleuchter aus. Wenn der letzte erloschen ist und wir Wellness davonschlurfen hören, springen wir drei rein und beginnen mit unserem Match. So geht es jede Woche. Das Muster auf dem Marmorfußboden ist unser Spielfeld mit Linien und Toren. Slinkers ist ganz schön kompliziert, hey. Es gibt eine Million Sonderregeln. Pats sagt immer, das Schwerste ist nicht, ein Tor zu schießen, sondern erst mal zum Tor hinzukommen. Okay, aber nicht für mich! Nicht heute! Ich versenke schon wieder einen Treffer, aus der Luft, und muss so kichern, dass ich mich hinlegen muss. Als wir mit der nächsten Runde anfangen, trifft es mich plötzlich wie ein Haken in die Leber (Marcus nennt das »mexikanischer Korkenzieher«), dass ich auf dem besten Weg bin, das ganze verdammte Match zu gewinnen. Ich sehe meine Freunde an. Sie würdigen mich immer noch keines Blickes. Kein gutes Gefühl. Im Grunde habe ich nämlich nur diese beiden Freunde, okay, meine Schul-Freunde. Echt, das war’s. Ich denke nicht gern darüber nach, warum das so ist, aber es ist die Wahrheit.
Ich kann Pats’ Slink nicht abblocken und verliere deswegen den nächsten Punkt. Und dann noch einen. Jetzt fangen meine Freunde wieder an zu lächeln und zu plaudern. Schon bald streiten wir uns. Wir streiten uns ständig. Momentan geht es um unsere Luftwaffe und dass wir Mirage-Kampfjets haben und ob die besser sind als die kubanischen Migs, gegen die wir an der angolanischen Grenze kämpfen. Die Mirages hat Israel im Sechstagekrieg eingesetzt, aber die Migs wurden von einem Juden konstruiert. Ari meint, die Mirages wären besser. Pats sagt, das ist Quatsch. Ich sage, was mein Bruder Marcus mir sagen würde, nämlich, dass es von dem Modell abhängt, das die Kubaner im Kampf gegen uns einsetzen, weil unsere Mirages ziemlich alt sind und keiner uns neue verkauft wegen der Sanktionen. Schon bald schreien wir uns an, wie immer. Das Geschrei hallt unter dem Dach wider, das kuppelförmig ist wie das Innere von so einem Haartrocknerhelm, unter dem alte Damen sitzen, nur ist es hier total dunkel, wenn das Licht nicht brennt. Am Ende verliere ich die Diskussion, wie immer. Dann verliere ich noch mehr Slinkerspunkte, und je mehr ich verliere, desto mehr lachen die anderen und klopfen mir auf den Rücken. Und dann verliere ich das Match, wie immer. Und dann verliere ich den Streit, welchen Weg wir zu Pats nach Hause nehmen sollen. Letztlich werde ich immer Dritter von dreien hinter meinen beiden Freunden. Das ist mein Platz. Aber heute frage ich mich zum ersten Mal allen Ernstes, warum.
2
Wir gehen zu Pats Haus auf der Route Alpha Kilo Leopard. Wir haben Codes für alle unsere Wege. Manchmal streiten wir uns darüber, wie lange wir durchhalten würden, wenn man versuchen würde, uns unter Folter unsere Codes zu entlocken. Die Wetten stehen zwei zu eins, dass ich als Erster reden würde, aber wir sind uns alle drei einig, dass die schlimmste Folter ist, wenn sie einem Nadeln in die Eier stecken. Wir gehen zu Fuß, klar, weil man am Schabbes nirgendwohin fahren darf – das ist gegen die Thora –, deswegen wäre es Chuzpe de luxe, vor der Synagoge mit einem Auto aufzukreuzen. Der alte Meyerson hat das mal gemacht, hat sich von seinem Sohn Neil hinfahren lassen, und jetzt redet keiner mehr mit ihm.
Gegen eins oder so erreichen wir den Emmarentia-Damm, und der Wind kühlt mein Gesicht in der heißen Sonne. Das Wasser glitzert und schlägt kleine Wellen. Die Angler befestigen Kugeln aus matschigem Brot an den Angelschnüren, damit sie vom Boot aus die Haken erkennen können. Kajakfahrer paddeln wie wild, und Windsurfer fallen vom Brett, klettern wieder rauf und bücken sich, um ihre schweren Segel hochzuziehen. Der Eismann verkauft rundes Granatapfel-Stieleis, dick wie Kricketbälle, und ruft: »Zuckerwatte, Zuckerwatte, wer möchte Zuckerwatte?« Wir gehen am Straßenrand neben den geparkten Autos entlang. Überall liegen am grasbewachsenen Ufer Leute mit ölig glänzender Haut auf Handtüchern. Weiße, die versuchen, braun zu werden. Die afrikanische Sonne kocht sie mit Vergnügen windelweich. Ich rieche Kokosnuss-Sonnencreme, Babyöl und Würstchenrauch. Die Luft schlägt Wellen über der heißen Straße. Aus einem geparkten Auto dröhnt: »Do you really want to hurt me« von Boy George aus dem Radio, und ich denke an den Sänger mit Hut und Mädchen-Make-up in der Sendung Pop Shop, die wir zu Hause immer aufnehmen – freitags um fünf. Ich weiß noch, dass der eine Typ, wie heißt er noch, in Pop Shop gesagt hat, 1986 gehöre dem New Wave, was sich total cool angehört hat, aber ich habe keine Ahnung, wie ein Jahr einer Sache gehören kann oder was New Wave eigentlich bedeutet.
Ein gelber VW Golf, nicht der schnelle GTI, sondern so einer, von dem Da sagt, dass den nur Ladys kaufen, bremst hinter uns. Das macht mich echt nervös, ehrlich. Es ist schon oft passiert, dass jemand hinten aus dem Auto raus was Antisemitisches gebrüllt hat. Ari trägt seine Jarmie, er hat sie im Haar festgesteckt und legt sie nie ab. Er ist gläubiger als wir beiden anderen. Pats trägt seine Jarmie manchmal auch außerhalb der Synagoge, weil er üben will, stolz darauf zu sein, dass er Jude ist. Pats steckt voller solcher bekloppten Ideen. Die hat er von Laurel, seiner Schwester, die Drama an der Wits studiert und schwarze Kerzen in ihrem Zimmer anzündet und so. Doch sogar ich trage natürlich meine Schul-Klamotten, die an einem sonnigen Samstag hier am See total komisch sind – mein bestes Hemd mit langen Ärmeln und Kragen, schicke, braune lange Hosen und meine ledernen Jarmans – das Teuerste, was meine Ma mir je gekauft hat, wie sie immer wieder betont –, und man sieht uns sofort an, wer wir sind, auch ohne Jarmie. Neulich hat jemand gerufen: Jo! Blöde Scheißjuden! Ich sehe noch das Gesicht vor mir, das zum Fenster rausschaute, ein blonder Typ mit Ohrring. Er sah nicht mal böse aus, ja er schien sich sogar zu freuen, als ich ihn anschaute. Als hätte er gerade ein leckeres Erdbeereis mit Schokosauce verspeist. Manchmal frage ich mich, was er gesehen hat, ich meine, wie mein Gesicht für ihn ausgesehen haben muss. Und warum hat es Blondi so Spaß gemacht, uns zu beschimpfen? Aber wir ignorieren es immer, wenn so was passiert. Was sollen wir auch machen? Der gelbe VW fährt vorbei, ohne dass es Probleme gibt, und schon geht’s mir besser. Erleichtert atme ich auf.
Als wir das andere Ufer erreichen, wo die Straße bergauf vom See wegführt, sehe ich hektische Bewegungen in den Weiden am hinteren Ende. Ich muss einfach stehen bleiben und frage: »Hey, habt ihr das gesehen?«
Pats schirmt die Augen gegen die Sonne ab und rümpft seine spitze Nase, während er hinüberspäht. »Wer sind die?«
»Der eine trägt ein Solomon-Rugbyshirt«, sage ich.
»Quatsch«, erwidert Pats.
»Doch, das sind die Farben«, sage ich. »Ich schwöre, er hat eins an. Ein Solomon-Shirt.«
»Na und?«, fragt Ari.
Ich hole tief Luft. »Kommt, wir gehen hin und sagen hallo.«
»Du kennst sie, oder.« Es ist keine Frage; Pats ist einfach nur unheimlich sarkastisch.
»Klar kenne ich die«, sage ich. Manchmal fliegen mir die Lügen einfach wie von selbst aus dem Mund. Pats lacht, und die beiden gehen weiter. Aber ich rühre mich nicht. Ich denke wieder an Slinkers und dass ich kein einziges Match gewonnen habe, seit wir, als wir noch klein waren, damit angefangen haben – bis heute, wo wir schon unsere Barmies hinter uns haben und richtige Männer von dreizehn Jahren geworden sind und demnächst auf die Highschool gehen. Es ist besonders peinlich, weil ich der Älteste von uns bin – Mann, ich werde dieses Jahr vierzehn, schon bald! Also warum konnte ich das Match heute nicht gewinnen, obwohl ich eigentlich nicht mehr aufzuhalten war? Warum muss ich immer Letzter sein? In mir blinkt eine Antwort auf wie ein Warnlicht auf einem Armaturenbrett, eine Antwort, die mir nicht gefällt: weil es sie zufrieden macht.
Mittlerweile sind die Jungs auf der Straße stehen geblieben, schauen zurück und rufen nach mir, als hätte ich mich verirrt. Aber ich bewege mich immer noch nicht. Mein Herz klopft wie wild. »Los, Jungs«, sage ich. »Kommt mit.« Ich gehe auf die Stelle zu, wo sich die Weiden aus dem Gras erheben. Hinten am Ende des Sees steht eine dichte Baumgruppe, fast wie ein Minidschungel, ehrlich.
Als ich mich umdrehe, folgen sie mir tatsächlich. Das ist eine ganz schöne Überraschung, in gewisser Weise, aber dann bin ich plötzlich ganz froh, weil ich will, dass sie das sehen, sehr sogar. Ich will sie mit ihren verdammten Nasen draufstoßen.
3
Ich erreiche die Weiden zuerst. Vorne lassen die riesigen Bäume ihre biegsamen Zweige ins Wasser hängen, und hinter ihnen drängen sich noch mehr Bäume, so dass man wie von einer Mauer geschützt ist. Zigarettenrauch weht mir in die Nase, aber ich kann in den Schatten nichts sehen, denn wenn man aus der hellen Sonne ins Dunkle guckt, wird man sofort zu Stevie Wonder. Ich blinzle noch und versuche, etwas zu erkennen, als drei Typen rauskommen. Sofort warnt mich so ein kribbliges Gefühl, dass ich abhauen sollte, aber Ari und Pats kommen hinter mir her, und dann sehe ich wieder die Farben – die hat nur eine Highschool in ganz Johannesburg. Ein ziemlich großer Typ, der älter ist als wir, fünfzehn oder sechzehn, kommt auf mich zu und zieht eine Zigarette aus dem Mund. Er hat so einen breiten, weichen Mund, bei dem die Lippen ungefähr zwei Nummern zu groß sind für sein Gesicht, und über den Augen hat er einen dicken Knochenwulst, die mich an einen Totenschädel erinnert, nur dass Totenschädel so aussehen, als würden sie breit grinsen, und dieser Typ hat kein Grinsen für mich übrig. Stattdessen sticht er mit seiner heißen Zigarette genau auf mein Auge, echt jetzt! Er trifft nur deshalb nicht, weil ich reflexartig zurückweiche. Als ich mein Gleichgewicht wiederfinde, sehe ich, dass die andern zwei Jungs hinter Pats und Ari stehen – wir sind umzingelt.
»Was macht ihr Milchbubis hier unten?«, fragt Schädelgesicht.
»Ich war – ich hab nur gesehen, dass er das Rugbyshirt von der Solomon trägt«, antworte ich, drehe mich um und deute mit dem Kinn zu dem Typen mit dem Shirt. »Geht ihr alle auf die Solomon? Welche Klasse?« Ich lege mich ins Zeug, grinse die ganze Zeit, aber es wirkt alles falsch, so funktioniert das nicht.
»Ach so, Süßer«, sagt Schädelfratze. Und noch während er das sagt, holt er mit einem Arm aus, und etwas explodiert mit einem lauten Knall auf der ganzen Seite meines Gesichts. Ich bin für einen Moment weg, und als ich wieder zu mir komme, stoßen die drei Großen uns tiefer zwischen die Weiden. Überall liegt Entenscheiße rum, und im dunklen Schlamm unten um das hohe Unkraut am Wasser sind tiefe Sumpflöcher, Millionen von Libellen huschen umher und schweben in der Luft wie winzige Hubschrauber. Keiner sonst ist hier, alle sind draußen in der Sonne auf dem Rasen. Mir wird kalt, und ich fange an zu zittern, aber das liegt nicht am Schatten. Meine eine Gesichtshälfte fühlt sich so dick an wie das blaue Gummi, aus dem Flipflops gemacht werden, und pocht wie verrückt. Ich fühle die rauhe Hand des großen Typen in meinem Nacken, und er packt mich am Kragen. Ich blicke mich um, und er liest das Schild in meinem Hemd. Einer von den anderen fragt ihn: »Was machst du da, Crackcrack?«
Crackcrack sagt: »Der trägt Zeug aus dem OK Bazaar. Ungelogen. Polyester, Sonderangebot aus der Krabbelkiste. Seine Mutter geht auf Flohmärkte. Sie kauft bei den Shochs ein, ich wette mit euch.«
Ich höre, wie Pats mit ihnen diskutiert. Kaum zu glauben, wie ruhig er klingt. Er sagt so was wie, dass wir doch alle Juden seien, sie müssten doch auch welche sein, wenn sie an der Solomon sind, also sollten wir uns doch vertragen. Der mit dem Rugbypulli packt Pats am Kopf und rammt ihn mit der Stirn, als wäre er eine Axt und Pats Kopf das Holz. Pats wird kreideweiß und hört auf zu reden. Ohne mich anzusehen, kneift mir Crackcrack so fest in die Brust, dass ich am liebsten aufgeschrien hätte, aber ich mache keinen Mucks. »Meine Schuhe sind handgemacht und aus Kalbsleder«, sagt Crackcrack. »Ich wette, dein Daddy fährt Toyota. Ich habe meinen eigenen Maserati. Mein Fahrer Edison hat ihn oben geparkt und wartet auf uns. Edison fährt mich, bis ich meinen Führerschein habe. Wir cruisen durch die Gegend, die Mädels gaffen uns an. Und ihr braven Rabbi-Jungs kommt aus der Schul und glaubt, ihr könnt uns anmachen?«
Er zieht mich an der Haut meiner Brust herum, lässt plötzlich los, und ich falle fast gegen den im Rugbyhemd. »Geschenk für dich, Polovitz«, sagt Crackcrack.
»Ich will ihn nicht«, entgegnet Polovitz.
Ich sehe, dass der andere von ihnen Aris rote Jarmie genommen hat. Ich weiß, dass sie ein besonderes Geschenk von seinem Vater war. Ari bedeckt den Kopf mit den Händen und sieht aus, als würde er gleich laut anfangen zu heulen, aber er beherrscht sich und sagt: »Aber ihr verstoßt gegen den Sabbat. Und das nimmt HaSchem sehr übel. Ihr tut mir jetzt schon leid, wenn ich dran denke, was er mit euch machen wird.« Alle erstarren einen Augenblick lang. HaSchem ist ein starkes Wort, ein Schul-Wort. Es ist hebräisch und bedeutet »der Name«, weil der wahre Name G-ttes nicht genannt werden darf, nur geschrieben, in heiligen Texten wie der Thora.
Crackcrack packt Ari am Ohr. »Süßer«, sagt er und dreht Aris Ohr so, dass er ihn dadurch zu Boden zwingt. Er nimmt schwarzen Schlamm, klatscht ihn auf Aris Wange und verschmiert ihn über sein ganzes Gesicht. »Jetzt siehst du wie der Shoch aus, der du bist«, sagt er. »Halt die Klappe, Shoch.« Ari kann nicht mehr und fängt an zu weinen. Tränen laufen über den Schlamm, und er schluchzt, als hätte er einen Asthmaanfall. Er merkt nicht mal, dass die beiden anderen seine Jarmie als Frisbee benutzen. Pats steht einfach nur da, sein Gesicht immer noch so weiß wie Tipp-Ex, nur dass eine dicke rote Beule aus seiner Stirn wächst wie ein Riesenpickel, der zum schlimmsten Fall von Akne seit Menschengedenken erblüht.
Crackcrack schaut auf das Wasser und sagt: »Was meinst du, Russ?«
Der Typ namens Russ grinst breit und schaut runter auf den armen Ari mit seinem mit Matsch und Rotz verschmierten Gesicht. Russ sagt: »Badezeit für die Babys!«
Ich sehe zu, wie Crackcrack seine Zigarette wegschnippt und sich mit einem goldenen Feuerzeug langsam eine neue anzündet. Wie er dabei die Schultern hochzieht, die Augen zusammenkneift und versucht, cool auszusehen, hat er sich sicher aus Filmen abgeschaut. Dann sehe ich, dass er amerikanische Camels raucht. Die gibt’s in den Geschäften gar nicht mehr zu kaufen, wegen der Sanktionen. Aber er will zeigen, dass er welche kriegt, und das zählt mehr als nur Geld. Genau wie die anderen beiden trägt er Puma, Lacoste und Fila – wie eine Art Uniform. Plötzlich trifft es mich wie ein Hieb mit dem Kricketschläger: wie viel weniger ich bin als die, weil ich nicht diese Logos trage. Und dass sie aus einer anderen Welt kommen, von der ich keine Ahnung habe. Und das bringt mich sofort auf Marcus.
»Alles klar«, sagt Crackcrack. »Partytime. Ihr kleinen Rabbi-Jungs schafft jetzt eure Ärsche ins Wasser.«
Keiner bewegt sich.
»Los, ihr Schwulis. Ich sag’s nicht noch mal. Ich zähle jetzt bis drei, und dann geht ihr da rein, oder es wird euch leidtun!«
Ich blicke hinter mich und sehe, dass in dem grünen Wasser zwischen dem Ufergras alles Mögliche rumschwimmt, schleimiges Moos, Schlieren von Entenscheiße, Bierdosen und anderer herumdümpelnder Müll. Ich schaue die drei vor uns an. Ich überlege zuzuschlagen – ich meine ernsthaft. In Gedanken sehe ich meinen Bruder auf den schweren Sack in unserem Garten einprügeln, baff! baff! baff!, wobei die Schweißtropfen fliegen. Wenn ich alleine war, habe ich es auch ein paarmal versucht, aber die Schläge meiner knochigen Fäuste sind nur kleine Schubser gegen den harten Stoff, den ich kaum einbeulen kann. Ich schaue in ihre Gesichter und versuche mir vorzustellen, dass ich so auf eine echte Nase, ein echtes Kinn einschlage, und bei dem Gedanken fühle ich mich schwach, und mir wird fast übel. Mir ist, als würde ich schmelzen, immer weiter, in meine Socken rein.
»Eins«, zählt Crackcrack.
Zwischen zweien von ihnen klafft links eine kleine Lücke. Ich bewege mich langsam darauf zu, drehe mich seitwärts, aber Pats sagt: »Lass das, Helger. Die tun uns sonst nur noch mehr weh.«
Es ist dieses Wort, das dritte Wort. Helger. Es zerplatzt wie eine Bombe. Ich meine, ich sehe es in ihren Gesichtern – kabumm.
Plötzlich denke ich schneller als Jody Scheckter mit 500 km/h auf der Kyalami-Rennstrecke. Ich gehe auf die Lücke zu und weiß, dass sie jetzt nicht mehr versuchen werden, mich aufzuhalten. Ich gehe zwischen ihnen durch, und sie machen – nichts. Sie stehen einfach da wie gefrorene Scheißhaufen, mit offenen Mündern. Ich drehe mich zu Ari und Pats um. »Kommt, Jungs«, sage ich. »Die tun euch nichts. Lasst uns abhauen.«
Polovitz sagt zu Russ: »Verdammte Scheiße. Er ist es, oder?«
»Kann nicht sein«, erwidert Russ. Aber er klingt nicht mehr wie noch vor ein paar Sekunden. Seine Stimme ist ganz hoch, wie die eines Mädchens.
Crackcrack geht auf mich zu, als wolle er diesen Quatsch auf der Stelle klären. »Wie heißt du?«
»Ich bin Martin Helger«, sage ich.
»Was soll der Scheiß?«
»Das ist heftig«, sagt Russ. »Er ist sein Bruder. Sein kleiner Bruder.«
»Der hat doch gar keinen kleinen Bruder«, erwidert Crackcrack.
Ich spüre, wie alle mich ansehen, während ich Crackcracks Blick erwidere. »Mein Bruder geht auf die Solomon«, sage ich. »Vielleicht kennt ihr ihn. Er heißt Marcus. Marcus Helger. Ich wollte euch einfach nur fragen, ob ihr ihn kennt. Vorher.« Jetzt sagt keiner mehr ein Wort. Ich erzähle ihnen, dass mein Bruder Marcus in der Matriek ist – in der zehnten Klasse, der letzten Klasse der Highschool. Also ist er älter als sie, achtzehn inzwischen. Ich frage sie noch einmal, ob sie ihn kennen, aber die Antwort weiß ich bereits. Etwas Riesiges ist unter meiner Kehle angeschwollen. Ich fühle mich, als würde ich auf einem Turm stehen und auf sie hinunterschauen.
Jemand gibt einen Laut von sich, wie ein Gähnen, nur anders. Es erinnert mich an das Geräusch, das Ma damals in Rosebank gemacht hat, als wir diesen jungen schwarzen Typen die Straße entlangrennen sahen, und ein Polizist rannte hinter ihm her und schoss auf ihn. Der Mann rannte so schnell, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Er hatte den Kopf gesenkt, ruderte wild mit den Armen, und seine Jacke flatterte hinter ihm her. Der Bulle hielt seine Riesenknarre in beiden Händen, die Arme gestreckt, sie machte plopp-plopp-plopp, und wir konnten es nicht glauben, und Ma stieß diesen Laut aus, den ich nie vergessen werde. Russ gibt genau diesen Laut noch einmal von sich und starrt mich an mit Augen, so groß wie die Räder eines Spielzeuglasters. »Ich hab dich nicht angefasst, hey«, sagt er zu mir. »Ich nicht.« Er dreht sich um, macht zwei, drei große Schritte, und dann rennt er einfach weg und ist verschwunden. Crackcrack sagt zu mir: »Du bluffst doch.« Polovitz will auch etwas sagen, aber schluckt es runter, dreht sich um und rennt ebenfalls weg. Einfach so.
Crackcrack weicht zurück; er kaut auf dem Daumennagel. Ari packt ihn am Arm. »Lass mich los!«, sagt Crackcrack, lässt mich dabei aber nicht aus den Augen und versucht nicht, seinen Arm wegzuziehen. Er will lächeln, aber es sieht – wie Ma sagen würde – einfach garstig aus. Er sagt, er hätte nur Spaß gemacht, als er gedroht hat, uns ins Wasser zu schmeißen. Das hätten sie nie wirklich getan. »War ein Witz, Leute, war nur ein Witz.«
Ari sagt: »Du hast mich Shoch genannt.« So wie er das sagt, klingt es schlimmer als schlimm, wie das Schlimmste, das man zu jemandem sagen kann. Und es ist ziemlich schlimm, aber ich glaube, mit dem Schlamm dazu war es noch schlimmer. Crackcrack steckt die Zungenspitze ein Stück raus, fährt sich schnell über die wulstigen Lippen, schluckt dann heftig und streckt die Hand aus. Sie zittert. »Hey, Mann«, sagt er zu Ari. »Tut mir leid. Lass gut sein.« Dann schaut er uns andere an. »Tut mir leid, Jungs. Echt jetzt.«
Ari ignoriert die Hand. Crackcrack hält sie mir hin. Ich schaue auf sie hinunter. Ari sagt: »Sei nicht blöd, Helger. Lass ihn nicht so einfach davonkommen.«
Ich stehe eine Weile da und starre die Hand an. Dann überrascht mich Pats, als er in mein Ohr flüstert: »Lass ihn einfach gehen, hey. Lass ihn, und gut ist.«
Ari hört ihn. »Nein, es ist nicht gut!«, sagt er. »Absolut nicht!« Ihm bröseln überall noch Reste von trocknendem Matsch vom Gesicht, und eine Wange ist rot und geschwollen. Die ganze Zeit hält mir Crackcrack die Hand hin. »Komm schon, China«, sagt er – er nennt mich seinen Kumpel, als wären wir die besten Freunde. »China, brauchst deinem Bruder ja nichts zu sagen, okay? Sag’s nicht Marcus. Wir sind doch Männer, oder? Wir belassen es dabei. Ich hab mich entschuldigt. Tut mir echt leid.«
Ich starre ihn an. »Tu’s nicht«, sagt Pats. Aber schon höre ich meine eigene Stimme. Sie klingt tief und rauh, als wäre es nicht meine. »Stimmt nicht«, sage ich. »Du verdammter Lügner.«
4
Anschließend folgen wir im Gänsemarsch dem Pfad durch das hohe Schilf. Unsere Füße quietschen im Matsch. Es ist heiß wie in einem Treibhaus, ich schwitze wie verrückt, und als wir rauskommen und kühle Luft über meine Haut streicht, ist es, als würde Plastikfolie von mir abgepellt. Draußen können wir wieder über die Felder hinter den Squashplätzen bis zur Letaba Road blicken. Ich zittere immer noch. Pats dreht sich zu mir um und fragt: »Wie konntest du das nur machen?«
»Weiß nicht«, antworte ich. »Ich hab’s eben einfach gemacht.«
»Das war ein Fehler«, sagt Ari. »Ein Riesenfehler!«
Ich spüre, wie sich mein Gesicht verzieht. »Klar, das sagst du jetzt. Aber vorhin hast du das nicht gesagt. Vorhin wolltet ihr genauso zu denen gehen wie ich.«
»Ich nicht!«
»Doch!«
»Wie konntest du das tun, Martin?«, fragt Pats noch einmal. »Das war bescheuert.«
Ich schaue weg. Mein Schädel brummt. »Keine Ahnung«, sage ich. »Es war, als wäre es jemand anders gewesen.«
»Du warst es«, erwidert Ari.
Dann fängt Pats wieder davon an, wie bescheuert ich bin, und dabei steigt wieder das Gefühl von eben in mir auf, und ich sage mir: Scheiß auf ihn! Er hat’s verdient. Er hat es verdammt noch mal verdient! Neben mir steht ein armseliger kleiner Busch, der keinem was getan hat. Ich gehe hin, packe ihn und zerre daran herum, aber er ist zäher, als er aussieht. Ich grunze und zerre und reiße mir die Hände auf, bis ich ihn mit der Wurzel rausziehen kann. Dann drehe ich mich um und schmeiße ihn in die Binsen. Ich spucke aus und wische mir den Mund ab, keuchend wie nach einem Geländelauf. Die beiden andern glotzen mich an. »Du hast sie doch nicht mehr alle«, sagt Pats leise.
Ich deute auf ihn. »Ihr habt beide voll mitgemacht.«
Ari reibt sich die Nase und sagt: »Die haben sich so dermaßen in die Hosen geschissen, das hab ich noch nie gesehen. Dein Bruder muss ein ganz schön großes Tier auf der Solomon sein.«
»Keine Ahnung. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gleich gesagt, wer ich bin.« Ich hatte wirklich keine Ahnung, denn Marcus redet nicht mehr mit mir wie früher, als wir noch klein waren, schon seit Jahren nicht, seitdem er auf diese Highschool geht.
»Aber warum geht dein Bruder überhaupt auf die Solomon?«
Jetzt ist es raus, nach all den Jahren. Ich habe es vor ihnen geheim gehalten, und das hat funktioniert, weil sie Schul-Freunde sind, die nie zu uns nach Hause zum Spielen kommen, und weil Marcus nie in die Synagoge geht und weil sie nie viele Fragen über meine Familie stellen, denn sie reden ohnehin nur über sich selbst. Aber ich habe immer gewusst, dass sie es irgendwann rausfinden – vielleicht habe ich das deswegen heute gemacht, bin deswegen dahin gegangen. Ich stütze die Hände in die Hüften und schaue weg. Ich warte auf das, was jetzt kommen muss.
»Und, auf welche Highschool gehst du nächstes Jahr?«
Irgendwie fühlt es sich gut an, das Geheimnis auszuspucken wie einen faulen Zahn. »Ich gehe auch auf die Solomon.«
Einen Augenblick lang sehen sie mich ungläubig grinsend an, bis ihnen dämmert, dass ich es todernst meine. Dann schauen sie einander an, als könnten sie es nicht glauben. Ari sagt: »Wieso gehst du auf die Solomon?«, und Pats fragt: »Warum hast du uns angelogen?«
»Ich hab gar nicht gelogen«, erwidere ich. So ganz stimmt das allerdings nicht. Seit Jahren habe ich sie in dem Glauben gelassen, dass ich auf die staatliche Highschool gehen würde, genau wie sie. Ich meine, ich gehe auf eine staatliche Grundschule, also warum dann nicht auf eine staatliche Highschool? Außerdem wissen sie, dass ich in Greenside wohne, in einem alten Bungalow ohne Swimmingpool, und Jungs aus Greenside gehen nicht auf die Solomon. Sie hätten mir vielleicht geglaubt, wenn ich gesagt hätte, ich ginge auf eine andere jüdische Privatschule, eine für die Mittelschicht – aber nicht auf die Wisdom of Solomon High School für jüdische Jungen oben in Regent Heights. Niemals. Ich habe nicht gelogen!, würde ich am liebsten zu meinen einzigen beiden Freunden sagen oder, besser noch, es laut herausschreien, aber stattdessen beiße ich mir mit brennendem Gesicht auf die Lippen. Nein, ich hab nicht gelogen. Ich hab’s nur nicht gesagt. Das ist ein Unterschied, oder? Ich hab nur die Klappe gehalten, bis heute, als ich den Rugbypullover unten zwischen den Weiden entdeckt habe. Ich wollte es ihnen einmal unter ihre arroganten Nasen reiben und ihnen zeigen, dass sie nicht besser sind als ich, denn das sind sie nicht.
Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt, und zwar ungefähr so: Erlaubt mir, euch ein paar zukünftige Mitschüler von der Solomon vorzustellen. Und die Solomon-Jungs hätten gesagt: Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Wirklich sehr erfreut. Denn auf die Solomon gehen lauter Gentlemen, und ich werde einer von ihnen sein, und ich will auch so sein und solche Freunde haben, und das werde ich auch. Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Typen wirklich von der Solomon waren. Bestimmt war das nur der Abschaum. Andererseits wundert es mich in gewisser Weise doch nicht allzu sehr, wenn ich überlege, wie sich Marcus verändert hat, seit er auf die Solomon geht. Eine Stimme in mir sagt, klar doch, das ergibt absolut Sinn, aber ich will auf diese Stimme nicht hören und verdränge sie. Sie verursacht mir ein ganz übles Gefühl bis runter in die Eier.
Währenddessen wendet Pats ein: »Dein Alter arbeitet auf einem Schrottplatz und fährt in einem alten, verbeulten Pick-up rum.« Sofort sehe ich ihn vor mir, meinen Vater Isaac Helger, den knubbligen Ellbogen am offenen Fenster seines rostigen Datsun, den dicken, mit rötlichen, lockigen Haaren bedeckten Unterarm, wie er auf dem Weg nach Hause die Clovelly Road entlangrattert und durch die Zähne pfeift. Die gleichen rötlichen Locken ringeln sich über seinem faltigen, sonnenverbrannten Gesicht mit der dicken Nase und den abstehenden Ohren. Ich hasse mich dafür, dass ich mich schäme, aber so ist es eben.
»Wie kann er sich das leisten?«, fragt Ari, pumpt sich auf und deutet mit dem Finger auf mich wie im Film ein Anwalt vor Gericht, der am Ende den Bösen drankriegt. »Woher hat er das Geld? Man muss sich das doch leisten können!«
»Du hast völlig recht«, sagt Pats zu ihm. »Die Sheinbaums gehen auf die Solomon. Die verdammten Sefferts. Die Ostenbergs schicken ihre Kinder hin.« Er zitiert berühmte Namen aus der Sunday Times und so – Besitzer von Diamanten- und Goldminen, Erbauer großer Casinos und protziger Shoppingmalls, Eigentümer börsennotierter Unternehmen. Nur dreihundert Jungs besuchen die Solomon, und alle stammen aus solchen Familien. Es sind keine Söhne von Schrotthändlern aus Greenside darunter.
»Da stimmt doch was nicht«, sagt Ari.
Es ist, als wäre ich gar nicht da, so wie sie über meinen Kopf hinweg über mich reden. In Gedanken sehe ich sie schon nach Hause rennen und die Neuigkeit rausposaunen: der kleine Marty aus der Shaka Road, und dann finden sie raus, was ich längst weiß. Denn nur, weil der alte Helger aussieht wie ein Arbeiter, wenn er an Jom Kippur in der Synagoge auftaucht, in diesem alten, schlechtsitzenden Anzug, ohne Krawatte, mit faltigem Kragen, schwieligen Pranken und sonnenverbranntem Gesicht, und nur, weil er in einem rostigen Truck sitzt, ist er deswegen noch lange nicht … so wie sie. Denn die sind die Idioten. Die wissen nicht, dass Isaac Helger unseren Schrottplatz besitzt. Sie wissen noch nicht, dass so ein Laden schmutzig und hässlich aussehen kann, aber dass man deswegen noch lange nicht arm sein muss. Ich weiß das, denn Da hat es mir oft genug gesagt: Es sind die schmutzigen Fingernägel, die richtig Geld ausgraben.
Ari wendet sich an mich. »Die werden dich fertigmachen, my broe’.«
Pats fragt: »In welche Klasse geht dein Bruder noch mal?«
»Du weißt doch, dass Marcus in der Matriek ist«, erwidere ich. »Tu doch nicht so.«
»Ich meine damit nur, dass er nächstes Jahr weg ist, wenn du auf die Solomon kommst, oder? Die Typen werden dich umbringen für das, was du gemacht hast.«
Für das, was ich gemacht habe. Als wären sie nicht dabei gewesen.
»Sei doch mal ehrlich«, sagt Ari. »Du hast keine Freunde. Du bist unsportlich, weil du so ein Lauch bist. Deine Noten sind so schlecht, dass du schon mal sitzengeblieben bist. Du hast echt keinen Charakter, ich meine, gib’s doch zu. Und dann schau dir mal an, was du heute gemacht hast. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir!«
»Falsch«, sage ich mit trockenem Mund. »Das war nicht ich, das waren wir zusammen.« Ich bemerke, dass ich angefangen habe, hin und her zu tigern. Ich kann nicht stillstehen. Erstaunlich, wie viel sie über mich wissen, und ätzend, wie recht sie haben. Mir kommt plötzlich in den Sinn, dass die Leute, die man kennt, wahrscheinlich viel mehr über einen wissen, als sie einem ins Gesicht sagen. Das findet man offenbar erst raus, wenn die Kacke am Dampfen ist.
»Du hast uns doch da rübergeschleift«, erwidert Pats ganz ruhig und berührt die Beulen auf seiner Stirn, die allmählich blau werden. Und da kapiere ich es. Was sie von mir wollen. Sie wollen bloß, dass ich mich entschuldige, wie immer. Sie wollen, dass ich sage, es wäre 100-prozentig mein Fehler gewesen. Ich müsste dieses kleine, nasale Lachen ausstoßen und den Kopf senken, wie ich es immer mache, wenn ich verliere, als wollte ich sagen: Na ja, was kann man schon machen? Das erinnert mich an unseren alten Hund Sandy und daran, wie sie sich auf den Rücken rollt und ihren weichen Bauch zeigt, damit man sie krault. So soll ich sein. So bin ich immer. Wenn ich das jetzt mache, wird alles wieder normal, wir können alle zusammen zu Pats nach Hause gehen wie immer, nach dem Mittagessen Risiko spielen, und ich verliere, und dann werfen wir Steine in den Pool und tauchen sie hoch, und ich verliere auch bei diesem Spiel. Und plötzlich kapiere ich es – sie sind neidisch! Ich spüre, wie sich meine Fingernägel in mein Schlüsselbein graben, ohne dass ich mich erinnern könnte, meine Hand dorthin gelegt zu haben. »Alles klar«, sage ich. »Ich geh jetzt, Leute.«
»Du gehst?«, fragt Pats.
»Ja, nach Hause«, sage ich.
»Alles klar, dann geh doch«, sagt Ari, das Gesicht verkniffen, als hätte er in eine Zwiebel gebissen. »Los, geh!«
»Mach ich«, sage ich.
»Alles klar. Du Wichser.«
»Es ist nicht deine Schuld«, sagt Pats.
»Ach, wirklich?«, sage ich. Ich trabe los, und Ari fragt, was mit mir los wäre. Ich habe die Hände in den Taschen zu Fäusten geballt. Unsportlich, schlechte Noten, keine Freunde.
Einmal auf dem Schrottplatz hat mich mein Vater dabei erwischt, wie ich gelogen habe. Er hatte mich gebeten, bei einem Auspuff auf blauen Qualm zu achten. Ich sagte ihm, da wäre keiner, dabei hatte ich nicht mal hingeschaut. Ich las gerade ein Buch, Tales of mystery and imagination von Edgar Allan Poe. Mein Vater Isaac hat dicke Pranken, und seine Haut ist durch die vielen Schwielen rauh wie Schleifpapier. Er ist alt, aber diese Hände sind so wahnsinnig stark, Mann. Wie Schraubstöcke, ehrlich. Er hat mich am Arm gepackt, so dass ich spürte, wie sich die Finger bis auf den Knochen gruben und fünf Blutergüsse hinterließen, die mir noch zwei Wochen lang blieben. Und ich erinnere mich an jedes Wort, das er zu mir gesagt hat: Dein guter Name ist alles, was du auf dieser Welt hast, Junge. Wenn du deinen guten Namen verlierst, kriegst du ihn nie wieder zurück. Die Leute müssen an diesen Namen glauben. Helger. Wenn du Lügen erzählst, dann verlierst du deinen Namen. Er wird nichts mehr wert sein. Vergiss das nie.
Da hatte so recht. Nichts ist wichtiger. Das sieht man schon allein daran, wie die Jungs vor dem Namen Marcus Helger ausgerissen sind, nur vor seinem Namen! Ein Name kann so greifbar sein wie eine Pistole oder ein Messer. Ich werde mir auf der Solomon einen Namen machen – für irgendetwas. Was immer ich dafür tun muss. Ich brauche Ari nicht. Ich brauche Pats nicht. Ich brauche gar niemanden. Mein Gesicht ist nass.
HaSchem bedeutet »der Name«. Der wahre Name ist zu heilig, um ihn jemals laut auszusprechen.
Als ich in der nächsten Woche nicht zur Schul gehe, fragt mich Ma, warum, und ich antworte ihr, dass ich nicht mehr an den Namen glaube.
Der Alptraum
5
Ich bin draußen im Garten in mein Spiel vertieft – mein größtes Geheimnis –, als ich höre, wie das große Tor geöffnet wird und das Auto hereinfährt. Wir haben zwei Tore, beide aus Stahl, mit scharfen Spitzen obendrauf und natürlich immer abgeschlossen. Ich hätte genügend Zeit, mein Spiel zu unterbrechen und reinzugehen, aber ich bleibe draußen, weil ich so neugierig bin. Ich höre das Haupttor zuschlagen, dann eine Autotür, Stimmen und Schritte. Jetzt wird das innere Tor aufgeschlossen, und sie kommen auf dem Gartenweg herein – für diese wenigen Sekunden, während sie um die Ecke biegt, habe ich das neue Mädchen ganz für mich. Bemüht gelangweilt, blicke ich ihr entgegen. Ich wusste, dass es ein Mädchen sein würde, aber als sie erscheint, ist es, als würde mir das Blut in den Adern gefrieren und als würde dann jemand mit einem Hammer draufhauen. Auf mich kommt eine ausgewachsene Frau zu, eine echte Schönheit. Ihr schwarzes, lockiges Haar, die olivfarbene Haut und die vollen roten Lippen verleihen ihr etwas Orientalisches. Groß und rund zeichnen sich ihre Brüste unter dem T-Shirt ab, grüne Cargohosen schmiegen sich um breite Hüften, und an einer Fessel funkelt über den offenen Sandalen mit Glitzerriemchen und Korkplateaus ein Fußkettchen. Sie trägt einen Rucksack auf dem Rücken und einen Koffer in jeder Hand.
Es ist Dezember 1988, und, großer Gott, ich kann mein Glück kaum fassen!
Nachdem sie im Alten Zimmer ausgepackt hat, setzt sie sich zu uns an den Abendbrottisch, auf Marcus’ ehemaligen Platz, und stellt sich uns als Annabelle Justine Goldberg vor, »aber bitte sagt Annie zu mir, ja? Ich studiere Anthropologie im Hauptfach an der Columbia, in New York City.« Sie freut sich sehr über die Praktikumsstelle, die sie sich hier in Johannesburg organisiert hat. Ihr Akzent klingt nach Fernsehen und Kino. Nach Demi Moore, Michael Jackson, Sly Stallone, nach Dallas und Denver-Clan. Amerika! Ihr breiter Akzent ist pure Coolness im Vergleich dazu, wie wir unsere Wörter verschlucken, als schämten wir uns für sie.
»Wo wirst du denn unterrichten, an der Wits?«, fragt Arlene.
»An der Uni? Oh, nein«, erwidert Annie. »An einer Grundschule.«
»Und an welcher?«, fragt Arlene, während sie mit beiden Händen gleichzeitig das hölzerne Salatbesteck in den Kartoffelsalat sticht.
»Sie liegt in Julius Caesar«, erklärt Annie. »Das ist eine Township, richtig?«
Arlene hält für einen Moment beim Massakrieren der Kartoffeln inne und starrt Annie mindestens zehn Sekunden lang wortlos an, ehrlich! Arlene ist diejenige, die diese Annie hier angeschleppt hat. Sie ist schon seit ewigen Zeiten Mitglied der Zionistischen Damenliga Johannesburg, Abteilung nordwestliche Vorstädte, und als eine Gastfamilie gesucht wurde, die für einige Wochen eine jüdische Studentin aufnimmt, meldete sie sich. Sie war der Meinung, im Haus sei genügend Platz für einen Gast, nun, wo Marcus weg war und Gloria nicht mehr lebte und wir wegen Isaacs unvernünftiger, sturer Weigerung, ein neues Hausmädchen einzustellen, immer noch keinen Ersatz für sie hätten. Am meisten erstaunte mich, dass Isaac nicht sofort wieder einen lautstarken Streit vom Zaun brach, sondern nur mit den Achseln zuckte. Vielleicht hatte er die Nase voll von den Auseinandersetzungen – es hatte einfach zu viele gegeben, nachdem Marcus über Nacht verschwunden war. Es dauerte lange, bis das »ruhige Zeitalter« eintrat, wie ich es nenne. Im Zeitalter des Unfriedens hatte ich angefangen, meine Eltern Isaac und Arlene statt Ma und Da zu nennen. Damit versuchte ich ihnen klarzumachen, dass sie sich mal wie Erwachsene benehmen sollten. Ich bin jetzt knapp siebzehn und finde, dass wir alle in diesem Haus erwachsen sind und uns entsprechend verhalten sollten. Arlene, Isaac und Martin. Zaydi nenne ich selbstverständlich nicht bei seinem Vornamen, Abel. Zaydi muss unseren Berechnungen nach mindestens zweiundneunzig sein. Meistens sitzt er im Garten, klappert mit seinem Gebiss, betet und führt Selbstgespräche. Es würde sich nicht richtig anfühlen, ihn anders als Zaydi zu nennen, Jiddisch für Großvater. Eine Zeitlang waren meine Eltern genervt, aber irgendwann haben sie sich daran gewöhnt. Und jetzt sind wir nicht mehr nur drei Erwachsene und ein Senior, jetzt sind wir zu viert. Wir plus Annie Goldberg. Annie, das Nicht-Mädchen, Annie, die erwachsene Frau, die in eine Township will. Arlene steht unter Schock, und in Isaac kocht es, weil er diesen bescheuerten Unsinn nicht rechtzeitig unterbunden hat. Und ich? Mann, ich danke immer noch meinem Schöpfer im Himmel! Man muss sie sich ja nur mal ansehen! Außerdem ist das Schuljahr vorbei, und ich habe Sommerferien. Wir sprechen hier von Wochen! Und ich bin noch Jungfrau.
6
Ich schrecke aus dem Schlaf hoch. Wieder Fetzen des Alptraums. Stöhnend und verängstigt liege ich da. 02:05 Uhr, lese ich auf dem Wecker in roten Ziffern. Nach einer Weile sehe ich Licht im Spalt zwischen den Gardinen flackern. Ich gehe auf die Knie, um nachzusehen. Mein Zimmer ist lausig, nicht nur, weil es gerade mal so groß ist wie ein Schrank, sondern weil alle anderen Zimmer zum Garten hin liegen, meins aber zum Hinterhof, der eigentlich nur ein Zementviereck ist, auf einer Seite begrenzt von Glorias ehemaligem – jetzt natürlich leerstehenden Zimmer – und einem windmühlenartigen Metallding zum Wäscheaufhängen in der Mitte. Marcus hat hier immer trainiert. Ich habe ihm oft zugesehen, wie er seine Hände mit Bandagen umwickelte. Ich blickte von meinen Gedichtbänden auf und beobachtete ihn heimlich, wie er das Springseil so schnell durch die Luft sausen ließ, dass es aussah, als wäre er von einem Kraftfeld umgeben. Ich sah zu, wie er auf den schweren Sack eindrosch, schnaufend wie eine Dampflok. Dann blickte ich wieder nach unten und las zum Beispiel:
In Xanadu
Ließ Kublai Khan
Ein stattliches Lustschloss errichten …
Ich mochte schon immer den Klang von Gedichten und die Art, wie sich die Worte vom reinen Weiß der Seiten abheben. Wenn man sie wieder und wieder liest, erfasst einen so ein luftiges, schwebendes Gefühl genau unter dem Herzen, kein Witz. Total schön. Doch jetzt denke ich daran, wie ich vor inzwischen fast vier Jahren, mit dreizehn – gleich nach dieser schlimmen Sache mit Ari und Pats am Emmarentia-Damm –, eines Tages mein Buch hinlegte, rausging und darauf wartete, dass Marcus eine Pause einlegte. Ich fragte ihn: »Möchtest du, dass ich die Zeit für dich stoppe?« Doch mein Bruder schüttelte nur den Kopf. Ich sagte: »Ich wollte dich was fragen. Wegen der Schule. Der Highschool. Wie es da so ist …« Aber Marcus schnaubte nur und fuhr sich mit seinem mächtigen Unterarm über die Nase, wobei sein Bizeps mit den dicken Adern, der unter dem abgeschnittenen T-Shirt rausguckte, anschwoll wie ein Partyballon. Dann drehte er mir den Rücken zu. Ich habe ihm also nie von dem Vorkommnis am Damm erzählt. Ich ging rein, stellte mich vor den Spiegel, schob einen Ärmel hoch und verzog genervt und angewidert das Gesicht.
Jetzt knie ich auf dem Bett, und mir bietet sich ein ganz anderes Bild als damals. Keine kämpferischen Bewegungen – nein, Annie Goldberg tanzt im hellen Mondlicht auf dem Zementboden des Innenhofs, barfuß, in abgeschnittenen Jeans und einem blauen T-Shirt mit dem Aufdruck irgendeiner mir unbekannten Sportart. Seahawks steht drauf, und man sieht klar und deutlich, dass sie darunter keinen BH trägt. Sie hat Kopfhörer auf den Ohren und einen Walkman mit einem Clip am Hosenbund befestigt. Sie tanzt so geschmeidig wie warmes Öl, kein Witz. Ihre Arme winden sich wie Schlangen um die Hüften, und diese Hüften machen so eine flatterige Auf-und-Ab-Bewegung, wie es nur Frauen können. Ein überwältigendes, reines Verlangen rast durch mich hindurch wie Buschfeuer durch trockenes Gras. So stark, wie ich es noch nie erlebt habe, und dann, ganz plötzlich, wirbelt sie herum und sieht mich an.
Ich mache den Donald und ducke mich so schnell, dass ich das Gefühl habe, mein Haar würde ohne mich in der Luft zurückbleiben. Keuchend wie unser Hund Sandy früher an heißen Tagen, liege ich da und drücke mir ein Kissen aufs Gesicht. Am Morgen bleibe ich in meinem Zimmer, bis ich höre, wie sie sich fertigmacht, dann schleiche ich mich hinaus zum großen Feigenbaum an der Gartenmauer zur Clovelly-Road-Seite. Isaac und Arlene sind wie immer zur Arbeit gegangen, und Zaydi ist bereits mit seinen Stöcken zu den Stühlen unter den Pflaumenbäumen hinausgetappt. Als Annie rauskommt, bin ich oben in den Zweigen, gut versteckt. Über die Mauer hinweg beobachte ich, wie ein alter, rotzgrüner Chevy 4100 sie aufgabelt. Das Auto ist voller Schwarzer, und wie sie so beiläufig zu ihnen reinschlüpft – ich will nicht sagen, dass es mich schockiert, weil ich total liberal bin und so, aber na ja, es würde jeden in unserer Gegend schockieren. Greenside, wo wir wohnen, ist eine typische nördliche Vorstadt, lauter Bungalows mit hohen Mauern, Gärten und Swimmingpools, jede Familie ist natürlich weiß, weil das ja von Gesetzes wegen ein weißes Wohngebiet ist. Man sieht kaum jemanden auf der Straße, nur manchmal stehen Maids an der Ecke und warten auf den Chinesen in seinem alten Opel mit den Lotterieergebnissen, oder dicke Ladys verkaufen frischen Mais aus großen Jutesäcken, die sie auf ihren Köpfen balancieren, und rufen: »Green mielies! Green mielies!« – »Grüner Mais! Grüner Mais!« Jedenfalls wette ich, dass die alte Mrs Geshofski gegenüber Zustände kriegen würde, wenn sie Annie in ein Auto voller Schwarzer hüpfen sähe. Und der verrückte Mr Stein, der nebenan wohnt – keine Ahnung, was der machen würde, vielleicht mit einem selbstgebauten Flammenwerfer oder irgend sowas rausrennen, weil er komplett meschugge im kop ist, wie Isaac sagt, der meint, dass Mr Stein nach Tara gehört, ins Irrenhaus. Bevor Annie die Tür des Chevy zuzieht, erhasche ich ein paar klimpernde Noten der schwarzen Musik aus dem Auto und bemerke vertrocknete, schrumpelige Dinger, die am Rückspiegel hängen. Breites Grinsen und Gelächter auf dem überfüllten Rücksitz, als sie losfahren.
Ich klettere vom Baum und gehe rein. Ich habe unendlich viel Zeit in diesen langen Sommerferien. Sechs Wochen keine Schule; ein unglaublicher Luxus an freien Stunden und Tagen, die sich bis zum neuen Schuljahr erstrecken. Ich trete an die Tür zum Alten Zimmer, das jetzt ihres ist. Ich strecke die Hand nach dem Türgriff aus. Mach das nicht!, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Die Tür ist abgeschlossen, Gott sei Dank. Aber ich weiß, wo der Ersatzschlüssel ist. Lass das, Martin!, sage ich mir, aber ich werde wie von einem Magneten angezogen. Ich zittere und muss auf die Toilette. Dann stelle ich fest, dass der Ersatzschlüssel nicht am Brett hängt. Mann, bin ich dankbar! Kaum zu glauben, was ich da fast getan hätte. Ich gehe in den Garten und verbringe den Rest des Tages mit meinem Spiel.
Das Spiel ist etwas, das ich wirklich nicht mehr tun sollte. Ich mache das schon, seit ich ganz klein war. Ich habe den Garten immer geliebt. Mein Lieblingsspielzeug war der Gartenschlauch, und ich besprühte Mas Blumenbeete, die Strelitzien, die Proteas und alles andere. Ich trug noch Windeln, als mich Gloria auf Sandys Rücken setzte und wir Pferdchen spielten. Ich erinnere mich an das weiche Fell unter meinen dicken kleinen Beinchen und an Glorias warme, dunkle Hände um meine Rippen, die mich aufrecht hielten, und an ihren angenehmen Geruch und ihren Sotho-Akzent in meinem Ohr. Später wanderte ich träumend im Garten umher – aber es waren mehr als Tagträume, ich lebte in den Geschichten, die ich erfand, echt wahr. Ich war so versunken, dass ich nicht mitkriegte, wie ich dabei Selbstgespräche führte, komische Gesichter schnitt und Geräusche von mir gab, bis man es mir sagte. Ungefähr da erkannte ich, dass das nicht jeder machte, und nannte es »spielen«. Ich war immer der Held in meinen Spielen. Ich kroch durch geheime Tunnel unter den Aprikosenbäumen, sprang auf Güterzüge, setzte die Bösen schachmatt wie Bruce Lee in Der Mann mit der Todeskralle, rettete weibliche Gefangene und trug sie davon wie Conan, der Barbar. Als ich älter wurde, versuchte ich mich vom Spielen abzuhalten. Aber ich schaffte es nicht. Ich verberge es nur, so dass es keiner sieht (außer einem). Irgendwann wurde es so schlimm, dass ich nicht mehr zum Hausaufgabenmachen kam und durchrasselte – ein ganzes Schuljahr wiederholen musste. Danach hatte ich es besser im Griff, aber ich kann immer noch nicht damit aufhören. Denn es beruhigt mich, ernsthaft. Es nimmt mir meine Angst. Danach fühle mich wieder sicher.
In dieser Nacht spricht Annie Goldberg zum ersten Mal allein mit mir. Es passiert im Flur vor der Küchentür. Sie kommt einfach raus und steht, bämm, genau vor mir. Sie spricht leise, als wolle sie nicht, dass es jemand außer mir hört. Es tut fast weh, ihr in die Augen zu sehen. Annie hat so wunderschöne Augen, ganz groß und karamellbraun mit kleinen mintgrünen Sprenkeln darin. Als sie meine Schulter berührt, habe ich das Gefühl, dass mein Blut in Brand gesetzt wird. »Ich bin noch auf New Yorker Zeit«, sagt sie zu mir. »Und welchen Grund hast du, Schlafwandler?«
Dafür, dass ich um zwei Uhr nachts wach war und ihr beim Tanzen im Hof zugesehen habe … Ich frage mich, wie ich für sie ausgesehen haben muss, als ich sie dort vom Fenster aus beobachtet habe, voll der Spanner, und spüre, wie mein Gesicht peperonirot anläuft. »Ähm … Ich habe manchmal einen Alptraum, von dem ich aufwache.«
»Immer denselben?«
Die Frage kommt wie ein schneller Stoß, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, so wenig habe ich sie erwartet. Sie muss sie wiederholen, ehe ich nicke. Sie riecht nach Zitronen. Als ich den Blick senke, trifft er auf die dunklen Höfe um die Brustwarzen unter ihrer Bluse, und ich muss sofort wieder aufblicken, und zwar pronto. »Dann musst du nämlich genau darauf achten.« Sie stellt es fest wie eine Tatsache, wie einen Befehl. »Wiederkehrende Träume wollen uns etwas sehr Wichtiges sagen. Oft etwas, das wir nicht gerne hören wollen. Worum geht es in deinem Traum?« Ich schüttle nur den Kopf. »Was passiert in diesem Alptraum?« Aber ich will nicht antworten.
In jener Nacht schlafe ich schlecht, und als sie am nächsten Morgen ihr Schaumbad nimmt, gehe ich sofort wieder zur Tür des Alten Zimmers, und diesmal steht es einen Spalt offen. Mein Herz trommelt in meiner Brust wie der Drummer von Iron Maiden, und ich bleibe erst eine ganze Weile stehen, ja will die Tür schon zuziehen, aber dann denke ich daran, wie sie jetzt nackt in der Badewanne liegt, mit ihrer weichen, perfekten, olivfarbenen Haut, und meine Beine tragen mich voran, ohne dass ich sie aufhalten kann. Es ist kühl und dunkel im Zimmer. Wir heben dort alle alten Uhren von Zaydi auf. Als Zaydi vor Ewigkeiten nach Südafrika gekommen ist, aus dem Dorf Dusat in Litauen, wo fast alle südafrikanischen Juden herkommen, hatte er nichts als Löcher in den Taschen und sprach kein Englisch (das tut er bis heute nicht, nur Mameloschn). Er eröffnete einen Uhrmacherladen in Doornfontein, wo Isaac auch aufgewachsen ist, hinter dem Laden, so richtig superarm. Als Isaac unser Haus gekauft hat, nachdem er zusammen mit Hugo durch den Schrottplatz genug Geld verdient hatte, baute er für Zaydi ein Zimmer mit eigenem Bad an, und dort zog Zaydi ein, nachdem Bobe – meine Großmutter, die ich nie gekannt habe – gestorben war. Zaydi brachte alle seine Uhren mit, die ihm aus Doornfontein geblieben waren, und sie haben sie in dem großen hinteren Zimmer hübsch ausgestellt. Am Fenster hängen schöne Gardinen, und auf dem Boden liegt ein großer, weicher türkischer Teppich. Wir nennen es das »Alte Zimmer«, wahrscheinlich wegen der alten Uhren. Ich bin immer gerne dort gewesen; es riecht nach Holz, Politur und Messing.
Es ist dort jetzt stiller denn je, weil all die tickenden Uhren für Annie angehalten wurden. Arlene hat ihr eine Matratze auf den türkischen Teppich gelegt und einen Kleiderschrank und einen Schreibtisch an die Wand gestellt. Mit nackten Füßen laufe ich über den kühlen, weichen Flor. Das Bett ist ganz zerwühlt, und überall liegen Kleider herum. Auf dem Schreibtisch türmen sich Bücher und Zeitschriften, dazwischen sind Becher, Kämme und anderes Zeug. Meine Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit, und ich entdecke eines von Annies Höschen, das unter einer Jeans hervorschaut. Überrascht stelle ich fest, dass es mit Spitze besetzt ist, sehr feminin. Diese Seite von ihr bleibt normalerweise unter coolen Jeans und Jungs-T-Shirts verborgen. Ich knie mich hin und hebe den Slip mit klopfendem Herzen auf, immer ein Auge auf die Tür gerichtet. Wieder kann ich nicht anders, drücke die Unterhose an mein Gesicht, ganz fest auf Mund und Nase und sauge Luft ein, die nach ihrem Schritt riecht, nach ihrem intimsten Schweiß. Mein Gott, was mache ich hier? Mir wird schwindlig, und ich stöhne laut. Es ist zu viel: die Erregung, die Schuldgefühle, und ich lasse die Unterhose fallen und renne raus. Als ich kurz darauf zurückkehre, bin ich viel ruhiger, und Annie ist immer noch im Badezimmer. Ich blättere durch einige ihrer Bücher auf dem Schreibtisch. Soziologie, Anthropologie, Langweilologie. Ich betaste den klobigen Schmuck in der kleinen Schachtel. Mein Blick wandert wieder zu der Unterhose, aber ich höre, wie im Badezimmer der Föhn angeht, und weiß, es ist Zeit, hier abzuhauen. Aber ich fühle mich den ganzen Tag über verwegen, und als sie abends zurückkehrt, schaue ich ihr direkt in die karamellfarbenen Augen und frage: »Und, gefällt dir dein Zimmer?«
»Ja, aber es wundert mich, dass ich nicht das von deinem Bruder bekommen habe.«
»Er hat es abgeschlossen«, antworte ich.
»Ja, ist mir aufgefallen. Hältst du das für normal? Sein Zimmer mit einem Vorhängeschloss zu sichern?«
»Nicht wirklich.«
»Daran ist das verf… Militär schuld! Das hat ihn traumatisiert. Und du wirst doch auch bald eingezogen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?«
Sie hat das f-Wort benutzt, und ich bin total schockiert. Sie hat es ganz beiläufig eingeworfen. Bei uns zu Hause hat es noch nie jemand ausgesprochen – meine Eltern würden mich umbringen, im Ernst.
»Marcus ist nicht eingezogen worden«, stelle ich richtig. »Er wurde gleich nach der Highschool zurückgestellt. Er war in der Uni-Auswahlmannschaft; er hat Maschinenbau studiert. Aber dann hat er sein Studium abgebrochen, ohne jemandem was davon zu sagen. Er ist einfach gegangen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Er hat sich freiwillig gemeldet«, erkläre ich. »Im Grunde.«
Sie sperrt den Mund weit auf, schließt ihn wieder und geht. Ich stehe da und denke: Hm, wohl nicht so gut gelaufen.
7
Doch Annie Goldberg verschließt nie ihre Tür, wenn sie morgens im Bad ist. Deswegen gehe ich jeden Morgen zu ihr rein. Der Föhn ist mein Alarmsignal. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber ich kann nicht aufhören, es ist wie eine Sucht, wie das Spiel. Schon allein bei dem Gedanken daran, ihre Sachen zu durchschnüffeln, zittere ich. Ich kann den nächsten Morgen gar nicht abwarten – und dann den nächsten …
Als ich diesmal ihr Zimmer verlasse, bemerke ich, dass die Wanduhr neben der Tür schief hängt. Vielleicht bin ich dran gestoßen. Als ich sie geraderichte, verrutscht etwas Schweres im Inneren und kippt mit einem dumpfen Geräusch um. Ich öffne das kleine Türchen vorne an der Uhr, sehe aber nur die üblichen Zahnrädchen. Aber als ich die Uhr etwas von der Wand wegziehe, fällt hinten etwas Großes heraus. Ein Schuh! So ein Discoding mit dicker Korksohle und Glitzerriemchen. Ich drehe ihn eine ganze Weile lang in den Händen hin und her, bis ich das Rauschen des Föhns höre, dann lege ich ihn vorsichtig zurück.
Ich muss die ganze Zeit an diesen Schuh denken, und als der nächste Morgen kommt und Annie in der Badewanne ist, eile ich wieder in ihr Zimmer, durchsuche alles gründlich und entdecke tatsächlich den zweiten Schuh oben auf dem Gardinenbrett, mit Tesafilm hinter der Blende festgeklebt. Warum versteckt man ein Paar Schuhe oben an der Gardine und in einer Uhr? Wozu? Dann fällt mir ein, dass sie diese Schuhe trug, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe.
Die Sache ist die: Ich bin auch so ein Geheimniskrämer und verstecke Sachen, weshalb ich mich ihr jetzt noch näher fühle. Ich möchte ihr meine Loyalität beweisen; ihr Geheimnis ist jetzt mein Geheimnis. Wir sind vom selben Schlag. Jedes Mal, wenn ich ihr Zimmer betrete, empfinde ich eine unerklärliche Zärtlichkeit für sie, während ich unter der Matratze krame, ihre Taschen durchwühle, Innenfutter befühle, in ihre Koffer gucke, über Daunenkissen und -decken und Laken streiche und mit einem Zahnstocher in ihren Tuben und Tiegeln taste. Doch ich finde sonst nichts mehr, deswegen wende ich mich wieder den dicken Korkschuhen zu, inspiziere sie und lege sie jedes Mal genau so zurück, wie ich sie gefunden habe.
Ich denke angestrengt nach, um mir einen Reim darauf zu machen. Dass sie die Schuhe an ihrem ersten Tag getragen hat, bedeutet, dass sie sie am Flughafen anhatte. Also muss sie sie auch auf dem Flug getragen haben. Ich zähle eins und eins zusammen, und es ist sonnenklar, aber ich bin vorher nicht drauf gekommen, weil ich ein Blödmann bin: Sie ist damit durch den Zoll gekommen. Sie fühlen sich nicht schwer an, und man hört nichts, wenn man sie schüttelt. Aber sie sind so groß, dass man etwas darin verstecken könnte. Eine Innensohle klappt ein wenig auf, und alter Kleber zieht sich wie Pizzakäse. Meine Neugier wächst. Ich muss es unbedingt wissen – also hole ich Alleskleber und ein Stanleymesser aus dem Schuppen. Sobald Annie im Bad ist, schlüpfe ich ins Zimmer wie der Blitz. Die Klinge des Stanleymessers trennt die Innensohle ab wie Butter, aber