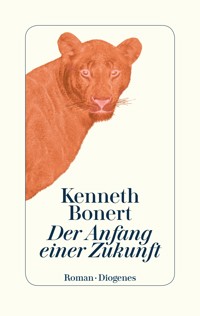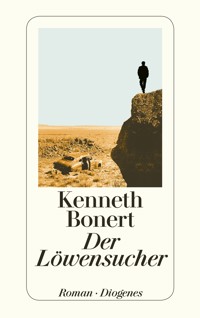11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Mutter, ein erfolgreicher Charmeur, eine Immobilienmaklerin: Eigentlich geht es ihnen ganz gut. Dann kommt der Tag, an dem ihr Leben aus dem Ruder läuft – endlich. Alle begegnen sie jemandem, der sie auf eine Weise erkennt, wie es nur ein Fremder kann. Und durch den sie merken, was ihnen fehlt, um in sich selbst heimisch werden zu können – und vielleicht sogar glücklich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kenneth Bonert
Toronto
Was uns durch die Nacht trägt
Aus dem kanadischen Englisch von Stefanie Schäfer
Diogenes
Familienangelegenheiten
Sie hatte das Cellospiel als einen der vielen Wege der »Bewältigung« oder »Heilung« begonnen – was diese abstrakten, verschwommenen Begriffe in der Zeit nach der Katastrophe auch immer zu bedeuten hatten – und genau wie alle anderen (Aquarellmalen, Segeln, Curling, Gruppentherapie) in einem Dunstschleier der Erschöpfung wieder aufgegeben, überwältigt vom inneren Malaria-Dschungel ihres unendlichen Schmerzes. Sie hatte versucht, sich solche Pfade ins Nirgendwo freizuschlagen, doch schon bald waren sie wieder überwuchert, als hätte es sie nie gegeben.
Mit dem Cello war es jedoch insofern etwas anderes, als sie das sperrige Instrument behielt (sie hätte besser eins mieten sollen). Es machte sich im Garderobenschrank breit wie ein lebendiges Wesen und beäugte sie von dort aus griesgrämig ob der Vernachlässigung wie unter einem staubigen, stets vorwurfsvoll hochgezogenen Augenlid hervor. In jenem Winter hatte sie seine stumme Anklage satt, nahm es heraus, reinigte und stimmte es. Sie redete sich ein, sie mache das nur, um es endlich zu verkaufen, aber dann setzte sie sich hin und begann zu spielen.
Irgendwo im Strom der verlorenen Zeit, in dem jene Musizierenden schwimmen, die Geist und Körper ganz auf das Instrument konzentrieren, klopfte draußen jemand gegen die große Eichentür. Im Nachhinein sah sie darin einen wundersamen mystischen Zufall, ein Zusammentreffen der Umstände, dass sie das Cello im Augenblick des Klopfens zwischen ihren weit gespreizten Oberschenkeln hatte und den glatten, lackierten Körper in der klassischen, uralten Haltung einer Frau hielt, die das Fleisch und den Samen eines Geliebten tief in ihren Schoß aufnahm.
Frisch: Nicht nur war er jung, höchstens Mitte zwanzig, sondern auch die Art und Weise, wie sein rasiertes, blasses Gesicht seine rosige Jugend verströmte und wie der Tag hinter ihm im eisigen Winterglanz knisterte – der tief aquamarinblaue, wolkenlose Toronto-Himmel und die sanften Hügel der Schneewälle glitzerten und dampften im goldenen Sonnenlicht. Sonntagmorgen, menschenleere Straßen. »Ja? Kann ich Ihnen helfen?« – sofort bedauerte sie ihren Tonfall, zu übereifrig, wie sie fand, zu abschreckend, während sie sah, wie die Röte seine rundlichen Wangen überzog wie Nesselausschlag. Er drehte an den Enden seines Schals und sagte: »Entschuldigung. Ich wollte nur. Entschuldigung, aber ich habe mich gefragt … es ist, ähm, der Wohnungsmarkt ist momentan so angespannt, und ich dachte, ich kam zufällig hier vorbei, und ich dachte, ich hätte mal ein ›Zu vermieten‹-Schild auf Ihrer Veranda gesehen? Ist schon eine Weile her, ich weiß …«
»Mehr als eine Weile«, erwiderte sie. Sie wusste, wann. Über die Inseln der Jahreszeiten hinweg, in einem schwülen Sommer voller Schweiß, Erschöpfung und unerträglicher Aussichtslosigkeit. Das Summen der Klimaanlagen auf der Straße und das Sirren der Mücken in ihrem Ohr, wenn sie sich auf klammen Laken wälzte und drehte und vergeblich um den Schlaf rang, der nicht kommen wollte. Ein Jahr. Es musste gut über ein Jahr her sein.
»Entschuldigung«, sagte er erneut und schaute zu Boden, wo er von einem Fuß auf den anderen trat. »Ich wollte nicht … wollte nicht stören …«
Sie bemerkte, dass sie an ihm vorbeistarrte, und wandte den Blick wieder auf sein glattes, leuchtendes Gesicht mit den rosigen Wangen. Sein blondes Haar war an den Seiten kurz geschnitten, oben fiel es jedoch lang und glatt herunter, was sie an einen Welpen erinnerte, der unsicher auf zitternden Beinen steht. Sie war fast größer als er. »Macht nichts«, sagte sie. »Sie haben recht, da war ein Schild. Hier.« Sie deutete auf die Verandascheibe.
Sie hatte damals gedacht … was hatte sie gedacht? Hatte sie überhaupt gedacht? In dem Durcheinander der Katastrophe gab es keine Logik, lächerliche Vorstellungen hatten sich ohne irgendeinen Zusammenhang in ihrem Kopf niedergelassen und ein Eigenleben geführt wie ein wildes Rudel von Störenfrieden. Eine davon war, einen Untermieter ins Haus zu holen. Als ob sie das Geld bräuchte. Die Ausgleichsregelungen hatten ihr ein hypothekenfreies Haus beschert, und sie hatte auch noch was auf der hohen Kante. Nein, ihr Gehalt reichte für ihre und Warrens Ausgaben aus.
Sie hatte damals nicht erkannt, dass der Gedanke an einen Untermieter womöglich daher rührte, dass ein Teil von ihr vor kurzem amputiert worden war und die frische Wunde des Verlustes in stummem Schmerz nach Linderung durch die Anwesenheit eines anderen Mannes im Haus schrie. Ein Dritter, um das zerbrochene Dreieck wieder zu vervollständigen. Kaum war es ihr klargeworden, hatte sie das Schild wieder abgenommen.
Zu vermieten. Sie erinnerte sich daran, wie sie es bei Canadian Tire gekauft hatte. Rot und schwarz. Ja, sie hatte es an die Scheibe der verglasten Veranda gehängt. Hatte sie das wirklich getan? Waren das ihre Hände gewesen oder die von jemand anderem? Hatte sie es Warren machen lassen? Schwer zu sagen, welche Erinnerungen real und welche eingebildet waren, wenn das Gehirn nicht mehr richtig funktionierte, halb gelähmt vom Schock der Ereignisse, als ob es vom Gift einer eindringenden Kreatur verseucht worden wäre, die man Stress oder Angst nannte oder mit einem anderen erfundenen Wort bezeichnete, um die Realität mit einem hübschen Klangpaket zu beschönigen. Damals hatte sie auch Tabletten genommen. Sie hatte diese chemische Verseuchung gebraucht, denn das war noch bevor sie das Wahre Wissen entdeckt hatte …
»Sie ist schon weg, oder?«, fragte er, und sie stellte fest, dass sie mehrmals den Kopf schüttelte, aber ihr Gesicht musste etwas anderes ausgedrückt haben, denn er fragte: »Nicht?«
»Ich habe mich dann entschlossen, doch nicht zu vermieten.«
»Oh«, sagte er. »Okay. Ich verstehe. Darf ich fragen, ob es im Souterrain war?« Er lächelte. »Dann wäre ich nicht so enttäuscht.«
»Ach? Und warum?«
»Ich will nicht mehr in einem Keller leben«, antwortete er. »Ich habe die Nase gestrichen voll von Kellern.«
Das Lächeln und die verdrehten Augen waren eher eine bewusste Geste als ein echter Ausdruck von Heiterkeit, und er präsentierte sie mit großem Selbstvertrauen, wie eine Fahne des Übermuts über der Verwundbarkeit, die sie darunter erahnte. Sie fand das unerwartet rührend und sagte: »Im Souterrain gibt es ein Zimmer mit Bad.« Dann fügte sie wahrheitsgemäß hinzu (aber warum nur?): »Und es gibt noch eine Wohnung – im dritten Stock.«
Schnell fragte er: »Welche Einheit wollten Sie vermieten?« Eine gebildete Ausdrucksweise, eine Prise Intelligenz und sprachliche Gewandtheit als Ergänzung zum weichen Welpenhaar und zu den strahlend weißen Zähnen.
»Wusste ich selbst nicht so genau«, antwortete sie. »Irgendeine. Beide.«
»Aber dann haben Sie sich dagegen entschieden«, sagte er, zuckte mit den Schultern und drehte seine Handflächen nach oben. »Schade.« Er blickte geradewegs nach oben, dorthin, wo die durchscheinenden Eiszapfen wie eine Reihe tropfender Reißzähne von der Dachtraufe hingen. »Tolles altes Haus.« Er deutete nach rechts. »Die U-Bahn ist gleich um die Ecke. Schöne Geschäfte. Coole Bars. Ich mag die Gegend.«
»Sind Sie Student?«, fragte sie.
Er stieß einen abfälligen Laut aus und schüttelte den Kopf.
So begann es. Sie hätte ihn die gefegte Treppe hinuntergehen und wieder in der klaren Frische verschwinden lassen können, aus der er erschienen war wie Schneestaub, hätte sich hinter ihre dicke Eichentür zurückziehen und das Cello zwischen ihre gespreizten Knie sinken lassen können. Aber sein körperliches Schulterzucken schien in ihr ein mentales ausgelöst zu haben, ein Gefühl von: warum nicht?, und so holte sie diesen jungen Fremden ins Haus und zeigte ihm beide potentiellen »Einheiten«, wie er sie nannte, zuerst das Souterrainzimmer gegenüber der Waschküche mit eigenem Bad, und dann stiegen sie gemeinsam die knarrende Treppe in den dritten Stock hinauf, ein Weg, den sie seit Ewigkeiten nicht mehr zurückgelegt hatte – seit der Katastrophe. Ihre Hand zitterte auf dem Geländer.
Es war fast schockierend, einzutreten und eher das Gefühl eines sich öffnenden Raumes zu verspüren als die vertraute düstere Beklemmung, die erstickende Atmosphäre von kränklicher Wärme und medizinischem Geruch, und nach etwas anderem, süßlich Fauligem, unverkennbar der von (oh, das wusste sie, und wie sie das wusste) verwesendem Fleisch. Verfaulend, während das Herz weiter schlug.
Er fragte sie, ob es ihr gutginge, ob ihr durch das Treppensteigen schwindelig geworden sei oder so. »Nein«, sagte sie. »Es geht mir gut. Gehen Sie rein. Schauen wir uns mal um.«
Sie war sich immer noch nicht sicher, warum sie das tat, denn diese Wohnung wollte sie nie wirklich vermieten – oder? –, aber sie schlüpfte ganz mühelos in die Rolle der Immobilienmaklerin, die einen potentiellen Kunden durch die Räumlichkeiten führte. In der Kochnische stand ein neuer Kühlschrank (nicht angeschlossen), und in den Schubladen befanden sich sogar Kochutensilien, Töpfe und Pfannen, im Hängeschrank stand Geschirr. Sie erinnerte sich erst daran, dass all das noch hier war, als sie es sah und berührte – Instrumente vergeblicher Ernährung, denen sie nicht mehr hatte nahekommen können, nachdem es vorbei war. Es erschreckte sie, dass sie etwas so vollständig vergessen konnte. Welche anderen Bestandteile ihres alten Lebens waren für sie verloren?
Das Apartment bestand aus einem langgestreckten offenen Raum unter freiliegenden Dachbalken. »Im Sommer kann es hier oben sehr heiß werden«, erklärte sie. »Es gibt keine Klimaanlage, aber wenn man alle Fenster öffnet und die Deckenventilatoren einschaltet, ist es luftig und angenehm.« Schwüle wie giftige Suppe. Den ganzen Sommer über hatte sie keine Luft bekommen. Die lebhaften Farben draußen im Garten, drinnen das triste Grau – die Arzneifläschchen, der Kittel der Krankenschwester, die Laken und das fahle Fleisch. Andere schwitzten, aber ihm wurde nie richtig warm, sogar unter zusätzlichen Decken zitterte er. Seine Stimme, die im Delirium wegdriftete – er redete vom Thermostat und einem zerbrochenen Fenster, sein sehr kanadischer Alptraum, auf einen herannahenden Winter nicht vorbereitet zu sein. Sie erzählte ihm von dem Park draußen, wenn sie vom Joggen zurückkam, von den üppigen Blumenbeeten, von den gründelnden Gänsen im Teich, von den wundersam verdrehten Zedernbäumen am Ufer. Doch er murmelte etwas von Eisstürmen, gefrierendem Graupel – sein persönlicher Winter, eine schwarze, eisige Jahreszeit, die gekommen war, um ihm die Wärme seines Blutes für immer zu stehlen.
Die Süd-Fenster, hohe, spitz zulaufende Dreiecke, gemahnten fast an eine Kirche, und sie zog die Jalousien hoch, um dem jungen Fremden die Schiebetüren zu zeigen, die sich zu einem Balkon öffneten – eine kleine Holzkiste, die über dem Garten thronte und einen Blick über die Dächer hinweg auf den fernen See bot. Gemeinsam schauten sie hinaus über den Schnee auf dem Balkon, und er lehnte sich am Türrahmen nach vorne und sagte, was die Leute immer sagten: »Wow! Wirklich schön hier oben.«
Der Himmel Ontarios war so weit und tief wie ein umgekehrtes, gefrorenes Meer, in das der spitze Finger des CN-Towers im Osten stach, umgeben von dichten Hecken plastikgelber und blutergussblauer Wohntürme. Toronto: flach und breit und fade. Blasser Rauch stand fast unbeweglich über den Schornsteinen am Horizont; die Abgase verzogen sich durch die Winterkälte nur im Schneckentempo. Die Sonne schien hell auf die nackten Ahornbäume hinter dem Schuppen im Garten unten.
Zurück in der Wohnung, zeigte sie ihm das Badezimmer. Der Duschkopf stand in seltsamem Winkel vom steil abfallenden Dach über der Wanne ab. (»Zum Glück bin ich nicht groß«, sagte er, und wieder fragte sie sich, warum sie als Verkäuferin für etwas auftrat, das sie nicht verkaufen wollte.) Sie vermied es, den Arzneischrank und die Toilette anzusehen – sie ließen zu viele schlimme Erinnerungen aufblitzen.
Sie öffnete die Schlafzimmertür, trat aber nicht hindurch und beobachtete, wie er über den knarrenden Hartholzboden schritt. »Schön groß«, sagte er. »Und viel Stauraum, wie ich sehe.«
Durch die Fenster der Dachgaube blickte man auf die Straße, von der er gekommen war, sowie auf die Veranden gegenüber. Er stand vor dem begehbaren Kleiderschrank. Sie starrte in die Ecke, in der das Bett gestanden hatte. Dort drüben der Stuhl für die Krankenschwester. Der fahrbare Infusionsständer mit den baumelnden Beuteln mit Morphium und anderen klaren Flüssigkeiten und seinem unaufhörlichen Zwitschern hatte dort gestanden, an dieser Stelle. Sie war sich sicher. Ziemlich sicher.
Wieder fragte er, ob es ihr gutgehe. Sie stellte fest, dass sie sich entfernt hatte und auf dem Geländer mit Blick auf die kurze Treppe hinunter zur Tür saß, die Arme verschränkt und in sich zusammengesunken.
Diesmal sagte sie nicht, dass es ihr gutginge. Sie sagte: »Wir sollten jetzt lieber gehen.«
Die Betäubung durch die Arbeit – darauf hatte sie sich immer verlassen können. Welche Gefühle, Erinnerungen und Beklemmungen von dem Besuch des potentiellen Mieters am Sonntagvormittag auch aufgewühlt worden waren (Gespenster, hätte sie gedacht, wenn sie an diese nicht mit einer Gewissheit geglaubt hätte, die die Verwendung des Wortes als Metapher ausschloss; es wäre ihr als eine Art leichtfertiger Blasphemie erschienen, die nur die Ahnungslosen in den Mund nahmen, die in das Wahre Wissen nicht eingeweiht waren), so wurden sie am Montag und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag unter dem Druck ihrer Tätigkeit als Einkäuferin für eine Mode-Einzelhandelskette, die sich auf Bekleidung für Frauen im reifen Alter spezialisiert hatte, schnell begraben. Ihre Arbeitstage verbrachte sie wie immer vor dem Bildschirm am Schreibtisch mit Blick auf den Dundas Square (eine armselige Miniaturkopie des New Yorker Times Square, Sinnbild sowohl für Torontos kriecherischen Minderwertigkeitskomplex, die Hassliebe der Unterlegenen, als auch für den real existierenden Kultur-Kolonialismus der mächtigen USA) den ganzen Tag flackerte ein riesiger Fernsehbildschirm an der Seite eines Gebäudes. Die Kaffeetassen im Büro wurden klebrig, die Blumen welkten in den Töpfen, und die Telefone ergossen ihr stummgeschaltetes Meckern unaufhörlich über die Büroeinheiten und die grauen Quadrate des Industrieteppichs; das Plastikgeklapper der Tastaturen wie ein konstanter Atem im Hintergrund.
Taubheit. Jeder bei der Arbeit ist müde, die Haut spannt sich über die Wangenknochen. Die Arbeitswelt ist die Zombie-Welt. Man wusste die Schönheit von Kindheit und Jugend nicht zu schätzen, bis man an diesen Ort gelangte. Kränklich blass unter den Quadraten der Natriumdampflampen. Oder bis man so weit war, eben diese Zombie-Tristesse als die Droge zu begrüßen, die sie war.
Die meiste Zeit saß sie mit Headset am Computer, zugleich online und am Telefon, und verhandelte in dieser Haltung mit Lieferanten auf anderen Kontinenten, gewöhnlich in Entwicklungsländern, bis sie am ganzen Körper stocksteif war. Termindruck und adrenalinpushende Risiko-Momente machten es gnädigerweise unmöglich, an etwas anderes zu denken. Kein Platz für irgendwelchen Spuk.
Als am Freitag das Telefon klingelte, stieg ihr schon die Röte über den Nacken, bevor sie den Hörer abnahm – sie wusste genau, wer es war. Dann hörte sie die Stimme und sah im Geist das frische Gesicht unter dem blonden Welpenhaarschopf vor sich. Der Zufall mit dem Cello und seinem Auftauchen (aber es gibt keine Zufälle in dieser Welt, sie glaubte es, sie wusste es, sie fühlte, dass in Wahrheit der Zufall nur die Oberfläche der tiefer verborgenen Wirklichkeit ist, welcher der menschlichen Wahrnehmung verborgen bleibt) war, wie dieser noch stärkere Moment der Vorahnung, ein Schimmer der tieferen Wahrheit, der die Textur des Alltags durchdrang.
Er entschuldigte sich sofort dafür, dass er sie bei der Arbeit angerufen hatte, dass er sie »nervte«, aber es sei dringend, die Wohnungsknappheit in Toronto sei wirklich extrem. Es gebe nur Kellerräume, und die Mietpreise, die verlangt wurden, seien »einfach astronomisch«. (Die Immobilienpreise schossen ebenfalls raketenartig in die Höhe, wie jeder wusste; getrieben von magersüchtigen Zinssätzen und dem Zustrom ausländischen Kapitals und wohlhabender Einwanderer in die Stabilitäts-Utopie Kanadas inmitten einer chaotischen Welt.)
Sie habe erwähnt, wo sie arbeite, und er hoffe, es mache ihr nichts aus, dass er »die Initiative ergriff« und es noch einmal versuchte, um zu hören, ob sie es sich noch einmal überlegen würde; er habe sich richtig in diese leere Wohnung »verliebt«, und er würde ein »ausgezeichneter, ausgezeichneter Mieter« sein, sehr ordentlich und ruhig. Er sei bereit, ihr zusätzlich zur ersten und letzten sechs volle Monatsmieten im Voraus zu zahlen. Er könne sich … (und hier zögerte er zum ersten Mal, seine Zuversicht wankte) … zwölf- oder sogar … fünfzehnhundert im Monat leisten.
Sie musste unwillkürlich lächeln. Es ging ihr nicht um das Geld – und doch wusste sie, dass die Wohnung auf dem heutigen Markt locker zweitausend oder mehr einbringen konnte.
Sie bat ihn, einen Moment zu warten, saß still da und lauschte seinem Atem und fernen Klängen von Musik im Hintergrund. Das Gerede über Geld hatte in ihr eine Saite des Mitleids zum Schwingen gebracht. Mitleid mit der Leere im dritten Stock, dem Hohlraum in ihrem eigenen Leben. Mitleid für die Verzweiflung, die sie unter der Munterkeit dieser jungen Stimme spürte. Mitleid: eine Kerze im schwarzen Sturm um uns herum, dem scheinbar gefühllosen Gesicht der Natur. Die Kälte draußen, die immer versucht, in unser Leben einzudringen, es uns zu nehmen. Dieses Universum ist eine Prüfung. Wirst du die Flamme, die Wärme bewahren?
Das Mitleid ging mit den Botschaften einher, die sie aus der tieferen Wirklichkeit erhalten hatte, mit dem Cello-Zufall und dem Wissen um den Ruf, der sie zur Aufmerksamkeit mahnte. Das Wort »Engel« geht auf das hebräische Wort für »Bote« oder auch »Botschaft« zurück. Von oben. Dieser junge Mann hielt etwas für sie bereit.
»Sie haben mir noch gar nicht erzählt, was Sie beruflich machen«, sagte sie ins Telefon und stellte fest, dass seine Fähigkeit, so lange schweigend zu warten, sie beeindruckt hatte.
»Ich bin Maler«, sagte er. »Und zwar nicht im Sinn von Anstreicher.«
Warren erzählte sie davon, während sie abends das Essen zubereitete, was für sie zu einem Ritual geworden war. Die Heftigkeit seiner Reaktion traf sie unvorbereitet. Er wandte abrupt sein ernstes, schmales Gesicht ab, nahm sein Glas Milch, das er immer nach dem Essen trank, und ließ sie allein am Tisch sitzen. Er brauchte das Wort nicht aussprechen. Verräterin. Sie konnte ihm nicht hinterhergehen, denn was hätte sie auf seinen Vorwurf erwidern können, wenn ein Teil von ihr selbst so dachte?
Der Erste dieses eisigen Monats fiel auf einen trostlosen, dunklen Samstag. Der Mieter traf nicht mit einem Laster oder Lieferwagen ein, sondern lediglich mit einem verrosteten alten Chrysler, den ein Freund fuhr. Auf dem Dach war eine Matratze festgezurrt, deren herabhängende Ränder unter einer flatternden Plastikplane sichtbar waren. Sie saß auf der Couch und tat so, als würde sie lesen, während das alte Haus von dem dumpfen Dröhnen und dem gedämpften Schleifen der Möbel erbebte, die die Eichentreppe hinaufgeschleppt wurden. Es gab einen Seiteneingang, den er als seinen eigenen benutzen konnte. Als sie seltsame hölzerne Klopfgeräusche hörte, wagte sie es, die Tür zu öffnen, die »ihre« Etage (das instinktive Bewusstsein für Raum, Territorium und Besitz hatte sich bereits verschoben) mit dem Treppenhaus verband. Er ging gerade unbeholfen mit einer zusammengeklappten Staffelei unter dem Arm die Stufen hoch. Ein Maler, nicht im Sinn von Anstreicher – was malte er wohl? Immer noch neugierig, zog sie sich zurück, ohne dass er sie gesehen hatte.
Erst der Tumult, dann die Ruhe. Zuerst der rauschende Wasserfall und dann die ungetrübte Stille des Sees; zuerst Blitz und Donner, dann der stetige Regen. Auch unter den Menschen ereignet sich der Energieausbruch jedes Mal an dem Punkt, an dem sie einander begegnen und die Beziehungen definiert werden. Anschließend verebbt er in einer flachen Ebene kontinuierlicher Stabilität, etwa wenn sich zwei Gruppen von Frauen treffen und ihre hohen, vogelähnlichen Schreie ausstoßen, ihre Arme wie Flügel flattern lassen, ihre gespitzten Münder wie Schnäbel in die Gesichter der anderen picken, dann aber bald in einen ruhigeren, konstanten Sprechrhythmus verfallen, den sie über Stunden hinweg durchhalten können …
Zugegebenermaßen empfand sie einen Stich – von was? Enttäuschung? –, als in den Tagen nach dem anfänglichen Wirbel, dem Schock des Neuen, ein fortgesetztes Schweigen folgte, gerahmt von der angespannten unterschwelligen Gewissheit, dass sich nun ein anderer Mensch über ihr aufhielt, unterbrochen von dem diskreten Knarren, das sein Gewicht durch das gealterte Holz des Hauses sandte. Weder hörte er laute Musik, noch empfing er Besucher. Er benutzte die Treppe unregelmäßig und schien die meiste Zeit zu Hause zu sein. Sie erwartete, dass ihr das alles allmählich gleichgültig werden würde, aber das geschah nicht. Die langen Phasen absoluter Stille oben wirkten wie ein Vakuum, das Bilder von ihm aus ihrer Phantasie hervorzauberte, wie er in dem hellen offenen Raum bei der Arbeit war. Diese selbst erdachten Bilder hatten etwas Romantisches – was könnte romantischer sein als ein Maler in einem Dachgeschoss, der die einsame Reise des Künstlers durch die langen einsamen Minuten eines jeden Tages unternimmt?
Doch als sie ihn schließlich bei der Arbeit zu Gesicht bekam, wurde sie von der prosaischen, beinahe schmuddeligen Banalität der Szene enttäuscht. Die Gelegenheit dazu bot sich, als sie am Wochenende einmal einen Dachdecker in die Wohnung lassen musste, damit er einen Blick auf den Zustand des Schiefers über dem Balkon auf dieser Seite des Hauses werfen konnte. Sie klopften, hörten aber keine Antwort, und daher benutzte sie ihren Schlüssel, um sich Einlass zu verschaffen. Sie hatte sich einen sauberen Raum mit einer breiten Leinwand auf der Staffelei vorgestellt, die er am Tag seines Einzugs die Treppe hinaufgeschleppt hatte, davor den Künstler mit Palette in der Armbeuge im strahlenden Licht, das durch die großen Fenster hereinfiel. Stattdessen fand sie ein Durcheinander aus verstreuter Kleidung, Socken und Unterwäsche vor, und in der Küche stand schmutziges Geschirr herum. Abgenutzte Möbel, wie sie die Leute zum Mitnehmen auf den Bürgersteig stellen, entweihten diesen heiligen Raum; einige waren mit Tüchern bedeckt, entweder, um sie zu verhüllen, oder weil sie zu schmutzig waren.
Der »Künstler« selbst kauerte vor einem klapprigen Schreibtisch in einer hinteren Ecke, und man sah sofort die weißen Kabel, die ihm aus den Ohren hingen und die heutzutage bei Einzelpersonen in der Öffentlichkeit zur Standardausrüstung gehören. Sie waren an einen Laptop angeschlossen: Seine Finger huschten über die Tasten, als leiste er ganz normale Büroarbeit. Zwar lag ein Stapel weißer Papiere herum, auf denen Skizzen zu sein schienen, und weitere Blätter waren unter dem Schreibtisch und um seine Füße herum verstreut, aber sie sah keinerlei Anzeichen von Farbe oder einer Staffelei.
Entweihung.
Das tat ihr tatsächlich in der Seele weh, während sie und der Dachdecker sich durch die Unordnung auf dem Dielenboden einen Weg in Richtung seines gebogenen Rückens bahnten. Als wäre das Grab mit Dung überhäuft worden, als wäre darauf gespuckt worden! Ich will ihn raushaben, raus!
Er erschrak, als der Schatten des Dachdeckers über ihn fiel, fuhr herum, sah sie, zuckte zusammen und riss mit derselben Bewegung die Ohrstöpsel heraus. Im Schreckmoment spiegelt das Gesicht eines Menschen am ehrlichsten seine Psyche wider, denn es bleibt keine Zeit, eine Maske zu konstruieren. Für einen Augenblick sah sie das verzerrte Gesicht eines kleinen Jungen, der gleich anfangen würde zu weinen, die Mundwinkel nach unten gezogen, die Augen aufgerissen, die Stirn gerunzelt. Dann stand er auf, und seine Gesichtszüge versteinerten.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Wir haben geklopft, aber niemand hat reagiert.«
Seine Augen huschten zum Dachdecker und zurück, und dieser, ein gedrungener, herzlicher Mann mit dem Singsang der kanadischen Seeprovinzen, sagte fröhlich: »Will nur mal eben einen Blick auf die Schindeln werfen«, entriegelte pfeifend die Schiebetür, trat hinaus auf den Balkon, schob mit den Stiefeln den hohen Schnee beiseite und ließ einen Zug frische Winterluft in die Wärme des chaotischen Zimmers. Sie nutzte die Gelegenheit, sich an ihrem Mieter vorbeizudrängen, die Tür zuzuschieben und sich unter vier Augen an ihn zu wenden, um sich erneut zu entschuldigen. Doch er kam ihr mit zitternder, leiser und erstickter Stimme zuvor: »Sie müssen mir vorher Bescheid geben.«
»Wir haben angeklopft …«
»Das spielt keine Rolle«, sagte er, sah sie nicht an und ließ den Blick stattdessen über den vollgemüllten Boden schweifen. »Sie müssen mir mindestens vierundzwanzig Stunden vorher Bescheid geben.« Er schwieg. »Laut Vertrag.«
Das Wort fiel mit einem stählernen Gewicht zwischen sie, und sie sahen sich über seinen lautlosen Aufprall hinweg an. Jetzt verzog sie das Gesicht, und ihr inneres Kind kam jammernd zum Vorschein. Er war kein Familienmitglied oder Gast in ihrem Haus – er war ein Mieter. Mit Rechten, die ihm der Staat gewährte und die von der ganzen Kraft seiner ehernen Autorität geschützt wurden. Man musste schon sehr naiv sein, um sich zur Vermieterin aufzuschwingen, ohne sich vorher mit seinen Rechten und Pflichten vertraut zu machen. Wieder einmal zeigte sich ihre Unfähigkeit, auch nur die geringsten häuslichen Aufgaben zu übernehmen, und sie stotterte: »Ich … Ich wusste nicht, dass wir … dass wir so … förmlich sein müssen … diese Handwerker, man weiß nie, wann mal einer Zeit hat … und dann kommen sie nicht, wann sie sollen, und ich muss mir extra freinehmen. Aber ich bin … Es tut mir leid, wenn Sie das Gefühl haben, dass …«
»Schon gut«, sagte er, winkte ab und drehte sich weg. Aber er murmelte noch: »Mir wäre nur …«
»Wie bitte?«
»Ach, ich weiß nicht, mir wäre es eben lieber gewesen, wenn ich es vorher gewusst hätte. Dann hätte ich aufgeräumt …«
Eilig versicherte sie ihm, das mache doch nichts, die Wohnung sei vollkommen in Ordnung. Die Lüge sprudelte mit der ganzen Fröhlichkeit der kanadischen Pseudo-Aufrichtigkeit heraus, Höflichkeitslügen, die so selbstverständlich fallen wie die Schneeflocken vom fahlen Winterhimmel.
Am nächsten Tag bei der Arbeit googelte sie ihn zum ersten Mal und fand zu ihrer Enttäuschung nur wenige Informationen – keine Website, keine Accounts in den sozialen Netzwerken. Er wurde nur hier und da erwähnt – etwa in einem College-Absolventen-Newsletter, bei einem Hockeyteam –, doch daraus erfuhr sie kaum mehr, als sie bereits wusste. Ein Maler, der keine Bilder produziert, ist überhaupt kein Maler. Ich habe mir einen völlig Fremden ins Haus geholt! In einer Art Panik las sie im Residential Tenancies Act, dem kanadischen Mietgesetz, nach, und stellte fest, wie unwissend sie war, denn in ihrer Provinz Ontario war das Gesetz ganz auf Seiten des Mieters, und sie sah mit Schrecken, dass er nicht nur recht hatte, was die Notwendigkeit einer (schriftlichen) Vorankündigung vor einem Besuch jeglicher Art betraf, sondern dass es als schwerwiegende Verletzung der Mieterrechte angesehen wurde, dies nicht zu tun. Sie hatte nicht gewusst, dass es für sie praktisch unmöglich war, einem Mieter zu kündigen – selbst wenn er keine Miete mehr zahlte. Sie geriet in helle Panik. Sie hatte die Miete für diesen Monat noch nicht erhalten (sie hatte nicht auf den sechs Monaten im Voraus bestanden, die er ihr damals am Telefon angeboten hatte, sondern nur auf zwei). Es könnte Monate, vielleicht Jahre dauern, bis ein Urteil gefällt wurde, damit er ausziehen musste, und in der Zwischenzeit … In den Internetforen wimmelte es von Horrorgeschichten über Vermieter, deren Eigentum missbraucht und denen das Leben von skrupellosen Mietern schwer gemacht wurde.
Der Schatten der Erinnerung in den Räumen über ihr war ihr wundester Punkt gewesen – die menschliche Sterblichkeit, immer nah, stets verdrängt, ignoriert –, beladen mit dem Gewicht eines sterbenden Mannes, den sie einen so großen Teil ihres Erwachsenenlebens lang geliebt hatte, dessen Anwesenheit einst so tiefe Spuren in ihrem Wesen hinterlassen hatte, dass es schien, als wären sie eins gewesen.
Jetzt hauste im Stockwerk über ihr eine andere Angst, die nicht im Geringsten gelindert wurde, als er am Ende des Monats an »ihre« Tür klopfte – die Tür zur Treppe im Flur –, an einem Donnerstagabend, während sie und Warren in der Küche Nudeln kochten und der Dampf die Fenster über der Spüle beschlug. Der Mieter stand lächelnd in seinem verblichenen blauen Wintermantel da und reichte ihr einen unverschlossenen Umschlag. Sie öffnete ihn, sah darin Geldscheine und war sich nicht sicher, was sie damit machen sollte. Sie erinnerte sich an alle Websites, auf denen es hieß, man solle bloß kein Bargeld von einem Mieter annehmen. »Lassen Sie sich vordatierte Schecks schicken«, wurde geraten. Bargeld könnte ein Zeichen für illegale Aktivitäten sein. Er verlangte eine Quittung.
»Ich … habe keine«, sagte sie. »Tut mir leid. Ich habe keinen Quittungsblock.«
Er zuckte mit den Achseln und erwiderte, sie könne ihm die Quittung ja unter der Tür durchschieben; dann ging er die knarrende Treppe hinauf, bevor ihr eine Erwiderung einfiel, und ließ sie mit dem Geld in der Hand und ihrer Martha-Stewart-Schürze um die Taille zurück. Am nächsten Tag ging sie bei Staples vorbei, kaufte einen Quittungsblock, füllte eine Quittung ordnungsgemäß aus und unterschrieb sie. Als sie hinaufging, um sie unter seiner Tür durchzuschieben, blieb sie einen Moment davor stehen, holte tief Luft und klopfte an. Diesmal hatte er wohl keine Stöpsel in den Ohren, denn sie hörte prompt seine Schritte und dann schwang die Tür auf.
»Ich bringe Ihnen Ihre Quittung.«
»Danke.«
Sie zwang sich, gar nicht erst zu versuchen, an seiner Schulter vorbei und die Treppe hinauf zu blicken, um den Zustand des Zimmers zu kontrollieren, und sagte: »Sie zahlen also lieber bar?«
Er nickte. »Ja, das funktioniert bei mir besser. Das ist doch kein Problem für Sie, oder?«
»Nein«, log sie sofort. »Es ist nur … es wäre einfacher für Sie, ich meine – mit Schecks. Sie müssten nicht jeden Monat vorbeikommen und mir das Geld geben.«
Er lächelte. »Aber mir ist es so lieber«, sagte er. »Es ist irgendwie altmodisch. An jedem Ersten des Monats Bargeld in der Hand.« Er schwieg. »Ich finde, die Leute begegnen sich heutzutage viel zu wenig persönlich. Alles geht online.«
»Okay«, war alles, was sie sagte, und sie gab sich geschlagen und ging wieder nach unten. In dieser Nacht fand sie keinen Schlaf; die unsichtbaren Fäden der Angst sanken durch die Decke herab, um an ihrem Körper zu zerren, als wäre sie eine Marionette und er die kapriziöse Hand, die sie zum Zappeln und Drehen brachte. Gegen Mitternacht hörte sie ein leises Knarren und wusste, dass er über ihr umherlief. Sie stellte sich vor, wie er ins Badezimmer mit dem schrägen Dach und dem extragroßen Medizinschrank ging, den sie hatte anbringen lassen. Dadurch stiegen automatisch Bilder von Rory in ihr auf, auf dem großen elektrisch verstellbaren Bett ausgestreckt, das sie für ihn gekauft hatten, die Augäpfel tief in den knochigen Höhlen versunken. Sein Körper hatte in seinen fiebrigen Kämpfen sogar die mageren Fettreserven des Gesichts aufgezehrt, so dass sie den beunruhigenden Eindruck hatte, sein Gehirn selbst schrumpfe jetzt, und vielleicht war das am Ende auch der Fall gewesen.
Sie lag wach und wartete darauf, dass der Fremde wieder zu Bett ging, wurde aber von noch lauterem Knarren überrascht, diesmal von der Treppe her. Er ging hinunter und dann durch die äußere Seitentür hinaus. Sie hörte, wie sie sich öffnete und schloss. Sie lag noch sehr viel länger wach, noch um fünf Uhr morgens, als er im Dunkeln zurückkehrte und knarrend die Treppe wieder hinaufstieg.
Irgendein innerer Kern ihres Gehirns reagierte nun auf seine Ausflüge am frühen Morgen, auf seine Bewegungen auf der Treppe, die sie zuvor verschlafen hatte. Sie erwachte unweigerlich sowohl bei seinem Aufbruch als auch bei seiner Rückkehr. Warren beendete jedes Abendessen mit einem Glas Milch, in das mehrere Esslöffel Muskelaufbaupulver eingerührt waren. Er war schmal für seine dreizehn Jahre, ein schüchterner Junge, der die Angewohnheit hatte, nervös auf seiner Unterlippe zu kauen. Er fragte sie, ob er nach unten in den Kellerraum ziehen dürfe. Es war ihr nicht recht, aber sie fand keinen triftigen Grund, ihn davon abzuhalten. Sein Zimmer lag neben ihrem, und sie wusste, dass auch er das Rumoren und Knarren des Fremden im Obergeschoss hören konnte, und er sagte, dass es ihn störe. Inzwischen kannte sie das Muster der nächtlichen Exkursionen ihres Mieters: Jeden Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend verließ er gegen Viertel nach zwölf das Haus und kam gegen halb sechs Uhr zurück. Sie hätte ihn gerne danach gefragt und überlegte, wie sie das wohl bei der Entgegennahme des Bargeldumschlags am Ersten jedes Monats beiläufig tun könnte, doch immer, wenn er direkt vor ihr stand, brachte sie es nicht über sich, lächelte nur und reichte ihm die Quittung.
Das Bargeld in der Hand.
Irgendwie altmodisch, hatte er gesagt. Lieber nicht online. Menschlicher Kontakt statt unpersönliches Internet. Doch eben dieses Internet warnte sie davor, Bargeld anzunehmen, da es auf illegale Aktivitäten hinwies. Ein junger Mann, der nachts unerklärliche Dinge trieb. Ein Drogenhändler: gar nicht abwegig.
Wenn es an der Tür zum Flur neben der Küche klopfte, war das für Warren der Startschuss, nach unten in sein neues Zimmer zu eilen – er wollte nicht dabei sein, wenn der Fremde, der auf der Todesetage lebte, auftauchte. Bald schon entschuldigte er sich früh an jedem Monatsersten, lange bevor sich der Mieter ankündigte. Sie dagegen wartete voller Anspannung auf sein Klopfen. Die Quittung lag dann bereits ordentlich ausgefüllt neben dem Basilikumtopf auf der Fensterbank bei dem Regal mit den dicken Kochbüchern, gegenüber der glänzenden Spüle mit den darüberhängenden Utensilien, die sie stets makellos sauber hielt (was für ein Kontrast zum Zustand der Küche oben!).
In diesem Monat ertappte sie sich dabei, wie sie das Geschirr vor seinem üblichen Klopfen wegräumte, eine Kanne Pfefferminztee zubereitete und einen Teller mit Butterkuchen hinstellte. Und als das Klopfen ertönte, faltete sie ihre Schürze, legte sie weg, warf einen Blick in den Spiegel und strich sich vor dem Öffnen eine verirrte Locke hinters Ohr. Mit seinem Lächeln und seinem Umschlag mit Bargeld stand er vor ihr. Diesmal war er aus der Wohnung oben gekommen und nicht wie sonst von draußen. »Kommen Sie herein«, sagte sie. »Und setzen Sie sich.« Sie ging weg, bevor er die Chance hatte, ihr Angebot abzulehnen.
Sie setzte sich an den Tisch und sah zu, wie er zur Küchentür hereinkam, ein junger Mann mit zaghaftem Lächeln und dichtem blondem Haar. Man kann niemanden dazu zwingen, etwas von sich preiszugeben, aber welcher Kanadier würde schon an Gewaltanwendung denken, wenn Freundlichkeit so viel effektiver und eleganter Zugang verschafft und neugieriges Schnüffeln ermöglicht? »Trinken Sie eine Tasse Pfefferminztee mit mir? Ich koche ihn aus frischen Blättern.«
Sie sah ihn zögern. »Bitte. Ziehen Sie Ihren Mantel aus.« Ein weiterer kanadischer Imperativ – die Unhöflichkeit, den Mantel anzulassen, wäre zu krass gewesen, als dass er sich widersetzen konnte, und er zog ihn aus und hängte ihn über die Stuhllehne, wobei seine Augen zu dem Butterkuchen huschten. Sie forderte ihn auf, ihn zu probieren, ein altes Familienrezept, allerdings mit Rosinen. Wieder zögerte er, und sie schob ihm den Teller zu. »Und, wie läuft es bei Ihnen da oben?«
Und so begannen die Gespräche, zunächst förmlich bei diesem ersten Besuch und ziemlich steif, so dass sie ihn unmöglich nach seinen nächtlichen Touren fragen konnte. Nicht einmal höflich-distanziert verbrämt (obwohl sie es mit der Frage versuchte, ob er gerne hier in der Gegend Konzerte besuche? Es gebe mindestens zwei gute Konzertsäle die Straße hinauf und in vielen Kneipen Live-Musik), aber andererseits hatte die Förmlichkeit auch ihre Vorteile, da sie dazu beitrug, die Mietzahlung mit dem Ritual einer Plauderei bei Tee und Kuchen zu verknüpfen. Wie bei einem sich wiederholenden Theaterstück hob sich der Vorhang jedes Mal zur gleichen Stunde, kurz nachdem Warren sich entschuldigt hatte, um sich in seinen Keller zurückzuziehen. Der Pfefferminztee sowie die Süßspeise des Monats kamen auf den sauberen Tisch, das Radio wurde leise auf 96,3 – den Klassiksender – eingestellt, die Schürze gefaltet und weggelegt. Er saß ihr immer gegenüber, das Bündel Bargeld im Umschlag dezent auf die Anrichte gelegt, wo die unterschriebene Quittung auf ihn wartete. Ein Handel quasi. Dies war der Vorwand. Bargeld für Wohnraum. Aber das Gespräch beim Tee war eine andere Form der Bezahlung – seine Gesellschaft für eine Frau, die sehr lange nicht mehr allein einem Mann gegenübergesessen hatte, jedenfalls nicht ohne Zeugen. Vor allem nicht seit der Katastrophe vor über einem Jahr.
Die Katastrophe – dieses Geheimnis trug sie wie ein heimliches Giftschlamm-Reservoir in sich. Genau so wie sein Geheimnis des nächtlichen Verschwindens offenbar in ihm steckte. Doch statt über ihre Geheimnisse sprachen sie über aktuelle Ereignisse – den jüngsten verrückten Tweet des amerikanischen Präsidenten, den dramatischen Fall eines lokalen Fernseh-Promis, der Frauen sexuell belästigt haben sollte –, aber jedes Mal kamen sie wie magisch angezogen auf die großen philosophischen Theorien über die Natur des Lebens zurück. Er war Atheist und Materialist, und während er sämtliche Gründe für seine festen Überzeugungen aufzählte, lächelte sie nur und schüttelte den Kopf, als hörte sie einem Kind zu, das die Existenz einer schwebenden Zauberstadt beschrieb. »Natürlich glauben Sie das«, sagte sie. »Weil Sie jung sind.«