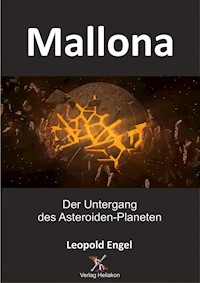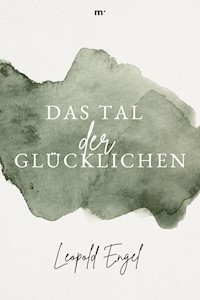Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich? — — Was ist mein Sein? — — Ich sehe nichts um mich als meine Klarheit. Mein eigen Ich erkenne ich, doch was bin ich? Mein Kleid ist Licht. Mein Fühlen, Denken reicht nicht weiter, als mein Auge schaut! — Wo bin ich? Was hat mich geboren? — Ich bin — und war doch nicht, bevor ich lebte. — Was ist mein Sein? — Ich fühle, dass ich bin und heißes Streben regt sich in mir, zu wissen — warum ich bin, weshalb ich war? Lass mich dich Kraft erkennen, die mich ins Dasein rief, die mir das Leben gab, die Einsicht, dass ich sei, ins Hirn mir pflanzte und das Bewusstsein gab: Ich bin! — Warum bin ich? — Das will ich wissen, muss es wissen! Antwort erwarte ich in heißester Begierde und wenn du bist, o Schaffenskraft, so offenbare dich! Zeig dich und sage, was dein Wille!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Magier und andere Erzählungen
Leopold Engel
Verlag Heliakon
Bild Cover: Pixabay (Kellepics)
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
2019 ©Verlag Heliakon
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Der Magier
l. Die Burg Rottstein
2. Der Burgherr
3. Ein fragwürdiger Ritter
4. Das Geheimnis der Burg Rottstein
5. Wie der Kreuzzug endete
6. Der Ritter von Tromburg
7. Der Magier
8. Ein kranker Mann
9. Ein Geisterspuk
10. Beatus, der Magier
11. Der Überfall
12. Die Eroberung der Burg
Das Tal der Glücklichen
Luzifers Bekenntnisse
l. Luzifers Berufung
II. Luzifers Schuld
III. Luzifer, der Satan?
IV. Luzifers Fall
V. Luzifers Plan
VI. Das Reich der Finsternis
VII. Jesus von Nazareth
VIII. Luzifers Saat
Zeit und Ewigkeit
Montezuma, der letzte Aztekenkaiser Mexikos
Das Leben des Menschen. Woher? Wohin?
Woher?
Wohin
Der Urkraft Quell
Stimmen in einem alten Park
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Finale
Der Magier
l. Die Burg Rottstein
Als Peter von Amiens den Kreuzzug predigte, um Palästina in den Besitz des Abendlandes zu bringen, und jene Stätte des Heiles und der Duldung später mit Blut durch das Schwert erkauft worden war, machte sich nicht nur innerhalb Deutschlands eine Pilgerschaft der Frommen und Gläubigen aus religiösen Gefühlen bemerkbar, sondern es wurde unter dem Deckmantel des Pflichtkampfes gegen die Ungläubigen auch einem Strauchrittertum Vorschub geleistet, das sich in den Dienst der Kreuzzüge stellte, nicht aus religiöser Begeisterung, sondern lediglich aus höchst eigennützigen Motiven. Den Türken Schätze abzunehmen, an denen sie nach sagenhaften Berichten großen Überfluss haben sollten, erschien manchem Rittersmann, dem die Burg seiner Väter vom Zahn der Zeit sehr benagt worden war, ohne dass er die Mittel besaß, dem sichtlich näher rückenden Einsturz Vorbeugen zu können, mindestens ebenso verdienstlich als die Befreiung des heiligen Grabes aus den Händen der Ungläubigen.
Als es gelungen war, wenn auch nur auf kurze Zeit, das heilige Land zu erobern und in Jerusalem den Sitz eines Königtums herzustellen, als geregeltere Verkehrsverhältnisse und sichere Zustände allmählich eintraten, entstand ein näheres Berühren des Abend- und Morgenlandes, das auch in Deutschland durch das Umherziehen seltsamer Persönlichkeiten sich kennzeichnete.
Morgenländische Magier, Quacksalber, Sterndeuter, Ärzte und Alchemisten tauchten hier und da auf, blieben meist eine kurze Zeit sesshaft, um ebenso spurlos, wie sie gekommen, wieder zu verschwinden. In alten Chroniken findet man nicht selten Aufzeichnungen über das Treiben derartiger Männer, deren geheimnisvolles Wesen die große Menge anzog. Eine abergläubische mit Furcht gepaarte Verehrung wurde ihnen gezollt, sodass es den meist schlauen Abenteurern leicht war, die Gläubigen mit ihren Gaukelkünsten zu betrügen und auszunutzen.
Nicht alle waren Betrüger. Es befanden sich unter ihnen auch Männer von tiefem Wissen, denen die Menschenliebe ihre oft wunderlichen Taten vorschrieb und denen keinerlei Selbstsucht nachgewiesen werden konnte. Das Eingreifen eines solchen Mannes in die Geschicke eines alten Geschlechtes wollen wir hier erzählen, wie dieses durch auf uns gekommene Mitteilungen berichtet worden ist.
* * *
Nicht weit von der Heeresstraße, welche von Augsburg nach München führt, erhob sich, umgeben von dichtem Wald und wenig kultivierten Ländereien, auf einem nicht sehr hohen Hügel eine Burg. Seit mehreren hundert Jahren befand sie sich auch im Besitz der Familie Rottstein.
Hoch ragten die Zinnen in die reine Waldluft empor. Auffällig ist der die Südseite der Burg schützende Wartturm. Trotzig, aus ungemein festem Mauerwerk erbaut, steht er nicht im unmittelbaren Zusammenhange mit dem eigentlichen Burggebäude, sondern erhebt sich frei, unabhängig, am nicht sehr hohen Hügelhang. Seine Bestimmung war, den Eingang der Burg mit der Zugbrücke, der sich in nächster Nähe des Turmes befindet, zu decken und von seiner Höhe aus, etwaigen Belagerern das Eindringen mittelst Wurfgeschosse unmöglich zu machen. Der Turm sollte uralt und auf den Trümmern eines alten Römerkastells erbaut worden sein. Zahlreiche Sagen knüpften sich an ihn, die von der Landbevölkerung in den Spinnstuben gerne an Winterabenden erzählt wurden.
Sein Name „Der Gespensterturm“, erschien gerechtfertigt, unheimlich genug sah das alte schwarze Gemäuer aus, mit den mächtigen Quadern, den kleinen Schießscharten und den gewaltigen Zinnen, die sein Haupt krönten.
Die Burg selbst war nicht groß, sie bedeckte den ganzen Hügel, der, an der Nordseite schroff abfallend, von dort einen weiten Blick in das Land gestattete.
Die Nordseite umfasste eine Plattform, groß genug, um der Burgbesatzung einen Zufluchtsort zum letzten verzweifelten Widerstand zu gestatten.
In dem Burghof war ein geschäftiges Treiben. Es schien, als bereite der Burgherr den Aufbruch zu einer Fehde vor. Knechte putzten an Harnischen und Helmen, besserten das Sattelzeug aus, untersuchten die Zäumung, den Hufbeschlag der Pferde. An einem Wagen beschäftigten sich einige Leute damit, das Beschläge desselben, sowie die Radreifen und Speichen genau zu untersuchen. Aus ihren Reden geht hervor, das der Wagen für eine weite Reise in Ordnung gebracht wird und benutzt werden soll, das Gepäck des Burgherrn und seiner Begleiter fortzuschaffen.
Mehrere Mägde brachten Futtervorrat für die Pferde herbei und verstauten denselben in einen Teil des geräumigen Wagens.
Als ein Knecht ihnen einen derben Scherz zurief, liefen sie lachend in das Innere der Burg zurück, anscheinend nicht sehr geärgert über die kecke Sprache des hübschen Burschen.
»Hast Recht«, rief jenem lachend einer seiner Genossen zu, »die drallen Dinger wären so ein rechtes Fressen für den Harem eines Türken. Na, wir werden ja bald sehen, ob uns die Weiber eines Paschas schön genug sind.«
»Du, halt den Mund in Ruhe! Wenn der Ritter hört, mit welchen Gedanken du ins heilige Land ziehst, gibt er dir den Sold, und nimmt dich nimmer mit hinaus. Weißt doch, er ist ein frommer Mann«, warnte der Erste.
»Hallo, als wenn ich es nicht auch wär. Da schau her, so fromm, ach so fromm.« Mit diesen Worten verdrehte er die Augen zum Himmel und faltete die Hände.
Die anderen Knechte lachten über seine Grimmasse.
Einer rief schallend ihm zu: »Hast es wohl von den Bettelmönchen gelernt? Die laufen ja haufenweise umher, wollen alle Leute bekehren und versprechen jedem, der gegen den Türken ziehen will, das sichere Himmelreich.«
»S’ irdische Reich, wenn’s was gut’s zu essen und zu trinken gibt und eine hübsche Dirn sind mir fast grad so lieb …«
»Oho du, spotte nicht über das Heiligste, was der Mensch hat, sonst besorge ich dir, bevor du ausreitest, noch eine Kirchenstraf«, unterbrach ihn ein älterer Kriegsknecht mit ergrauendem Bart, der gerade mit dem Putzen seines Helmes fertig geworden war und diesen beiseitelegte.
Den anderen Knechten eine Grimmasse zuschneidend, die ausdrücken sollte, er habe eine Unvorsichtigkeit begangen, wandte der Spötter sich zu dem Alten und meinte begütigend: »Fast, habe ich gesagt, Freund, nur fast. Aber du kannst nicht ableugnen, dass solche irdische Dinge etwas handfestes und sicherer sind, als aller versprochener Reichtum der Himmelsherrlichkeit. Ich dachte, du hast es auch immer mit dem Sicheren gehalten? Meinst nicht?«
»Wills grad’ nicht absprechen«, brummte der Mann, »aber ins heilige Land zieht ein rechter Reitersmann mit weniger irdischen Gedanken. Man schlägt sich mit den Ungläubigen, um einen Schatz im Himmel zu haben!« —
»Aber auch, um ihnen die anderen Schätze abzunehmen«, lachte der Spötter und die anderen nickten ihm zustimmend zu. »Konrad, gesteh es, du würdest mit beiden zufrieden sein. Nicht?« —
»Hol der Teufel euch junges Volk, man kann euch nicht gram sein. Wie der Himmel will, wir nehmen an, was er uns gnädig bescheren wird«, antwortete gut gelaunt der Gefragte, nahm den Helm auf und trug ihn in das Innere der Burg.
2. Der Burgherr
In einem der größeren Räume, dem Rittersaal der Burg, in den durch das geöffnete, in Manneshöhe angebrachte Fenster der helle Sonnenschein hineinflutete, saßen um einen eichenen Tisch drei Männer in der damaligen Tracht der Ritter. Lange Gewänder umkleideten die kräftigen Gestalten. Der ältere der Männer war in eine Art graues Büßergewand gekleidet, seine Hüften wurden von einem Strick umgürtet, auf der linken Achsel zeigte sich eine großes rotes Kreuz aufgenäht. Es war der Burgherr, der durch die Annahme dieses Kreuzes sich verpflichtete, an dem Kreuzzug des Kaisers Friedrich II. teilzunehmen. Die beiden Genossen waren sein etwas jüngerer Bruder und dessen Sohn Willibald, die ebenfalls dem Kreuzzug sich anschließen wollten, jedoch diese Absicht noch nicht durch das Tragen des Kreuzes offenkundig bewiesen.
Auf dem Tisch stand eine Kanne mit Wein, vor jedem, ein mit Wein gefüllter zinnerner Becher, dem der Hausherr nur selten, um so eifriger jedoch die anderen Ritter zusprachen.
Der Hausherr, der Ritter Ernst von Rottstein, erhob seinen Becher, stieß mit Bruder und Neffen an und sagte:
»So möge denn der Herrgott uns alle wieder gesund in die Heimat zurückführen, die wir morgen verlassen werden. Inzwischen soll deine Eheliebste in diesen Mauern als Hausfrau walten, zum Schutz meiner Kinder. Gott vergelte ihr die Liebe!«
Der Bruder Kuno stieß nochmals kräftig mit seinem Becher an, tat einen tiefen Zug und sagte lachend:
»Bruder, auch ohne Liebe hätte sie es getan. Wüsste nicht, wo das brave Weib sonst unterbringen, wenn nicht bei dir. »Hole der …«. Er schluckte hastig, räusperte sich und sprach den schon auf den Lippen schwebenden Fluch nicht aus.
»Die schlechten Zeiten, die mich fast um mein Hab und Gut gebracht. Auch die Pfaffen haben ein gut Teil daran, die mir gram sind und Steine in den Weg legen, über die ein Rittersmann stolpern muss. Doch sei getrost, meine Hausfrau wird deine Kinder schirmen. Potz tausend ist ein hübsche Jungfrau worden, deine Ludwiga, in den Jahren da ich sie nicht gesehen. Dachte nicht, als wir vor drei Tagen hier einzogen, das kleine Ding von damals so erwachsen vorzufinden. Das wird mal eine begehrte Hausfrau werden, um die gar mancher freit.«
»Dazu ist Zeit, kehr ich nach Lösung meines Gelübdes heim. Die Tochter eines armen Ritters wird der Freier nicht zu viel haben!«
»Nun, nun, so arm ist es nicht bestellt mit dir. Weiß doch, dass dir, dem Erstgeborenen, gar manches Kleinod aus dem elterlichem Haus zugefallen. Auch Denare und Silberbarren.«
»Sie gingen längst verloren, wie die deinen«, sagte gesenkten Auges der Burgherr.
»Glaub es wohl, wird auch dort hängen geblieben sein im Guten, wo man mir es im Bösen nahm«, erwiderte Kuno mit einem vielsagenden Blick auf das graue Gewand des Bruders. »Nun, hin ist hin! Der Türk muss uns ersetzen, was andere genommen.«
Dem Burgherrn war es offenbar unangenehm über diese Dinge zu sprechen, er erhob sich und ging mit kräftigem Schritt durch das Gemach, dann wandte er sich zum Bruder und sagte: »Will sehen was Ludwiga und Robert machen und ob die Knechte arbeiten, wie sie sollen!« Darauf verließ er das Gemach und ließ Vater und Sohn allein.
Kuno warf dem Davongehenden einen verächtlichen Blick nach. Als der Ritter verschwunden und seine auf den Steinfließen des Ganges schallenden Schritte verhallten, meinte er zu seinem Sohn:
»Willibald, dank du dem Satan oder wem du willst, dass dein Vater nicht so ein Pfaffenknecht geworden, wie dein Oheim. Im Türkenland werden wir andere Dinge zu finden wissen als Schätze, die im Himmel nicht rosten. Trink Bursche, stoße mit deinem Vater auf gute Beute an, dass wir für das den Pfaffen verkaufte Gut Ersatz finden und nicht abhängig bleiben von der Güte des frommen Betbruders.«
Willibalds breites, grob geschnittenes Gesicht zog sich in die Breite, er nickte lachend, trank seinen Becher in einem Zug leer, vergaß aber nicht, ihn sofort zu füllen. Seinem Vater die Kanne reichend, sagte er grinsend: »Der Wein ist das Beste hier im ganzen Nest, er lässt vergessen, welche fromme Luft hier bläst. Sorgt Kaiser Friedrich für gleiches Getränk auf der Fahrt kann es lustig werden.«
»Bursche, lass nicht einst durch die Gurgel laufen, was wir den Türken abzunehmen gedenken. Ein ehrlicher Durst ziemt einem Rittersmann, doch darüber wird es gefährlich.« —
»Keine Sorge, Vater, euer Sohn trinkt nie mehr als er verträgt!«
Lachend schlägt der Ritter auf den Tisch: »Und da mein Sohn stets einen Trunk verträgt, trinkt er jederzeit, wenn es was gibt! Ich gönne es dir und mir. Schenk ein!« Er hatte den Becher geleert und schob ihn dem Sohn zu.
In diesem Augenblick hörte man den Hornstoß des Türmers, womit er den Burgbewohnern anzeigt, dass ein Fremder sich der Burg naht und Einlass begehrt. Beide horchten auf und stiegen auf die hohe Bank am Fenster, um hinauszusehen. Die starke Mauer gestattete nicht, den Blick direkt in den Burghof zu werfen, deswegen setzte sich Willibald in die Fensterhöhle und schaute in den Burghof hinab. Über die Zugbrücke ritt auf derbem Pferde ein geharnischter Reiter, ein Knecht führte das Tier am Zügel in den Burghof. Neugierig musterten dort die arbeitsamen Knechte den fremden Ankömmling, der mit lauter Stimme den Burgherrn zu sprechen begehrte.
Als Willibald die Stimme des Angekommenen hörte, zuckte er unwillkürlich zusammen und beugte sich weit vor. Der Fremde wandte sein Gesicht dem Fenster zu.
»Justus!«, rief Willibald erfreut hinab.
Der Fremde blickte empor, und sah den freudig ihm Zurufenden.
»Hallo, Freund Willibald«, tönte es überrascht von seinen Lippen.
Willibald war rasch vom Fenster ins Gemach gesprungen und rief seinem Vater zu:
»Justus, unser Freund Justus ist soeben eingeritten! Was Teufel, bringt ihn hierher, schnell ihm entgegen!« —
Kuno von Rottstein zeigte ebenfalls große Überraschung und ging behäbig seinem Sohn nach, der schnell zur Tür hinausstürzte, den Freund zu begrüßen.
Als Ernst von Rottstein, seinen Bruder und Neffen verlassen hatte, um, wie er sagte, seine Kinder aufzusuchen, trat ihm der ältere Kriegsknecht, den wir bereits im Gespräch mit den Knechten kennen gelernt hatten, im Flur entgegen.
»Konrad«, fragte der Burgherr, »ist alles geordnet, wie ich befahl? Du stehst dafür, dass alles nach meinen Anordnungen im Hof und Haus geschieht.«
»Alles, Herr«, antwortete Konrad, »Ihr wisst, auf mich könnt Ihr Euch verlassen!« —
»Weiß das, alte treue Seele«, erwiderte der Burgherr, »bist erprobt in den langen Jahren, die wir beisammen sind. Dienst mir und meinem Haus nun schon 15 Jahre und darüber und wirst, so unser Herrgott will, ihm noch länger in Treue dienen.«
»Hab keinen anderen Wunsch als diesen, Herr!« Freudig blitzte es bei den innig gesprochenen Worten in den Augen des treuen Vasallen auf.
Leise wandte sich der Ritter zu ihm und flüsterte heimlich: »Wenn alles in dieser Nacht schläft, wirst du in den Rittersaal kommen und mich dort erwarten. Dir biederen Seele will ich anvertrauen, was niemand außer mir und dem Herrgott weiß. Du bist erprobt in vielen Gefahren, dir kann ich trauen.« —
Erstaunt blickt Konrad auf seinen Herrn, sieht sich scheu um und erwidert leise: »Ich werde kommen, Herr, seid gewiss!« —
In diesem Augenblicke ertönte der Hornstoß des Türmers.
Der Ritter Rottstein sagte zu Konrad:
»Sieh nach, was es gibt!« — und entfernte sich nach dem Ende des Ganges, wo das Zimmer seines Sohnes sich befand, des zehnjährigen Robert. Kaum hatte sich Konrad nach dem Burghof begeben, um dem Befehl des Ritters nachzukommen, als Willibald die vom ersten Stock der Burg herabführende Treppe hinabpolterte, gemächlich gefolgt von seinem Vater. Schnell eilte er hinaus und auf den Ankömmling zu, der, vom Roß herabgestiegen, die vom langen Ritt steif gewordenen Glieder durch kräftige Schritte gelenkig zu machen suchte. Ein Knecht hatte ihm Schild und Speer abgenommen. Das heraufgeschlagene Helmvisier zeigte ein bärtiges, verwegenes Gesicht, das nicht mit Unrecht als eine Galgenphysiognomie bezeichnet werden konnte. Ungemein listig und kalt blickende Augen gaben dem Gesicht etwas Unsympathisches, eine breite Schmarre zog sich über die Stirn des Ankömmlings, seine Sprache war bärbeißig, rau und laut.
Mit lautem »Hallo, hallo« begrüßte er Willibald, reckte ihm die Arme entgegen und drückte ihn kräftig an sein Panzerhemd, das die ungemein knochige und sehnige Gestalt schützte.
»Alle Teufel, das heiße ich ein unverhofftes Wiedersehen im Bayernland! Dachte nicht beim Herrn von Rottstein, den Neffen — und auch den Herrn Bruder zu begrüßen!« — die letzten Worte fügte er lauter hinzu, da er Kuno aus der Tür treten sah, der ihm lebhaft zuwinkte.
Willibald löste sich aus der kräftigen Umarmung und fragte den Freund wie er hierhergekommen.
Justus jedoch meinte: »Das lässt sich alles besser bei einem Becher Weines besprechen, meine Kehle ist ausgedörrt wie trockener Sandboden. Vor allem lege ein Wort für mich ein, dass dein Onkel mir für kurze Zeit Herberge bewilligt.«
»Der Wunsch wird erfüllt«, rief Willibald aus, und Kuno, der die Worte gehört, bestätigte die Zusage, indem er dem Ankömmling kräftig die Hand schüttelte.
3. Ein fragwürdiger Ritter
Justus wurde in den Rittersaal geführt. Er löschte zunächst seinen Durst durch die Leerung zweier großer Humpen, legte sein Schwert ab und setzte sich tief aufatmend in einen der bequemen Sessel.
»Wie kommt es, dass ich euch beide auf Burg Rottstein antreffe?«, fragte Justus.
»Wirst das alles erfahren«, erwiderte Kuno, »sei aber vorsichtig, wenn mein Bruder mit dir spricht.«
Justus blinzelte den Freund schlau an, pfiff leise durch die Zähne und sagte: »Aha, ich verstehe und begreife! — Der fromme Ritter will wohl ins Land der Heiligkeit? Viel Glück dazu!« —
Er wollte noch mehr sagen, schwieg aber weil Ritter Ernst eintrat. Aufstehend ging er ihm entgegen und reichte ihm die Hand. »Darf ich hoffen, Ritter, dass ihr mir kurze Zeit Herberge gewährt? Hier euer Bruder und Neffe werden die Bürgschaft geben, dass ihr keinen Unwürdigen aufnehmt.« Eifrig und laut beteuerten Kuno und Willibald die Bravheit ihres Freundes.
»Die Tore von Rottstein sind jedem gerechten Wanderer stets geöffnet. Seid willkommen Ritter. Wie nennt ihr euch?«
»Justus heiße ich!« — Er nannte noch einige nähere Bezeichnungen, die von seinen Freunden mit Kopfnicken und heimlichem Schmunzeln angehört wurden.
Die vier setzten sich an den Tisch und sprachen dem Weine zu.
»Wir treten morgen die Reise nach Italien an«, erklärte Ernst. »Es gilt das heilige Land den Ungläubigen zu entreißen. Schließt euch uns an!« —
»Hab’ wenig Lust dazu. Mir liegt die letzte Fahrt noch in den Gliedern. Bin froh, dass damals ich mit dem Leben noch davongekommen. Mein letzter Lehnsherr, dem ich verpflichtet war, der allerchristliche Landgraf von Thüringen, der jetzt ebenfalls unterwegs nach Brindisi, ließ denselben Wunsch mir melden, doch schlug ich es ab. Das hat ihn so geärgert, dass ich es vorzog, mein Roß zu satteln und Urlaub von ihm und seiner frommen Gemahlin Elisabeth zu nehmen. Nun bin ich unterwegs, mir einen rechtschaffenen großen Herrn zu suchen, der meine Dienste braucht und anerkennt. Ich habe Empfehlungen an den Erzbischof Jacob von Kapua und hoffe durch ihn zu finden, was ich wünsche.«
»Der Erzbischof ist der Freund des Kaisers, er würde auch sicher raten, dem Kaiser ins heilige Land zu folgen.«
»Ganz wohl, doch braucht der Kaiser auch während seiner Abwesenheit in seinen Erblanden tüchtige Leute, zu denen ich mich gerne zählen würde. Meine Wiege stand einstens in Sizilien, ich spreche die dortige Landessprache, wie die hiesige. Mein Vater war ein Deutscher, meine Mutter Sizilianerin. In späteren Jahren schlug mich das Geschick, nachdem ich mir die Sporen verdient, nach Deutschland, jetzt möchte ich wieder in das Land meiner Jugend zurück.«
»Nun Ritter, tut wie ihr wollt, doch da die Reise über die Alpen für uns dieselbe ist und während derselben ihr euch noch entschließen könnt, so reist mit uns. In Gesellschaft werdet Ihr den Gefahren der Reise besser trotzen, als allein.«
Justus rief erfreut: »Das ist ein Anerbieten, Ritter, das ich gerne annehme. Hier meine Hand, ich reise mit euch und das Weitere wird sich finden.« Kräftig schallte der Handschlag durch den Raum, alle griffen zu den Bechern und besiegelten das Abkommen mit einem Trunk.
Der Burgherr lehnte sich zurück in seinen Sessel und sagte: »Ritter, wenn es euch genehm, erzählt mir von Eurer Kreuzfahrt, die ihr erwähntet, ich bin begierig davon zu hören. Ihr seid ein Mann, der viel von der Welt gesehen, während ich, erbgesessen auf dieser Burg, nicht mehr kenne, als die nächste Umgebung bis Augsburg. Gewiss wisst ihr von den Ereignissen der früheren Jahre, die vorausgingen bis jetzt der Zug zustande kam, gar manches zu berichten, was uns hier unbekannt.«
Justus lachte auf: »Hallo, ob ich zu berichten weiß! Mehr als mancher hier in Deutschland, mehr als die Mönche, die allerwärts predigen zur Teilnahme an dem Zug.
Habe zu genau hineingesehen in all das Getriebe und will es euch gerne erzählen, was die Pfaffen …«
Willibald gab dem Sprecher unter dem Tisch mit dem Fuß einen warnenden Stoß, ergriff die Kanne und schenkte den leeren Becher des Justus voll, dabei sich viel bedeutend räuspernd. Justus begriff und endete seinen Satz — »wie das bösmäulige Volk oft die frommen Beter nennt, verschweigen. Hört also.«
»Als Kaiser Friedrich 1215 in Aachen zum Könige gekrönt wurde, gab er das Versprechen, sich an einem Zug zur gänzlichen Befreiung des heiligen Landes zu beteiligen, es hat also 12 Jahre jetzt gedauert bis er sein Versprechen einlöst. Ist ihm sauer genug geworden in der langen Zeit. Papst Honorius hat während seiner ganzen Papstschaft vergeblich darauf gewartet, was der Kaiser seinem Vorgänger, dem Innozenz versprochen und wäre Seine Heiligkeit Papst Gregor nicht aus anderem Holz als er gewesen, so versammelten sich jetzt in Brindisi gewiss nicht die Streiter zum Kampf gegen die Türken.«
Der Burgherr fiel dem Sprecher in die Rede: »Der Kaiser hat doch nie mit Absicht sein Gelübde auf die lange Bank geschoben. Er hatte genug zu tun mit Kämpfen in seinem Erblande.«
»Weiß, weiß wohl«, lachte Justus, »kann schon sein, dass ihn die Ordnung des sizilianischen Reiches abhielt. Aber gerne ist er aus diesem Grund daheimgeblieben. Und dem Papst Honorius war es auch nur lieb, als der Kaiser endlich einen Zug ausrüstete, aber er selbst daheimblieb und nur sein kaiserliches Heer absandte. Wäre doch im Fall des Gelingens dadurch dem Papst der Glanz der guten Tat zugefallen, nicht dem Kaiser. Was aber dabei herausschaut, wenn die Kirche glaubt mit den Bischöfen und Prälaten an der Spitze allein einen Heereszug auszuführen, das wurde schon im August 1217 bewiesen, als König Andreas von Ungarn eine Kreuzfahrt mit den Bischöfen von Bamberg, Zeitz München, Utrecht und anderen zustande brachte. — Die Herren katzbalgten sich untereinander, jeder wollte dreinreden und befehlen. Ordnung war ein Ding der Unmöglichkeit, dann gab es Zank und Streit und schließlich war es am Ende. Nach drei Monaten kehrte König Andreas um, der Mut war ihm ausgegangen, den Türken eins überzuhauen, aber schöne Reliquien hat er mitgebracht für die Andächtigen. Die Hände der Apostel Thomas und Bartholomäus, ein Stück von dem Stab Aarons und einen von den Krügen, die aus der Hochzeit von Kana das Wasser enthielten, das der Herr Jesus in Wein verwandelte.1
»Ha, ha, hat ein Heidengeld gekostet all das Zeug, hätten es von mir billiger beziehen können.«
Willibald gab seinem Freunde wieder heimlich einen mahnenden Stoß und Justus fuhr fort.
»Na und dann kam vor sechs Jahren der Zug, den ich erwähnte und mitgemacht habe. Der Papst drängte den Kaiser immer mehr, sein Gelübde zu halten und endlich selbst den Zug zu führen. Es war am Tag, dass nur Friedrich, dem der Papst am 27. November des Jahres vorher in Rom die Kaiserkrone aufgesetzt hatte, Erfolg haben würde. Im Juli waren 40 Schiffe bereit und unter den Befehl des Admirals Grafen Heinrich von Malte und des Kanzlers Walter von Paleria gestellt. Wir segelten ab, hatten gute Fahrt und kamen in Ägypten ans Land. Der Kaiser hatte befohlen, vor seiner Ankunft, die im August stattfinden sollte, nichts zu unternehmen, doch das passte dem päpstlichen Legaten und dem Papste schlecht. Sie wollten Erfolge auch ohne den Kaiser, daher wurde beschlossen, in Ägypten Eroberungen zu machen. Wir zogen nach Kairo zu, die Stadt zu erobern. — Verdammt sei der Gedanke und der, der hierzu geraten, ohne genau zu wissen, ob es möglich ist, den Zug auch auszuführen. Niemand kannte das Land und die Fallen, die man uns stellen konnte. Wir, dumm und täppisch, gingen auch in eine solche hinein. Der Türke wich aus, es kam zu keiner Schlacht. Der Sultan Elkamel von Ägypten dachte uns besser abzufangen und seine Leute zu schonen. Wir hatten unser Lager aufgebaut, nicht zu weit vom Nil entfernt, des Wassers wegen. Ha, ha, bald sollte es Wasser geben, mehr als wir brauchten. Hinter uns durchstachen die Schufte einen Damm, der das Nilwasser hindert ins Land zu fließen. Und als das Nilwasser, wie alljährlich stieg, ein Zeitpunkt, den unsere klugen Führer natürlich nicht kannten, schnitt es uns den Rückzug ab. Alle Schleusen wurden geöffnet, die das Land unter Wasser setzten, und in kurzer Zeit schwammen wir in unserem Lager wie die Wasserratten umher. Hunde sind die Türken, heißt es, aber kühnere, bessere Reiter und Schützen sah ich nie. Was dem Wasser entlaufen wollte, schossen die Kurden und Araber mit ihren Pfeilen nieder. Der Hunger wütete unter uns, denn die Proviantflotte hatte der Feind genommen. Elend und Entsetzen lähmte jede Tatkraft. Kein Mann wäre entkommen, alles ersoffen, wäre nicht noch der Sultan großmütig gewesen und bereit zu Unterhandlungen. Die hatten auch Erfolg. Die Gefangenen wurden ausgewechselt und ein Frieden auf 8 Jahre geschlossen. Die Stadt Damiette, die die Christen erobert, musste ausgeliefert und am 8. September dem Sultan übergeben werden.
Der Rest des Heeres wurde gerettet, doch 40.000 Christenleben hat der Zug verschlungen, der so gründlich misslang, wie noch keiner.2 Und warum? Weil Kaiser Friedrich nicht selbst am Platz war, seine Untergebenen gescheiter sein wollten und der Papst, wo er konnte, ihm Steine in den Weg warf! Der Gregor macht es nicht besser.« —
»Ihr seid kein Freund des Papstes?«, fragte der Burgherr.
»Ein Freund des vorigen war ich nicht, musste ich doch so manchen guten Kameraden ersaufen sehen durch seine Schuld. Ob man ein Freund des Gregors sein kann, wird sich bald zeigen. Doch begreift Ihr wohl, Ritter, dass bei solchen Erfahrungen die Lust vergeht, den Zug mitzumachen, denn mehr als ein Leben hat man leider nicht zu verlieren!« —
»Und was tut es, wenn im Dienst der heiligen Sache dieses eine Leben verloren geht? Wird es nicht ins Buch des Himmels eingeschrieben, um was man es geopfert?« —
»Weiß nicht, ob jemand schon jemals dieses große Buch gesehen hat und sein Guthaben da hinein gebucht! Möchte es fast bezweifeln, doch will ich niemand den guten Glauben daran nehmen!«
»Wer Glauben hat, der kann ihn nicht verlieren«, meinte ernst der Burgherr, »doch wollen wir darüber nicht streiten, ein jeder tue, wozu das Herz ihn drängt.« Der Burgherr erhob sich und entschuldigte sein Gehen damit, dass er die letzten Tagesstunden noch seinen Kindern widmen wolle.
Als Ernst von Rottstein gegangen war, lachte Justus in sich hinein und sagte leise zu seinen Freunden:
»Hab’ immer schon gehört, dass er ein frommer Duckmäuser sein sollte. Wie kommst du, Kuno, zu solchem Bruder? — Was würde der für Augen machen, wüsste er, woher ich wirklich komme.«
Aufmerksam horchten die andern und Kuno flüsterte: »Habe mir gleich gedacht, dass deine Lehnsherrschaft beim Landgraf von Thüringen eitel Dunst ist, wie käme Justus zu diesem allerchristlichsten Gebieter!« —
Listig zwinkerte ihm Justus zu:
»Du hast wie immer eine feine Nase. Du kennst doch den Freienfels, den sie den roten Hans in der Umgegend nennen?« —
Eifrig nickten Vater und Sohn. Willibald fragte hastig: »Was ist’s mit dem, plündert er noch immer die Kaufleute aus, die nach Nürnberg ziehen? In letzter Zeit soll er es arg getrieben haben.«
»Nicht mehr!«, brummte Justus, »seine Burg haben sie berannt. Der Herzog von Bayern hatte die Geduld verloren. Den Hans haben sie erwischt und gefangen!« —
Erschreckt fuhren beide auf, sahen sich viel bedeutend an. Grinsend meinte dann Willibald: »Na, und du?« —
»Ich roch den Braten und meinte, vorgesehen ist besser, sattelte meinen Klepper noch rechtzeitig und entwischte, denn helfen konnte ich unserem Hans doch nicht mehr. Mir ist die Gegend hier zu heiß geworden und denke darum, dort unten mich abzukühlen.«
»Reite mit uns, ins Türkenland. Dort ist für Leute unseres Schlages was zu holen«, meinte Kuno.
Justus schnitt ein Gesicht: »Weiß schon was dort zu holen ist, Fieber, Pest und Wunden, doch wenig Gold. Na abschwören will ich es trotzdem nicht. Werde mir es überlegen, wenn wir die Grenze hier hinter uns haben.« —
Die Dreie steckten die Köpfe zusammen und unterhielten sich von ihren Streichen, die sie früher oft gemeinsam unternommen hatten.
4. Das Geheimnis der Burg Rottstein
Ernst von Rottstein hatte die letzten Abendstunden mit seiner Tochter Ludwiga, einem Mädchen von fünfzehn Jahren sowie mit seinem Erben, dem zehnjährigen Robert, zugebracht, nicht ohne Sorge, was während seiner Abwesenheit geschehen würde. Er glaubte sein Haus gut bestellt zu haben. Seine Schwägerin verstand es, einen Hausstand wie den seinen zu führen. Er vertraute ihr und misstraute nicht seinem Bruder, der, wie er wusste, zwar verschuldet war, dem er jedoch nichts Böses zutraute. In jener Zeit hörte man auf den Burgen wenig von dem, was außerhalb des Umkreises derselben geschah, oder es mussten eben Dinge sein, die das allgemeine Interesse des ganzen Landes angingen und deswegen durch Boten bekannt wurden. Da Kunos kleine Besitzung weit im Norden des Landes lag, war dem eigenen Bruder nichts von den verwegenen Streichen bekannt, die dort ausgeübt, und noch weniger wusste er, dass Kuno gezwungen gewesen, seine Besitzung an das dortige nahe Kloster zu verkaufen, dessen Abt das Mittel der Abfindung wählte, um den durch seine Streifzüge berüchtigten Ritter aus der Gegend zu entfernen. Kuno erhob von jedem Wanderer einen Zoll, entweder gutwillig oder mit Gewalt, der die über sein Gebiet führende Landstraße passierte, ein Faustrecht, das in jener Zeit viel geübt wurde. Die Einladung des Bruders, Kunos Hausfrau sollte während der Abwesenheit des Burgherrn, die doch Jahre dauern konnte, seiner Tochter Ludwiga die Mutter ersetzen, seine Gattin war ihm schon vor Jahren gestorben, — ergriff der Strauchritter freudig und gab vor, dass auch er mit seinem Sohne den Kreuzzug auf sich nehmen wolle, da er sein Gut dem Kloster verpachtet habe, um seine Schulden zu tilgen. — Er könne daher das Nützliche mit den Bruderpflichten vereinen.
Die Erziehung seines Sohnes Robert hatte der Burgherr dem älteren, würdigen Abt des nahen Franziskanerklosters übergeben, bei ihm wusste er diesen in den besten Händen. —
Ritter Ernst glaubte also ruhig sein ihm heiliges Gelübde erfüllen zu können, aber dennoch erfasste ihn stets eine peinigende Empfindung des Unbehagens bei dem Gedanken, die Burg zu verlassen, von der er sich keine Rechenschaft geben konnte. Er hatte bemerkt, dass seine Tochter, trotz ihrer jungen Jahre und ohne dass sie sich dessen bisher selbst eigentlich bewusst war, eine Zuneigung zu dem jungen Ritter von Tromburg gefasst habe, dessen stolze väterliche Burg am Lech stand und der es nie versäumte, so oft er nach Augsburg kam, auf Burg Rottstein vorzusprechen. Er hatte bemerkt, mit welchem Vergnügen der junge, unabhängige Ritter die heranblühende Ludwiga heimlich betrachtete, und der Gedanke einer zukünftigen Verbindung beider erfüllte ihn mit frohen Hoffnungen. Dieser stille Wunsch stellte ihn vor die Verpflichtung, für das Heiratsgut seiner Tochter solche Sorge zu tragen, dass es unangetastet und ihr erhalten bliebe, falls er nicht zurückkehren sollte. In jener Zeit war eine Sicherstellung nicht so leicht zu bewerkstelligen. Viel hatte er nachgedacht, welche Wege wohl die besten wären und schließlich hatte er einen Ausweg gefunden, der ihm der sicherste schien. —
Es war Nacht geworden. Früh hatten die Bewohner der Burg, vielleicht zum letzten Mal, sich auf ihre heimatlichen Ruhestätten niedergelegt, gleich nach Sonnenaufgang sollte die Abreise vor sich gehen. Kuno und Willibald nebst Justus hatten sich noch einmal gründlich am Wein gelabt und dann schwerfällig zur Ruhe begeben.
Nur Ritter Ernst war in seinem einfachen Schlafgemach beim Schein einer Wachskerze noch wach. Er schaute in ein Pergament, das Zeichnungen und sie erklärende Sätze enthielt, faltete es zusammen und barg es in einer inneren, verborgenen Tasche seines Wamses. Dann ergriff er die Kerze, verließ das Gemach und begab sich nach dem Raum, den wir schon kennen. Als er eintrat, erhob sich Konrad, der ihn bereits hier erwartete, von einem der Stühle. Der Burgherr ging auf den treuen Diener zu und sagte:
»Konrad, die Stunde ist gekommen, wo ich dir den Beweis des höchsten Vertrauens und du mir den deiner Treue geben kannst. Schwöre mir bei Gott und seinem Sohne, dass du als Geheimnis hüten wirst, was ich dir anvertraue, und dass du handeln wirst wie ich dir sage.«
Unbedenklich antwortete Konrad:
»Herr, ich schwöre bei Gott und seinem Sohn, so zu tun, wie Ihr mir sagen werdet und Euer Geheimnis zu wahren.«
»Gut, so folge mir!«
Der Ritter ging nach der Ecke des Gemaches, das an den Wänden bis zur Manneshöhe eine Holzverkleidung ringsum zierte. Er zeigte Konrad, wie sich diese an einer Stelle hochheben ließ, nachdem einige starke Eisenstäbe hervorgezogen.
Von den nun sichtbaren Steinquadern der Mauer waren zwei um eine Achse drehbar, sie verbargen eine Öffnung, groß genug, um durchschlüpfen zu können.
Hier führte eine schmale Treppe in die Tiefe. Der Burgherr gebot Konrad, ihm zu folgen. Er tat es und nun zeigte ihm der Ritter, wie von der anderen Seite aus die Öffnung zu schließen sei, sodass ein in das Gemach tretender Bewohner der Burg nichts außergewöhnliches bemerken konnte.
Die Treppe zog sich zwischen der starken Burgmauer hinab, manchmal zweigten Seitenwege ab. Der Burgherr erklärte, dass in ähnlicher Weise sich noch nach anderen Gemächer Auswege befanden. Schließlich öffnete sich am Ende der Treppe ein mannshoher Gang seitwärts. Diesen entlang schreitend, erklärte der Burgherr, dass dieser Gang unter den Burghof hinweg zum Gespensterturm führe. Ein Fallgatter sperrte den Weg. Es wurde leicht hochgezogen, wenn man den Mechanismus kannte.
Etwas weiter befand sich eine eiserne Tür, die mittelst eines Quereisens verwahrt werden konnte. Nunmehr kamen sie in einen kleinen Raum, der anscheinend keinen Ausweg besaß. Auch hier befand sich ein drehbarer Quader, der eine Öffnung zum Durchschlüpfen verschloss. —
Herr und Diener gelangten nun in einen weiten, runden Raum, einem tief gelegenen, geheimen, unterirdischen Gemach des Gespensterturmes, in das man nur auf dem zurückgelegten Weg und auf einer Treppe innerhalb der nach dem Burghofe zugewandten Turmmauer gelangen konnte. Wer jedoch innerhalb des Turmes in die Kellerräume stieg, ahnte nicht, dass ein Verließ sich noch auf dem Grund desselben befand.
In damaliger Zeit besaßen alle Burgen, für den Fall einer Flucht bei gefahrvollen Belagerungen, geheime Gänge und Räume, die nur dem Burgherrn zu seiner und der Familie Sicherheit bekannt waren.
Der Ritter leuchtete an der Mauer entlang und zeigte Konrad einen Stein auf dem ein kleines Kreuz eingegraben war, diesen verbanden zwei Klammern mit den Nachbarsteinen der Mauer.
»Hinter diesem Steine«, sagte er, »in einem Hohlraume verborgen, liegt in Gold und Silber das Gut, das ich von meinen Eltern ererbte und meinen Kindern gehört, wenn ich nicht wieder heimkehre. Ebenfalls liegt dort in einer Blechkapsel ein Pergament, auf welchem die geheimen Gänge der Burg gezeichnet sind.
»Du wirst, falls mein Tod vom Herrn der Welt beschlossen ist, heimkehren und sorgen, dass meine Kinder in den Besitz dieses Schatzes gelangen.«
»Solltest du jedoch selbst verhindert sein, weil sich dir der Tod naht, sol bist du verpflichtet, das Pergament, das ich bei mir trage und das du an dich nehmen sollst, wenn ich sterbe, durch den Mann, dem du am meisten vertraust, dem Abt des Klosters zuzusenden, der Roberts Erziehung übernahm.
»Noch wisse, dass aus diesem Gemach ein Gang weit hinaus in den Wald führt. Das Pergament, von dem ich sprach, sagt, wo der Gang mündet.
»Hast du alles wohl verstanden?«
»Ja, Herr!«, antwortete zustimmend Konrad.
»So komme zurück und bewahre mein Geheimnis. Es ist besser, zwei wissen nun dasselbe, denn unerwartet kann mich der Tod abrufen und dann wäre es mit mir begraben.«
Schweigend gingen die Männer zurück, trennten sich dann, um noch bis zum Aufbruch zum letzten Mal unter heimatlichem Dache zu ruhen.
5. Wie der Kreuzzug endete
Jahre waren vergangen. Der Kreuzzug, den Kaiser Friedrich II. unter ungeheuren Schwierigkeiten beendete, brachte viele Enttäuschungen und kostete zahlreiche Opfer. Nicht das Schwert, aber Seuchen hatten furchtbar gewütet. Unter anderen war durch die furchtbare Krankheit auch der Landgraf von Thüringen dahingerafft worden, der Kaiser selbst wurde von ihr erfasst, jedoch siegte seine kräftige Natur, er musste aber seine bereits begonnene Fahrt nach Syrien unterbrechen und in den Bädern von Puteoli völlige Herstellung seiner Gesundheit suchen. Die dadurch entstehende Verzögerung des Zuges erregte den dem Kaiser feindlich gesonnenen Papst derartig, dass er ihn in den Kirchenbann tat, als Verächter und ungehorsamer Sohn der Kirche.
Der Kaiser ließ sich dadurch nicht behindern. Sein diplomatisches Genie brachte es fertig, ohne Schwertstreich zu erringen, was er sich als Ziel gesetzt, die Befreiung des Heiligen Grabes.
Am 8. September 1227 trat der Kaiser seine missglückte Fahrt an, auf der er von der Seuche niedergeworfen wurde, und am 17. März 1229 konnte er seinen Einzug in Jerusalem halten, dessen Besitz er vertragsmäßig von dem Sultan Elkamel von Ägypten zugesprochen erhielt. An diesem selben Tage setzte sich Kaiser Friedrich in der Grabeskirche die goldene Krone als rechtmäßiger König von Jerusalem selbst auf das Haupt.
Unleidliche Zustände in Italien, hervorgerufen durch die Feindschaft des Papstes zwangen den Kaiser, zwei Tage nach seiner Selbstkrönung zurückzukehren, um seine kaiserlichen Rechte zu wahren.
Es folgte nunmehr eine Zeit des Kampfes mit der Kirche, die schließlich zugunsten Friedrichs ausfiel, ihm aber schweren Kummer verursachte.
Ihren Gipfel erreichten die Schicksalsschläge durch die immer sichtbarer werdende Undankbarkeit seines Sohnes Heinrich, König von Deutschland. Dieser junge Fürst war viel zu früh mit der höchsten Gewalt betraut worden. Von Natur aus herrschsüchtig, ertrug er, zum Mann herangewachsen, jede Beschränkung durch seinen Vater, den Kaiser, nur mit der größten Ungeduld. Nicht die besten Freundestanden ihm zur Seite, deren Hetzereien, Ratschläge und Verführerische Vorschläge darauf hinzielten, den jungen Fürsten zur offenen Empörung zu veranlassen.
Langsam bereitete sich die Katastrophe vor. König Heinrich verschleierte seine Vorbereitungen, die ihm die unbeschränkte Herrschaft in Deutschland bringen sollten, und suchte unter die Edel und Nichtedel des Landes Anhänger zu werben.
Was war inzwischen aus dem Ritter und Burgherren geworden? Was aus seinem Bruder, dessen Sohn und aus Justus?
Mit dem Ergebnis des Kreuzzuges waren die letzten drei keineswegs zufrieden. Ihre Hoffnungen, den Türken ihre Schätze abnehmen zu können, waren schmählich getäuscht worden, zu einem Kampf, der Beute, womöglich Plünderung der besiegten Ortschaften gestattete, kam es gar nicht. Es bot sich ihnen daher gar keine Aussicht, billige Reichtümer zu erwerben.
Kuno, Willibald und Justus, der in der Hoffnung aus türkische Schätze sich doch angeschlossen hatte, verfluchten die Stunde, in der sie sich entschlossen dem Wunsch des Burgherrn nachzugehen. Keinesfalls wollten sie ohne klingenden Lohn die Heimat wieder aufsuchen.
Sie hörten von den Absichten des Sultans Elkamel, mit dem Kaiser Friedrich seinen Vertrag abschloss.
Dieser günstige Vertrag war nur zustande gekommen, weil der Sultan das Reich von Damaskus gemeinsam mit seinem Bruder, dem Sultan von Kelat (Mesopotamien), erobern wollte und für diesen Plan der Neutralität des Kaisers bedurfte, dessen Heer ihm gefährlich werden konnte, falls es sich gegen ihn kehren würde.
Dieser Umstand kam den drei Strauchrittern sehr gelegen. Sie waren sofort entschlossen, dem Sultan ihre Dienste anzubieten, der Leute ihres Schlages recht gut brauchen konnte. In diesem Kampf konnten sich ihre Wünsche doch noch verwirklichen.
Die drei Kumpane zögerten nicht und nahmen beim Sultan Kriegsdienste an.
Ernst von Rottstein hatte keine Ahnung, dass sein Bruder sich den Ungläubigen verdingte, er würde es ihm und Willibald niemals verziehen haben. Das wusste Kuno auch sehr wohl, daher schwieg er sowie Willibald und log seinem Bruder vor, dass er dem Kaiser nach Italien folge. Ernst hatte jedoch gelobt, einige Zeit an den heiligen Stätten zuzubringen, um durch Gebet und Bußübungen sein Seelenheil zu fördern.
Kuno, Willibald und Justus verabschiedeten sich von ihm und gingen ihre unlauteren Wege. Sie sollten den Burgherrn niemals wiedersehen.
Ernst von Rottstein, dessen Gesundheit durch das ungewohnte Klima gelitten, der auch seinem Körper durch Fasten und Kasteiungen zu viel zumutete, erkrankte alsbald gefährlich. Sein getreuer Konrad pflegte ihn getreulich.
Damals stand die ärztliche Kunst noch lange nicht auf der Höhe wie jetzt. Die orientalischen Ärzte verstanden mehr als die Feldsheeren der Deutschen, kein Wunder, dass der Zustand des Ritters, der sich nicht den Händen eines eingesessenen Arztes anvertrauen wollte, keineswegs besserte.
Als die Krankheit jedoch sichtliche Fortschritte machte, der Ritter immer mehr zu leiden hatte, drang Konrad darauf, dass ein orientalischer Arzt geholt würde. Ein Kriegskamerad, dem sich der getreue Diener seit er in Jerusalem weilte, enger angeschlossen hatte, weil er die Landessprache recht gut beherrschte, riet ihm, einen Arzt zu befragen, der geradezu Wunderkuren vollbracht habe und den selbst Kaiser Friedrich zu sich rufen ließ, um seinen Rat gegen Unpässlichkeiten zu hören, die ihm in letzter Zeit zu schaffen machten.
Heinrich nannte sich dieser Kriegskamerad Konrads. Auf Konrads Bitte holte Heinrich den Arzt, einen noch jungen Mann, der, wenn er nicht orientalische Kleidung getragen hätte, für einen Europäer gelten konnte.
Der Arzt prüfte den Zustand des Ritters, fand denselben sehr bedenklich und gab keine Hoffnung für seine Genesung.
Seine schlimme Diagnose sollte nur zu richtig sein. Ritter Ernst fühlte, dass er sterben müsse und erinnerte Konrad an seinen Schwur.
Der getreue Diener stand schon nach einigen Tagen an der Totenbahre seines Herrn. Konrad sorgte für ein christliches Begräbnis des Ritters und beschloss, nach der Heimat zurückzukehren, um seinen Eid zu erfüllen.
Die Reise aus dem Morgenland nach Deutschland war nicht nur langwierig, sondern auch teuer. Um die Kosten zu ersparen, wusste Heinrich, der Kriegskamerad, Rat. Auch er beabsichtigte nach Deutschland, seinem Vaterland, zurückzukehren. Der Kaiser hatte wohl Jerusalem verlassen aber noch nicht Palästina. Heinrich riet Konrad an, mit ihm in die Dienste des Kaisers zu treten, der ganz besonders gerne Deutsche in seiner Leibwache sah. Er wolle es schon dahin bringen, dass sie angenommen würden.
Konrad sah ein, dass dieser Weg zwar ein bedeutender Umweg sein würde, da er nicht sogleich wieder den kaiserlichen Dienst verlassen könne, aber er schien ihm immerhin am geeignetsten, wenigstens mit Sicherheit die Heimat wieder zu erreichen. Seine Mittel waren nur gering, das Begräbnis seines Herrn, den er seinem Stand gemäß zur Ruhe bestattete, zehrte die ihm zur Verfügung stehenden Gelder fast gänzlich auf und auf neue hatte er nicht mehr zu rechnen. Es blieb ihm daher nichts anderes übrig, als dem Vorschlag Heinrichs zuzustimmen.
Am ersten Mai 1229 verließ der Kaiser das Morgenland, um sich nach Apulien zu begeben. Sieben Galeeren beförderten ihn und sein Gefolge nach Italien, unter dem sich auch Konrad und Heinrich befanden.
Papst Gregor hatte nichts unversucht gelassen, um den Kaiser während seiner Abwesenheit machtlos zu machen, es gelang ihm nicht.
Das päpstliche Heer, die sogenannten Schlüsselsoldaten, nach dem päpstlichen Abzeichen, die gekreuzten Schlüssel Petri, so benannt, ergriffen alsbald vor den gefürchteten Deutschen im Heere des Kaisers die Flucht, als es zum Kampf kam, sodass der Kaiser ende Oktober sein Land, das bereits so gut wie verloren schien, zurückerobert hatte.
In diesen Kämpfen wurde Konrad schwer verwundet. Heinrich erhielt einen Hieb über das Gesicht, der ihn später stark entstellte.
Die beiden Kameraden hatten stets treu zueinandergehalten, sich treue Freundschaft gelobt, die auch Heinrich jetzt dem schwer Verwundeten bewies. Er verließ ihn nicht in seiner Not und sorgte brüderlich für ihn. Allerdings wollte es das Schicksal, dass seine Mühe nicht belohnt wurde.
Konrad starb, konnte jedoch dem getreuen Gefährten noch des Burgherrn Geheimnisse anvertrauen, Heinrich das Pergament übergeben und ihm das Versprechen abnehmen, nunmehr an seiner Statt, den letzten Willen des Ritters von Rottstein zu erfüllen.
Heinrich versprach dem Sterbenden, die übernommene Pflicht als die seine zu betrachten und Sorge zu tragen, dass der Junker Robert, der Sohn des Ritters, und seine Schwester in den Besitz des väterlichem verborgenen Erbteils gelangen. Beruhigt schloss Konrad die Augen zum ewigen Schlummer, überzeugt, dass sein Kamerad das gegebene Versprechen getreulich erfüllen würde.
Heinrich gehörte zu den gewissenhaften Menschen, denen ein gegebenes Wort heilig ist, er war fest entschlossen, dasselbe zu erfüllen. Ihn banden jedoch Verpflichtungen an den kaiserlichen Hof, von denen Konrad niemals eine Ahnung besaß und die mit der Heilung seiner entstellenden Wunde zusammenhing.
Die Bande der Dankbarkeit fesselten den Braven noch an das Land und namentlich an den selben Arzt, der vergeblich den Ritter Ernst von Rottstein zu retten suchte und ebenfalls am Hof des Kaisers jetzt weilte.
Im Laufe der nächsten Zeit, kurz nach dem Tod Konrads, war es Heinrich gar nicht möglich, nach Deutschland zu reisen, um sein Wort zu erfüllen, es vergingen sogar einige Jahre, bevor es ihm möglich werden sollte. Die Ereignisse der Weltgeschichte kamen ihm für seine Absicht zur Hilfe.
6. Der Ritter von Tromburg
Auf Burg Rottstein hatte die Kunde von dem Ableben des Burgherrn große Trauer hervorgerufen. Namentlich Ludwiga war untröstlich, dass sie den geliebten Vater niemals wiedersehen solle. Ihr Bruder Robert war noch zu jung und unerfahren, um den herben Verlust ganz zu empfinden. In dem Knaben steckte weit mehr das Zeug zu einem Gelehrten als zu einem Rittersmann, ein Umstand, den sein Vater frühzeitig schon erkannte, und deswegen auch Robert dem Abt des nahen Klosters zur Erziehung übergab, der mit Freuden den aufgeweckten Jungen Unterrichtete.
Die Tante Ludwigas, die Frau von Kuno und Mutter Willibalds, nahm ebenfalls die Nachricht vom Tod ihres Schwagers mit anscheinend tiefem Herzeleid entgegen, dachte aber im Herzen ganz anders.
Sie war eine Ränkespinnerin und selbstsüchtige Person, die mit ihrem Gatten vor dessen Abreise in sehr eingehender Weise einen Plan entwarf, wie sie in Abwesenheit des Burgherrn sich das Regiment aneignen könne, eine Absicht, die durch dass Vertrauen des Burgherrn sehr erleichtert wurde. Ritter Ernst gab ihr ja Vollmacht völlig als Hausfrau zu wirtschaften und an Ludwiga Mutterstelle zu vertreten. Die herrschsüchtige Frau nützte denn auch die eingeräumten Rechte gründlich aus und wurde bald der Schrecken des Dienstpersonals und eine regelrechte Stiefmutter.
Sie respektierte nur eine Person, das war der Abt des Klosters. Dieser ein ernster, hochgelehrter, dabei äußerst energischer Mann, den Ritter Ernst als Verwalter seiner Güter einsetzte, sah oftmals nach dem Rechten, sodass sie sich vor allzu groben Übergriffen scheute, namentlich, seitdem der Abt als bestellter Vertrauensmann des abwesenden Ritters ihr derartiges streng verwies und sie mit Kirchenstrafe bedrohte, falls sie ihr herrisches Betragen nicht unterlasse. Immerhin hatte ihre Umgebung noch genug zu leiden, namentlich, als die Todesnachricht eintraf und sie sich jetzt mehr als je als Herrin fühlte. Es war niemand da, der ihr das Verwandtenrecht abstreiten konnte oder sie der von Ritter Ernst erhaltenen Hausvollmacht hätte entbinden können.
Einige Jahre stoßen dahin. Ludwiga entwickelte sich zur blühenden Jungfrau, Robert immer mehr zu einem jungen Mann, dem die Bücher und Studien im Kloster lieber waren als jede ritterliche Übung, letztere ertrug sein nicht allzu kräftiger Körper nur widerstrebend.
Frau Regina gab sich alle Mühe den jungen Menschen womöglich zu bestimmen, Mönch zu werden, angeblich um seines Vaters Seelenheils wegen, für das er doch als Priester auch nach dessen Tode noch für das Jenseits sorgen könne.
Die intrigante Frau wollte auf diese Art sich des Erben entledigen, hoffte auf die glückliche Wiederkehr ihres Gatten und Sohnes, denen sie ein warmes Nest zubereiten wollte. Ludwiga sollte dann die Frau Willibalds werden und dadurch die Burg mit ihren Ländereien in den Besitz ihrer Familie kommen. Sehnsüchtig wartete sie auf Nachrichten aus dem Morgenland, die ihr die baldige Rückkehr von Gatten und Sohn verkünden würden, aber nicht eintreffen wollten. Nichtsdestoweniger verfolgte sie ihre Pläne unentwegt mit Zähigkeit.
Da gab es eines Tages eine große Überraschung. Ohne vorherige Ankündigung trafen Willibald und Justus auf der Burg ein.
Sie brachten die Trauerkunde mit, dass Kund von Rottstein im Kampf umgekommen sei und ein christliches Begräbnis erhalten habe. Allerdings sagten sie nicht, dass er im Dienste des Sultans einen unrühmlichen Tod gefunden, sondern behaupteten, er sei im Kampf mit den Ungläubigen als ein Held gefallen.
Frau Regina war über diese Trauerkunde schnell getröstet. Ihr war die Hauptsache, dass Willibald unversehrt zurückkehrte und dadurch ihre Pläne mit Ludwiga keinen Abbruch erhielten.
Mutter und Sohn waren sehr bald einig, als Regina auseinandersetzte, wie sie sich die weitere Zukunft dachte. Befremdend war ihr nur, dass Ritter Ernst gar kein bares Geld hinterließ, daher nur die allerdings nicht unbedeutenden Einkünfte der zur Burg gehörenden Ländereien Erben zustoßen, über die als Sachwalter und Vormund der höchst unbequeme Abt stets wachte. Einnahmen und Ausgaben wurden von ihm genau kontrolliert und gebucht, sodass Frau Regina durchaus nicht frei über die eingehenden Gelder verfügen konnte.
Das passte auch dem Willibald herzlich schlecht, umsomehr als er durchaus nicht Reichtümer aus dem Orient mitbrachte und mit seinem Freunde Justus auf ein bequemes Leben auf der Burg gehofft hatte.
Über ihre Erlebnisse im Orient schwiegen sie hartnäckig, sie behaupteten, nicht viel erlebt zu haben, verrieten auch mit keinem Wort, was sie im Dienste des Sultans getrieben und aus welchem Grund sie zurückgekehrt waren. Wer die Kumpane näher kannte, musste unschwer erraten, dass sie zweifellos etwas auf dem Kerbholz hatten und wahrscheinlich aus zwingenden Gründen sich aus dem Staub machten.
Die Absichten Reginas mit Ludwiga kamen nicht vorwärts. Willibald war dem jungen Mädchen sehr bald gründlich verhasst geworden, sein rohes Wesen, das sich mit einer Vorliebe zum Trunk vortrefflich einte, stieß sie ab.
Doch war es das nicht allein, was ihr Herz abwandte.
Sie liebte den Ritter von Tromburg, der bereits früher oftmals Gast ihres Vaters gewesen, und dieser brachte ihr aufrichtige Gegenliebe entgegen.
Der Abt war Mitwisser des heimlichen Verlöbnisses beider und bei ihm im Kloster hatten sich die Liebenden auch manchmal treffen können.
Er wusste, dass Ritter Ernst bei Lebzeiten den Wunsch hegte, einstens Ludwiga als die Hausfrau des jungen unabhängigen Ritters zu sehen und war auch überzeugt, dass Ludwiga keinen besseren Gatte erwählen könne, deswegen gab er sich zu der Rolle des Beschützers der Liebenden gerne her.
Sehr zu seinem Leidwesen besaß er nicht die Macht den Ritter Tromburg mit Ludwiga zu vereinen. Der verstorbene Burgherr hatte ihm wohl die Erziehung seines Sohnes übergeben, auch die Verwaltung seines Vermögens sowie die Ordnung desselben im Falle seines Todes, aber er konnte ihm nicht die Rechte eines Familienhauptes übergeben. Adlige Geschlechter unterstanden in jener Zeit bis zur Mündigkeit der Einzelglieder stets dem Willen des Familienoberhauptes, das war in diesem Fall Willibald. Er war nach seiner Rückkehr das älteste Glied der Rottsteiner, da Onkel und Vater mit dem Tod abgingen. Seine Einwilligung war daher zur Verheiratung Ludwigas erforderlich oder ein Spruch des Kaisers, bis Ludwiga die Mündigkeit erreicht hatte.
Da Willibald selbst die Hand seiner Cousine verlangte, war natürlich jede Möglichkeit seiner Einwilligung ausgeschlossen. Ritter Tromburg konnte demnach nur auf einen Eingriff des Kaisers hoffen, der ihm wohlgesinnt war, infolge der Verdienste seines Vaters und des Ansehens, das er selbst sich bei dem Monarchen erworben.
Der Kaiser war jedoch weit entfernt, residierte in Palermo und hatte mit Regierungssorgen seine liebe Not, wie wäre es da möglich gewesen, ihn mit einer Liebesangelegenheit zu behelligen, die kaum sein Interesse erwecken konnte. So dachte der junge Ritter. Er sollte bald erfahren, dass seine Ansicht nicht die richtige war und dass Friedrich alle Ursache hatte, die ihm getreuen deutschen Ritter durch Wohltaten möglichst an sich zu fesseln.
Ludwiga war immer mehr in Bedrängnis geraten, sie wusste nicht mehr aus noch ein. Ihre Tante ließ längst ihr gegenüber die Maske fallen und drängte mit allem Ungestüm darauf, dass sie ihre Hand dem Willibald reiche. Ludwigas Festigkeit wurde durch allerlei Quälereien langsam erschüttert, hielt man sie doch wie eine Gefangene, die die Burg nicht verlassen durfte, auch nicht um im nahen Kloster zu beichten, wie sie es sonst getan, und sich bei dieser Gelegenheit mit dem Abt zu besprechen.