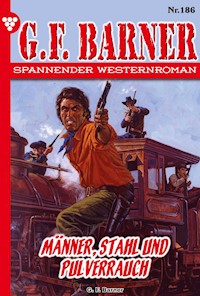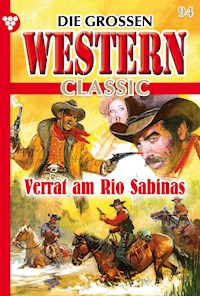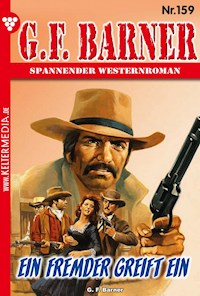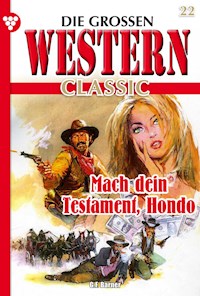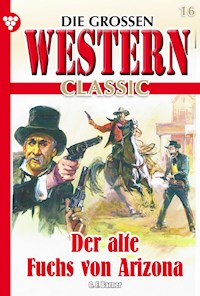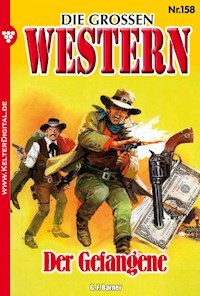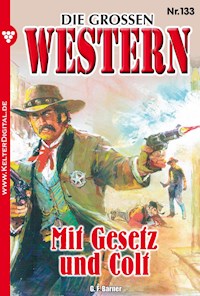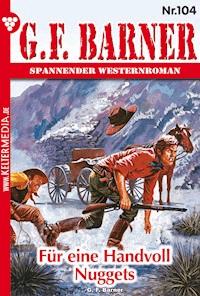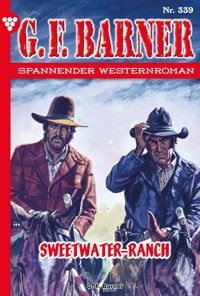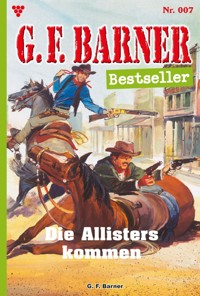Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Es gibt nur einen einzigen wuchtigen Knall, dann ist der Mann auch schon da und reißt den Arm hoch. In seiner Hand liegt der Revolver, und die dunkle, drohende Mündung blickt Ben Sharkey mitten zwischen die Augen. Hinter dem Mann klappt die Tür nach einem Hackentritt wieder zu. Der Mann geht rückwärts, dreht mit der linken Hand den Schlüssel um, und dann erst sagt er grimmig: »Jetzt habe ich dich, Mr. Sharkey. Du wirst reden, du doppelzüngige Natter, oder ich blase dir eine Kugel durch dein verteufelt gerissenes Gehirn! Antworte – wo ist Mathews?« Sharkey bleibt ganz ruhig hinter seinem Schreibtisch sitzen. Der große, sehnige Sharkey, dessen Gesicht Härte und Zorn widerspiegelt, rührt sich nicht. In seinen dunklen Augen taucht ein wilder Funke bei der Anrede auf. »Der Ordensträger«, murmelt Ben Sharkey. Er blinzelt schon wieder träge und lächelt voller Spott. »Sieh einer an! Mein Freund Danville – Marshal von Sacramento – kreuzt hier auf. Hallo, Marshal.« Das verdammte, spöttische Lächeln allein reizt Marshal Danville bereits genug. Danville würde, wenn er könnte, Sharkey über den Haufen knallen, aber gegen den Hundesohn gibt es keine Beweise. Dabei muß er zwei Dutzend Leben, wenn nicht mehr, auf dem Gewissen haben. Mit seinem dunklen gewellten Haar und dem prächtigen weißen Hemd gleicht Sharkey auf den ersten Blick einem vollendeten Gentleman. Er ist nur keiner. »Er kommt hier einfach herein und hält mir den Colt vor den Kopf«, murmelt Sharkey. Seine Stimme wird immer leiser und grimmiger, obgleich sein Gesicht ganz ruhig wirkt. »In meinem eigenen Palast wagt der verdammte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 102 –
Der Mann aus Sacramento
Zu viele Vermisste für eine Stadt
G.F. Barner
Es gibt nur einen einzigen wuchtigen Knall, dann ist der Mann auch schon da und reißt den Arm hoch. In seiner Hand liegt der Revolver, und die dunkle, drohende Mündung blickt Ben Sharkey mitten zwischen die Augen.
Hinter dem Mann klappt die Tür nach einem Hackentritt wieder zu. Der Mann geht rückwärts, dreht mit der linken Hand den Schlüssel um, und dann erst sagt er grimmig: »Jetzt habe ich dich, Mr. Sharkey. Du wirst reden, du doppelzüngige Natter, oder ich blase dir eine Kugel durch dein verteufelt gerissenes Gehirn! Antworte – wo ist Mathews?«
Sharkey bleibt ganz ruhig hinter seinem Schreibtisch sitzen. Der große, sehnige Sharkey, dessen Gesicht Härte und Zorn widerspiegelt, rührt sich nicht. In seinen dunklen Augen taucht ein wilder Funke bei der Anrede auf.
»Der Ordensträger«, murmelt Ben Sharkey. Er blinzelt schon wieder träge und lächelt voller Spott. »Sieh einer an! Mein Freund Danville – Marshal von Sacramento – kreuzt hier auf. Hallo, Marshal.«
Das verdammte, spöttische Lächeln allein reizt Marshal Danville bereits genug. Danville würde, wenn er könnte, Sharkey über den Haufen knallen, aber gegen den Hundesohn gibt es keine Beweise. Dabei muß er zwei Dutzend Leben, wenn nicht mehr, auf dem Gewissen haben. Mit seinem dunklen gewellten Haar und dem prächtigen weißen Hemd gleicht Sharkey auf den ersten Blick einem vollendeten Gentleman. Er ist nur keiner.
»Er kommt hier einfach herein und hält mir den Colt vor den Kopf«, murmelt Sharkey. Seine Stimme wird immer leiser und grimmiger, obgleich sein Gesicht ganz ruhig wirkt.
»In meinem eigenen Palast wagt der verdammte Kerl mich zu bedrohen! So, was wolltest du Narr doch schnell wissen? Ich will dich loswerden, Mister. Je schneller, desto besser. Du könntest mich sonst so lange ärgern, bis du plötzlich tot bist.«
»Du Bandit!« sagt Danville mit Zorn. »Ich bin der Marshal dieser Stadt und trage den Orden. Wäre ich es nicht – ich schwöre dir, ich würde dich mit der Waffe auf die Straße jagen, du Massenmörder?«
Sharkey wird langsam blaß. Seine Kinnladen pressen sich sekundenlang fest aufeinander. Dann hat er sich wieder in der Gewalt.
»Ich weiß nicht, wo Mathews ist«, sagt er heiser. »Ich habe gehört, daß die Kutsche überfallen wurde, aber ich habe keine Ahnung, wo Mathews steckt. Und jetzt raus, raus mit dir, du Affe! Ich spucke auf dein Gesetz, ich…«
»Du weißt es wieder mal nicht, was?« erwidert Danville. »Aber dafür weiß ich etwas, Mister. Mathews arbeitet für dich als Geldbegleiter. Er ist dein Mann – und er ist in Locke ausgestiegen. Vorher sagte er zu Blunt, dem Händler, der mit derselben Kutsche fahren wollte, Blunt solle es lassen. Es könnte heute gefährlich werden. Und was ist passiert, du Halunke? In Locke ist Mathews ausgestiegen, und zwischen Locke und Courland wurde die Kutsche überfallen. Willst du mir verraten, woher Mathews gewußt hat, daß der Überfall kam? Los, rede, du geschniegelter Affe!«
Ben Sharkeys Mund wird zu einem schmalen Strich. Sein Blick wird stechend scharf.
»So ist das«, sagt er ganz leise und finster. »Mathews hat Blunt abgeraten, die Kutsche zu nehmen, und ist selbst nur bis Locke gefahren. Und daß er ausgestiegen ist, das ist nun dein Beweis, daß Mathews von dem Überfall gewußt haben muß. Ich verstehe. Kann ich jetzt auch mal meine Meinung sagen?
Danville, in dieser Stadt hast du wenig Freunde. Um genau zu sein – keine. Du bist klug, aber du kannst die Leute hier nicht nehmen, wie sie sind, du machst dir immer wieder Feinde mit deiner verdammten Art, die Leute anzufahren. Ich weiß nichts von Mathews.
Der Bursche hatte viereinhalbtausend Dollar in einer Tasche bei sich und die sind weg. Mathews hätte sich längst gemeldet, wenn ihm nichts zugestoßen wäre.«
Der Colt in der Hand von Sherman Danville ruckt höher.
»Eine prächtige, verlogene Story, die du mir da vorsingst«, sagt Danville grimmig. »Dein Mann hat gewußt, daß ein Überfall geplant war. Er ist ausgestiegen und seitdem verschwunden. Er verließ die Station in Locke. Von da an hat ihn niemand mehr gesehen. Vielleicht wollte er mit dem Geld durchgehen, was?«
Ben Sharkey schüttelt leicht den Kopf. »Das würde er nicht wagen.«
»Nicht bei dem Boß, was?« sagt Danville wild. »Alles, was du anfängst, ist immer durchdacht. Du machst nie einen Fehler, Shark.«
Er weiß, daß Sharkey die Verstümmelung seines Namens in Shark, was gleichbedeutend mit Hai ist, nicht liebt. Aber es gibt viele Leute in der Stadt, die Sharkey so nennen.
»Denkst du, was?« fährt Danville scharf fort. »Kaum zwei Jahre bist du hier – und du hast dir einen Saloon nach dem anderen, eine Spielhalle und noch eine beschafft. Deine Methoden waren rauh, deine Leute sind es noch. Du bist ein Shark, Mister – ein gefräßiger, unberechenbarer Hai.
Ich habe genug von dir, Mister. Dies war in acht Wochen der fünfte Postkutschenüberfall. In zwei Wochen neun Tote und sieben Vermißte, von denen niemand weiß, wo sie geblieben sind. Alle hatten Geld – und alle sind verschwunden. Mensch, diese Stadt wird ruhig sein, wenn du tot bist.«
Ben Sharkey lehnt sich zurück. Er legt die Hände flach auf den Schreibtisch und sieht Marshal Danville mit einem eiskalten, durchdringenden Blick an.
»Ich mag dich nicht, Danville«, sagt er ganz leise und kalt. »Du wirst nicht mehr lange leben, das weiß ich. Und ich weiß auch warum, Mister. Du bist ein Narr! Eines Tages werde ich vor deiner Leiche stehen und nichts als ein Lächeln für dich haben. Das schreibe dir hinter die Ohren. Ich bin ein Hai, was? Nun gut, ich mache meine Geschäfte, aber bringe mir den Beweis, daß ich jemanden betrogen oder geschlagen habe, um groß zu werden.
Ihr seid alle von derselben, billigen Sorte – alles, was einen Orden trägt. Ich hasse nichts mehr als Männer mit einem Orden. Und jetzt raus, sonst wirst du getragen werden?«
»Du drohst?« fragt Marshal Danville lauernd. »Mörder, wo hast du deine Opfer gelassen? Sind es die Toten, die manchmal nach Wochen irgendwo in der Bay von Frisco angeschwemmt werden – aufgedunsene, unkenntliche Leichen? Eines Tages hängst du – und ich werde ganz bestimmt dafür sorgen.« Er zuckt zusammen, denn Ben Sharkey, der Hai dieser Stadt, lächelt plötzlich dünn und sieht rechts an ihm vorbei.
»Soll ich, Boß?« fragt eine leise, sanfte und kehlige Stimme schräg hinter Marshal Danville. Der Mann flüstert beinah. Wie er in den Raum gekommen ist, bleibt Sherman Danville ein Rätsel. »Boß, soll ich ihn…?«
»Nein – noch nicht, Nevada«, murmelt Sharkey. »Er trägt einen Orden, Nevada – und in den macht man ein Loch, aber von vorn. Er ist ein Narr und Narren sterben früh. Warum hier und jetzt?«
»Boß, er hat dir mehr an den Kopf geworfen, als ich mir an deiner Stelle bieten lassen würde.«
»Schon gut, Nevada«, erwidert Sharkey schleppend und erhebt sich langsam trotz Danvilles Revolver.
»Drück ab, Danville – und du wirst ein toter Mann sein. Nevada schießt augenblicklich.«
»Das Halbblut«, stößt Danville durch die Zähne. »Hölle und Pest, das Halbblut! Wie ist der Halunke…«
Er sieht sich vorsichtig um. Das Halbblut, das keinen anderen Namen als den seiner Heimat hat, lehnt an der Wand neben einer Tür. Diese Tür ist ein Stück der Holztäfelung des Arbeitszimmers.
Das Halbblut hat den langläufigen Vierundvierziger in der Faust. In seinen schwarzen Augen liegt nichts als Todesdrohung.
Wie immer trägt Nevada seinen dunklen Anzug, das dunkle Hemd am Hals offen und seinen runden, seltsamen Kugelhut auf dem Kopf.
»Genug gesehen?« fragt Nevada zischend. »Marshal, ich bin ein Halbblut, aber kein verdammtes. Mein Vater war ein ehrlicher Mann.«
»Dafür bist du ein Killer!« antwortet Danville. »Los, drück ab – sie werden dich hängen.«
Nevada zuckt die Achseln – das ist alles, was er als Antwort für Marshal Danville hat. Danach bewegt er sich wie eine Schlange und tritt an die Tür. Er dreht den Schlüssel um, macht die Tür auf und wartet ab.
»Verschwinde, Marshal«, sagt Sharkey finster. Er sieht neugierige Gesichter draußen und hebt die Hand. »Hau ab, Mann – du hast gesagt, was du wolltest. Jetzt sage ich dir etwas: Du bist in vier Jahren der fünfte Marshal hier – und du wirst es die längste Zeit gewesen sein.«
Er wendet sich um, und gerade seine Art, dem Gesetz den Rücken zu kehren, bringt Danville richtig in Wut. »Einer von uns ist zuviel in dieser Stadt«, sagt Danville scharf. »Wir werden sehen, wer es ist, Shark!«
Er macht kehrt, wirft dem an der Tür stehenden Nevada einen stechenden Blick zu und geht hinaus.
Die Tür fällt zu, Nevada lehnt sich wieder an die Wand und verschränkt die Arme über der Brust, nachdem sein Colt blitzschnell verschwunden ist. Seine stoische Ruhe ist anscheinend durch nichts zu zerstören.
»Nevada – ich mag ihn nicht, verstehst du?«
»Ja«, sagt das Halbblut. Das ist alles.
»Hast du gehört, was er von Mathews gesagt hat?«
»Yes, Boß, ich habe es gehört.«
»Und – was denkst du?«
»Mathews hatte seine Ohren überall, Boß.«
»Dann kümmere dich darum, verstanden?«
»In Ordnung.«
Nevada verschwindet durch die Wandtür, und Ben Sharkey starrt vor sich hin.
»Shark«, sagt er leise. »Verdammt, ein Hai hat Zähne – so scharfe, daß ein Biß tödlich sein kann, was, Danville? Mach so weiter, dann beiße ich zu.«
*
Hank Oaks geht zuerst zu seinem neuen Boot und streicht über die Planken. Das Boot, das ihm endlich von der Reusenfischerei abbringen soll, ist fast fertig. Es hat eine Länge von sechs Yards und kann gefahrlos bei scharfem Wind auch über die Bay von San Franzisko gesegelt werden.
»Ach, zum Henker«, sagt Old Hank Oaks mürrisch. »Drei Tage hält mich O’Toole, dieser Schwachkopf, beim Bootsbau auf. Kann nicht segeln, der Kerl, fährt sein Boot auf einen Stein. So was – der hat doch keine Augen für eine Untiefe. Und wen holt er, um den morschen Kahn reparieren zu lassen? Mich natürlich! Ich verstehe schließlich was davon, mehr als andere, will ich meinen. Das wird ein Boot.«
Der Alte lebt hier, nur zwei Meilen unterhalb von Rio Vista am Sacramento River. Früher hat er einmal, wie andere Narren, nach Gold gesucht, aber nichts gefunden. In seiner Jugend hat er einmal Bootsbauer gelernt und dreißig Jahre davon geträumt, einmal ein schweres Boot zu haben.
Bis auf vier Planken ist sein Meisterwerk nun fertig.
»Alle Teufel, die Reusen«, brummt Hank. Er ist mit sich und seiner Arbeit zufrieden.
»Die stecken schon drei Tage im Fluß. Habe ich Glück, sind sie voll. Dann fahre ich nach Rio Vista und verkaufe so viel, daß ich mir ein Pfund Kautabak und zehn Flaschen Brandy holen kann. Die Reusen – Mann, oh Mann, die hätte ich doch bald vergessen!«
Mit der Hast eines alten Mannes, der ungern etwas aufschiebt, holt Old Oaks sein einfaches Paddel. Dann steigt er in den kleinen Flachkahn und stößt vom Ufer ab.
»Die sind voll, wetten?« brabbelt er vor sich hin. »Ich kann mir zehn Flaschen guten Brandy kaufen.«
Er hat die Reusen drüben an der sumpfigen Uferseite versenkt und mit Stangen gezeichnet. Immerhin muß er in seinem Flachkahn fast dreihundert Meter weit paddeln, ehe er an der ersten Stange ist. Eilig macht er das Seil los, zieht und lacht in sich hinein.
In der Reuse sind mindestens fünfzehn Pfund Fische. Das patscht und quirlt durcheinander, daß silbrige, gleißende Reflexe dem Alten in den Augen blenden.
»Tsst, tsst!« sagt Old Oakes und kratzt sich am Bart. »Wenn in den anderen dreien auch so viel ist, dann habe ich zwei Wochen keine Sorgen mehr, was? Wenn ich sie nicht so gut aufgestellt hätte, he?«
Old Oaks kommt zur zweiten Reuse, zieht sie hoch und staunt. Auch diese Reuse ist voll.
»Ich werde reich!« ruft Oaks laut. »Mann, so viel Fische auf einen Schlag zu erwischen – Leistung, he? Dann wollen wir mal!
Er paddelt zur dritten Reuse, zieht und keucht. Alle Teufel, da muß er einen Walfisch gefangen haben, was? Das Ding ist ja schwer wie Blei.
Und dann denkt Old Hank Oaks gar nichts mehr.
Er stiert nur auf das Einlaufmaul der Reuse, der Weidenringe, das Netz und den Mann, der sich darin gefangen hat.
Old Oaks dreht das Fanggerät und kann das Gesicht des Toten sehen. Er fährt zurück, bewegt die Lippen und denkt jäh an die Geschichte, die der Nachbar von O’Toole gestern erzählt hat.
»Mathews!« sagt Oaks gepreßt. »Hol’s der Teufel, ich will keinen Ärger haben – schon gar nicht mit Sharkey. Der kauft zwar manchmal Fische von mir, aber – Ärger mit ihm könnte verdammt gefährlich werden. Komm her, Mathews, ich bringe dich an Land.«
Er macht eins der Reusenseile an Mathews und der hinteren Bank des Kahns fest. An Bord zu ziehen wagt er Mathews nicht.
Schwer und mühselig paddelnd legt der Alte den Weg zur anderen Uferseite und seinem Schilfstreifen mit dem Anlegesteg zurück.
Hier sieht ihn niemand mehr. Das Schilf und die Büsche, die Oaks Haus umgeben, verbergen alles, was nun am Landesteg vor sich geht. Minuten später hat Oaks den Toten an Land.
Jetzt erst erkennt er die Verletzungen an Mathews’ Kopf. Mathews muß zusammengeschlagen und dann erstochen worden sein. Dann hat man ihn in den Fluß geworfen.
»Was jetzt?« nuschelt der Alte. Er greift in die Tasche, schneidet sich ein Stück Kautabak ab und schiebt es zwischen die hinteren Zähne.
Kauend überlegt er, was er tun soll. »Der Teufel soll es holen, aber ich werd’s dem Marshal melden.«
*
Oaks schüttelt verwundert den Kopf, als Sherman Danville sich wieder hundert Meter entfernt und dann ein Stück Brett nimmt.
»Oaks, paß auf, wenn es auf deiner Höhe vorbeischwimmt, verstanden? Dann hebst du den Arm, klar?«
»Hör mal, Marshal, was soll das?«
»Wirst du schon sehen, Alter.« Danvilles sonst strenges, hartes Gesicht hat einen gespannten Ausdruck angenommen.
Die Uhr in der einen Hand, schleudert der Marshal das Brett mit der anderen ins Wasser.
Es ist früh am Morgen – Danville hat nicht eher kommen können, aber Oaks versprochen, ihm die Fische zu ersetzen, die nun verderben. So ist es Old Hank gleich gewesen, wann sich Danville einfinden würde.
Das Brett klatscht ins Wasser – Danville starrt auf die Uhr und dann zu Oaks. Es dauert einige Zeit, bis die Strömung das Brett zu Oaks trägt und der den Arm hochreißt.
»In Ordnung!« stellt der Marshal zufrieden fest. »Ganz schöne Strömung, Oaks. War der Fluß vor drei Tagen so schnell – stand das Wasser so hoch?«
»Ja, genauso, meine ich«, erwidert Oaks und kommt näher.
»Wozu machst du das, Marshal? Hör mal, nimm den Kerl mit. Erzähle, was du willst, nur laß mich aus dem Spiel. Ich will nicht eines Tages wie der da schwimmen, verstehst du?«
»Sicher.« Danville setzt sich hin, zieht sein schmales Notizbuch heraus und beginnt zu schreiben und rechnen.
Der Alte blickt ihm über die Schulter, aber Danville schreibt so schräg, daß Old Oaks nur die Zahlen ohne seine Brille lesen kann.
»Marshal, was rechnest du da?« will der Alte neugierig wissen. »Hat das etwas mit Mathews zu tun?«
»Ich denke schon«, gibt Danville zurück. Er lächelt sogar kurz – etwas, was man bei ihm fast nie sieht.
»Als die Stagecoach in Locke war, kam die Dämmerung. Du hast am späten Nachmittag die Reusen gesetzt. Von Locke bis hier müßte ein treibender Gegenstand etwa zwei Stunden brauchen, wenn er leicht ist.«
Er murmelt vor sich hin, schreibt wieder, rechnet und steht schließlich auf.
»Yeah, etwa drei Stunden!« brummt er und klappt sein Buch zu. »Ich würde sagen, es müßte in der Nähe von Locke gewesen sein. Oaks, du kennst doch den Fluß wie deine Westentasche, oder?«
»Soll ihn wohl kennen, wenn ich elf Jahre hier lebe«, erwidert Oaks nuschelnd. »Und?«
»Hör mal, am Fluß oder in Flußnähe gibt es doch überall eine Menge halbverfallener Diggerhütten und Löcher.«
»Sicher, Marshal, die sind da – überall am Fluß. Was meinst du damit?«
»Ah, nichts – mach dir keine Gedanken«, antwortet Sherman Danville kurz. »Nun gut, ich bringe Mathews in die Stadt. Und dann werde ich sehen, wo es passiert ist. Ich wette, es war nicht in Locke. In der Stadt würden sie es nicht gewagt haben. Wer schlägt einen Mann, der schreien könnte – und er muß, verstehst du? – Er muß geschrien haben, als sie ihn hatten.«
»Ah?« fragt Old Oaks verständnislos. »Marshal, ich begreife das nicht. Woran denkst du?«
»An eine Menge Dinge«, brummt Danville. »Der verdammte Sharkey. Ich wette, er hat seine Hand dabei im Spiel gehabt.«
*
Als Danville in der Dunkelheit das Pferd in den Stall bringt, öffnet sich die Hintertür des Office. Walt Rogers, einer von Danvilles Deputys, blickt heraus. Licht fällt in den Hof, und Rogers fragt heiser. »Wer ist da?«
»Das bin ich nur, Walt«, erwidert Danville finster. »Bring die Laterne mit und komm her – ich habe etwas für dich.«
Zwei Minuten später bleibt Walt Rogers verstört im Stallgang stehen. Sein Adamsapfel tanzt, seine Augen flackern plötzlich.
»Mein Gott – Mathews!« stößt er heraus. »Marshal, wo hast du ihn gefunden?«
»Am Fluß – und danach konnte ich es nicht lassen, sechs Stunden wie ein Narr das Ufer nach der Stelle abzusuchen, an der man ihn hineingeworfen haben muß. Es wurde zu dunkel, ich mußte aufgeben. Kein Wort zu jemandem, Rogers, verstanden? Zuerst holst du den Doc her. Ich will wissen, wie lange Mathews im Wasser gelegen hat.«
Rogers würgt, denn Mathews bietet keinen besonders erfreulichen Anblick. Schnaufend hastet der Deputy davon, während Sherman Danville den Toten in eine Box legt.
Kaum ist Danville damit fertig, als der Doc auch schon erscheint. Er untersucht Mathews und sagt dann: »Er war tot, als man ihn ins Wasser warf, Marshal. Ich schätze, er lag zwischen dreißig und vierzig Stunden im Wasser. Obwohl ich eine ganze Menge Ertrunkener gesehen habe – genau läßt sich das nicht sagen. Wer hat ihn gefunden?«
»Ich selbst«, antwortet Danville.
»Nun gut – he, Rogers, was gibt es denn?«
Im Office erklingt scharfer Wortwechsel. Rogers, der dort geblieben ist, streckt nun den Kopf heraus und sagt heiser: »Marshal, Mr. Sharkey und sein Freund Clay Patterson sind da. Sie wollen mit dir sprechen.«
Hastig verläßt Danville den Stall. Kaum betritt er sein Office, als er einen Fluch von Patterson, einem Frachthändler, dem auch noch zwei Saloons gehören, entgegengeschleudert bekommt.
»Zum Teufel, da ist er ja endlich«, knurrt Patterson, ein großer, kräftiger Mann, der immer mit Sharkey zusammensteckt. »Wir sind eine Abordnung, verstanden? Wir haben es, verdammt noch mal, nicht nötig, dauernd vorzusprechen und auf dich zu warten, Marshal. Welcher verfluchte Idiot hat sich einfallen lassen, die Saloons mit einer neuen Beerdigungssteuer zu belegen – wer war das?«
Marshal Danville sieht den aufgeregten Händler kühl an. Sein Seitenblick trifft Ben Sharkey, der am Fenster lehnt und wie unbeteiligt hinausblickt auf die dunkle Straße.