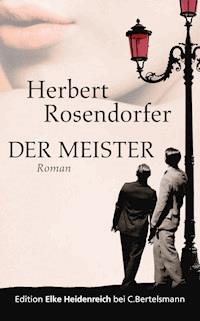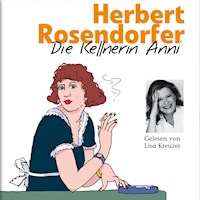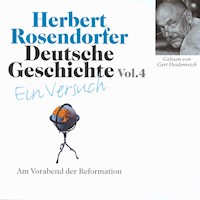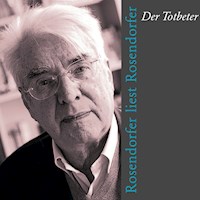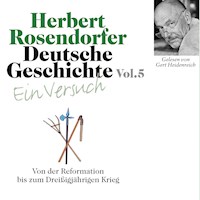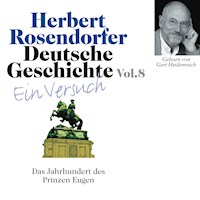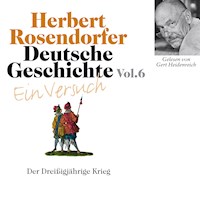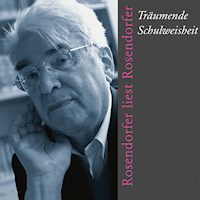9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein italienisches Insel- und Liebesabenteuer um einen Großmogul auf Klein-Capri Der neue Roman von Herbert Rosendorfer, für den Axel Munthes weltberühmtes Buch von San Michele Pate steht, erzählt mit viel Charme und hintersinniger Komik von einer italienischen Insel, die auf wundersame Weise und nur für kurze Zeit zum internationalen Jetset-Ziel avanciert. Lange wurde die kleine Insel Zompara, die zwar keine Blaue Grotte, aber immerhin eine Mondscheinbucht hat, von Touristen verschont. Das ändert sich grundlegend, als der mysteriöse armenische Großmogul Kasparian beschließt, dort ein Feriendomizil zu errichten. Seine abenteuerlich futuristische Villa in den Klippen macht Zompara zum Architekturmekka. Der Mogul, dessen abstehende Ohren in der Abendsonne golden leuchten, verliebt sich in das schöne Aktmodell Caterina, sorgt für zahlreiche Inselattraktionen und damit für einen Tourismusboom, der erst nach dem plötzlichen Verschwinden Kasparians wieder nachlässt. Jahre später schildert der mäßig erfolgreiche Münchner Maler und Ich-Erzähler Felix Mahr jenen schnellen Aufstieg und Niedergang Zomparas, an dem er nicht ganz unbeteiligt war. Mahrs höchst unterhaltsame Erinnerungen an den »Fall Kasparian« sind immer auch kokette Abschweifungen, durchsetzt mit wunderbaren Anekdoten und Rückblenden auf seine vier gescheiterten Ehen und mit einem typisch Rosendorferschen Arsenal seltsamer Figuren: neben den Einheimischen vor allem deutsche Künstler wie der Beuys-Schüler Horadam, der immer eine Flasche Pilsner Urquell zur Hand hat, der aus Ravensburg stammende Großschriftsteller Heribert Caesar, der steinalt ist, die Insel aber nie mit derselben Frau besucht, ferner Thesa, die Gattin eines Honorarprofessors, und eine schwerreiche »Fra Angelico«-Dame, die ihr teures Kunstwerk immer in einem Koffer mit sich trägt. Unterhaltsam-scharfsinnig und mit leichter Hand zeichnet Herbert Rosendorfers Roman über eine fiktive Insel auch ein liebevolles und zugleich selbstironisches Bild deutscher Italiensehnsucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Weitere Lesetipps
» Impressum
INHALT
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Informationen zum Autor (Klappentext)
Weitere Lesetipps
Impressum
[Menü]
I
Irgendwann erschlage ich ihn noch. Ich stelle mir vor, er dreht sich um, damit ich nicht sehe, wieviel er in seiner unordentlichen Kassenschublade hat, befürchtend, ich könne daraus schließen, wieviel mehr er von den Touristen für meine Arbeiten nimmt, wenn er schon welche verkauft, was selten genug der Fall ist, und ich nehme diese wider-liche Bronzeplastik seiner Lieblingsbildhauerin, einer absolut talententbehrenden Deutschen namens Ehrtrud Kolbranz-Schüttling, und haue sie ihm über den Schädel. Die Bronzeplastik würde sich dazu eignen, weil sie erstens schwer ist und zweitens scharfkantig und zackig. Was mich vom Mord abhält, sind nicht ethische Motive, das Gewissen oder die Sündhaftigkeit der Tat (obwohl ich so kaltherzig bin zu behaupten, ein Mord an Luca Veracci ist nichts Sündhaftes, wenn ich mich vielleicht auch nicht dazu versteige, ihn als gute Tat zu bezeichnen, mit der ein Pfad-finder seine Tagespflicht erfüllt hätte)–nein, von der Tat hält mich nur der Zustand der italienischen Gefängnisse ab, denn in ein solches käme ich ja wohl dann. Auf der Insel haben sie kein eigentliches Gefängnis, nur einen Kotter in der Carabinieri-Station, in dem aber die Frau des Maresciallo ihr Bügelzimmer eingerichtet hat. Ich würde mit dem Hubschrauber, vermute ich, in die Provinzhauptstadt aufs Festland geflogen. Schon das Strafe genug: ein Hubschrauberflug. Wenn der Motor aussetzt, fällt ein Hubschrauber herunter wie ein Stein. Ein Flugzeug kann wenigstens noch weitersegeln, die Chance dazu besteht. Ein Hubschrauber nicht. Und das Gefängnis dort in der Provinzhauptstadt dürfte eine dichtgedrängte Hölle sein. Man weiß, daß jede italienische Regierung, sie sei, wie sie wolle, gezwungen ist, auch den dürftigsten Anlaß wahrzunehmen, um eine Amnestie zu verfügen. Nicht aus Menschlichkeit, sondern, um die Gefängnisse insassisch auszudünnen. Die letzte Amnestie erfolgte, glaube ich, anläßlich des hundertsten Jahrestages des Erfrierens einer italienischen Polarexpedition. Oder der Erfíndung der Sackkarre. Aber Mörder, selbst Mörder von Galeristen und Kunsthändlern, fallen regelmäßig nicht unter die Amnestie.
Also werde ich ihn nicht erschlagen, auch nicht erwürgen oder ihm sonst eine Behandlung angedeihen lassen, die ihm eigentlich gebührt, denn er ist als Galerist für mich immerhin besser als gar nichts, außerdem der einzige auf der Insel, und wer weiß, ob nicht noch ein größerer Gauner nachfolgt. Ab und zu verkauft er ja doch ein Bild an einen Touristen. Früher, noch vor drei Jahren, war alles anders. Da hat es sechzehn Galeristen und Kunsthändler auf Zompara gegeben. Sie sind alle weg, nachdem die Sache mit Kasparian sozusagen zu Ende war, und damit der Tourismus, jedenfalls der große solche. Jetzt kommen nur noch Deutsche in kurzärmeligen Hemden mit einem Photoapparat vor dem Bauch, die die Reise in Ravensburg pauschal gebucht haben und sich in den bloßen Sand legen, weil sie zu geizig sind, um einen Liegestuhl zu mieten. »Ravensburg«: Ich habe nichts gegen Ravensburg, ich nehme es nur als Beispiel. Ich könnte auch Osterwied oder womöglich Rudolstadt sagen, mir ist nur Ravensburg eingefallen, weil Caesar dort geboren ist. Nein, nicht Gaius Julius, sondern Heribert Caesar, von dem noch die Rede sein wird, denn er hat mich darauf gebracht, dies alles hier und die Geschichte mit Kasparian und der Insel niederzuschreiben. In Wirklichkeit heißt er–ich meine Caesar, nicht Kasparian–Albert Zürner, aber das hört er nicht gern. Auch nicht, daß er nur in Ravensburg geboren ist und nicht in Paris, zum Beispiel, oder wenigstens in Bad Homburg vor der Höhe. Ich glaube auch nicht, daß er weiß, daß ich von Zürner und Ravensburg weiß. Er hat nur einmal unten bei Amanda seinen überirdisch eleganten Kamelhaarmantel hängen lassen (als wir hingingen, war es frisch, als wir das Lokal verließen, war es inzwischen warm geworden), und im Mantel war sein Paß. Amanda hat mir den Mantel gegeben, ich solle ihn dem Professore bringen, weil der ja auch oben wohne, wie ich. Ich weiß, daß man so etwas nicht tut, aber ich habe in seinem Paß nachgeschaut. Immerhin ist Heribert Caesar als Künstlername eingetragen. Die Gefahr, daß Caesar dies hier liest, ist gering, obwohl, wie gesagt, das alles auf seine Anregung hin niedergeschrieben wird. Caesar liest nichts, was nach 1945 verfaßt wurde. »Alles was nach 1945 verfaßt wurde, und das gilt nicht nur für die deutsche Literatur, ist Schrott. Mit ganz wenigen Ausnahmen.«
Selbstverständlich zählen seine Werke zu den Ausnahmen, die braucht er aber nicht zu lesen, weil er sie ja selber geschrieben hat und vermutlich also kennt. Daß er dies hier zu den Ausnahmen zählt, ist unwahrscheinlich. Ich kann über ihn also hier schreiben, was ich will–obwohl, ich schätze ihn. So ist es nicht. Ich bewundere ihn sogar in mancher Hinsicht. Er ist der eleganteste Mensch, den ich kenne, und zwar nicht nur sozusagen äußerlich (seinen überirdischen Kamelhaarmantel, maßgeschneidert!, habe ich schon erwähnt), sondern auch innerlich. Er hat Redewendungen von brillantenem Glanz. Er hat ein Gesicht, als trüge er ein Monokel, trägt aber keins. Er hat einen Hut von einer aristokratischen Schäbigkeit, die aber den Glanz der Krone eines abgedankten Herrschers ausstrahlt. Sozusagen die Ruine einer Kostbarkeit. Ich vermute, daß der Hut als neuer mehr gekostet hat als etwa das kleine Auto, mit dem Amanda auf der Insel herumfährt. Der wahre Wert des Hutes ist im Inneren, im Futter verborgen: das Etikett des Herstellers. Es handelt sich dabei allermindestens um den königlich-englischen Hoflieferanten, womöglich aber um einen finnischen Huthersteller, ein Geheimtipp der eleganten Welt, der nur drei Exemplare pro Jahr fertigt. Etwas in die Richtung.
»Der Hut«, sagt Caesar, »hat inzwischen Wunden. Was sonst. Er hat alle Heimsuchungen miterlebt, die der feindliche Weltgeist als über mein Haupt zu schütten für angebracht gefunden hat.«
Caesar verachtet die Menschen, aber er behandelt sie mit der feinsten Rücksichtnahme.
[Menü]
II
Arri Kasparian kam das erste Mal auf die Insel, da lebte ich, wenn ich mich recht erinnere, seit sieben Jahren hier. Nicht nur das mickrige Inselblättchen vermerkte dieses Ereignis, sondern sogar der Messaggero. Als ich, Felix Mahr, das erste Mal auf die Insel kam, vermerkte das nichts und niemand. Auch sonst unterschied sich Kasparians Ankunft von meiner erheblich. Ich meine nicht meine endgültige Übersied-lung hierher, ich rede von meinem allerersten Aufenthalt auf Zompara, das liegt viele, viele Jahre zurück.
Ich war viermal verheiratet. Vier Mal zu viel. Vier Mal geschieden. Kein Mal zu wenig. Meine erste Frau hieß Annelore, war etwas älter als ich und die einzige Tochter aus besserem Hause. Wenige Wochen, nachdem ich–damals erst mit 21–volljährig geworden war und meine Eltern es mir nicht mehr verbieten konnten (also, um dies vorwegzunehmen, die beiden Leute, die als meine Eltern galten, ob zu Recht, ist bis heute ungeklärt), fuhr ich mit Annelore in Urlaub. Wir waren noch nicht verheiratet, allerdings verlobt, sogar mit richtiger Verlobungsfeier, die mir höchst unangenehm gewesen war. Ich hatte bis dahin noch nie das Meer gesehen, überhaupt war mein touristischer Horizont eng begrenzt, reichte über Berchtesgaden im Süden und Osten und im Norden und Westen über Dinkelscherben bei Augsburg (wo eine Großmutter ins Altersheim gepfercht worden war) nicht hinaus. Ich hatte gehofft, daß der Herr des besseren Hauses, aus dem Annelore stammte, die Reisekosten übernehmen würde, aber das bessere Haus war gleichzeitig ein sparsames Haus. Anders ausgedrückt: Der Alte war von grünem Geiz beseelt. Er rückte ganze fünfzig Mark heraus, nicht ganz wenig damals, aber selbstverständlich längst nicht genug. Zum Glück hatte ich eine wohlmeinende Tante, die mir das Geld lieh. So fuhren wir nach Zompara. Eigentlich wollte ich nach Capri, denn ich hatte eben Axel Munthes Das Buch von San Michele gelesen, aber nachdem ich die Prospekte studiert hatte, war klar, daß Capri unsere Finanzkraft weit überstieg. So wichen wir nach Zompara aus, das damals noch nicht einmal im fremdenverkehrlichen Aufstieg begriffen war. Es gab nur ein Hotel, das kein Hotel war, sondern ein einfaches Gasthaus und Gloria di Garibaldi hieß. Selbstverständlich behaupteten auch die Zomparesen (auf zomparesisch: Sz’compé), daß Garibaldi auf Zompara geweilt habe. So wie in ganz Italien kein Ort zu finden ist, und sei es das kleinste Drecknest, in dem es nicht eine Via Cavour gibt, so gibt es keinen Schrittbreit italienischer Erde, den nicht Garibaldi mit seinem Fuße geheiligt und–wie böse Zungen behaupten–ein uneheliches Kind hinterlassen hätte. Es heißt, hätte Garibaldi bei der Eroberung Siziliens seine Kuckuckseier mitgeführt, wäre es nicht der Zug der Tausend, sondern der Zug der Zehntausend gewesen. Der alte Meßdiener Peregrino, der voriges Jahr gestorben ist, hat sogar behauptet, Garibaldi sei auf Zompara geboren.
»Er war so alt«, sagte die schöne Wirtin Amanda, »daß er sagen hätte können, er weiß es, denn er war dabei.«
Annelore wäre mit Capri einverstanden gewesen. Annelore war auch mit Zompara einverstanden. Sie war immer mit allem einverstanden und wollte nichts als schlank und schön sein und bewundert werden und war der Meinung, es habe immer einer da zu sein, der für sie sorge. Damals war ich es. Ich verehrte sie kniefällig. Ich versuchte, ihre Liebe dadurch zu erringen, daß ich sie mehr und stärker bewunderte als alle anderen Verehrer. Ich errang ihre Liebe. Erst danach bemerkte ich, daß es mit der allgemeinen Bewunderung nicht soweit her war. Aber da war es zu spät. Sie kümmerte sich um nichts, nicht um die Fahrkarten, nicht um die Abfahrtszeiten. Da sie, auf ihre Schlankheit achtend, kaum etwas aß, brauchte sie sich auch nicht um Fragen der kulinarischen Verpflegung während der langen Fahrt zu kümmern. Ich hatte sie, so sah ich es später, dabei wie einen Koffer. Stellte ich sie irgendwohin, blieb sie stehen und beschäftigte sich damit, schön zu sein. Bis ich sie wieder abholte. Ich fügte mich allem. Günstig war, daß sie allerdings keine Launen hatte, da ihr Gefühlspendel nicht ausschlug, weder nach dieser noch nach jener Seite. Und außerdem war sie stark kurzsichtig, war zu eitel, eine Brille zu tragen, und Haftschalen gab es damals noch nicht. So stand sie also am Kai, während ich die Schiffsbiglietten löste und dabei das erste Mal das Meer sah, und war schön und wartete darauf, daß ich sie auf die Fähre schob.
Der Aufenthalt auf Zompara war eine Katastrophe. Zwar malte ich fleißig, aber die übrige Zeit war von quälender Langeweile. Freilich: Annelore konnte einfach dasitzen und nichts tun, nicht einmal denken. Nur fort ließ sie mich nicht. Sie klebte an mir. Besser gesagt, sie erwartete wortlos und selbstverständlich, daß ich an ihr klebe. Und ich klebte, verliebt wie ich war, und wir saßen–ich gähnend–in dem, was der Wirt der Gloria di Garibaldi als »Lounge« bezeichnete, oder, noch schlimmer, im resopalstilistisch eingerichteten Zimmer. Wobei der Begriff einrichten nicht wirklich zutraf. Der Wirt hatte wahrscheinlich andernorts nicht benötigte Möbel hier abgestellt. Es waren daher vier große, stark unterschiedliche Schränke im Zimmer, aber nur ein Stuhl. Bad und WC waren auf der anderen Seite des Flurs. Das WC war so angeordnet, daß man–es gibt so unvergeßliche Dinge im Leben–immer mit einem Fuß den Türgriff hochdrücken mußte, denn die Tür war nicht sperrbar. Ich erspare dem Leser die Schilderung der, wenn der Ausdruck gestattet ist, notwendigen Verdauungsakrobatik, zumal das WC-Becken ziemlich weit von der Tür entfernt angebracht war. Oder überlasse es dem Leser, daß er hier eine Pause macht und sich die Kalamitäten selber ausmalt. Ich wünsche keinem Leser, daß er solche Kalamitäten erleidet, nicht einmal einem, der eventuell dieses Buch gestohlen hat.
Man bedenke, daß damals, in den frühen fünfziger Jahren, die geschlechtliche Sprunghaftigkeit unter jungen Leuten noch nicht so ausgeprägt war wie heute. Zwar hatte Annelore, wie ich eben in den zwei Wochen in Zompara festzustellen glaubte, schon gewisse Erfahrungen in dieser Hinsicht. Ich nicht. Ich hatte nur seelenraumgreifende Phantasien. Annelore war die erste Frau, die ich nackt sah. Auch da war sie sozusagen unbekümmert, schlief nackt, rannte nackt über den Flur ins Bad. Zog sich am Strand nackt aus, bevor sie in den Badeanzug schlüpfte. Und, ob man es glaubt oder nicht, ich lag zwei Wochen in einem Bett, das die Italiener Matrimoniale nennen, neben ihr, neben der nackten Annelore, und ich erkannte sie nicht.
Später einmal, da waren wir schon verheiratet, kam die Rede darauf, und sie sagte: ja, sie habe sich damals sehr gewundert. »Warum hast du nichts gesagt?« fragte ich. »Ich dachte«, sagte sie, »du sagst etwas.« War es die Tragik dieser Ehe, daß sie immer darauf wartete, daß ich etwas sagte?
Dies also war mein erster Aufenthalt auf der Insel Zompara, die, das ist allerdings etwas übertrieben gesagt, mein Schicksal werden sollte, sofern man es als Schicksal betrachtet, daß ich nunmehr seit über zwanzig Jahren hier lebe und nicht vorhabe, in meinem restlichen Leben wegzuziehen.
Etwa zehn Jahre später kam ich das zweite und sozusagen vorletzte Mal auf die Insel. Dem Leser ist klar, was ich damit meine? Das letzte Mal, hoffe ich, kam ich damals vor über zwanzig Jahren (genau: 24 Jahren) mit meinem nicht sehr umfangreichen Umzugsgut hierher, mit dem Auto bis in die Provinzhauptstadt, wo ich das Auto verkaufte, und dann per Fähre auf die Insel. Was tu ich mit einem Auto auf der Insel, wo ich alles, was ich brauche, zu Fuß in längstens einer Viertelstunde erreiche? (Allerdings habe ich mir schon ein paarmal überlegt, nein: kein Fahrrad, dafür sind die Wege zu steil, sondern einen Esel zu kaufen.) Will ich, was selten genug ist, auf die andere Inselseite, wo die verlassenen, langsam verfallenden Hotelkästen und Ferienhäuser stehen, so nehme ich den Omnibus, oder Amanda kutschiert mich mit ihrer Primula dorthin.
Das vorletzte Mal also, daß ich die Insel betrat, war ich oder waren wir, Annelore und ich, finanziell erheblich besser ausgestattet. Wir waren verheiratet und hatten zwei Kinder, zwei Mädchen, damals drei und sechs Jahre alt: Linda und Lewina. Die finanziell bessere Ausstattung verdankten wir nicht meinen Erfolgen als Maler, sondern dem Geiz des Alten, also Annelores Vater. Ja, dem schon erwähnten grünen Geiz, wohlgemerkt, nicht der Großzügigkeit.
Ich schiebe eine Bemerkung ein, die mir wohl nicht zur Ehre gereicht; ich war als Maler nicht erfolgreich. Ich war so trotzig, den Trend in den fünfziger Jahren zu verachten, und malte saubere Landschaften–Südliches mit viereckigen weißen Häusern und Zypressen. Ich gestehe, daß die schwarz-grünen Flammen der Zypressen an Van Gogh erinnerten. Es ist schwierig, Zypressen zu malen, ohne daß einem Van Gogh im Wege steht. Bei Sonnenblumen ist es noch schlimmer, aber davon ließ ich zum Glück die Finger. Es gibt eben Helden der Vorzeit, die dies oder jenes abschließend behandelt haben, und dann sollten die Posterioren ihr Haupt demütig beugen und Ruhe geben. Aber zurück zum alten Knüpriß, Annelores Vater.
Er wollte den Installateurlohn einsparen und bohrte selber. Er bohrte auf eine Starkstromleitung. Der Bohrer lief noch, als die Mutter Annelores ihn fand. Der Stromschlag, ergab die Obduktion, wäre nicht tödlich gewesen, tödlich war der Sturz von der über zwei Meter hohen Leiter mit dem Kopf auf die Kante einer alten, unschönen und wurmstichigen Truhe aus der Nachkriegszeit, die Annelores Mutter immer schon zum Sperrmüll geben wollte. Der Alte aber hatte darauf bestanden, daß man sie behalte, weil man nicht wisse, ob man sie nicht noch einmal brauchen könne.
Annelore und ihre Mutter erbten je die Hälfte des nicht unbeträchtlichen Vermögens.
Ich kann nicht genau sagen, warum ich für die ersten Ferien im Wohlstand ausgerechnet Zompara wählte. Nun hätten wir uns Capri leisten können. (Annelore wählte selbstverständlich gar nichts. Sie kofferte, wenn ich diesen Ausdruck erfinden darf, immer noch, auch als Ehefrau und Mutter.) Wegen Amanda? Die schöne Amanda hatte es mir sicher nicht angetan, denn als ich das erste Mal auf der Insel war, wurde eben erst Amandas spätere Mutter geboren. Warum dann? Die Erinnerungen an den ersten Aufenthalt waren, wie der Leser dem oben Gesagten entnehmen kann, nicht dazu angetan, die Insel wiedersehen zu wollen. Der Versuch, ob es diesmal besser gehe? Wohl kaum. Die Ehe war längst am unteren Ende der schiefen Bahn angekommen. War es, jetzt greife ich in die literarischen Harfensaiten, das Walten ebenjenes, oben schon bemühten Schicksals, das, ohne daß ich es wußte, daran ging, mich für immer auf die Insel zu ziehen? Wenn ja, mußte es noch zwanzig Jahre warten. Aber erwähntes Schicksal und dessen Walten prägten mir die Insel diesmal in schönerem Licht ins Gedächtnis. Ich beschäftigte mich mit den Kindern, ergötzte mich an der sechsjährigen Linda, die sehr rasch erkannte, daß sie durch bloßes Nennen der Zimmernummer in der Hotelbar die sofortige Herbeibringung eines Eisbechers oder einer Aranciata erwirkte, die sie dann mit elegant übergeschlagenen Beinen in dem viel zu großen Sessel sitzend aß oder schlürfte. Ich machte mit den Kindern Eselsritte, baute Sandburgen, spielte unendliche Mensch-ärgere-dich-nicht-Partien, wobei Linda auch für Lewina mitwürfelte, die so tat, als verstehe sie das Spiel schon. Und was dergleichen mehr ist.
Frau Annelore Mahr-Knüpriß saß inzwischen am Strand und war–war immer noch schön? Auch sie war natürlich zehn Jahre älter geworden; innerlich zehn und äußerlich, behaupte ich, zwanzig Jahre. Sie, die früher Wert auf Chic gelegt, die, in erwähnter Unbekümmertheit, hochgewagt Erotisches getragen–oder sogar nicht(s) getragen–hatte, befleißigte sich jetzt textilisch biederer Spießigkeit in Braun und Dunkelgrau und verstieg sich sogar zu Strickkleidern. Am Strand trug sie einen Badeanzug in einer Farbe, die bei der Klerikalausstattungs-Firma Camarelli in Rom »colore vescovo« heißt, und von einem Schnitt, der mich verwundern ließ, daß nicht die Gemeindeverwaltung eingriff: wegen Verunstaltung des Gesamtbildes durch Zurschaustel-lung von Textilantiquitäten aus Kaisers Zeiten. Das einzig Lebendige an der Ehe waren die relativ regelmäßigen Auseinandersetzungen, bei denen Annelore schimpfen und kreischen konnte. Sie ärgerte sich dabei, weil sie als Frau, sagte sie, mit ihrer hohen Stimme im Nachteil, und vor allem, weil ich, so ihre Meinung, ungeeignet zum ernsthaften Streit sei. Ich sagte nämlich immer nur: »Du hast recht«, oder »Ja, ich bin ein Schwein«. Es endete fast immer damit, daß sie das Haus verließ, sich sozusagen in die kalte, fremde Welt werfend, ohne Mantel im Winter, im Sommer ohne Schuhe, nach dem Prinzip: »Recht geschieht es dem Vater, wenn mir die Hände abfrieren, was kauft er mir keine Handschuhe.«
Soll ich ganz ehrlich sein? »Ehrlichkeit ist nur literarisch vertretbar«, sagt Heribert Caesar, »im wirklichen Leben ist Lügen angesagt.« Also ehrlich: Der Grund für manche dieser Auseinandersetzungen war mein zwar nur gelegentliches, aber manchmal weiter gespanntes Interesse für andere Frauen. Nichts davon. »Der Kavalier schweigt auch, wenn er längst nicht mehr genießt«, sagt Caesar.
Aus der nebenbei erwähnten Hotelbar, in die sich meine Tochter Linda setzen konnte, schließt der aufmerksame Leser sofort, daß sich der touristische, gastronomische Zustand der Insel geändert hat, obwohl sich Arri Kasparian, der skrupelabstinente Kommerzmogul, Waffenschieber, Reeder und Drogengrossist, noch lange nicht für die Insel interessierte. Es war–mit irgendwelchen europäischen Geldspritzen für unterentwickelte Regionen–eine Straße, wenngleich noch unbefestigt, zur anderen Seite der Insel gebaut worden, wo die schönen Strände sind. Der Hafen war ausgebaut worden und sollte noch weiter ausgebaut werden. Das eine Fährschiff, die Massimo d’Azeglio, war sogar schon ein Tragflügelboot. Und es gab ein kleines Hotel, noch durchaus nach menschlichem Stil erbaut. Die Gloria di Garibaldi hieß jetzt Al Sole und nannte sich Restaurant, das zwar über keinerlei Sterne in irgendeinem Gourmet-Führer verfügte, wo man sich aber immerhin bemühte, saubere weiße Tischtücher aufzulegen.
Auf der Rückreise trat das nicht unerwartete tatsächliche (noch nicht das juristische) Ende meiner ersten Ehe ein. Ich wollte, den Kindern zuliebe, die lange Fahrt nicht an einem Tag machen und hatte beschlossen, in Verona zu übernachten, nicht bedenkend, daß zu der Zeit die Opernfestspiele in der Arena tobten. Ich absolvierte, den Guide Michelin in der Hand, eine Herbergssuche, wobei ich von vier roten Häuschen auf drei, zwei, ja letztlich auf ein Häuschen herunterrutschte, bis ich in einer Frühstückspension, deren Namen ich selbstverständlich längst vergessen habe, er könnte Sanguinaccio gelautet haben, für uns vier ein Zimmer bekam. Bereits beim Abendessen kam es zum Streit. Diesmal verdächtigte mich Annelore zu Unrecht. Es war in der Zeit keine Eheabwegigkeit meinerseits vorhanden. Schon gar nicht hatte ich auf der Insel dergleichen Bande geknüpft, dies nicht einmal versucht. Dennoch greinte Annelore. Im Zimmer dann, ungeachtet der erstaunten Kinder, ging sie zum Kreischen über. Vergangene Verfehlungen, die nicht von der Hand zu weisen waren, wurden seitlich neben den aktuellen Verdächtigungen aufgetürmt, worauf ich sagte: »Du hast recht, ich bin ein Schwein, und ich möchte jetzt schlafen.«
Daraufhin passierte das Übliche. Annelore klappte ihre Seele zu und verließ–wie sie war, ohne Handtasche, zwar nicht im Nachthemd, aber nur in Rock und Bluse (braungrau)–das Zimmer und die Frühstückspension. Es war zwei Uhr in der Nacht.
»Geht Mammi zum Arzt?« fragte Linda.
»Wahrscheinlich«, sagte ich, »schlaf’ jetzt.« Lewina schlief längst trotz des Lärms.
Normalerweise kehrte Annelore in solchen Fällen nach einigen Stunden zurück und tat so, als sei nichts gewesen. In jener Nacht in Verona und in ihrer zornigen Seelenverschlossenheit bedachte sie aber nicht, daß man die Familienpension nachts zwar verlassen und die Tür von innen öffnen konnte, von außen aber nicht. Einen Nachtportier oder zumindest eine Nachtglocke gab es nicht. Es war keine Tücke von mir, daß ich sie dennoch gehen ließ, denn ich merkte diese Falle erst am nächsten Morgen.
Darüber, was Annelore, kurzsichtig, ohne Geld, ohne Ausweis, ohne alles, in der Nacht tat und wie und wann sie wieder nach München kam, gibt es zwei unterschiedliche Versionen, die ich an geeigneter Stelle berichten werde. Als sie in der Früh noch nicht wieder da war, ging ich mit den Kindern zum kärglichen Frühstück. Wenigstens machte die Padrona für die Kleinen einen Kakao. Danach war Annelore noch immer nicht da. Ich ließ die Kinder kurz in der freundlichen Aufsicht der Wirtstochter und ging das Auto aus einer Tiefgarage drei Straßen weiter holen. »Ist Mammi immer noch beim Arzt?« fragte Linda. »Wahrscheinlich«, sagte ich. Ich wartete noch eine Stunde. Dann verständigte ich die Carabinieri, das heißt, ich versuchte es. Mein Italienisch war damals noch nicht so weit, daß ich einen derart komplizierten Sachverhalt hätte darlegen können. Es blieb also ohne Folgen. So verpackte ich die Kinder auf die Rücksitze und fuhr ab.
»Bleibt Mammi hier im Krankenhaus?« fragte Linda.
»Wahrscheinlich«, sagte ich.
[Menü]
III
Caesar war wieder auf der Insel. (Jetzt, meine ich, während ich dies schreibe.) Mit einer neuen Frau oder Freundin. Noch nie ist Caesar ohne eine neue Frau oder Freundin auf die Insel gekommen. Seine Frauen und Freundinnen sind stets von allererster Qualität. Nicht Schickimicki, nicht Prominien, Stars, Starlets oder so schnellverderbliches Zeug, kein Naddl-Moddl, sondern wirkliche Klasse. Meist reich, schön sowieso. Heribert Caesar ist wohlgemerkt, ich glaube, ich habe das noch nicht erwähnt, zehn Jahre älter als ich. Dennoch: Er ist von unerschöpflichem, wenngleich höchst dezentem Geschlechtsinteresse erfüllt. Ich kann mich daran erinnern, daß wir einmal, es war in der Turbulenz-Zeit, wie ich die Jahre zwischen dem Auftauchen und dem Verschwinden Kasparians nenne, in Amandas Trattoria saßen, und am Tisch nebenan saß Milva, die große, berühmte, rothaarige Milva, die einzige, der ich mit meinem ausgeprägten Ausschließlichkeitsanspruch für sogenannte Ernste Musik gestatte, mir zu gefallen. Nicht nur durch das, was sie singt.
Schon das spricht für La Milva, daß sie, flankiert von zwei stark mit Schmuck behangenen Junggreisen, nicht eins der Miramonti, Blue Sea oder Las Vegas besuchte (ganz zu schweigen von einer der kulinarischen Fast-Food-Höllen, deren Bezeichnung der berühmte Münchner Wirt Süßmayer von fast… also nicht ganz »Food« ableitet, oder Gold Dragon, denn die Chinesen hatten sich fast noch schneller auf die Insel gedrängt als die anderen alle). Nein, La Milva war in der Trattoria Vittoria, die seit Vittorias leider zu frühem Tod Amanda führte und die deswegen allgemein »bei Amanda« heißt.
Jedenfalls: Ständig schaute La Milva nicht zu mir herüber, das hätte ich nicht erwartet, ich bin alles andere als ein maskulines Oilpainting, wohl aber, obwohl sie ihre Galane dabeihatte, stets nur zu Caesar, dem über achtzig Jahre alten Caesar, der offenbar für weibliche Sympathie-Antennen eine bereits ins Mystische spielende Anziehungskraft hat. Und der Gipfel der Sache: Caesar würdigte dieser offensichtlichen weiblichen Huldigung–einer Milva!–keinerlei Aufmerksamkeit, und als ich ihn, nachdem La Milva mit ihren pavianischen Hominiden Amandas Lokal verlassen hatte, darauf hinwies, sagte Caesar nur: »Ach, da schau her. Der Abend wird für mich in unauslöschlicher Erinnerung bleiben. Wer ist Milva?«
Selbstverständlich war auch La Milva in der Turbulenz-Zeit gelegentlich auf Zompara. Sie mußte ja. Jeder, der dazugehörte (und vor allem jeder, der dazugehören wollte), mußte mindestens einmal im Jahr auf Zompara sein. Der Leser erinnert sich vielleicht, entsprechende Berichte in der Bunten oder sonst einem Knall-Blatt gelesen zu haben. Übrigens Caesar nicht; erstens gehörte Caesar nicht dazu. Zwar war er unter Literaten–mit Recht, wie ich meine–einigermaßen angesehen, aber Promi im jetsetischen Rummel-Sinn war er nicht. Und zweitens war er schon oft auf Zompara gewesen, ehe die Anwesenheit Kasparians die Turbulenz-Zeit hervorrief, und er kommt auch jetzt, danach, wieder. Übrigens: Das »sogenannte« vor dem Epitheton Ernste vor dem Begriff Musik ist keineswegs abwertend gemeint. Das sogenannt bezieht sich nur darauf, daß die sogenannte Ernste Musik, wie der Musikfreund weiß, durchaus heiter, fröhlich, lustig und sogar unernst sein kann. Ich stampfe den Unterschied zwischen E-und U-Musik mit Entschiedenheit bejahend auf den Boden. Ich verstehe in den Abkürzungen zwar etwas anderes. E-Musik und U-Musik: echte Musik und unechte, wobei bei dieser der Terminus Musik eigentlich nicht angebracht ist. Das was die JaulnickelInnen von sich geben, sind lediglich akustische Phänomene, die jene für Musik halten. (Ich verwende bei JaulnickelInnen, wie man, hoffe ich, bemerkt, die furzdumme Mittelmajuskel, die ich sonst selbstverständlich vermeide, verwende sie hier nur, um meine Abscheu vor jener sogenannten Musik zu verdeutlichen.)
Und noch etwas: Amandas Trattoria war auch in der Rummelund Kasparian-Zeit im gewissen Sinn ein Ruhepol. Ich weiß nicht, ob das alles zu dem Roman dazugehört, den ich auf Anregung Caesars schreibe, zum Beispiel das mit Amandas Trattoria und der Milva. Ich bin unsicher. Eigentlich wollte ich ihm die paar Seiten, die ich bisher zusammengebracht habe, erst nicht zeigen. (Aber ist es überhaupt herabwürdigend, was ich über ihn geschrieben habe? Ist es nicht eher eine, wenn auch nur schwer erkennbare Huldigung?) »Du wirst nicht erwarten«, sagte er jedoch, »daß ich wegen deines ohne Zweifel weltbewegenden Elaborates die Lektüre des Briefwechsels zwischen Arthur Schnitzler und Olga Waisnix unterbreche?« Ich gehe also das Risiko ein und erwähne, obwohl es vielleicht nicht zum Roman gehört und die Handlung, die sich ja auf Kasparian konzentrieren sollte, unterbricht, wie das mit Amandas Trattoria war. Vittoria hieß Amandas Mutter. Ob ich den Familiennamen jemals gewußt habe, weiß ich nicht. Wenn ja, habe ich ihn vergessen. Die Trattoria heißt auch Vittoria oder Da Vittoria, denn Vittorias Vater, also Amandas Großvater–den ich nicht mehr gekannt habe–, hat die Trattoria gegründet und nach seiner Tochter benannt, wobei das, vermute ich, ein zu hochgestochenes Wort ist:gegründet. Er hat halt die Wirtschaft da unten am alten Hafen, der damals noch der neue Hafen war, aufgemacht und Pasta und Fleisch und Fisch gekocht und auf den paar wackeligen Tischen serviert. Später hat ihm die Brauerei Pironi neue Tische und Stühle und die Kaffeefirma Illy eine Theke für die Bar spendiert, wie es so üblich ist. Dafür wird nur Pironi ausgeschenkt, ein Bier, das–dies sagt ein Bayer–als solches kaum kenntlich ist, und der Espresso nur mittels Illy-Bohnen hergestellt, was allerdings sozusagen der Rolls-Royce unter den Kaffeesorten ist. Es ist auch damals, erzählte mir Vittoria, doch tatsächlich ein Emissär von der Firma Illy aus Triest gekommen und hat, bevor der Vertrag abgeschlossen wurde, die Lokalität begutachtet, denn die Firma Illy sieht darauf, daß ihre Kaffeejuwelen nicht an unwürdigen Orten verwendet werden.
Es ist nicht hymnisch genug zu besingen, daß die Trattoria Vittoria auch in der Turbulenzund Promi-Zeit der Insel im Großen und Ganzen blieb, was sie war. Dazu half die Lage, denn mit Öffnung des Neuen Hafens rückte, Städte und Orte haben ja auch ihre Bewegungen, der Ort Zompara, die Hauptstadt der Insel, wenn man so will, ein wenig zur Seite des Neuen Hafens hin, und die Gasse am alten Hafen (sie, Corso Cavour, na ja, war etwa fünf Meter breit), in der die Trattoria lag, etwas in den Windschatten. Und außerdem mußte es ja neben den bald erblühenden Verköstigungs-Institutionen mit dreisprachigen Speiskarten in Schweinsleder und meterhohen Pfeffermühlen einen Ort geben, wo auch die zahlenmäßig zurückgequetschten Einheimischen hingehen konnten.
Ich könnte Amanda fragen: Wann ist deine Mutter gestorben? Aber Caesar riet mir: »Keine Recherchen. Türme keine Lexika neben deinem Manuskript auf. Lasse es aus deinem Organ, das dir der Weltgeist hinter deinen grau werdenden Brauen dediziert hat, so herausfließen, wie es herausfließen will…« Also frage ich nicht. Aber die Erinnerung befrage ich, und die sagt, daß Vittoria einige Jahre nach dem ersten Auftreten Kasparians starb. Leukämie oder so etwas. Sie war keine fünfzig Jahre alt und immer noch eine nicht hübsche, sondern schöne Frau. (Amanda muß es ja irgendwoher haben.)
Es war schon zur Turbulenz-Zeit, längst war ich Bewohner der Insel, sogar von den Zomparesen größtenteils akzeptiert, zählte nicht zu den Touristen. Es war also keine Anbiederung oder Anmaßung, daß ich, wenn auch selbstredend weiter hinten im Kondukt, nach den Angehörigen und engeren Familienfreunden im Leichenzug mitging. Es hatte etwas Anrührendes, dieser Leichenzug. Vittoria war beliebt gewesen. Ihr Mann, ein Schlawiner irgendwo aus dem Friaulischen her, kein Mensch belastete seine Erinnerung damit, wie er geheißen, hatte sie verlassen, als Amanda noch ein Schulkind war. Man trug ihr (wie sonst nicht in Italien) nicht nach. Auch nicht, daß sie danach einige Liebhaber hatte, zur Vorsicht allerdings nie einen Mann von der Insel. Mit Hochachtung bemerkte man, daß sie nach dem Tod ihres Vaters resolut die Wirtschaft weiterführte, »tüchtig wie ein richtiger Wirt« (so der alte Gobbo, der Hirt, das Orakel der Insel). Sie starb nach nur ganz kurzer Krankheit. Ich glaube, daß es keine vierzehn Tage dauerte, nachdem die ersten seltsamen Flecken in ihrem Gesicht und auf den Händen aufgetaucht waren. Der alte Inseldoktor, ein Männlein, das stets einen altmodischen grünen Jagdanzug trug, obwohl niemand je gesehen hat, daß er auf die Jagd ging (was sollte man auf Zompara auch groß jagen außer Eidechsen), war ratlos. Die Inselbewohner sind kerngesund ihr Leben lang und sterben an Altersschwäche. Dottor’ Bitroffi war sein medizinisches Leben lang allenfalls mit Grippe, Durchfall oder Platzwunden nach Raufereien konfrontiert. Mit den Flecken in Vittorias Gesicht und auf ihren Händen war er überfordert.
Es ist eigenartig: Der Rechtsanwalt, wenn er konsultiert wird, muß im Buch nachschauen, wenn er in den Augen des Klienten als kompetent erscheinen will, der Arzt darf nicht im Buch nachschauen, sonst hält ihn der Patient für unfähig. Woher kommt das? »Eins der vielen Rätsel«, sagt Heribert Caesar, »die der Weltgeist uns noch zur Lösung vorhält.« Also ging Dottor’ Bitroffi in seine bereits etwas archäologisch wirkende Praxis und schaute hinter verschlossener Tür in seinen vergilbten Büchern nach. Und erschrak. Er glaubte nichts Geringeres als Aussatz diagnostizieren zu müssen. Damals hatten schon zwei deutsche Ärzte eine stahlglänzende, wohlweislich außerhalb des italienischen Gesundheitssystems angesiedelte Privatpraxis eröffnet. Dottor’ Bitroffi wandte sich an sie, und der eine der beiden Deutschen ging mit Bitroffi zu Vittoria und sagte, er habe einige Jahre in den Tropen gearbeitet, er habe Aussatz gesehen, der schaue anders aus. Man kam überein, Vittoria ins Krankenhaus der Provinzhauptstadt zu überweisen, zumal die Flecken noch auffälliger geworden waren und Vittoria zunehmend unter bleierner Müdigkeit und Kopfschmerzen litt. Im Provinzspital wußte man auch nicht weiter, und Vittoria wurde in ein Krankenhaus in Neapel verlegt. Ich besuchte sie dort.
Sofort nach diesem Besuch und noch von sorgenvollen Gedanken über Vittorias Zustand erfüllt, trat ich, obwohl, wie erwähnt, kein Auto mehr besitzend, dem ADAC bei und schloß eine Rückhol-Versicherung im Krankheitsfall nach Deutschland ab. Es ist dann der einzige und womöglich letzte Fall, daß ich mich dorthin bewege (bewegen lasse). Ich hoffe, mit meiner Schilderung des italienischen Gesundheitswesens diese Nation, die die Wiege des modernen Humanismus ist, die Mutter der Künste und überhaupt der Hort menschlicher Freundlichkeit nicht zu beleidigen. Es war fürchterlich. Sie lagen zu sechst im Zimmer, dabei hatte Vittoria noch Glück, daß sie nicht auf dem Flur lag. Einzelzimmer gab es nur wenige, so wurde mir gesagt, und da kommen nur die schwerst Ansteckenden und die Sterbenden hinein. Wenn man also in ein Einzelzimmer kommt, sagte mir ein überaus freundlicher und gesprächiger Arzt, wisse man, welches Stündlein geschlagen hat. Dabei muß man gerechterweise sagen, daß die ärztliche Versorgung an sich vorzüglich ist. Nicht umsonst haben die medizinischen Fakultäten von Padua und Salerno Traditionen begründet, die bis heute fortwirken. Aber die Pflege…der Patient muß seine eigene Bettwäsche mitbringen. Klo und Dusche am Flur. Das Pflegepersonal stammt aus Polen oder Slowenien oder im Härtefall aus Marokko, ist zwar gutmütig und vielleicht nicht einmal unwillig, aber es hapert, wie sich denken läßt, mit der Verständigung. Die italienische Küche ist nach meinem Dafürhalten nicht nur die beste der Welt, sondern die einzig genießbare. Ich höre die Franzosen aufheulen. Hilft nichts. Ich bleibe bei meiner Behauptung. Ich bin nicht zuletzt des Essens wegen nach Italien gezogen. Dem spricht die Verpflegung in den Krankenhäusern Hohn. So wie übrigens auch, unverständlicherweise, in den italienischen Speisewägen.
Es wird–in den Krankenhäusern–erwartet, daß Angehörige im Turnus die Pflege, soweit sie nicht medizinischer Art ist, übernehmen. Leichtere Eingriffe, wie Blinddarmoperationen, werden ebenfalls den Angehörigen überlassen. Italien ist ein Land engen Familienzusammenhalts, und da sind derartige Liebesdienste selbstverständlich.
Nein, das mit den Blinddarmoperationen stimmt natürlich nicht, leider aber das Schlimmste: In den Abteilungen mit den Augenkranken wird naturgemäß am meisten gestohlen, aber auch in anderen Abteilungen ist es tunlichst so, daß der Patient kein Geld und keine Wertsachen, kein Handy, keine Uhr mitnimmt. Es gibt Banden, die darauf spezialisiert sind, Krankenhäuser auszurauben. Es sind selbst in Verbrecherkreisen verachtete Banden, denn nichts ist leichter, als einem frischoperiert Dahindämmernden die Brieftasche wegzunehmen. Manchmal fällt auch Gewalt vor. Ärzte und Pfleger werden gefesselt oder in Schach gehalten, dann die Wertsachen der Patienten abgeräumt. Nicht selten die wertvolleren medizinischen Geräte auch. Einmal, das war in unserem Provinzkrankenhaus, hatte es die Bande auf ein ganz neues, hochmodernes Beatmungsgerät im Wert von so und so viel hunderttausend Euro (oder waren es noch Millionen Lire?) abgesehen. Es hing ein alter Mann dran. Ein Arzt schrie bittend: »Vorsicht! Der alte Mann–« »Wie alt ist er?« fragte der Bandit. »Über neunzig«, sagte der Arzt. »Dann hat er lang genug gelebt«, sagte der Bandit, zog den Stöpsel heraus, es machte »Blopp«, der Patient machte »Fff-tt«, und das Gerät tauchte später auf dem Schwarzmarkt auf. Das Krankenhaus konnte es relativ günstig zurückkaufen.
»Und was ist aus Ihrer Anzeige geworden?« fragte ich den Arzt, der mir das erzählte.
»Nichts, weil wir es nicht angezeigt haben. Werden uns hüten…«
Das Leben kann schon lustig sein in Italien.
Als ich Vittoria das zweite Mal besuchte, sah man schon, daß es zu Ende ging. Sie hätte sehr viele Bluttransfusionen gebraucht, aber den Handel mit Blutkonserven überwacht die Camorra. Entweder war der Klinikchef mit den Schutzgeldzahlungen im Rückstand, oder er gehörte der falschen Partei an, jedenfalls wurde das Krankenhaus nur zögerlich mit Blutkonserven beliefert, und Vittoria, die keine Privatpatientin war, stand in der Liste weit unten. Und wenig später kam sie ins Einzelzimmer…